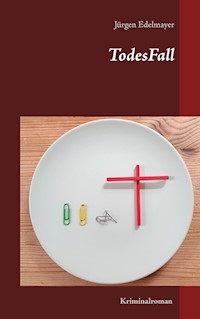Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Konzernchef Rudolf Vogt hegt große Ambitionen. Er möchte Deutschlands neuer Führer werden und das Land zur dominanten Nation auf dem europäischen Kontinent machen. Um dies zu erreichen, verfolgt er einen ebenso geheimen wie perfiden Plan, der die deutsche Wirtschaft ins Chaos zu stürzen droht. Als Vogt erfährt, dass ein Hobbyforscher das Grab des Cheruskerfürsten Arminius entdeckt zu haben glaubt, ist sein Interesse geweckt. Was wäre besser geeignet, seine Führerschaft zu symbolisieren als jene Waffe, die der siegreiche Germane bei der Varusschlacht getragen hat? Doch die Jagd nach dem Schwert läuft bald aus dem Ruder.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Romanhandlung zu Griff nach der Macht wurde frei erfunden. Die Spekulation der Gebrüder Hunt soll in früheren Jahrzehnten tatsächlich stattgefunden haben.
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
KAPITEL 46
PROLOG
Eine Rotte von zwölf Wildschweinen bewegte sich auf ein zum Hintertaunus gehörendes Waldstück zu. Dort befand sich eine Suhle, die das Schwarzwild häufiger aufsuchte. Zu dieser nächtlichen Stunde war normalerweise kein Mensch unterwegs, der die Schwarzkittel störte. Heute war es jedoch anders. Grelles Licht überflutete einen Teil des Unterholzes und ein Zweibeiner grub mit Hacke und Spaten den Waldboden auf. Dieser Jemand war männlich, etwa Mitte 40 und wirkte ungepflegt. Sein Gesicht war von Bartstoppeln übersät und die dunklen Haare hatte der Mann seit mehreren Tagen nicht gewaschen. Die Tiere im Wald konnten ihn bereits auf große Entfernung riechen. Als das Leittier den Mann bemerkte, führte es die Rotte zu einer weiter westlich gelegenen Lichtung.
Der Mann blieb allein an diesem mit dichtem Unterholz bewachsenen Platz zurück und trieb einen Spaten in den Boden. Er hatte einen mit Batterien betriebenen Leuchtstrahler aufgestellt, der ihm das für seine Arbeit nötige Licht spendete. Der nächste Waldweg war weit genug entfernt, sodass er keine Entdeckung fürchten musste. Es war nicht das erste Mal, dass er hier grub. Schon seit geraumer Zeit war er an diesem Ort zugange. In den Nächten, in denen er hier zugange war, hatte er die Ausgrabungsstätte stets mit einer Plane abgedeckt und nach getaner Arbeit mit Laub, Ästen und Zweigen gründlich getarnt. Er fühlte, dass er die Plane nicht mehr häufig würde verwenden müssen und seinem Ziel ganz nahe war. Dieses Gefühl verlieh ihm neue Energie, und obwohl er physisch erschöpft war, wischte er sich den Schweiß von der Stirn und setzte seine Arbeit fort. Als er im hellen Scheinwerferlicht meinte, außer einem freigelegten Skelett einen mit Patina überzogenen Gegenstand zu erkennen, legte er den Spaten beiseite und griff zu feineren Hilfsmitteln.
Es dämmerte bereits, als der Mann sich endlich auf den Weg zurück nach Hause machte und eine Ausgrabungsstätte zurückließ, die er sorgfältig wieder mit Erde, Laub und Zweigen bedeckt hatte. Diesmal hoffentlich für immer.
KAPITEL 1
„Das alles, mein lieber Junge, gehörte einst zum Deutschen Reich.“
„So viel?“ Der kleine Rudi hatte erst wenige Schultage hinter sich gebracht. Das Kind saß auf dem Schoß seines zwei- undsechzigjährigen Großvaters und folgte mit den Augen dem Finger, der auf dem Schulatlas ein heute zu Polen gehörendes Gebiet umkreiste.
„Das ist ganz schön viel Land, nicht wahr?“, sagte der alte Mann und seufzte. „Unsere Familie besaß dort ein großes Gut, aber wir haben den Krieg und damit auch unsere Ländereien alle verloren. Die Polen und Russen haben uns alles weggenommen.“
„Wenn ich groß bin“, sagte Rudi und machte dabei ein ernstes Gesicht, „hole ich unser Land zurück!“
Großvater klappte den Atlas zu, lächelte seinen Enkel an und strich ihm mit der Hand übers Haar.
„Jawohl, Rudi. Eines Tages holst du uns unser Land zurück.“
Rudolf Vogts Gedanken kehrten aus dem Jahr 1961 in die heutige Wirklichkeit zurück. Er betrachtete eingehend das Porträt an der Wand neben dem Kamin. Es zeigte einen Mann in einer Soldatenuniform des Ersten Weltkriegs. Seine Augen schienen streng auf den Betrachter herabzublicken. Jemand anderer hätte es möglicherweise als unangenehm empfunden, auf diese Art gemustert zu werden, aber für Vogt strahlten die ernsten Züge seines Großvaters eine charakterliche Stärke aus, die in ihm ein Gefühl der Geborgenheit und angenehme Erinnerungen an seine eigene Kindheit hervorriefen. Die äußerliche Erscheinung des Betrachters war der des Porträtierten ähnlich. Beide hatten silbergraues Haar und kantige Gesichtszüge. Die Augen waren dunkelbraun und verliehen dem Blick eine gewisse Härte. Das Foto zeigte nicht die Statur des Großvaters, doch Vogts Erinnerung zufolge war der mit einem Meter achtzig nur wenige Zentimeter kleiner als er selbst gewesen und ebenfalls von schlanker Gestalt.
Vogt war seit Tagen nicht dazu gekommen, die Zeitung zu lesen. Für einen Großunternehmer wie ihn gab es häufig Wichtigeres zu tun. Doch für heute hatte er sich fest vorgenommen, wenigstens diesen Abend dafür zu nutzen, um die Lektüre ein wenig nachzuholen. Vor allem die Wirtschaftsnachrichten interessierten ihn, wobei sein besonderes Augenmerk den Börsenkursen für Silber galt. Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass es 22:30 Uhr war. Bis Mitternacht würde er noch einige Artikel lesen können. Der Unternehmer griff sich eine Zeitung und blätterte sie auf. Ein Artikel über einen möglicherweise sensationellen Ausgrabungsfund erregte seine Aufmerksamkeit. Ein Koblenzer Bürger namens Roland Maurer wollte irgendwo im Taunus das Grab eines bedeutenden germanischen Stammesführers ausfindig gemacht haben. Zu Vogts Missfallen gab der Artikel nicht viel her. Anstatt mit Sachinformationen aufzuwarten, erging sich der Verfasser in wilde Spekulationen. Die vom Artikelschreiber gebrauchten Formulierungen ließen jedoch darauf schließen, dass der Finder es ihm nicht eben leicht gemacht hatte. Offensichtlich war der sich selbst nicht sicher gewesen, wie viel er von seiner Entdeckung preisgeben wollte. Folglich hatte er es bei nebulösen Andeutungen belassen. Ein Hintergrundartikel verwies in diesem Zusammenhang auf ein Interview mit dem Hobbyarchäologen, der schon vor geraumer Zeit behauptet hatte, einer historischen Sensation auf der Spur zu sein. Dabei ging es um die letzte Ruhestätte des Cheruskers Arminius, dessen Grab nach Vogts Kenntnis eigentlich im Donaudelta vermutet wurde. Doch Maurers Aussagen wirkten auf Vogt so überzeugend, dass dieser der Sache auf den Grund gehen wollte.
Vogt erinnerte sich daran, dass er damals von seinem Geschäftspartner Gunter Hartfeldt einen Gefallen eingefordert und ihn genötigt hatte, Maurer zu besuchen. Hartfeldt war wenig begeistert davon gewesen, dem ihm völlig unbekannten Schatzsucher auf den Zahn zu fühlen, aber Vogt hatte seinen Kompagnon in der Hand und ihm keine andere Wahl gelassen. Hartfeldt hatte einen Millionenkredit bei einer Bank beantragt, die Teil von Vogts Geschäftsimperium war. Hartfeldt war auf diesen Kredit dringend angewiesen und konnte es sich nicht leisten, Vogt einen Gefallen abzuschlagen. Leider war bei der Aktion nichts herausbekommen. Maurer schien ein richtiger Kotzbrocken zu sein. Er hatte Hartfeldt hochkant aus dem Haus geworfen und auf üble Weise beschimpft.
Missmutig griff sich Vogt eine andere Zeitung und begann mit der Lektüre eines weiteren Artikels über den Schatzgräber. Er konnte diese Möchtegern-Abenteurer eigentlich nicht leiden. Sie taten seiner Ansicht nach besser daran, sich nicht in die Arbeit von Fachleuten einzumischen. Die Vorgänge um die Himmelsscheibe von Bebra waren ihm Beleg genug für die Richtigkeit seiner Auffassung. Immerhin war dieser historische Fund durch die unsachgemäße Handhabung von Stümpern erheblich beschädigt worden. Doch je ausführlicher sich Vogt mit dem aktuellen Artikel befasste, desto mehr nahm sein Interesse an der Arbeit dieses Schatzjägers erneut zu. Dass Roland Maurer seinen Fund auf die Zeit kurz nach Christi Geburt datierte und die Varusschlacht erwähnte, erweckte in Vogt ein weiteres Mal den Wunsch, der Sache nachgehen zu wollen. Der Unternehmer faltete die Zeitung sorgfältig zusammen und zündete sich eine Zigarre an. Während er vor sich hin paffte, kreisten seine Gedanken darum, welche Konsequenzen sich für ihn daraus ergaben, wenn hinter Roland Maurers Entdeckung mehr steckte, als er seinen Interviewern bislang erzählt hatte. Der Fabrikant griff zum Telefon und wählte eine Nummer.
Der Angerufene meldete sich unverzüglich. Er war es gewohnt, von seinem Chef zu den ungewöhnlichsten Zeiten angerufen zu werden und wusste, dass der äußerst ungehalten reagierte, wenn man ihn warten ließ oder er auf andere Schwierigkeiten stieß, die der augenblicklichen Erfüllung seines Wunsches im Wege standen. Daher ließ er den Anrufer nicht warten, begrüßte ihn mit einem höflichen „Guten Abend“ und fragte sich insgeheim, was Rudolf Vogt wohl zu dieser Zeit von ihm wollte. Da der seinem Angestellten das Handy mit der ausdrücklichen Anordnung, die dazugehörige Mobilfunknummer niemandem sonst mitzuteilen, übergeben hatte, konnte es sich nur um Vogt handeln.
„Dieser Arbeiter, den wir letzte Woche als Lagerist eingestellt haben. Wie hieß der gleich?“
„Woller“, antwortete der Angestellte.
„Ach ja, richtig. Bitte suchen Sie mir für morgen seine Personalakte heraus.“
„Stimmt etwas nicht mit ihm?“
„Das habe ich nicht gesagt“, entgegnete Vogt scharf. „Tun Sie einfach, was ich Ihnen sage.“
„Natürlich. Entschuldigen Sie bitte. Ich wollte nicht indiskret sein. Ich gebe die Akte gleich morgen früh bei Frau Offenburg ab.“
„Danke, und guten Abend“, sagte Vogt nun versöhnlich gestimmt und legte auf. Er ärgerte sich, dass er die Fassung verloren und grob reagiert hatte. Eigentlich wäre auch am nächsten Tag Zeit genug gewesen, sich Wollers Kontaktdaten geben zu lassen. Aber Geduld gehörte nun einmal nicht zu Rudolf Vogts Stärken. Darin ähnelte er seinem Großvater, dessen Geschichten über Glanz und Gloria Preußens und des Deutschen Reichs er als Junge hingebungsvoll in sich aufgenommen hatte.
Und wie sein Großvater konnte er ganz im Stil eines preußischen Junkers Untergebene scharf in die Schranken weisen, wenn diese nicht spurten.
Der Enkel von damals war längst erwachsen und in das letzte Drittel seiner zu erwarteten Lebensspanne eingetreten. Rudolf Vogt befand sich mit seinen einundsechzig Jahren inzwischen selbst in dem Alter, wo er als freundlicher Opa das Kind einer Tochter oder eines Sohnes auf den Knien hätte schaukeln können, wenn er denn irgendwelche Nachkommen gezeugt hätte. Dem war aber nicht so. Manchmal bedauerte Vogt diesen Umstand, doch vor einigen Jahren hatte er damit seinen Frieden gemacht. Womit er sich jedoch nie abgefunden hatte, war der Verlust der Landgüter seiner Großeltern im ehemaligen Ostpreußen.
Als erfolgreicher Unternehmer hatte er es zu wirtschaftlichem Erfolg und in diesem Zusammenhang beinahe zwangsläufig auch zu einigem politischen Einfluss gebracht. Was diesen Punkt anging, hielt er sich diesbezüglich jedoch weitgehend im Hintergrund, da er seine Zeit noch nicht ganz gekommen sah. Vogt finanzierte eine Partei namens Deutschland Voran!, deren Bedeutung momentan zwar recht überschaubar war, doch das konnte sich sehr bald ändern. Wenn es soweit war, würde er die Führung dieser Partei übernehmen. Niemand würde ihm seine Ambitionen streitig machen, denn seine Spenden waren nahezu die einzige Geldquelle von Deutschland Voran!. Die Partei hing an seinem Geldtropf und konnte nur existieren, wenn sie nach seiner Pfeife tanzte. Das war dem jetzigen Parteivorstand sehr wohl bewusst. Widerstand war von dieser Seite daher nicht zu erwarten, im Gegenteil. Um die Existenz von Deutschland Voran! auch weiterhin zu gewährleisten und unter Rudolf Vogts Führung auch künftig lukrative Posten einzunehmen, würden die Mitglieder des aktuellen Vorstands sich gegenseitig darin übertreffen, ihm ihre Ergebenheit zu erweisen. Damit seine Spendenpraxis der Öffentlichkeit verborgen blieb, ließ Vogt Deutschland Voran! nur Beträge unterhalb der Meldepflicht für Großspenden zukommen. Außerdem achtete er darauf, als Absender immer ein anderes zu seinem Firmenimperium gehörendes Unternehmen auszuwählen.
In seinen früheren Zwanzigern hatte Vogt mit Grundstücksspekulationen bereits ein ansehnliches Vermögen angehäuft. Danach hatte er ein Unternehmen erworben, das als Zuliefererbetrieb für die Automobilindustrie eine Schlüsselposition innehatte. Innerhalb weniger Jahre schaffte sich der Unternehmer eine Reihe von Firmen unterschiedlicher Branchen an. Lebensmittelvertriebe waren in dem Mischkonzern ebenso vertreten wie diverse Produktionsbetriebe des Baugewerbes und der Elektroindustrie. Den letztgenannten Bereich hatte Vogt in den vergangenen Jahren besonders stark ausgebaut. Einen Großteil seiner Unternehmensgewinne investierte der Unternehmer in Anleihen, Aktien und andere Wertpapiere. Sein Firmengeflecht war heute ein undurchdringliches Dickicht, in dem sich Steuerprüfer restlos verhedderten. Natürlich kamen ihm Vertreter von Ländern und Kommunen in mancher Hinsicht entgegen, wenn es um die Schaffung oder den Erhalt von Arbeitsplätzen ging. Er profitierte unter anderem von Steuererleichterungen, Zuschüssen und Ausnahmeregelungen, wenn es um die Ansiedlung von Produktionsstätten ging. Zu Vogts Bedauern reichte sein politischer Einfluss jedoch zumindest jetzt noch nicht aus, um die politische Linie der deutschen Regierung entscheidend mitzubestimmen. Er fragte sich, wie es dazu hatte kommen können, dass aus dem einst ruhmreichen Deutschen Reich ein verweichlichter Staat hatte werden können, der in Europa hauptsächlich die Rolle eines Zahlmeisters für die das Land überflutenden Flüchtlinge erfüllte und mit seinen Krediten die Wirtschaft anderer Länder am Laufen hielt. Dabei hatte dieses Land dank seiner ökonomischen Stärke doch alle Trümpfe in der Hand, um längst fällige Korrekturen historischer Ungerechtigkeiten durchzusetzen. Aber die politische Herrscherkaste in dieser Bundesrepublik war satt, ohne Visionen und allein darauf bedacht, ihre Privilegien und ihren Besitzstand zu wahren. Über Visionen verfügte schon seit langem kein Bundeskanzler mehr, von der Ex-Kanzlerin ganz zu schweigen. Stattdessen galt die Helmut Schmidt zugeschriebene Maxime, dass derjenige, der Visionen hatte, besser zum Arzt gehen sollte. Aber er, Rudolf Vogt, hatte durchaus eine Vorstellung davon, wie dieses Land geführt werden sollte. Und er verfügte über einen Plan, wie er das erreichen könnte. Wenn alle Entscheidungsträger in Deutschland so auf die Wirtschaft fixiert waren, dann musste er genau hier den Hebel ansetzen. Die Ökonomie war sowohl Stärke als auch Schwachstelle dieses Systems, das zu beseitigen Vogt fest entschlossen war. Als Eigentümer eines Mischkonzerns, der über beste internationale Geschäftsbeziehungen verfügte, wusste er um die Mechanismen und Regeln der freien Marktwirtschaft. Im Grunde ging es darum, Angebot und Nachfrage in einem ständigen Ungleichgewicht zu halten. Wenn die Nachfrage groß genug und das Angebot möglichst knapp bemessen war, ließen sich gute Preise erzielen. Die gegenwärtige Materialkrise zeigte dies sehr deutlich. Noch besser war es natürlich, ein Monopol auf ein stark nachgefragtes Produkt – oder einen unverzichtbaren Rohstoff zu haben. Was diesen Punkt betraf, hatte Rudolf Vogt einen Plan. Sobald er diesen erfolgreich in die Tat umgesetzt hatte, würde Deutschland Voran! an Bedeutung enorm zulegen und ihm selbst als neuem Parteivorsitzenden das ganze Land als Beute in die Hände fallen. Der Gedanke daran entlockte ihm ein schmales Lächeln.
Vogt öffnete die gut bestückte Hausbar und ließ seinen Blick über die dort versammelten Flaschen wandern. Zwölf Jahre in Holzfässern gelagerte Whiskysorten waren hier ebenso zu finden wie edle Weinbrände unterschiedlicher Herkunft. Nach einer kurzen Bedenkzeit hatte Vogt seine Wahl getroffen und griff nach einer Cognacflasche. Nachdem er sich zwei Fingerbreit des Weinbrands eingeschenkt hatte, setzte er sich wieder in seinen Sessel, lehnte sich zurück und hing erneut seinem Lieblingstraum nach. Der handelte davon, wie er sich des ersehnten Monopols bemächtigt und alle Trümpfe in der Hand hatte. Wirtschaftliche Stabilität war ja eine so fragile Angelegenheit. Wie der Krieg in Osteuropa zeigte, bedurfte es wahrlich nicht viel, um diese Stabilität ins Wanken zu bringen. Das hatten die Erdöl fördernden Länder bereits in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts eindrucksvoll bewiesen. Vogt fuhr sich mit der Hand über die Stirn. Nicht zu fassen, dass diese Araber unfähig waren, die ihnen zugefallene Macht angemessen auszuüben. Inzwischen war das Ende des Ölzeitalters abzusehen. Bodenschätze wie Edelmetalle und Seltene Erden waren mittlerweile für Wirtschaft und Gesellschaft mindestens ebenso unverzichtbar geworden und würden es auf längere Sicht bleiben. Wer diese Rohstoffe kontrollierte, der hatte die Macht über die gesamte verarbeitende Industrie und noch darüber hinaus. Ja, der konnte Politiker wie konkurrierende Unternehmer nach seiner Pfeife tanzen lassen.
Vogt nippte an seinem Glas und ließ den Geschmack des Cognacs auf seiner Zunge zergehen. Es ging immer nur um Macht, nichts anderes. Macht, die durch entsprechende Insignien symbolisiert wurde. Höchstens fünf Prozent der Bevölkerung strebte danach, indem sie sich aktiv in der Politik engagierten. Der Rest waren Mitläufer, die sich jedem System anpassen würden, in der Hoffnung, darin in Ruhe ein friedliches und gesichertes Dasein fristen zu dürfen. Wie leicht es war, die Leute zu faszinieren. Eine Lightshow, etwas bombastische Musik und ein paar Flaggen reichten aus, um jenes Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, das so viele Menschen in ihrem Leben vermissten. Ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und etwas Unterhaltung genügte bereits, um das Gros der Bevölkerung so zufriedenzustellen, dass von ihm keine Gefahr für den Machterhalt der Elite ausging. Vogt griff nach seinem Smartphone und entsperrte den Bildschirm. Ein Blick auf die Trendliste bei Twitter bestätigte seine Einschätzung. Die Präsentation des neuen Parteivorsitzenden der SPD verzeichnete knapp zwölftausend Kommentare, während der Rauswurf des derzeit meist gehassten Dschungelcamp-Bewohners zehn Mal mehr Menschen bewogen hatte, ihren Senf dazu abzugeben. Wer die wenigen charismatischen und wirklich führungsfähigen Personen für sich gewinnen oder ausschalten konnte, hielt alle Fäden in der Hand. Rudolf Vogt war entschlossen, dieser Mann zu sein. Und um seiner Machtfülle angemessen Ausdruck zu verleihen, bedurfte es eines adäquaten Gegenstands von überragender Bedeutung. Wie es schien, hatte der Hobbyarchäologe Roland Maurer genau diesen Gegenstand gefunden. Doch dieser Fund gehörte in die Hände eines geborenen Anführers, der es gewohnt war, stets das zu bekommen, was er wollte. Eines Anführers, der das Format eines Rudolf Vogts hatte.
Die Aussicht, die Waffe jenes germanischen Führers in die Hände zu bekommen, der im Jahre Neun nach Christus drei römische Legionen vernichtend geschlagen hatte, versetzte Vogt in Hochstimmung. Erneut erinnerte er sich an die Zeit, in der er als kleiner Junge hingebungsvoll den Erzählungen seines Großvaters gelauscht hatte. Geschichten über alte Schlachten und Kriege, wie die zwischen dem Sachsen Widukind und Karl dem Großen. Vogt konnte kaum glauben, dass seine Erinnerungen schon mehr als ein halbes Jahrhundert alt waren. Das Gut seiner Väter in Ostpreußen war für ihn verloren und gehörte seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges zu Polen. Inzwischen schien sich nicht einmal der Vertriebenenverband dafür zu interessieren. Seit seiner Einschätzung nach die Forderung nach Rückerstattung der alten Besitztümer auf dem Altar der guten Staatsbeziehungen zum polnischen Nachbarn geopfert worden war, hatte Vogt den Eindruck, dass beim Bund der Vertriebenen alle Ambitionen aufgegeben worden waren. Aber er würde sich niemals damit einverstanden erklären, auf das Erbe seiner Vorväter verzichten zu müssen. Er würde dafür sorgen, dass dieses, seiner Ansicht nach durch Besatzung und Einwanderung verweichlichte Deutschland, wieder zu alter Größe zurückfand. Das Reich Rudolf Vogts würde eine solche Vormachtstellung in Europa einnehmen, dass seine Nachbarländer sich glücklich schätzen dürften, wenn sie ihm nur die nach 1945 geraubten Gebiete zurückgeben müssten. Er, Rudolf Vogt, würde als Herrscher des neuen Deutschen Reiches in die Annalen eingehen und sichtbares Zeichen seiner Machtfülle sollte das Kurzschwert des legendären Germanen sein, der drei Legionen der Römer vernichtend geschlagen hatte.
Vogts Angestellter fragte sich unterdessen, was es mit dem Auftrag seines Chefs auf sich hatte. Warum diese Eile? Hatte Woller sich etwas zu Schulden kommen lassen? Hoffentlich nicht, denn der Lagerist war auf seine Empfehlung hin eingestellt worden. Offensichtlich hatte Vogt ein gewisses Faible für gescheiterte Existenzen. Die beschäftigte er vermutlich weniger aus einer sozialen Anwandlung heraus. Wahrscheinlicher war, dass die in Lohn und Arbeit gebrachten Problemfälle es Vogt mit einem besonders hohen Maß an Loyalität dankten und sich mit einem vergleichsweise geringen Gehalt zufrieden gaben. Der Sachbearbeiter verzog seine Mundwinkel zu einem schiefen Lächeln, als er sich eingestehen musste, selbst zu diesem Personenkreis zu gehören. Mit Volker Woller verband ihn zudem mehr als eine oberflächliche Bekanntschaft. Er fragte sich, wieso sein Chef nicht in der Lage war, das Offensichtliche zu erkennen. Sein Blick wanderte zu dem kleinen Radiowecker, der auf einem wackligen Beistelltisch stand. Die Angelegenheit war zum Glück nicht so dringend, dass Vogts Angestellter sich genötigt sah, noch heute zurück ins Büro zu fahren. Die Akte konnte er auch morgen früh heraussuchen. Der Alte war dafür bekannt, nicht vor zehn Uhr in die Firma zu kommen.
Als Rudolf Vogt am folgenden Tag gegen zehn Uhr dreißig die Firma betrat, saß seine Chefsekretärin, Silke Offenburg, bereits seit zweieinhalb Stunden an ihrem Schreibtisch. Die untersetzte Frau war seit mehr als fünfundzwanzig Jahren für den Betrieb tätig, kaum einen Tag krank und für ihren Arbeitgeber auch außerhalb der Dienstzeiten immer erreichbar.
„Guten Morgen, Herr Vogt“, begrüßte sie ihn. „Das wurde vorhin für sie abgegeben“, fügte sie hinzu und reichte ihrem Chef die Personalakte über Volker Woller. Vogt schlug den Hefter auf und überflog die Daten. Der Lagerist war 36 Jahre alt und erst vor kurzem in die Firma eingetreten. Bisher gab es keine Vermerke über ungewöhnliche Vorkommnisse, etwa wegen häufiger Fehlzeiten, Unpünktlichkeit oder anderer Vergehen, die eine Abmahnung oder Kündigung gerechtfertigt hätten. Vogt blätterte weiter, bis er auf den Vermerk stieß, der ihn vor allem an der Akte interessierte. Es war eine Notiz, die besagte, dass Woller in der JVA Koblenz eingesessen hatte. Er war dorthin verlegt worden, damit er dort unbehelligt das letzte Jahr seiner über ihn wegen schwerer Körperverletzung verhängten Haftstrafe absitzen konnte. Zuvor hatte er in der JVA Diez eingesessen, wo er mit Mithäftlingen in schwere Auseinandersetzungen geraten war. Ein weiterer Hinweis informierte Vogt darüber, dass Wollers Gewalttat einen fremdenfeindlichen Hintergrund gehabt hatte. Ein Zuwanderer türkischer Herkunft war von dem Lageristen brutal zusammengeschlagen worden. Während der Aggression hatte der Angreifer sein Opfer mit ausländerfeindlichen Beleidigungen überhäuft und vor Zeugen geäußert, dass, Zitat: „Die verdammten Kameltreiber alle vergast werden sollten“. Die Ankunft zweier Polizeibeamte hatte der völlig unter Adrenalin stehende Woller erst mitbekommen, als sie ihm bereits die Arme auf den Rücken gedreht und Handschellen angelegt hatten. Dass er die Uniformierten daraufhin als „Gestapo“ bezeichnete, brachte ihm im Nachhinein eine zusätzliche Anzeige wegen Beamtenbeleidigung ein.
Der Unternehmer klappte die Akte zu und machte sich auf den Weg in sein Büro.
„Keine Störung während der nächsten Viertelstunde“, wies er Silke Offenburg im Vorbeigehen an.
„Geht klar, Herr Vogt. Kann ich sonst etwas für Sie tun?“
Die Frage blieb unbeantwortet. Ohne darauf einzugehen, schloss Vogt die Tür zu seinem persönlichen Büro und holte ein Prepaidhandy aus der Schreibtischschublade. Die Telefonnummer mit Hilfe der kleinen Tastatur einzugeben, bereitete ihm ein wenig Mühe. Einmal vertippte er sich, aber dann stand die Verbindung.
Die Hip-Hop Klänge zeigten Volker Woller einen neuen Anruf an. Der etwas über einhundertneunzig Zentimeter hohe Sechsunddreißigjährige, der von seinen Freunden Wolle genannt wurde, meldete sich mit einem kurzen: „Ja?“
„Volker Woller, nehme ich an?“
„Fragt wer?“
„Jemand, der so viel über Sie weiß, dass er Ihnen einen Haufen Schwierigkeiten bereiten kann.“
Ehe Woller etwas erwidern konnte, verblüffte ihn der unbekannte Anrufer mit dem Wissen um sein Arbeitsverhältnis und einer Liste seiner Vorstrafen. Danach folgte der Hinweis auf Wollers Drogengeschäfte, die ihn aufgrund seiner Vorstrafen bei einer Verurteilung die Freiheit kosten konnten. Woller fuhr sich mit der Hand über die unrasierte Kinnpartie. Er fragte sich, woher der Kerl vom anderen Ende der Leitung seine Handynummer hatte und wieso er dermaßen gut über ihn Bescheid wusste. Sein geheimnisvoller Gesprächspartner beendete das Gespräch, nachdem er ihn für den Abend des folgenden Tages in eine seit Jahren leerstehende Fabrikhalle bestellt hatte. Dort sollte Woller genaue Informationen darüber erhalten, was der Fremde verlangte, der ihm außerdem einen stattlichen Geldbetrag als Aufwandsentschädigung in Aussicht stellte. Ein Versprechen, das seine Wirkung auf den Empfänger dieses seltsamen Anrufs nicht verfehlte.
„Ich werde zur Stelle sein“, versprach er.
Nachdem er aufgelegt hatte, nahm Vogt die Simkarte aus dem Handy, zerbrach sie in kleine Stücke und warf die Überreste in den Papierkorb. Die Raumpfleger würden sie am Abend vollends entsorgen.
KAPITEL 2
Volker „Wolle“ Woller, tastete sich durch eine ausgeräumte Fabrikhalle. Das zum Gewerbepark Koblenz Nord gehörende Gelände stand schon seit geraumer Zeit leer. In den Achtzigern war darauf eine Produktionsstätte für KFZ-Teile errichtet worden. Nach gut zwei Jahrzehnten war der Betrieb dann geschlossen und die darauf stehenden Gebäude dem Verfall preisgegeben worden.
„Blöder Ort für ein Treffen“, murmelte Woller. „Kann doch kein Schwein was erkennen“.
Er fragte sich, wer wohl der geheimnisvolle Anrufer gewesen war, der ihn hierher bestellt hatte. Kein Name, kein Hinweis darauf, worum es eigentlich ging. Alles in Allem recht mysteriös. Aber der Kerl wusste gut über ihn Bescheid. Die Vorstrafe wegen Körperverletzung, seine finanzielle Durststrecke inklusive Schufa-Einträge und natürlich die Zugehörigkeit zu einer vom BND als rechtsextrem eingestuften Splitterorganisation. Über all das hatte der unbekannte Anrufer genaue Kenntnis gehabt. Er hatte ihn gleich zu Beginn des Gesprächs mit seinem Wissen über diese Dinge konfrontiert und unter Druck gesetzt. Und woher kannte dieses Arschloch überhaupt seine Handynummer?
Das Geräusch einer über den Boden rollenden leeren Blechdose riss Woller aus seinen Gedanken.
„Ist da wer?“, fragte er ins Dunkel.
Keine Antwort.
„Geben Sie sich zu erkennen, verdammt nochmal, oder ich verschwinde auf der Stelle von hier. Ihre Spielchen können Sie jemand anderem aufzwingen. Ich habe jedenfalls keinen Bock auf diese Scheiße!“
Einige Sekunden lang blieb es weiterhin still. Dann hörte Woller ein lautes Klacken und musste gleich darauf die Augen schließen, als ihm ein Scheinwerfer direkt ins Gesicht leuchtete.
„Was soll das?“, schrie er.
„Seien Sie bitte still und hören zu“, tönte es aus dem Dunkel. Die Stimme schien von überall her zu kommen. Von den Wänden und der Decke hallten die Laute wider und machten es ihm unmöglich, den Sprecher zu orten. Außerdem benutzte der Kerl einen Stimmverzerrer. Warum? Musste er sich verstellen, weil Woller ihn kannte? Etwas fiel klatschend direkt vor seine Füße auf den Boden.
„Aufheben“, befahl die Stimme knapp.
Woller bückte sich und fingerte nach dem Gegenstand. Es war ein dickes Luftpolsterkuvert, ungewöhnlich lang, ungefähr einen Meter.
„Darin finden Sie alle Instruktionen und das, was Sie dafür brauchen“, beschied ihn der Unbekannte. Kurz darauf erloschen die Scheinwerfer.
„Hallo?“, rief Woller ins Dunkel. „Sind Sie noch da? Antworten Sie doch!“
Um ihn herum nur schwarze Stille. Er war wieder allein. Vorsichtig suchte er sich einen Weg zum Ausgang. Der Mann mit dem Sprachverzerrer hatte das Gebäude offensichtlich durch ein anderes Tor verlassen. Jedenfalls deutete nichts mehr auf dessen Anwesenheit hin.
Woller lief zu seinem rostigen Ford Fiesta und startete den Motor. Er konnte es kaum erwarten, den Umschlag bei sich zu Hause zu öffnen. Jetzt wollte er erst einmal weg von hier und zwar so schnell wie möglich.
In seiner im Koblenzer Stadtteil Lützel gelegenen Einzimmer-Dachgeschosswohnung angekommen, räumte Wolle hastig sein schmales, mit allen möglichen Klamotten bedecktes Bett frei. Dann setzte er sich und legte die Verpackung auf das fleckige Laken. Es dauerte beinahe fünf Minuten bis er das Klebeband entfernt hatte, mit dem der Umschlag verschlossen war. Endlich konnte er den Inhalt in Augenschein nehmen. Was er sah, entlockte ihm einen leisen Pfiff durch die Zähne. Vor ihm lag ein Schwert. Die Klinge reflektierte das Licht der kleinen Lampe, die er beim Hereinkommen eingeschaltet hatte. Wolle nahm das Schwert in die Hand, wog es darin, um ein Gefühl für die Waffe zu bekommen und ließ sie durch die Luft kreisen. Zuerst verhalten, dann schneller und kräftiger, bis er mit der Spitze gegen die Deckenbeleuchtung stieß, und der Stoß die Lampe über seinem Kopf heftig hin und her schwankten ließ. Er legte das Kurzschwert beiseite und griff nach dem Kuvert, das ebenfalls Bestandteil des Umschlaginhalts gewesen war. Es enthielt einige Geldscheine, deren Summe ihn erneut leise durch die Zähne pfeifen ließ. Wer immer der geheimnisvolle Auftraggeber auch war; er musste über einen Haufen Geld verfügen. Woller griff ein weiteres Mal in den Umschlag und entnahm ihm ein per Computer beschriebenes Papier. Es enthielt die Adresse einer Person mit Namen Rudolf Maurer und die Information, dass dieser Mann zusammen mit seiner Frau in einem kleinen Haus am Rand des wenige Kilometer außerhalb von Koblenz gelegenen Ortes lebte. Darunter stand die eindeutige Aufforderung, eine Antiquität, ähnlich dem Schwert, das ihm der mysteriöse Kerl in der alten Lagerhalle hatte zukommen lassen, aus Maurers Besitz zu entwenden. Die Prämie für den erfolgreich ausgeführten Auftrag sollte noch einmal das Doppelte von dem betragen, was der Auftraggeber seinem Schreiben als Anzahlung beigefügt hatte. Der Unbekannte erwartete die Ausführung des Auftrags binnen weniger Tage. Er würde sich bei Woller melden und nach dem Stand der Dinge erkundigen. Es folgte der Hinweis, dass das gesuchte Objekt vermutlich in einem sehr schlechten Zustand war und daher nur eine entfernte Ähnlichkeit mit dem intakten Kurzschwert aufwies. Der Brief schloss mit der Mahnung, das Schreiben nach der Lektüre unverzüglich zu vernichten.
Wolle hielt kurz inne und überlegte. Eine reiche Person, die ihn möglicherweise kannte und offensichtlich fürchtete, von ihm erkannt oder verraten zu werden. Ein Mensch, der über kriminelle Energie verfügte, sich aber nicht selbst die Hände schmutzig machen wollte. Jemand, der einen gehörigen Aufwand betrieb, damit er unerkannt blieb und sich das alles finanziell leisten konnte. Wer mochte das wohl sein? Er konnte sich beim besten Willen niemanden aus seinem Bekanntenkreis vorstellen, auf den diese Beschreibung passte. Aber eins war ihm klar. Wer immer diesen Aufwand betrieb und derart locker mit Geld um sich warf, war hinter etwas her, das bedeutend mehr wert war, als die Summe, mit der ihn der geheimnistuerische Auftraggeber abspeisen wollte.
KAPITEL 3
In seinem zu einem Dorf auf den rechtsseitigen Rheinhöhen gelegenen Einfamilienhaus saß Roland Maurer am Küchentisch und schlug die Zeitung auf. Was er dort las, verdarb ihm gründlich seine Laune. Wütend knüllte er das Blatt zusammen und schleuderte es auf den Boden. Seine Frau Petra war zum Glück nicht im Haus. So entging sie dem Wutanfall ihres achtundvierzigjährigen Mannes, den dieser jedes Mal bekam, wenn er mit einer Meinung konfrontiert wurde, die ihm nicht passte. Seit seiner Frühpensionierung vor sechs Monaten hatte sich der zuvor beim Finanzamt der örtlichen Verbandsgemeinde beschäftigte Beamte ganz seinem Hobby, der Archäologie, gewidmet. Zudem hatte er sich einen Vollbart wachsen lassen, der ebenso wie sein dichtes Haupthaar schwarz und mit grauen Stellen versehen war. Während der letzten Monate hatte Maurer einige Kilo Gewicht zugelegt. Er wusste, dass er gut daran tat, seine körperlichen Aktivitäten zu verstärken und mehr darauf zu achten, was er im Laufe eines Tages an Nahrung zu sich nahm. Schreibtischarbeit allein eignete sich nicht gerade als Fitnessprogramm. Nach sich über viele Jahre erstreckende Privatstudien war der ehemalige Finanzbeamte zu der unumstößlichen Überzeugung gelangt, dass die Varusschlacht im Jahre neun nach Christi am Kalkriese stattgefunden hatte. Damit deckten sich die Forschungen Maurers mit den Ergebnissen, die Forschungen der letzten Jahre zutage gefördert hatten. Dessen ungeachtet beharrten nach wie vor manche Experten (oder solche, die sich dafür hielten) darauf, dass sich die Vernichtung der drei römischen Legionen im Teutoburger Wald zugetragen hatte. Die Schlagzeile der nun auf dem Küchenfußboden liegenden Zeitung suggerierte die Richtigkeit dieser Sichtweise.
Maurer hob das Lokalblatt auf und legte es zurück auf den Tisch. Er trat ans Fenster und spähte über den kleinen verwilderten Vorgarten nach draußen auf die schmale Straße vor seinem Haus. Beruhigt, niemanden gesehen zu haben, zog er die Gardine zurecht und verließ die Küche. Von der Diele führte eine kleine Treppe in das obere Stockwerk des Hauses, wo sich Maurers Arbeitszimmer befand. Nach einem weiteren Blick aus dem in Richtung Waldrand hinausgehenden Fenster trat er an ein Regal, von dem er ein Dutzend Bücher herausnahm und auf seinem Schreibtisch stapelte. Vorsichtig tastete er nach einem länglichen Paket, nahm es herunter und legte es behutsam auf den Boden des kleinen Zimmers. Dann machte er sich daran, die Kordel zu entfernen. Als nächstes wickelte er das steife braune Papier auf. Nun galt es noch die Leintücher aufzuschlagen, um den Gegenstand freizulegen, der sich darunter verbarg. Nachdem dies vollbracht war, lag ein gut neunzig Zentimeter langes Schwert vor ihm auf dem Boden. Die Waffe war antik. Das würde jedem auffallen, der sie betrachtete. Die Klinge wies grobe Zacken und tiefe Scharten auf. Im oberen Bereich des Griffes fehlte ein Stück und an mehreren Stellen hatte sich Patina gebildet. Für Laien würde dieser Fund nicht weiter als ein rostiges