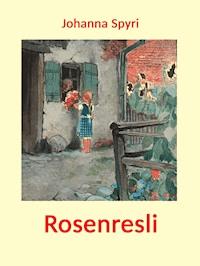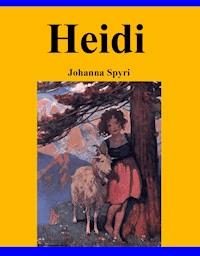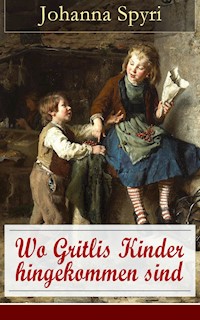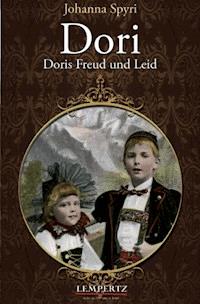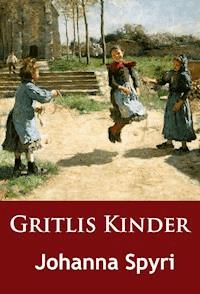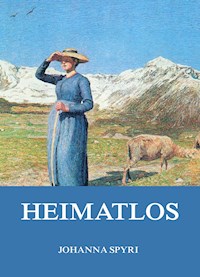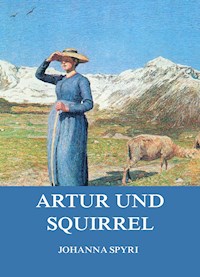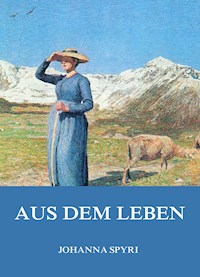Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lempertz Edition und Verlagsbuchhandlung
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nach dem frühen Tod ihrer Mutter Gritli wachsen Elsli und Fani mit ihren Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen auf. Fani träumt davon, ein berühmter Maler zu werden. In Basel versucht er sein Glück. Währenddessen muss die zarte Elsli in ihrem verarmten Haushalt schwere Arbeiten verrichten. Ihr trister Alltag erhellt sich, als sie in der kranken Nora eine Seelenverwandte findet. Zwischen den Mädchen entfaltet sich eine tiefe Freundschaft. Doch dann geht es Nora auf einmal rapide schlechter...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 116
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GritliGritlis Kinder
von
Johanna Spyri
Teil I
Wo Gritlis Kinder hingekommen sind
Frohes Leben im Doktorhaus
Ein missglücktes Gespräch
Elsli lernt Nora kennen
Wo ist Fani?
Die Sonne sinkt…
Elsli findet eine Heimat
Frohes Leben im Doktorhaus
„Guten Abend, Frau Doktorin“, tönte es vom Wege herüber, der durch eine Hecke von den Beeten getrennt war. »Sie haben doch immer das schönste Gemüse!“
Die Frau Doktorin trat an die Hecke und erwiderte freundlich den Gruß des Tagelöhners.
„Wie geht es denn, Heidi?“, fragte sie teilnehmend. „Immer viel Arbeit? Ist alles wohl daheim, Frau und Kinder?“
„Ja, ja, gottlob!“ entgegnete Heidi. „Arbeit gibt’s immer, aber man braucht ja auch Arbeit, die Haushaltung wächst an.“
„Eure drei kleinen Buben schauen gut aus, ich habe sie gestern wieder gesehen mit dem Elsli“, fuhr die Frau Doktorin fort.
„Aber das Mädel, das Elsli, ist gar so bleich und schmächtig! Ihr vergesst doch nicht, woran seine Mutter gestorben ist? Man darf das Kind gewiss nicht überanstrengen, es ist so zart.“
„Ja, ich werde nie vergessen, dass das Gritli so früh hat sterben müssen. Die Marget ist eine tapfere Frau und brav, aber das Gritli kann ich nicht aus dem Sinn bekommen!“ Heidi wischte sich mit der Hand ein paar Tränen fort.
Der mitfühlenden Doktorin kamen ebenfalls die Tränen in die Augen. „Ich vergesse es auch nicht, Heidi. Wie gerne wäre das arme Gritli noch bei euch und seinen beiden kleinen Kindern geblieben! Ich kann das Elsli nie sehen, ohne dass es mir Sorge macht, ob es auch nicht zu sehr angestrengt wird daheim. Und wie ist es denn mit dem Elsli, steht sich die Mutter gut mit ihm?“
„Nun, sehen Sie“ — der Heidi trat näher an die Hecke heran —, „das Kind gibt mehr nach. Es tut, was die Marget will, und hat kein Widerwörtlein den ganzen Tag und klagt nie, und wenn es auch von der Zeit an, wo es aus der Schule kommt, bis es ins Bett muss, immer zu helfen hat und die Buben hütet und das Kleine herumträgt.“ „Nur auch nicht zuviel, Heidi“, mahnte bekümmert die Frau Doktorin, „es ist mir eine rechte Sorge mit dem Kinde. Schickt mir doch die Marget bald einmal vorbei, ich möchte auch darüber ein Wörtchen mit ihr reden; sagt ihr, ich habe ihr etwas für die Kinder zu geben, entwachsene Kleidung von meinen.“
„Das will ich gerne tun, und ich sag’ auch schon jetzt herzliches. Vergelt’s Gott“. Aber jetzt, denk’ ich, sollt’ ich wohl wieder weiter.“ „Gute Nacht, Heidi…“
Die Frau Doktorin blieb sinnend zwischen den Gemüsebeeten stehen… Sie sah mit einem Mal ein fröhliches Mädchengesicht mit großen blauen Augen vor sich: das Gritli, armer Leute Kind, das aber immer so sauber gekleidet ging, als sei es eben frisch aus dem Ei gepellt. Mit achtzehn Jahren heiratete es den gutmütigen, fleißigen Heidi, der ihm oft gesagt, er wolle für sie beide arbeiten, wenn es nur seine Frau werden möge. Schon nach fünf Jahren welkte das zartgebaute Gritli an der Schwindsucht dahin. Ihre beiden Kinder, Stephan und Elsli, hatte die junge Frau vom ersten Augenblick an so schmuck und sauber gehalten, dass es ihnen für immer tief eingeprägt blieb. Der Heidi, obgleich untröstlich über Gritlis Hinscheiden, musste aber für sie wieder eine zweite Mutter haben, und die Leute rieten ihm, er solle die Marget zur Frau nehmen, denn sie werde ihm gut helfen in der Arbeit. So also heiratete er die Marget; sie war tüchtig und fest in allem Schaffen, aber auf Schmuck und Blumen und besondere Sauberkeit hielt sie nichts. Die kleben Buben und das Wiegen-kind sahen nicht so aus, wie der Fani und Elsli ausgesehen und auch jetzt noch aussahen, denn ihnen war die erste Gewohnheit geblieben und in Fleisch und Blut übergegangen.
Aus diesen Erinnerungen wurde die Doktorin durch ein fürchterliches Geschrei vom Hause her aufgeschreckt. Das achtjährige Rikli, um die Ecke kommend, stürzte auf sie los; hinter ihr drein der Bruder Fred, unter dem rechten Arm ein großes Buch, den linken mit geschlossener Faust ausstreckend.
„Jetzt sieh doch nur, Mama“, rief er entrüstet, „warum dieses vernunftlose Wesen, dieses Rikli, sich so gebärdet! Schau, dieses niedliche Fröschlein habe ich gefangen und dem Rikli unter die Nase gehalten.“
„Rikli, nun sei ganz still, es ist genug“, gebot die Mutter dem immer noch aufschreienden Kind, „und du, Fred, weißt sehr wohl, dass Rikli sich — allerdings in sehr unvernünftiger Weise — vor deinen Tieren fürchtet, warum musst du sie ihm also gerade unter die Nase halten?“
In diesem Augenblick nahte ein Wagen.
„Es ist die Dame mit dem kranken Mädchen, lass mich, Fred, lass mich“, sagte die Mutter, eilig den Buben beiseiteschiebend.
Der Wagen war schon da. Aus dem Stall kam Hans, der Pferdebursche, aus der Küche die Kathri gelaufen in einer sauberen weißen Schürze, denn man hatte ihr gesagt, sie müsse das kranke Mädchen die Treppe hinauf tragen.
Rikli eilte in die Stube hinein, um der Tante die Geschichte mit dem Froschli zu klagen, denn es konnte nicht darüber hinwegkommen, dass er ihm fast ins Gesicht gesprungen war. Aber die Tante schien augenblicklich keine Zeit zu haben: Oskar, der älteste Bruder, saß neben ihr, in ein ernsthaftes Gespräch vertieft.
Und kaum hatte die Tante ihre Unterhaltung mit Oskar beendet, als auch schon Emmi hereingesprungen kam und in großer Aufregung rief: „Tante! Tante! Sie gehen alle in die Erdbeeren, ein ganzer Trupp, darf ich noch mit? Sag doch schnell ja, ich kann jetzt nicht zur Mama, und es hat Eile.“
„Geh schon, aber komm nicht spät heim.“
Emmi war bereits draußen.
„Ich auch! Ich auch!“ schrie Rikli und lief der Schwester nach. Aber Emmi war in zwei Sätzen die Treppe hinunter und rief zurück: „Nichts! Nichts! Du kannst nicht mit! Im Walde hat’s Käfer und rote Schnecken!“
Rikli kehrte schleunigst um, und zum Ersatz für das entgangene Vergnügen wollte es nun seine bedauerliche Geschichte erzählen.
In diesem Augenblick ging drüben die Tür auf, man hörte Schritte und Stimmen, kurz darauf rollte der Wagen wieder fort.
Jetzt trat die Mutter ein, sehr erregt von dem eben Erlebten. Sie musste gleich der Tante, ihrer Schwester, davon erzählen, hatten sie ja doch von jeher Freud und Leid miteinander geteilt —! Nachdem sie die Kinder hinausgeschickt, berichtete sie, welch tiefe Teilnahme Frau Stanhope und ihr krankes Töchterchen ihr eingeflößt hätten. Das Mädchen sehe aus, als ob es nur noch halb der Erde angehöre; die Mutter aber suche sich selbst zu täuschen mit dem Trost, nur die Reise habe ihre Nora so sehr angegriffen, dass sie nun gar zu blass und durchsichtig aussehe. Jetzt in der frischen Bergluft werde es gewiss bald anders werden, darauf habe sie ihre ganze Hoffnung gesetzt.
Soweit hatte die Frau Doktorin berichtet, als ihr Mann von seinen ärztlichen Besuchen heimkam. Augenblicklich ging sie ihm entgegen und benachrichtigte ihn von der Ankunft der beiden Fremden. Der Doktor machte sich auch gleich wieder auf den Weg, um seinen ersten Besuch bei der neuen Patientin abzustatten. Erst spät am Abend kehrte er wieder zurück. Seine Frau und seine Schwägerin erwarteten ihn mit Spannung; sie wollten wissen, wie er den Zustand des Mädchens gefunden habe und ob er Hoffnung hege, der Sommeraufenthalt hier werde die gewünschte Genesung bringen. Aber der Doktor schüttelte den Kopf: „Da ist wenig Aussicht.“
Diese Nachricht stimmte die beiden Frauen sehr traurig.
Ein missglücktes Gespräch
Als der Arzt vom Rhein seinem Freunde in Buchberg geschrieben hatte, er möge für Nora und ihre Mutter eine geeignete Wohnung auf den gesunden Höhen seines Heimatortes auffinden, hatte dieser sogleich die Sache seiner Frau übergeben, die sofort mit der Tante zu beraten begann.
Auf dem Eichenrain stand seit dem Frühjahr ein neues Häuschen fertig, dessen ersten Stock der Bauer, dem es gehörte, bezogen hatte; die obere Etage aber war noch unbewohnt. Das Haus lag auf der Höhe des Eichenrains und hatte eine wundervolle Aussicht hinüber auf die grünen Hügel mit den Schneebergen dahinter und gegen Abend hinunter auf das rauschende Flüsschen im waldigen Talgrund.
Augenblicklich war die Frau Doktorin nach dem Eichenrain hinaufgegangen, und zu ihrer Freude hatte sie in der kürzesten Zeit mit den willigen und gefälligen Bauersleuten alles ausgemacht.
Es waren schon einige Tage vergangen, seit Frau Stanhope mit Nora dort eingezogen, und nur der Herr Doktor und auch einmal seine Frau waren dagewesen, denn Nora fühlte sich so angegriffen von der Reise, dass sie keinen Besuch empfangen durfte. Heute aber, da es ihr ein wenig besser ging, hatte der Arzt versprochen, dass seine Tochter Emmi kommen werde, und nun saß Nora am Fenster, das nach Westen ging und wo sie sich immer am liebsten aufhielt. Von dort aus konnte sie auf die hellen, schäumenden, rastlos wandernden Wellen des Bergflusses sehen, und gegen Sonnenuntergang schaute sie gern nach dem leuchtenden Abendhimmel und den golden schimmernden Hügeln davor.
Jetzt erblickte sie ein Mädchen, das den Hügel herauf dem Hause zueilte. Sollte das die Emmi sein, von der ihr der Doktor gesprochen? Mit größter Verwunderung sah Nora, wie das Kind, ohne abzusetzen, in riesigen Sprüngen den ganzen Rain heraufgerannt kam. Das war ihr unbegreiflich — sie meinte, das Mädchen müsse umfallen vor Erschöpfung.
Doch im nächsten Augenblick klopfte es an die Tür, und hereingelaufen kam dasselbe Kind, mit glühenden Wangen und einem großen Strauß von roten und blauen Blumen in der Hand.
Wahrhaftig, es war Emmi —! Frau Stanhope begrüßte sie freundlich und bat sie, sich zu Nora hinzusetzen.
Die beiden Mädchen, wie sie so einander gegenübersaßen, boten einen sehr verschiedenen Anblick dar. Die rotwangige Emmi mit ihren vollen, runden Armen und dem ungestümen Leben in jeder Bewegung ließ die zarte, schmächtige Nora noch schmaler und durchsichtiger erscheinen, so, als könne ein leiser Windhauch sie wegnehmen wie ein dünnes Rosenblättchen.
Frau Stanhope schaute eine kleine Weile auf die Kinder, dann wurden ihre Augen nass, und sie ging in das anstoßende Zimmer hinüber.
„Wo hast du die frischen Blumen geholt?“, fragte jetzt Nora ihren Gast.
„Auf der Wiese, jetzt im Herkommen“, entgegnete Emmi munter. „Oh, jetzt hat es so viele Margeriten und Glitzerblumen und blaue Vergissmeinnicht — so viele! Du solltest sie nur sehen, ganze Büsche! Sobald du gesund bist, gehen wir miteinander in die Vergissmeinnicht und dann in die Erdbeeren und nachher in die Heidelbeeren.“
Nora schüttelte den Kopf, und mit großen, ernsten Augen sagte sie: „Darauf kann ich mich nicht freuen.“
Emmi war sehr erstaunt, denn sie kannte nichts Herrlicheres, doch jetzt kam ihr ein Gedanke…
„Das kennst du gewiss alles nicht, Nora; aber wart nur, bis du mitkommen kannst — da wirst du dich einmal richtig freuen!“
Aber Nora schüttelte den Kopf: „Das war nie so bei mir, ich habe mich immer müde gefühlt, und ich kann mich gar nicht darauf freuen, dass es so werde wie bei dir; es kommt doch nicht.“
Der armen Emmi wurde es ganz angst „Ja, aber du musst dich doch auf etwas freuen können, und darum musst du es auch glauben, dass mein Papa dich ganz gesund machen wird.“
„Ich freue mich schon auf etwas, und immer wenn ich müde bin, denke ich daran, wie es im Himmel ist, noch viel schöner als hier! So herrliche Blumen sind dort, Rosen und Lilien, die gar nie welken, und alle Menschen sind froh und gesund für immer. Freust du dich nicht auch, in den Himmel zu gehen?“
Emmi wusste nicht recht. Sie glaubte schon, dass es schön sei im Himmel, aber sie wollte eigentlich lieber auf der Erde bleiben, bei den Eltern und Geschwistern, und es gab ja auch hier so vieles für sie, woran sie sich freuen konnte.
Nach einer kleinen Weile stand Emmi auf und schickte sich zum Abschied an. Auch von Frau Stanhope ließ sie sich nicht zum Bleiben bewegen, und Nora machte keinen Versuch, sie zurückzuhalten. Draußen vor der Tür nahm sie einen großen Anlauf und rannte dann ohne Aufenthalt bergab und wieder bergan, und gelangte so bald darauf keuchend daheim an die Haustreppe. Von dort stürzte sie sogleich in die Stube, wo die Tante allein am Nähtisch saß, denn die Mutter war soeben in die Küche gerufen worden.
Draußen in der Küche also stand die Marget; die Frau Doktorin schob ihr einen Stuhl zum Tische hin, schenkte ihr eine Tasse Kaffee ein, setzte sich dann zu ihr und sagte:
„Nehmt Euch einen Augenblick Zeit, Marget; ich hätte schon lange gern einmal mit Euch geredet. Denn es ist nicht nur um der Kleidungsstücke willen, dass ich Euch habe kommen lassen — es ist um des Elsli willen. Das Kind liegt mir recht am Herzen, es sieht gar zu zart und bleich aus, und immer sehe ich es mit dem schweren Hanseli auf dem Arm, und die anderen kleinen Brüder hängen daneben noch so an ihm, dass sie es fast zu Boden reißen. Ihr müsst wirklich Zusehen, dass das anders wird —.“
„Ja, ja, Frau Doktorin, das ist bald gesagt“, fiel jetzt die Marget ein, „aber was kann denn unsereins machen? Ich habe alle Hände voll zu tun vom Morgen bis in die Nacht hinein, dass auch nur täglich jedes etwas auf den Leib und etwas auf dem Löffel hat, da kann ich nicht noch alle die kleinen Schreihälse auf mir haben; wie sollte ich dann arbeiten? Und nun ist niemand anders da als das Elsli, das mir mit ihnen helfen kann — wer sollte es sonst tun? Der Fani könnte wohl manchmal helfen, aber er vergisst’s, er ist nicht bösartig, doch er hat seine eigenen Dinge im Kopf und ist nie zur Hand. Das Kind führt ein strenges Leben, ich weiß das, und es tut mir auch leid, aber es muss sich beizeiten gewöhnen, es kommt ja später nur immer strenger, weil es ja Geld verdienen muss.“
„Aber, Marget“, nahm die Frau Doktorin wieder auf, „das Kind ist nicht so kräftig wie all die anderen hier; es hält diese Lebensweise nicht aus, und wenn es krank wird — was habt Ihr dann?“