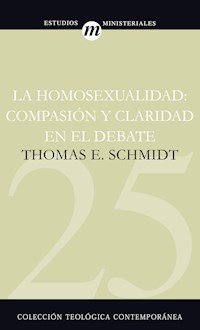19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Babyboomer gehen in Rente. Die große Generation tritt ab, die die Bundesrepublik geprägt hat wie keine vor ihr – auf wenig aufsehenerregende, aber souveräne Weise. Die zwischen 1955 und 1969 Geborenen waren der Kindersegen und das statistisch Allgemeine, und sie waren immer mittendrin: zwischen den Ruinen des Krieges, mit Adenauer und Brandt, der RAF und dem Pop, mit Habermas und Kohl, dem Mauerfall und den Kanzlern Schröder und Merkel. Thomas E. Schmidt ist einer von ihnen, auch er immer mittendrin. Spielerisch verfolgt er den Lebensweg der geburtenstarken Jahrgänge und schreibt dabei einen Bildungsroman der Bundesrepublik. «Im Wesentlichen haben wir unsere Aufträge erfüllt», meint Schmidt, «wir haben die Demokratie in Deutschland stabil gehalten, sind nie historisch rückfällig geworden und widerstanden nationalistischen Versuchungen.» Doch währenddessen machte diese Generation auch Karriere, sie lebte gut und verbrauchte die Ressourcen der Erde. Sie muss nun erkennen, dass die nächste Generation mit dem Erbe hadert: Dankbarkeit ist im Angesicht der Klimakrise kaum zu erwarten. Mit den Boomern vergeht auch die alte Bundesrepublik, und Thomas E. Schmidt blickt aus der eigenen Erfahrung auf die neue Gegenwart: ein autobiografischer Essay für die große Leserschaft dieser Generation, ebenso scharfsichtig wie ironisch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Thomas E. Schmidt
Große Erwartungen
Die Boomer, die Bundesrepublik und ich
Über dieses Buch
Die Babyboomer gehen in Rente. Die große Generation tritt ab, die die Bundesrepublik geprägt hat wie keine vor ihr – auf wenig aufsehenerregende, aber souveräne Weise. Die zwischen 1955 und 1969 Geborenen waren der Kindersegen und das statistisch Allgemeine und sie waren immer mittendrin: zwischen den Ruinen des Krieges, mit Adenauer und Brandt, der RAF und dem Pop, mit Habermas und Kohl, dem Mauerfall und den Kanzlern Schröder und Merkel.
Thomas E. Schmidt ist einer von ihnen, auch er immer mittendrin. Spielerisch verfolgt er den Lebensweg der geburtenstarken Jahrgänge und schreibt dabei einen Bildungsroman der Bundesrepublik. «Im Wesentlichen haben wir unsere Aufträge erfüllt», meint Schmidt, «wir haben die Demokratie in Deutschland stabil gehalten, sind nie historisch rückfällig geworden und widerstanden nationalistischen Versuchungen.» Doch währenddessen machte diese Generation auch Karriere, sie lebte gut und verbrauchte die Ressourcen der Erde. Sie muss nun erkennen, dass die nächste Generation mit dem Erbe hadert: Dankbarkeit ist im Angesicht der Klimakrise kaum zu erwarten.
Mit den Boomern vergeht auch die alte Bundesrepublik, und Thomas E. Schmidt blickt aus der eigenen Erfahrung auf die neue Gegenwart: ein autobiografischer Essay für die große Leserschaft dieser Generation, ebenso scharfsichtig wie ironisch.
Vita
Thomas E. Schmidt, geboren 1959, ist Publizist und Autor und arbeitet als Kulturkorrespondent der Zeit. In München und Hamburg studierte er Philosophie und Literaturgeschichte, war danach für das ZDF, die Frankfurter Rundschau sowie Die Welt tätig – und seit 2001 in der Redaktion der Zeit. Er lebt in Berlin.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Gerhard Richter 2022 (0037)
ISBN 978-3-644-01390-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Anfänge
Die Gespenster
Wir werden beobachtet
Die Politik und der Pop
Nachklänge der Gewalt
Wir emanzipieren uns, und wir werden emanzipiert
Das Scharnierjahrzehnt – aus uns wird eine Gesellschaft
Deutsche Einheit. Wir bleiben zu Hause
Ironie
Und dann kam Gerhard Schröder
Die Erfindung der Jugend
Spiegelstadium
ZITATE
Anfänge
Als ich ein kleiner Junge war, hatten die Autos drei Räder und die Männer nur ein Bein. Ich kam an einem der allerletzten Tage der Fünfzigerjahre zur Welt, ein paar Wochen zu früh und «zwischen den Jahren», wie man so sagt, sogar zwischen den Jahrzehnten. Auf den ersten Fotos lächeln meine Eltern, Tanten und Onkel noch ein bisschen mager, sie tragen die Ringe des Vergangenen unter den Augen, ihr Glück wirkt etwas verhärmt. In ein paar Jahren werden sie jünger aussehen. Der Krieg ist erst vierzehn Jahre aus. Ohne den Krieg und seine Verwerfungen hätte es mich nicht gegeben. Meine Mutter und mein Vater hätten sich niemals getroffen. Nach allem, was ich später hörte, kam das Ende für sie beide, die voneinander noch nichts ahnten, geräuschlos und beinahe unmerklich. Auf einmal passierte nichts mehr, und die Zeit hielt an. Bis der Motorenlärm der Sieger – lange noch nicht: Befreier – meine nachmaligen Eltern in die Wirklichkeit zurückrief. Natürlich gab es keine Stunde Null, aber ein Beginn war es auch. Bloß von was, wusste keiner.
Wie gering diese Frist, wie kurz dieser zeitliche Abstand zu jenem Ereignis war, dessen Wirklichkeit ich niemals erlebte, in dessen Strahlung ich jedoch aufwuchs, wurde mir erst sehr viel später bewusst, als ich selbst Zeuge historischer Einschnitte und ihres Nachhalls wurde. Der Krieg ist fort, als das Winzgesicht in dem riesigen weißen Kissen erscheint (wahrscheinlich bin ich es), und wo ich bin, ist der Krieg nicht mehr. Er war, erzählt man mir später, ziemlich rasch aus dem täglichen Leben verschwunden, mit mir beinahe schon erledigt. Aber selbstverständlich blieb er da, allerdings auf eine für die späten Fünfziger- und frühen Sechzigerjahre charakteristische Weise, zu der wiederum gehört, wie ein Kind sie erlebte und wie das Kind auf all die Ausblende- und Vorbeiredetaktiken ansprach, auf die Verdrängungsschauspiele oder auf das echte Vergessen. Vor allem auf die Art, wie die Erwachsenen mit Absicht oder unwillkürlich ihre Gefühle zeigten, sobald es um ihre – und irgendwie auch um meine – Vorgeschichte ging. Und nicht nur mich betraf das, nicht nur mich formte dieses Irrlichtern der aus der zivilisierten Welt gefallenen, an sich zweifelnden Gemeinschaft überlebender Deutscher, sondern alle diese Steppkes und kleinen Mädchen, die in großer Zahl in die erste Phase der gesellschaftlichen und politischen Zutraulichkeit hineingezeugt worden waren, sagen wir von 1955 an, die Wonnekinder des Neuanfangs, genauer des Widerrufs eines Endes.
Wir waren die lebendigen Beweise einer Stetigkeit des Lebens. Das Leben sollte nicht abreißen, und es riss nicht ab. So erfüllten wir von Anfang an eine Aufgabe. Es mag in den Tiefen des Unterbewussten verborgen bleiben, ob unsere schweigsame und doch des Ausdrucks so bedürftige Mitwelt sich in uns Kindern eine Art Publikum erschuf, vor dem eine Rechtfertigung irgendwann möglich wurde, oder ob wir schlichtweg diejenigen sein sollten, deren Aufzucht einen glücklicheren Ausgang nehmen musste. Unsere Existenz, unzureichende Verhütungsmethoden mal abgerechnet, verdankte sich dem Entschluss zum Weitermachen. Das war nicht selbstverständlich gewesen und war weiß Gott kein heroischer Entschluss. Selbst wenn viele dieser Eltern kaum Schuldgefühle zeigten, selbst wenn sie sich als Opfer ausgaben und sich den Panzer der Unbetroffenheit anlegten, selbst wenn sich die Frage nach Verantwortlichkeit im Zuge der Entnazifizierungen auf immer weniger Gestalten konzentrierte und die Politik nicht müde wurde, die Kollektivschuldthese zu bestreiten, muss eine Menge schlechtes Gewissen im Umlauf gewesen sein. Sei es, dass Skrupel bestanden, den Nachgeborenen in diesem zerstörten Deutschland überhaupt ein Leben zuzumuten.
Auch wer sich immer schon entlastet gefühlt hatte, konnte nicht davon absehen, dass dieses zertrümmert liegende Land moralisch befleckt und ein Spielball anderer Mächte war. Seine Zukunftschancen waren durchaus fraglich, alle Aussichten der Deutschen waren fraglich. Die Bundesrepublik – und ihre bald erkennbare Rolle als Frontstaat im Kalten Krieg verstärkte dieses Unbehagen noch einmal – würde fortan kein normales Land mehr sein. Eine trotzige Antwort auf diese Lage war der anschwellende Kindersegen. Der Kindersegen war die Behauptung einer Normalität unter Umständen, welche die Absonderlichkeit, vielleicht sogar Abwegigkeit von Zeugung erst langsam, dann umso nachhaltiger in Vergessenheit geraten ließen. Außerordentlich war man selbst geworden, außerordentlich waren die Kinder, aber sie waren die Chance, dass es vielleicht einmal wieder alltäglich würde. Argwöhnisch blickte man auf sich selbst und die anderen, übrigens auch auf die Deutschen jenseits des Eisernen Vorhangs. Gleichzeitig war man den Blicken der Besatzer ausgesetzt, die den beiden Deutschlands gegenüber misstrauisch blieben.
Der Anfang konnte nur Vorläufiges zutage fördern. Zu große Selbstgewissheit oder stolze Traditionsverbundenheit hätte man diesen Deutschen nicht durchgehen lassen. Experiment und Hoffnung, Gelegenheit und Makel – irgendwo dazwischen bildete sich das erste Bild von einem selbst. Daneben wurde über den Neuanfang in moralischer und geistiger Hinsicht viel debattiert, doch das interessierte im Wesentlichen nur die überlebenden Kulturprediger selbst. In Wirklichkeit hatte eine jede und ein jeder sich schon eine eigene Version von den Risiken und Chancen der neuen Zeit gemacht.
Mit den Kindern fing es wirklich wieder an. Es mag das Schicksal jeder jungen Generation sein, dass sie ein Opfer des Prägewahns der Alten wird. Das muss sie überstehen. In unserem Fall entwickelte sich das besonders deutlich. Denn zwischen den Generationen war nichts mehr selbstverständlich. Es gab buchstäblich nichts mehr zu vererben. So hing alles von der richtigen Auswahl des Verfügbaren ab. Es war von entscheidender Bedeutung, was wir lernen und was wir erfahren durften, vor allem, was wir nicht wissen oder nicht sofort wissen durften und nur unter Vorbehalt oder Anleitung, wie wir auf keinen Fall und wie wir unbedingt sein sollten, welches Deutschland wir nicht mehr verkörpern sollten und welches doch, und zwar mit Inbrunst, wenn auch nicht zu großer. Wir kamen also als Adressaten auf die Welt. Für unsere Generation gab es vielerlei Erziehungsprogramme, sie ergänzten oder widersprachen einander, sie hatten aber alle in besonderer Weise mit Menschenformung zu tun.
Das war nicht die Reeducation der Erwachsenen. Was uns betraf, spielte sich das unterhalb der offiziellen Wertevermittlung ab. Keine äußere Anleitung gab es dafür, und die Erziehung der Kinder war auch nicht der Gegenstand von formellen Verabredungen. Es fiel in den Bereich eines vorbewussten Handelns. Ganz sicher empfanden die Davongekommenen damals anders, als alle die Bücher wissen wollen, welche wir heute über sie lesen. Die Deutschen von damals verfügten ja über eine Innenperspektive. Sie hatte sich vom Gewesenen abgewandt, war keineswegs verstockt nazistisch, sondern vermutlich eher skrupulös ohne Ziel. Ich bin davon überzeugt, dass die Maximen, nach denen unsere Eltern unsere Erziehung einrichteten, sich jenseits der damals im Umlauf befindlichen Reden und Betrachtungen bildeten. Niemand hatte Zeit an volkspädagogische Erklärungen zu verschwenden. Vermutlich hatten die ersten Grundzüge unserer Erziehung gar nichts mit den ihnen später unterstellten psychologischen oder gar politischen Motiven zu tun. Und wahrscheinlich war dieser nie genau ausgeleuchtete Eigensinn die Voraussetzung dafür, dass wir uns zu dieser unwiderstehlichen, zufrieden pausbäckigen und die Physiognomie der Bundesrepublik bis heute nach unseren Gesichtern modellierenden Alterskohorte entwickeln konnten, eben zur Post-Nachkriegs-Generation, für die erst ganz spät und mit Verweis auf vergleichbare zeitgenössische Phänomene in anderen Ländern auch hierzulande der Begriff «Babyboomer» eingeführt wurde.
Die Gespenster
Anfang der Sechziger bollerten die letzten Holzbrenner durch die Straßen. Die Straßen waren eng und krumm wie die Bäche vor der Stadt. Ein damals keineswegs als charmante Altertümlichkeit empfundenes Kopfsteinpflaster sorgte für eine natürliche Art der Geschwindigkeitsbeschränkung, als hätte es einer solchen bedurft. Indem die Geschäfte am Vormittag und am Nachmittag nur verhältnismäßig kurz geöffnet hatten, gingen alle Frauen zur selben Zeit einkaufen. So kam ich ein wenig herum und betrachtete die anderen Kinder, ohne gleich mit ihnen spielen zu müssen. Ich sah gerne zu; das Stadtleben entlastet die Kleinen vom Zwang, irgendetwas vorführen oder irgendwie sein zu müssen. In Stuttgart oder Köln gab es zwar schon Fußgängerzonen, aber die echten, die mit Waschbeton eingeebneten und mit Pflanzenkübeln aufgehübschten, ließen noch zehn Jahre auf sich warten. Ich erinnere ein urbanes Gewusel, aber keines, das Anlass zu frühkindlicher Verkehrserziehung gab. Es ging eigentlich überall recht gemächlich zu. Ich lauschte dem Bass des Obsthändlers, des strengen Herrn über die Apfelsinen, ich roch an frisch gemahlenem Kaffee, der ein begehrtes Gift zu sein schien, oder sah atemlos in Kisten, wo sich junge Aale hilflos ineinander verschlangen. Im Fischladen floss noch Blut, kleine Fressfeinde wurden dort hingerichtet und kamen auf den Tisch. So natürlich war die Ordnung meiner Dinge, dass sie mir niemand erklären musste. Meine Aufmerksamkeit riefen Fahrzeuge aller Art hervor, wie etwa der Tempo-Kleinlaster oder der Messerschmitt-Kabinenroller. Bloß ein einziges Rad vorne, das war damals schon zu wenig. Die Isetta war ein rollendes Vogelei, aus dem sich ein Mensch schälte. Ich betrachtete solche Gefährte als unvollständige Autos, und Autos, der Stolz der militärischen Ent-Mobilisierung und einer neuen, zivilen Mobilität, spielten eine große Rolle, weil sie dem Jungen die ersten verständlichen Zeichen waren, mit der die Erwachsenen ihre Unterschiede und ihren Status markierten. Die Welt der Großen war also nicht nur beweglich, sondern auch gegliedert. Es ging darin etwas vor, in ständiger Veränderung war sie begriffen, und das betraf mich. Denn ich wurde ja selbst in einem Auto gefahren, und das Auto war die Verlängerung der intakten Blase, in der ich zu leben beanspruchte. Dreirädern hingegen fehlte etwas, sie sahen nach Bastelei und Behelf aus, und sie transportierten keine Familien. Es war also möglich, dass sich unter den Dingen eine ältere Zeitschicht verbarg. Es war auch möglich, dass sie sehr wohl auf mich zurückwirken konnte. Verstörend ragte das Kaputte also in meine Welt hinein und verwies hartnäckig auf etwas Ernsthaftes, vielleicht sogar Schlimmes. Das war also trotz allem da.
Das Kind kann von Entsprechungen nicht lassen, denn alle Dinge zeigen genau auf es selbst, von einem Anblick kann es sich nur schwer befreien. Mein kleines Bewusstsein erweiterte sich zwar jeden Tag, aber es gab so viel, das trotz geordneter Verhältnisse Unbehagen auslöste, und es kam wahrscheinlich aus der Vergangenheit. Drei Räder besaßen auch die Rollstühle der Kriegsversehrten. Hergestellt in den Deutschen Orthopädischen Werken in Berlin-Schöneberg oder von der Bad Oeynhausener Firma Voltmann, hatten sie sich schon nach dem Ersten Weltkrieg bewährt. Sie bestanden im Grunde nur aus zwei Antriebshebeln, dem Mechanismus und einem Sitz, davor die Beinablage. Die Kriegsversehrten juckelten auf ihnen grimmig durch die Straßen und grinsten die Kinder an. Sie fanden sich in Cliquen, bildeten menschlich-technische Zusammenballungen, und wenn ein bekanntes Gesicht darunter war, blieb meine Mutter mit mir bei ihnen stehen. Über den Beinablagen hingen graue oder braune Decken. Und darunter – ich wusste es genau, obgleich ich es nicht sah, der Grund, dass ich sofort zu flennen begann und mich an Mutters Hals verkroch – die fehlenden Gliedmaße!
Dies war eine ebenso unerträgliche wie vorweltliche, geradezu außerirdische Idee, das Vorgefühl einer Zeit, in der es mich noch nicht gegeben hatte, in der aber unzweifelhaft «der Krieg» war. Der Krieg war mein Nichtsein, und sie, die Invaliden, waren dessen böse Geister. Ich ahnte, ja ich wusste, dass Krieg gewesen war, und er war überall sichtbar. Die Zahnstümpfe der Häuser ohne Obergeschosse, die vermauerten Fenster und Brachgrundstücke fielen in einer notdürftig hergerichteten Stadtlandschaft umso deutlicher in den Blick und ernteten beim Vorbeigehen manchmal einen elterlichen Seufzer oder ein Kopfschütteln. Da war «immer noch» ein Zeichen der Versehrtheit zu sehen: Kerbe, Lücke, Stigma, Mahnmal, Wink, Fingerzeig, Symptom. Ich übersetzte das auf meine Weise, ich entwickelte mich schnell zu einem kleinen Psychoanalytiker der Dinge, belebt oder unbelebt. Und mit meinen kindlichen Fehllektüren lag ich genau richtig. In den Straßen gab es Trümmergrundstücke, die von Unkraut überwuchert waren, viele Schutthügel dienten uns selbstverständlich als Spielplatz.
Doch nichts ließ dieses zerstreute namenlose Entsetzen, das Gefühl einer endgültigen, durch nichts und niemanden behebbaren Beschädigung so nah an mich heranrücken wie das unsichtbare fehlende Bein. Die Kriegsversehrten waren wirklich, weil sie Anblicke waren und plötzliche Erscheinungen hervorriefen. Ihr Alter, ihre Gebrechlichkeit, die Trostlosigkeit, die sie ausstrahlten, ihre fehlenden Zähne, ihr sardonischer Humor, das seltsame Gerät, in das sie gebannt zu sein schienen, die Versuche, mich zu beschwichtigen und mir ihre Lage zu erklären, sie machten alles an ihnen nur noch unheimlicher. Vor mir lag ein Grauen. Das ahnte ich, und auf eine nicht kontrollierbare, meine Empfindungen quälende Weise betraf es mich. Sie, die Krüppel, waren die andere Welt. Ich war nicht deren Teil. An mir war alles dran, ich war vollkommen. Das fand meine Mama auch so, und darauf kam es an.
Kein Epos verrät uns, wie das Leben in Troja nach seiner Zerstörung weiterging. Äneas ist geflohen und gründet Rom. Aber Troja? Was dort vor sich ging, war nicht mehr erzählenswert, ein leerer Schauplatz, nicht mehr tauglich, ihm nachträglich eine dichterische Bedeutung beizulegen. Den Troja-nern ist das egal. Die Rufe der Zimmerleute hallen durch die zerstörten Quartiere, Frauen bevölkern die Straßen, mit Kindern auf dem Arm, auf der Suche nach Wasser und Nahrungsmitteln. Eine halbe Generation nach Kriegsende ist Deutschland keine reine Trümmerlandschaft mehr, es hat seine Trümmer vielmehr in Provisorien umgewidmet. Manches wird zur Zone eines bevorstehenden Aufbaus, anderes bleibt einfach liegen. Das Wort vom «Wunder» des Wiederaufstiegs ist in Wirklichkeit nur Platzhalter für ein nicht vollständig zu begreifendes Geschehen: Offenbar gelang es irgendwie, sich am Schopf aus dem Brunnen zu ziehen. Ich blicke auf eine gemeinschaftliche Bastelarbeit um mich herum, auf Planlosigkeit und glückliche Umstände hier und da. Nichts ist mehr für die Ewigkeit. Ich wahrscheinlich auch nicht, obwohl ich instinktiv dagegen rebelliere. Mein Eindruck ist der einer vollständigen Heldenlosigkeit. Die übrig gebliebenen Männer sind wieder verschwunden, diesmal in ihren Betrieben. Die Frauen, die vor einem Jahrzehnt das Leben retteten, haben sich in Mütter und Ehefrauen zurückverwandelt, in Krankenschwestern oder Psychotherapeutinnen.
Die Erinnerung an die Zeit der akuten Not hinterlässt ein Gefühl von Gleichheit. So gewaltig hatte die Faust der Geschichte zugeschlagen, dass Unterschiede eine Zeit lang keine Rolle mehr spielten. Das ändert sich erst mit uns, mit dem großen Kindersegen. Wer seinem Nachwuchs eine Zukunft in Aussicht stellt, hat schon mehr, als er für sich benötigt. Mit uns kann man prunken, sich mit anderen vergleichen, sich wieder als Bestandteil einer gegliederten Gesellschaft fühlen. Sämtliche Geschichten, die früher einmal den Aufstieg dieses Landes als unvermeidlich erklärten und ihm eine trotzige Notwendigkeit unterstellten, haben sich erledigt. Der Griff ins kulturelle Archiv verbietet sich. Es gibt keinen zureichenden Grund mehr, dass Deutschland fortbesteht oder dass es den Deutschen gut geht. So leben alle, während sie sich von den Fress- und Kaufwellen forttragen lassen, in einer Zeit ohne Geschichte, in reiner, wenn auch durch Zuversicht geschönter Gegenwärtigkeit – mag der Kanzler Adenauer auch in langen Linien denken und klug in Bonn regieren. Noch ist die Politik zu schwach, um eine neue Erzählung zu erzeugen, zu undurchschaubar, zu fern vom eigenen Leben. Erstaunlich lange existiert die Bundesrepublik als Land ohne Mythos. Das wirft ihre Menschen ebenso lange auf die eigenen Belange zurück, auf ihre Kreatürlichkeit. Was sie bewegt, hat mit dem Jetzt, aber nicht mit der Vergangenheit zu tun. Die eigene Biografie wird wichtig, und streng genommen kann nicht einmal von «Biografie» die Rede sein, wenn dieses Wort eine begriffene und sinnvolle Ganzheit des Lebens meint. Das Leben wird immer noch von der großen Zäsur geprägt. Es gab ein Vorher, nun gibt es dieses Nachher. Das ist ein simples Schema, ein Schicksal, das die Älteren teilen. So ziemlich alle haben dasselbe zu tun, dasselbe im Sinn, einfach sind die Ziele und die Erwartungen, kompliziert höchstens die persönlichen Ängste.
Ein sozialer Verband entsteht unter solchen Umständen nicht durch Gemeinsames, sondern mithilfe eines Parallelismus des je eigenen Daseins. Man war vereinzelt und doch immer wieder zusammen, irgendwann mit den anderen wieder oben auf einer Welle. In jener Zeit sind die Deutschen eine zusammengewürfelte Gemeinschaft, aber genau das sorgt für Zusammengehörigkeit. Bis sie eine Gesellschaft sind, wird noch viel Zeit vergehen, und dieser Unterbau einer erfahrenden Kollektivität der äußeren Umstände, die nicht mehr die einstudierte «Volksgemeinschaft» der Nazis ist, wird im Grunde nie mehr eingerissen. Er bleibt erinnert und zeigt seine Fundamente später wieder und wieder, in nationalen Krisen und in Phasen, die gemeinsames Handeln erfordern. In der Zeit ihres Aufstiegs half dieses frühe Kollektivempfinden der Bundesrepublik, jene stille Effizienz zu entwickeln, über die das Ausland sich bald wunderte und vor der es sich früh schon gruselte. Später begünstigte es allerdings auch die politische Stabilität. Es begründete das Phlegma der Mittigkeit, welches seine eigenen Schrecknisse entfaltete, eröffnete aber auch die Chance, sich friedlich in Europa einzugemeinden.
Man könnte sagen, indem sich das Gefühl einstellte, es gehe weiter, verfügte dieses aus eigenem Antrieb neu gestartete Deutschland nun über ein eigenes Altertum. Die Zeit vorher war von der Gegenwart durch eine unüberwindliche Schranke abgetrennt. Nichts wies dorthin zurück – was dazu führte, dass das Verdrängte in den Köpfen herumzuspuken begann. Es war eine Antike ohne einen Herakles und ohne einen Odysseus. Ihre Besonderheit bestand darin, in keiner Weise vorbildlich zu sein. Auf sie konnten sich keine Sehnsüchte richten, sie schloss Romantizismen und Renaissancen aller Art aus. Es war das Altertum, das keine Heldenerzählung, kein Epos mehr hervorbringen konnte, sondern sich nur noch in ganz kleinen Formen beschwören ließ, in Episoden und Selbstrechtfertigungen, in persönlichen oder familiären Erinnerungen. Es markierte so etwas wie den hinter den Menschen offen stehenden Abgrund; man war ihm entkommen, aber er lauerte. Ich hatte keine Möglichkeit, mir darauf einen Reim zu machen, ich war ja nichts Weiteres als ein kleiner postmythologischer Faun. Sofern ich den größten Teil meines Begreifens noch von meinen Eltern her beziehen musste, hatte ich an deren aufs Äußerste geschärfter Aufmerksamkeit für das Vorher und das Nachher teil. Ich übernahm gewissermaßen eine zäsurale Erinnerung, noch bevor sich in mir Erinnerungsinhalte überhaupt ansammeln konnten: «Dort drüben unter dem kleinen Hügel stand eine Flak.» Oder: «Diese Kuhle ist der Trichter einer Sprengbombe, die das Haus der K. zerstört hat.» Oder: «Diesen Park gab es vorm Krieg gar nicht, was war denn hier, waren hier Kasernen?» So sahen ungefähr meine ersten Landschaften aus. Was es zu sehen gab, schien die gespenstische Hohlform dessen zu sein, was an ihnen wirklich einmal sehenswert gewesen war. Oder eben fürchterlich. Ich sollte das Abwesende sehen – oder wenigstens ahnen, sah aber nur Reste.
Dabei trainierte ich wacker, das Alte vom Neuen zu sondern: Jene am Tonstich entlanglaufenden Schienen mündeten in eine verfallene Ziegelei, die ich nicht betreten durfte, obwohl die Loren und Ofenhöhlen mich doch so anlockten. Die ungeheure Dampflok war toll, während es schon neuere und leisere Lokomotiven gab. Riesige Ziegelmauern führten ins Nirgendwo, niemals würde ich an deren Ende gelangen, dahinter – manchmal erhaschte ich einen Blick durchs Tor – lagen gigantische Werkshallen, die ich für verlassen hielt, trotzdem wuselten Menschen in ihnen. Das rote, in den Himmel ragende Ziegelschloss der Maizena-Werke, aus dem mir einmal jemand eine Tüte Honigpops mitbrachte; es musste Großes, Zuckriges darin vorgehen, obgleich es von außen aussah, als läge es auf einem anderen Stern. Der Hafen war eine Zeitlandschaft, hier Wracks, Rost und ölige Taue, dort die neuen Schiffe, welche die Anerkennung meines Vaters hervorriefen und manchmal sogar tuteten. Es gab die echten, die verlassenen Ruinen, dann die wiederbelebten Tempel und Foren – und es gab plötzlich das ganz Neue, jene Bauwerke, welche die Zeitschranke vor die Augen stellten. Das eine wurde vernachlässigt, es wurde von allen missbilligt, dann verschwand es, obwohl ich es doch immer wieder gerne ansah und darin spielen wollte. Etwas anderes war dann plötzlich mit unbezweifelbarer Selbstverständlichkeit vorhanden. Einer erkennbaren Regel folgte das Ganze nicht. In Wahrheit ist eine solche Modernisierung eine Abfolge schrecklicher Zufälle. Es machte den Eindruck, als würde sich die Gegenwart selbst auffressen. Und das, bitte schön, war dann auch schon meine Gegenwart.
Gerne und häufig besuchten wir unsere Verwandten auf dem Land. Ihre Ehrfurcht gebietenden, rot-grün-weißen, reetgedeckten Bauernhäuser lagen unter Eichen oder waren umrahmt von Linden und Walnussbäumen. Die Straßen waren noch Sandwege. In schwarzen Schuppen warteten gefährliche Pflüge und Eggen auf ihren Einsatz, den ich allerdings niemals erlebte, was darauf schließen ließ, dass sie schon zu meiner Zeit Gerümpel waren, aber glücklicherweise nicht entsorgt wurden. Dahinter erstreckten sich die berühmten endlosen Roggenfelder. Das war dann echt alt. Es war nicht weit bis dorthin, nur eine ganz kurze Reise. Stadt und Land gehörten damals noch zusammen und bildeten ein stabiles Kontinuum. Aber bevor wir unser Ziel erreichten, pflegte meine Mutter mit mir einen Spaziergang zu machen. Irgendwann ging es an einem eingezäunten Hain vorbei. Der war eigentlich nichts mehr als ein sumpfiges, von Birken und Unkraut bewachsenes Grundstück, das an die Wiesen meiner Verwandten angrenzte.
Ein Wald war es schon deswegen nicht, weil kein Weg darin zu erkennen war, uns das Spazierengehen also verwehrt wurde. Wohl aber waren ganz hinten die blassen Reste einer ehemaligen Bebauung sichtbar, und es musste ein großes, bedeutendes Haus gewesen sein. Schon damals reizten unzugängliche Stätten des Verfalls meine Neugier, begleitet vom Impuls, ihr Geheimnis lüften zu müssen. Zu jener Zeit brach sich das in einem zappeligen Wissenwollen Bahn, was denn das gewesen sei und ob ich mal gucken durfte. Nein, durfte ich nicht. Meine Mutter schwieg beharrlich, bis sie, ich wurde langsam verständiger, erzählte, es sei ein Lazarett gewesen, ein spätes, hoffnungsloses und blutiges, eine Hilfsstation des Rückzugs, als den Verwundeten kaum noch geholfen werden konnte. So schlimm und endzeitlich das Ganze, so düster die Erinnerungen daran, dass man das unzerstörte Gebäude sich selbst überließ und später einfach einriss, weil es für die sich darin betrinkenden Jugendlichen zu gefährlich wurde.
Aber davor, lange davor sei das Haus etwas Tröstlicheres gewesen, nämlich ein Erholungsheim, vor allem für ärmere Leute, die viel gearbeitet hatten und dann erschöpft waren und Ruhe brauchten. Nicht, dass mich diese Antwort befriedigt hätte – und auch danach habe ich diese reizvolle Ruine leider nie untersucht. Aber Jahrzehnte später, als ich Peter Weiss’ «Ästhetik des Widerstands» las, begegnete sie mir noch einmal. Weiss verknüpfte das «Rekonvaleszenzheim», wie er es nennt – und manches spricht dafür, dass er tatsächlich genau jenes meinte –, mit dem Schicksal seines Erzählers, eines jungen kommunistischen Revolutionärs, der sich daran erinnert, dass seine Mutter dort einst als «Hilfsschwester» gearbeitet hatte, sein Vater dort Patient war, worauf es im Jahre 1917 an eben jenem mir unerreichbaren, aber meine Einbildung so außerordentlich anregenden (die, wenngleich nicht um Hilfsschwestern, sondern eher um finstere Generäle oder Geheimagenten kreiste) Ort nicht weniger als zu seiner Zeugung gekommen sei.
Der Ursprung der Weiss’schen Erzählung, die mir auch später mindestens so groß vorkam wie die backsteinernen Industrieanlagen meiner Kindheit, lag auf dem Weg zu unseren Verwandten! Ich will nicht behaupten, dass dies ein sensationeller literarischer Fund war, aber damals, als ich das Buch las, kam mir Weiss’ Geschichte gar nicht als Roman vor, sondern wie ein allzu glaubhaft klingender historischer Bericht. Er verband mein Erleben, mein dann schon jungerwachsenes, reflektiertes Erleben, mit einer großen Erzählung. Sie war allerdings aus der Geschichte meiner Familie nicht abzuleiten, und für sie gab es aus vielerlei Gründen in dieser Familienhistorie auch keine Anknüpfungspunkte. Der Weiss’sche Kosmos des Widerstands und der Revolution, historisch gesehen tatsächlich ein Teil der größeren Welt, aus der ich regional stammte, blieb somit ein Idealkosmos. Er war jene Antike, in die ich mich zu jener Zeit hineinwünschte. Es war die willentliche Aneignung einer Vergangenheit, wie sie sein sollte, aber tatsächlich nicht war, denn revolutionäre Bestrebungen jeder Art sind von meiner Familie nicht überliefert, einer Familie, die bürgerlich und politisch unaufgeregt lebte, keine literarische Vorzeigefamilie, sondern eine, deren Vergangenheit, sagen wir mal, gesprenkelt aussah. Zuzeiten meiner ersten Weiss-Lektüre nahm ich ganz selbstverständlich die Möglichkeit in Anspruch, mir eine Geschichtserzählung anzueignen und mich gleichsam selbst in sie einzulassen, und genau dazu war ich auch von meinen Schulen und meinen Universitäten, wenn ich es recht bedenke, immer wieder ermuntert worden. So spielte das Erholungsheim in meinem geistigen Haushalt für ein paar Jahre eine sorgfältig behütete widerständige Rolle. Ich und Peter Weiss, immerhin.
Den Bahndamm hinab, eine Wiese querend, auf der nie ein Vieh stand, war es dann nur noch ein kurzer Fußweg bis zu unserem Ziel, die bukolische Welt von Tante O. und Onkel A. Meine Mutter fühlte sich dieser Familie besonders verbunden. Ehrlich gesagt pflegte sie zu ihrer Tante ein herzlicheres Verhältnis als zu ihrer Mutter. Viele Bombennächte hatte sie dort verbracht, nicht einmal in Sicherheit, denn der vom Himmel regnende Phosphor machte dem Reet oft genug in kürzester Zeit den Garaus, was dann aus der Ferne als nächtliches Flammenspektakel zu beobachten war wie ein böses Osterfeuer. Im Grunde war meiner Mutter eine Kindheit auf dem Lande vergönnt gewesen, inmitten eines Großbauern-Clans, dessen Fertilität jeder deutschen Krise trotzte und niemals zu wünschen übrig ließ. Spielkameraden gab es dort für jedes Alter, auch für mich. Doch leider war dieser besonders liebenswürdige Teil unserer Verwandtschaft der einzige, der sich mit dem Nationalsozialismus eingelassen hatte. Dort waren sie: Blut und Boden. Von dort schienen sie alle herzukommen, die Ähren tragenden blonden Mädel und die entschlossen blickenden Jungs in Pluderhosen, eine Sense auf der Schulter.
Was die Technik des «kommunikativen Beschweigens» anlangte, wie der Philosoph Hermann Lübbe sie später nannte, wurde ich mittels dieses Teils der Verwandtschaft in sie eingeweiht. Auch später erfuhr ich nicht ganz genau, wie weit das persönliche Engagement all dieser von Himmler und Goebbels Gemeinten reichte und welche propagandistischen Saturnalien man an diesem Ort gefeiert hatte, Sonnwendfeiern oder Feuertänze, sicher auch Erntedankfeste, die sich vermutlich nur durch den Flaggenschmuck von jenen unterschieden, auf denen ich mich später in der Schule herumdrücken musste. Allem Anschein nach lag keine ernsthafte Schuldverstrickung vor. Sie schwammen halt oben und zeigten sich voller Stolz. Erst als ich fast schon erwachsen war, flüsterte mir meine Mutter, Onkel A. und Tante O. hätten «unter der Fahne» geheiratet. Das war es, was die beiden in ihrer Familie dann doch ein wenig stigmatisierte. So etwas machte man nicht, auch damals nicht. Und so wurde dieses NS-Bekenntnis des Paares späterhin weniger als Skandal angesehen, sondern eher wie ein Fauxpas behandelt.
Die Familie hatte keine Kriegsverbrecher hervorgebracht, militärisch hatten ihre Mitglieder ohnehin keine hohen Ränge bekleidet. Das war auch glaubhaft, denn alles, was man wusste, wurde früher oder später erzählt. Bei aller Neigung zur Trübung oder Verschiebung der Wahrheit herrschte nach innen am Ende doch großer Rededruck, gelegentlich sogar Geständniszwang. Bloß nach außen sollte nichts durchdringen. Es gab keinen Sinn für Öffentlichkeit, sie existierte eigentlich nicht und galt als ein Stück feindliches Ausland. Man kam aus einer intakten protestantischen Schuldkultur und wollte darin bleiben. Das Schuldigsein, auch die Schuld des Gewusst-Habens, machte man mit sich ab oder im engsten Kreis, so entsprach es dem bürgerlichen Selbstverständnis. Mein Vater, urban und katholisch, gerade erst aus seiner Heimat vertrieben und noch arm wie ein Eichhörnchen, fremdelte zuerst in dieser Umgebung. Aber die neuen Familienbande erwiesen sich in den kommenden Jahren als robuster denn alle kulturellen Unterschiede. Als sein Sohn dort herumsprang, mochte er sie schließlich auch. In der Phase, als mir dieses arische Idyll echte Pein bereitete, zeigte er mir dann die Bizarrerien unseres Landstrichs, die auch hernach noch gepflegten Ahnenfriedhöfe, wo ganz schlimme Gestalten inmitten ihrer «Sippe» die letzte Ruhe gefunden hatten, die nahe Thingstätte, vom Propagandaminister persönlich eingeweiht, hinter einem kleinen Wassergraben eine Freilichtbühne, auf der noch immer ein Miniaturdorf steht, Schauplatz des einst volksgemeinschaftsstiftenden Dramas «De Stedinge». Er zeigte mir auch den Ort, an dem das Andenken an Erich und Mathilde Ludendorff und ihren «Bund für Deutsche Gotterkenntnis» wachgehalten wurde – immer wieder diese Findlingssteine mit den verdruckst-verräterischen Aufschriften in Fraktur- oder Runenschrift. Es lag außerhalb unserer Vorstellungskraft, dass diese Orte noch immer Anhänger anzogen, doch der Zustand der Anlagen ließ auf etwas anderes schließen.
Sämtliche Fraktionen des größeren Familienverbandes exorzieren das nationalsozialistische Gedankengut erfolgreich – niemals Spuren von Revanchismus oder alten Sympathien. Als ich danach fahnde, bin ich eher überrascht, wie wenig tief es eingesickert war. Die Verwandten meines Vaters, treue Zentrumswähler, waren ohnehin unbegeistert geblieben, sie hatten sich zurückgehalten, wo es ging, und der ewige politische Streithansel Onkel J. hatte sich in den Dreißigerjahren sogar bei der KPD herumgetrieben! Onkel A. wiederum mausert sich zu einem knorrigen Sozialdemokraten, was in der Familie, die sich aufs Christdemokratische einpendeln wird, wieder nicht ganz dem Muster entspricht. Sein Sohn B., mein Cousin, der streng genommen mein Vetter nicht ist, doch der Kindersegen kompliziert die verwandtschaftlichen Beziehungen mittlerweile derart, dass sie robust vereinfacht werden, wird sich später zu einem Rebellen entwickeln. Er, der acht oder zehn Jahre Ältere, wird heftige Kämpfe mit seinem Vater ausfechten, ein naturwüchsiger Achtundsechziger, der ohne marxistische Theorie auskommt und trotzdem Grund hat, seine Herkunft zu befragen. Wir spielen. Ich bin stolz, dass er mit einem Zwerg wie mir spielt, aber vielleicht liefere ich ihm auch nur den Anlass, einen neuen Streich auszuhecken.
Im Haus lebt allerlei fremdartige Verwandtschaft, eine ältere Schicht, die in keiner erkennbaren Beziehung zu mir steht, für die ich mich auch weiter nicht interessiere, so wenig wie sie an mir Interesse zeigt. Es lebt dort auch in einem von Zigarrenrauch gebräunten Zimmer Opa S. Wessen Großvater er genau ist, bleibt ewig ungeklärt. Opa S. ist mürrisch und ungeheuer korpulent, sein Gesicht scheint nur aus Wülsten zu bestehen, in ihrer Mitte der Stumpen. Ich habe eine Heidenangst vor ihm, vor allem weil ihm das Bein fehlt und er sich überhaupt nicht mehr zu bewegen scheint. Schon wenn ich den Rauch rieche, verkrümele ich mich. Gleichwohl besitzt er einen ebenjener Rollstühle, die in meinen Augen die Haupthinterlassenschaft des kriegerischen Altertums bilden. B. und ich sehen uns im Vestibül den geparkten Wagen genau an, wir prüfen seine Funktionsfähigkeit und versichern uns seines Spaßfaktors. Und dann hebt mich B. ins Polster, setzt sich hinter mich, zerrt an den Antriebshebeln wie ein Irrer, wir rappeln über den Hof, biegen auf den Weg ein und brettern ihn in unglaublicher Geschwindigkeit hinunter.
Es ist ein Augenblick vollkommenen Glücks. Der Sommerwind weht, durchs hohe Laub spielt das Licht, ich bin in der Obhut eines Älteren, der mir meine Furcht nimmt. Wir rasen und rasen, in Wirklichkeit sind es nur wenige hundert Meter. B. wird dafür hinterher die schwersten Züchtigungen erleiden, für ihn gilt noch das alte, drakonische Strafsystem für freche Kinder, während ich als Missbrauchter nichts befürchten muss, und meine Mutter würde sich übermäßige Strenge auch verbeten haben. Dann ist unsere Fahrt mit einem Rumms plötzlich zu Ende. Ich erinnere nicht mehr, ob wir im Graben landeten oder ob das alte Gestell einfach zusammenbrach, jedenfalls sieht es auf einmal aus wie eine tote Staubspinne, Speichen und Streben recken sich sinnlos und eckig in die Lüfte, der Sitz ist auseinandergebrochen, ein Rad dreht sich langsam überm Gras. Wir haben das Ding in einen Trümmerhaufen verwandelt, vielleicht haben wir auch eine Tinguely-Skulptur daraus gemacht. Wir jauchzen und springen herum. Für uns beide war es ein kleiner Sieg über die Gespenster.
Wir werden beobachtet
Als «geburtenstarke Jahrgänge» werden für gewöhnlich die zwischen 1955 und 1969 Geborenen bezeichnet, die bundesrepublikanische Kinderflut, eine demografische Ausnahmeerscheinung in der neueren Geschichte des Landes. Diese Zeugungseuphorie ist ein Phänomen, das in anderen Ländern etwas früher einsetzte und auf gute wirtschaftliche Aussichten zurückgeführt wird. In Westdeutschland bricht die Euphorie zeitversetzt aus, mit einem Höhepunkt im Jahr 1964 – beinahe 1,4 Millionen Lebendgeburten –, von wo es dann wieder etwas bergab geht, bis die Natalitätskurve fünf Jahre darauf fast vollständig absinkt: der «Pillenknick».
Bis dahin ging es munter zu. Immer zusammen, immer im Rudel, fast alle mit Geschwistern, inmitten strampelnder, sich schlängelnder Kinderleiber, in allen Verwahranstalten als Herde behandelt, auch später immer «der Trend», das gut und verlässlich Beobachtbare, statistisch gesehen die Wahrheit über die Republik. Indem wir so selbstverständlich da waren und das Ganze bildeten, blieben wir als Ganzes erstaunlich schwach konturiert. Lange Zeit verkörperten wir schlichtweg, was vor sich ging, und waren als solches auch nichts Bemerkenswertes.
Doch nun läuft die große Zeit der Kinder einer gelingenden Bundesrepublik langsam ab. Wir gehen in Rente, eine Rente, die als Alterskohorten-finanziertes Projekt für uns gerade noch gesichert ist. Wir beginnen zu verstummen, und die Ersten von uns sind schon gestorben. Jüngere, die feststellen, dass wir den Wohlstand des Landes, seine soziale Sicherheit und die politische Stabilität womöglich mit in unsere Gräber nehmen könnten, drückten uns am Ende noch einmal das Prädikat «Boomer» auf. Freundlich ist das nicht gemeint. Es klingt nach ewig roten Bäckchen und dicker Hose. Wir haben Dankbarkeit nicht zu erwarten. Und wieso auch? Wir leisteten uns mit unserem Geld einen historisch unvergleichlichen Lebensstil und strapazierten dabei die Ressourcen der Erde in schlimmer Weise. Umweht unser Ende also der schale Hauch der Ruchlosigkeit, ausgerechnet uns, den Schaffern und Besonnenen, denen noch beigebracht wurde, was Sekundärtugenden sind? Ohne uns, die wir nun in andere Statistiken hinüberwechseln, in jene der Kränkelnden, der Versorgungsfälle, der nach Betreuung Verlangenden, der Risikogruppen und Dementen, vergeht die alte Bundesrepublik tatsächlich. Ist sie dann wirklich verschwunden?
Diese Bundesrepublik entwickelte – wir waren daran nicht unbeteiligt – ziemlich geschickte Techniken der Selbsterhaltung. Auch nach 1990 ging die Bundesrepublik nicht unter, wie man zunächst befürchtete oder erhoffte, vielmehr erwies sie sich als außerordentlich zählebig. Sie wollte ungestört weiterleben, ökonomisch, gesellschaftlich und geistig, trotz der Versuche, in sie gewissermaßen eine historische Furche einzuritzen. Manche versuchten gezielt, sie mithilfe der Unruhe aufzustören, um ihre moralischen Defizite und Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Andere wollten die Einheitspotenziale nutzen, um aus dem Land eine «richtige» Nation zu machen, wie es auf seinem Sonderweg im Grunde nie gewesen war, fest stehend auf dem Grund des Beständigen in der Geschichte. Doch hatte die Bundesrepublik zu jenem Zeitpunkt eine eigene Gravitation entwickelt. Die selbsterhaltenden Kräfte des Weststaats, so wie er mit uns Geburtenstarken geworden war, ließen diesen späten deutschen Selbstkorrektur- und Selbstoptimierungsehrgeiz am Ende im Sande verlaufen. Die Bundesrepublik wirkte als politisches Gebilde seltsam, als Land aber recht anziehend. Wir wollten damals gar keinen besonderen Sinn für den großen geschichtlichen Einschnitt entwickeln, vielleicht lag ein solcher auch jenseits unseres Horizontes. Denker der Zäsur gehörten um 1990 vielmehr der Kriegsgeneration an. Ihnen standen Risiken und Chancen einer aufgerührten Vergangenheit noch vor Augen. Ihr Blick für die Potenzen der deutschen politischen Antike war noch geschärft, für das Grauen der deutschen Geschichte ebenso wie für ihre nicht erreichten Ideale. Wir hingegen hatten Interesse an einer vorerst nicht endenden Gegenwart, an der fabelhaften deutschen Modernität, die wir schließlich mitgeschaffen hatten und verkörperten.
Es ist wahrscheinlich, dass die geburtenstarken Jahrgänge einen erheblichen Anteil an einem sehr seltsamen Phänomen hatten: Nach 1990 wurde die Geschichte gleichsam ausgebremst und blieb, das wurde in den Folgejahren immer deutlicher, in einem jetztzeitlichen Aspik einfach stecken. Genauer gesagt teilte sie sich in eine tagespolitische Hälfte höchster Bewegtheit und in eine lebensweltliche mit lang anhaltender Beharrungskraft. Kaum etwas blieb von den Warnungen und den utopischen Aufschwüngen übrig. Von all den dialektischen Erwägungen fand nur Weniges Einlass in die politische Sphäre. Entscheidungen wurden von Tag zu Tag gefällt; demgegenüber erzwang die westdeutsche Selbstbehauptung Ruhe und bürdete die Einheitsfolgen den Menschen in einer sich Tag für Tag weiter auflösenden DDR auf. Und das wurde von diesen, ähnlich wie in der Sowjetunion unter Jelzin, nicht als Geschichte, sondern als Zerfall erlebt.
Der historische Schwung ist von meiner Generation einfach nicht aufgenommen worden. Wir blieben hocken, in