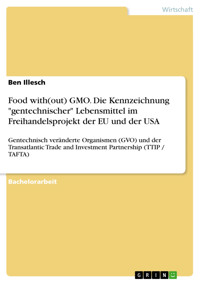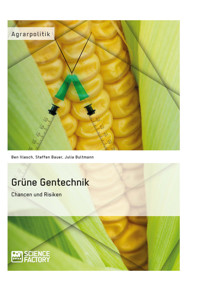
34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Science Factory
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das Thema Gentechnik spaltet die Menschen in Befürworter und Gegner. Besonders der Einsatz in der Landwirtschaft wird kontrovers diskutiert. Was genau sind die Methoden der Grünen Gentechnik? Wo liegen Gefahren? Müssen gentechnisch veränderte Lebensmittel gekennzeichnet werden und falls ja, wie? Dieser Band erklärt zunächst die Grundbegriffe der Gentechnik und geht dann auf die Lebensmittelkennzeichnung in der EU und den USA sowie das Freihandelsprojekt TTIP ein. Nach einem Überblick über die wichtigsten Akteure werden die Vor- und Nachteile der Grünen Revolution auf den Philippinen und in Afrika diskutiert. Am Beispiel von Mexiko werden biologische, rechtliche und sozio-ökonomische Folgen der Gentechnik erläutert. Aus dem Inhalt: Methoden der Gentechnik Lebensmittelkennzeichnung Transatlantisches Freihandelsabkommen TTIP Grüne Revolution Genmais
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Copyright © 2014 ScienceFactory
Ein Imprint der GRIN Verlags GmbH
Coverbild: pixabay.com
Grüne Gentchnik – Chancen und Risiken
Ben Paul Illesch (2013): Food with(out) GMO – Die Kennzeichnung „gentechnischer“ Lebensmittel im Freihandelsprojekt der EU und der USA
Lesehinweis
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
Gentechnik bei der Lebensmittelherstellung
Die Kennzeichnung von GV-Lebensmitteln
GV-Lebensmittel im Freihandelsprojekt TTIP
Zusammenfassung und Fazit
Abbildungen
Literaturverzeichnis
Steffen Bauer (2010): Gentechnologie als Beitrag einer modernen Agrarrevolution zur Hunger- und Armutsbekämpfung in Entwicklungsländern
Einleitung
Die Grüne Revolution
Zwischenfazit
Gentechnik in der Landwirtschaft
Akteure der Gentechnik
Aktuelle Situation
Argumente der Gentechnikbefürworter
Öffentliche Diskussion um die Gentechnik
Abschließende Bewertung
Literaturverzeichnis
Julia Bultmann (2010): Gefahren der Gentechnik für den Maisanbau in Mexiko
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Zukünftige Legalisierung der Gentechnik in Mexiko?
Entwicklung des Maisanbaus in Mexiko
Gefahren der Gentechnik – biologische und rechtliche Grundlagen
Sozio-ökonomische Konsequenzen für den Maisanbau in Mexiko
Ausblick
Bibliografie
Abbildungen
Ben Paul Illesch (2013): Food with(out) GMO – Die Kennzeichnung „gentechnischer“ Lebensmittel im Freihandelsprojekt der EU und der USA
Lesehinweis
Bei allen Bezeichnungen, die auf Personen bezogen sind, wird nach Möglichkeit eine geschlechtsneutrale Formulierung gewählt. Ansonsten wird die männliche Form verwendet, um den Text leicht lesbar zu gestalten. Diese gilt als Kurzform und berücksichtigt beide Geschlechter.
Alle Bezeichnungen, die sich an „Europa“ bzw. „Amerika“ anlehnen, stehen in dieser Arbeit nicht in Bezug zu dem jeweiligen gesamten Kontinent, sondern zu dem jeweiligen Staatenverbund – EU bzw. USA. Dies gilt sowohl bei Substantiven (wie z.B. Europäer, Amerikaner), als auch bei Adjektiven (europäisch, amerikanisch).
Abkürzungsverzeichnis
BMELV: Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
EFSA: Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit
FDA: Food and Drug Administration
GV-: gentechnisch verändert
GVO: Gentechnisch veränderter Organismus/Gentechnisch veränderte Organismen
IAGb: Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Gentechnologiebericht
IFIC: International Food Information Council Foundation
ISAAA: International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications
MKULNV: Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
RL: Richtlinie
TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership/häufig auch: Trans-Atlantic Free Trade Agreement (TAFTA)
VLOG: Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik e.V.
VO: Verordnung
WTO: World Trade Organization
EGGenTDurchfG: Gesetz zur Durchführung der Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft auf dem Gebiet der Gentechnik und über die Kennzeichnung ohne Anwendung gentechnischer Verfahren hergestellter Lebensmittel (EG-Gentechnik-Durchführungsgesetz)
FFDCA: Federal Food, Drug, and Cosmetic Act
RL 2001/18/EG: Richtlinie 2001/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.03.2001 über die absichtliche Freisetzung genetisch veränderter Organismen in die Umwelt und zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates
VO (EG) Nr. 834/2007: Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28.06.2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
VO (EG) Nr. 1829/2003: Verordnung (EG) Nr. 1829/2003 des Europäischen Parlament und des Rates vom 22.09.2003 über genetisch veränderte Lebensmittel und Futtermittel
VO (EG) Nr. 1830/2003: Verordnung (EG) Nr. 1830/2003 des Europäischen Parlament und des Rates vom 22.09.2003 über die Rückverfolgbarkeit und Kennzeichnung von genetisch veränderten Organismen und über die Rückverfolgbarkeit von aus genetisch veränderten Organismen hergestellten Lebensmitteln und Futtermitteln sowie zur Änderung der Richtlinie 2001/18/EG
Einleitung
„A future deal between the world’s two most important economic powers will be a game-changer. Together, we will form the largest free trade zone in the world.“[1]
José M. D. Barroso, derzeitiger Präsident der Europäischen Kommission
Das Oberhaupt der Europäischen Kommission spielt mit diesen Worten auf das Anfang des Jahres 2013 beschlossene Projekt zur Einführung eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und den USA an. Dieser in der Geschichte größte bilaterale Handelsdeal (TTIP) würde zwei der wichtigsten Handelspartner, die zusammen knapp die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung erbringen, noch enger zusammenschweißen. Bei den Verhandlungen um diesen Freien Güterhandel über den Atlantik sollen keineswegs nur Zölle liberalisiert, sondern auch administrative Handelsbarrieren abgebaut werden. Zu diesen zählen vor allem die unterschiedlichen Gesetze und Vorschriften für gewisse Güter-Bereiche. Eine Liberalisierung dieser, könnte sich allerdings bei den TTIP-Verhandlungen als sehr schwieriges Unterfangen herausstellen. Schließlich fußen die bisherigen Handelshemmnisse auf Grundlage unterschiedlichster Ansichten zu Themenspezifika zwischen den beiden Wirtschafträumen.
Eines dieser Konfliktthemen stellt die Einigungsgespräche und somit auch das ambitionierte Freihandelsprojekt schon zu Beginn auf eine harte Probe. So wurden die gerade erst begonnenen Verhandlungen um das Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) von der NSA-Datenschutzaffäre überschatten. Die damit verbundenen grundsätzlichen Fragen bezüglich des Datenschutzes gilt es, nicht nur um das erschütterte Vertrauen der EU wieder aufzubauen, sondern auch für das Zustandekommen des TTIP, zu klären.
Ein weiteres Problem könnte sich im Bereich der Gentechnik entwickeln. Schließlich boten der Einsatz sowie der Umgang mit dieser Technologie schon in der Vergangenheit, aufgrund der unterschiedlichen Meinungen der politischen und gesellschaftlichen Akteure – auf beiden Seiten des Atlantiks – ein erhöhtes Konfliktpotential.
Mittlerweile haben sich, auf Grundlage dieser unterschiedlichen Ansichten der beiden Handelspartner, auch völlig verschiedene Ansätze zum regulativen Umgang mit der Gentechnik und den damit verbundenen Gütern entwickelt.
In dieser Arbeit wird diesbezüglich das Augenmerk auf den Verbrauchsgüterbereich der gentechnisch veränderten Lebensmittel gelegt. Insbesondere wird jedoch die Kennzeichnung dieser fokussiert.
Die Arbeit ist in drei große Bereiche unterteilt. Im ersten Kapitel erfolgt eine Einführung in die Grundlagen rund um die Thematik der Gentechnik und der damit hergestellten Produkte. Dabei wird, neben den allgemeinen biologisch-technischen Konzepten und Methoden der Gentechnik sowie deren Anwendung bei der Herstellung von Lebensmitteln, auch auf den gesellschaftlichen Diskurs im transatlantischen Vergleich eingegangen. Diese grundsätzlichen Informationen, von der Theorie der Gentechnik über deren Anwendung im Lebensmittelbereich bis hin zur Reaktion der Verbraucher, schaffen das nötige Fundament für das darauffolgende zweite Kapitel. In diesem werden die einzelnen regulativen Maßnahmen, in Bezug auf die Kennzeichnung solcher gentechnisch veränderter Lebensmittel in der EU sowie in den USA, gegenübergestellt. Dabei gilt es, unter anderem folgende Fragen zu klären: Sind die bisherigen rechtlichen Standards in den einzelnen Staatenverbünden optimal an die Verbraucherrechte angepasst? Wollen die Konsumenten überhaupt eine Kennzeichnung, welche auf das (Nicht-)Vorhandensein bestimmter gentechnisch veränderter Stoffe hinweist? Wie stark sind in diesem Zusammenhang die regulativen und gesellschaftspolitischen Unterschiede in den beiden Staatenverbünden ausgeprägt?
Nach einer Darstellung der aktuellen Rechtslagen in Verbindung mit einem Erklärungsansatz der zuvor aufgestellten Fragestellungen, wird im dritten und letzten Kapitel die „Kennzeichnungsfrage“ bei GV-Lebensmitteln im TTIP erörtert. Bezugnehmend auf das erste und zweite Kapitel, werden einzelne ausgewählte Kennzeichnungs-Szenarien prognostiziert, sowie deren Vor- und Nachteile analysiert. Die oben aufgeführte Aussage Barrosos, dass das TTIP ein „game-changer“ sein könne, dient als Schlüsselhypothese dieses letzten Kapitels.
Am Ende wird die dargelegte Thematik durch eine Zusammenfassung und ein Fazit mit Blick auf die Zukunft der Gentechnik abgerundet.
Gentechnik bei der Lebensmittelherstellung
„Bei der so genannten grünen Gentechnik handelt es sich eher um einen Glaubenskrieg als um eine wissenschaftliche Debatte.“[2]
Andrea Fischer, ehemalige deutsche Bundesministerin für Gesundheit
Die Aussage von Andrea Fischer kann einerseits als scharfe Kritik an der Durchführung der (öffentlichen) Debatte über die Grüne Gentechnik, andererseits als bloße Mutmaßung verstanden werden. Um dies beurteilen zu können, müssen die Begriffe „Glaubenskrieg“ und „wissenschaftliche Debatte“ nach ihrem Sinninhalt nach erläutert werden. Ein Glaubenskrieg wird wegen unterschiedlicher Religionsvorstellungen geführt. Unter einer Debatte versteht man in der Regel das Zusammentragen von Pro- und Kontra-Argumenten zu einer bestimmten Thematik, dabei wird die Wissenschaftlichkeit durch rationalen Erkenntnisgewinn sowie nachprüfbare Aussagen sichergestellt. Bezogen auf das oben aufgeführte Zitat könnte dies folglich bedeuten, dass der Diskurs bezüglich der Anwendung der Grünen Gentechnik eher darauf zurückzuführen ist, was die beteiligten Akteure ganz subjektiv denken und weniger darauf, was die bisherigen wissenschaftlichen Ergebnisse zeigen. Ob diese Situation schon vorherrscht und somit das Fundament für das hypothetische Konstrukt eines „Gentechnik-Glaubenskrieges“ tatsächlich schon existiert, wird im letzten Punkt dieses ersten Kapitels geklärt.
Allen voran müssen zuvor wichtige Grundlagen der (Grünen) Gentechnik geklärt werden. Dabei liegt der Fokus auf der Erläuterung von speziellen Begrifflichkeiten, grundlegenden Methoden, Anwendungen sowie Zielen der Gentechnik im Bereich der Lebensmittelproduktion. Um die Bandbreite der Thematik rund um die Gentechnik zu untermauern, werden Zahlen und Fakten zum Einsatz dieser Technik dargestellt. In Bezug auf die Komplexität der gesamten Gentechnik-Diskussion wird auch auf die möglichen Chancen und Risiken des Einsatzes der Technologie eingegangen.
Terminologie
Im Jahr 1973 veränderten Stanley N. Cohen und Herbert Boyer zum ersten Mal die DNA einer Zelle im Reagenzglas und legten damit einen bedeutenden Grundstein für die moderne Gentechnologie[3] und der dazugehörigen Gentechnik-Industrie.[4]
In der heutigen Zeit wird die Gentechnologie vielfach als eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts angesehen.[5]
Sie ist ein abzugrenzendes Teilgebiet[6] des Sammelbegriffs der Biotechnologie[7]. Eine Begriffserklärung der Gentechnologie ist die der sogenannten Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages[8]. Sie definiert Gentechnologie als „die Gesamtheit der Methoden zur Charakterisierung und Isolierung von gentechnischem Material, zur Bildung neuer Kombinationen genetischen Materials sowie zur Wiedereinführung und Vermehrung des neukombinierten Erbmaterials in anderer biologischer Umgebung.“[9]
Ähnlich wie bei der Biotechnologie, wird die Gentechnologie weniger nach den einzelnen Methoden bzw. Verfahren, sondern vielmehr nach ihren Anwendungsbereichen differenziert.[10] Finden gentechnische Methoden im medizinisch-pharmazeutischen Gebiet Anwendung, spricht man von der Roten Gentechnik. Die Graue Gentechnik steht für den Einsatz von gentechnischen Verfahren im Bereich der Umwelt(schutz)technik, wie z.B. bei der Abfallwirtschaft. Bei der Weißen Gentechnik werden bestimmte Stoffe, wie etwa Enzyme, Vitamine, Aroma- und Zusatzstoffe sowie verschiedenste Feinchemikalien für die industrielle Verwendung hergestellt. Dabei ersetzen gentechnische Methoden häufig bestimmte chemische Prozesse bei der Herstellung dieser Stoffe.[11] Bei der Grünen Gentechnik geht es hauptsächlich um die Anwendung genetischer Methoden in der Pflanzenzüchtung.[12] Auf diesen wohl bekanntesten Zweig der Gentechnologie wird nach einer kurzen Einführung in die (traditionelle) Pflanzenzüchtung eingegangen.
Die meisten der in der heutigen Agrarindustrie verwendeten Kulturpflanzen haben durch die vom Menschen seit Jahrtausenden betriebene Zuchtwahl (Selektion) nur noch sehr wenig mit ihren ursprünglichen Stammformen gemein. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts wird diese Selektion der Bauern durch die industrielle Züchtung von Nutzpflanzen mittels gezielter Kreuzungs-Verfahren ersetzt.[13] Seitdem wurden mit Hilfe moderner Methoden, wie etwa der Hybrid-[14] oder der Mutagenesezüchtung[15], sehr ertragreiche Hochleistungssorten entwickelt. Sowohl bei den althergebrachten, als auch bei den modernen Methoden der klassischen Kreuzung, werden immer die gesamten Erbanlagen (Genom[16]) der sog. Elterngeneration einer Pflanzenlinie miteinander gekreuzt.[17] Es wird also das Erbgut der Pflanze verändert. Bei der Grünen Gentechnik kommt es ebenfalls zu einer solchen Veränderung, allerdings wird nur ein bestimmter Teil des Genoms (einzelne Gene) für eine Neukombination verwendet. Zudem wurde bei der Grünen Gentechnik, im Vergleich zur traditionellen Pflanzenzucht, die sog. „Artenschranke“ aufgehoben. Als „Spender“ kommen somit nicht mehr nur Pflanzen einer Art bzw. verwandter Gattungen, sondern jeder Organismus[18] in Frage.[19] Somit können Eigenschaften von Pflanzen über die Kreuzbarkeit hinaus gezielt „hervorgerufen, verstärkt, vermindert oder ausgeschaltet“[20] werden.[21] Wie diese Veränderung mittels gentechnischen Methoden erfolgt, wird folgend kurz und teilweise vereinfacht dargestellt.[22]
In einem ersten Verfahren – der Charakterisierung – wird mit Hilfe molekulargenetischer analytischer Methoden die genetische Information, welche für die Ausprägung eines bestimmten Merkmals verantwortlich ist, in der DNA eines Organismus identifiziert und beschrieben. Im anschließenden Schritt – der Isolierung – wird dieser Bereich der DNA aus dem sogenannten Spenderorganismus extrahiert. Danach kommt es zu einer Aufbereitung und Vermehrung dieses extrazellulären Erbguts. Das so erhaltene aufbereitete, extrazelluläre Erbgut kann nun „([…] unverändert oder neukombiniert) entweder direkt […] oder über Vektoren[23]“[24] in eine sogenannte Empfänger- oder auch Wirtspflanze übertragen werden. Von diesem letzten Verfahren – der Transformation – abgeleitet, werden solche neu ausgestatteten Pflanzen auch als „transgene Pflanzen“ bezeichnet.[25] Synonym werden die Begriffe „gentechnisch[26] modifizierte Organismen“[27] bzw. „gentechnisch manipulierte Organismen“ (GMO) oder auch „gentechnisch veränderte Organismen“[28] (GVO[29]), auch über die Grüne Gentechnik hinaus, verwendet.
„Vom Labor auf den Teller“ – Eigenschaften und Anwendungsgebiete von GVO
Seit den ersten wissenschaftlichen Erfolgen im Labor, Anfang der 1980er Jahre, entwickelte sich die Gentechnik innerhalb weniger Jahre zu einer anwendungsorientierten Technologie[30], deren Erzeugnisse seit nun mehr als 30 Jahren auf den Markt zugelassen sind.[31]
Für den im Vergleich noch relativ „jungen Einsatz“ gentechnischer Verfahren in der Lebensmittel[32]- bzw. Futtermittelproduktion ist hier vor allem die Grüne, aber auch die Weiße Gentechnik von Bedeutung.[33] Hierbei gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie GVO in Lebensmittel gelangen können, wobei transgene Pflanzen bisher die wohl bedeutendste Rolle einnehmen. Entweder transgene Pflanzen werden für die Lebensmittelproduktion „direkt […] oder über einen Veredelungsschritt als tierisches Produkt[34]“[35] eingesetzt. Der Anfang der Lebensmittel, welche aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden, liegt bei der Grünen Gentechnik in der Herstellung von GV-Saatgut[36] für die Agrarwirtschaft. Dabei ist das hauptsächliche Ziel der Gentechnik-Unternehmen, bestimmte Kultursorten (Events[37]) so zu verändern, dass sie für den Einsatz als Saatgut „auf dem Feld“ besonders vorteilhafte Eigenschaften zur Ertragssteigerung aufweisen. Hierbei gilt es, die hohen Ernteausfälle durch bestimmte Schädlinge, Unkrautkonkurrenz sowie Krankheiten entgegenzuwirken (siehe Abb. 1). Den globalen kommerziellen Anbau dieses GV-Saatguts beherrschen, mit gut drei Viertel der GV-Anbauflächen, die Kultursorten mit sogenannten Resistenzgenen gegen Herbizide (59% Stand: 2011)[38] und schädliche Insekten (15% Stand: 2011)[39]. Auf diese herbizid- und insektenresistenten transgenen Pflanzen wird aufgrund ihrer Bedeutsamkeit der gentechnischen Veränderungen im Folgenden kurz eingegangen.[40]
Bei transgenen herbizidresistenten Pflanzen werden mittels gentechnischer Verfahren Resistenzgene in die Pflanzen eingebracht, so dass diese gegen bestimmte, in der Landwirtschaft verwendete, unkrautvernichtende Pflanzenschutzmittel „immun“ sind.[41] Für den Einsatz solcher transgenen herbizidresistenten Pflanzen werden von den Gentechnik-Unternehmen verschiedene Vorteile im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft angebracht. So soll die eingesetzte Menge von Herbiziden bedeutend geringer ausfallen, was neben den positiven ökologischen auch einen finanziellen Effekt für den Landwirt bedeuten kann.[42] Zudem kommt es nicht zu Ernteeinbußen, die wiederum bei der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln in der konventionellen Landwirtschaft nicht zu verhindern sind. Außerdem müssen die Landwirte nicht mehr den Boden umpflügen, um das Nachwachsen von Unkräutern zu hemmen.[43]
Die Insektenresistenz ist das in der Landwirtschaft am zweithäufigsten auftretende Merkmal von transgenen Kulturpflanzen. Diese produzieren, dank des gezielten Einbringens bestimmter Gene[44] in das Pflanzengenom, eigene Abwehrstoffe gegen schädliche Insekten[45]. Wie bei der Herbizidresistenz soll auch hier der Einsatz chemischer Mittel – in diesem Fall Pestizide – verringert bzw. ganz vermieden werden, um so Vorteile für die Umwelt und den Landwirt zu generieren.[46]
Mit den bisher noch eher weniger verbreiteten Resistenz-Merkmalen gegen Krankheiten (Ernteausfälle: siehe Abb. 1), die bei Pflanzen durch Pilze, Bakterien und Viren ausgelöst werden, sollen weitere agronomische Ziele mittels der Grünen Gentechnik verfolgt werden.[47]
In den letzten Jahren ist die Forschung für die Entwicklung neuer Merkmalsausbildungen von transgenen Kultursorten überaus dynamisch.[48] Derzeit wird an der zweiten und dritten Generation von transgenen Kultursorten, unter anderem mit neuen Resistenzeigenschaften, geforscht.[49] Einige im Entwicklungsstadium befindliche neue Anpassungsmechanismen bei Kulturpflanzen durch gentechnische Verfahren, sind etwa der Aufbau von Resistenzen gegen sogenannte umweltbedingte Stressfaktoren, wie etwa Überflutungen[50], „hohe Salzgehalte, Dürre[51], Hitze oder Kälte.“[52][53] Für die Zukunft sollen zudem nicht mehr nur agronomische Ziele, die bisher vor allem dem Landwirt Vorteile brachten, verfolgt werden. So könnten transgene Pflanzen mit Hilfe gentechnischer Verfahren mit verbesserter „biochemische[n] und ernährungsphysiologische[n] Eigenschaften“[54] ausgestattet werden. Demgemäß könnten bei den aus diesen transgenen Pflanzen entwickelten Lebensmitteln positive Effekte[55] intensiviert und negative[56] verringert bzw. ganz ausgeschaltet werden, was speziell den Verbrauchern zu Gute kommen würde. Einige dieser GVO sind schon auf dem Markt zugelassen,[57] andere befinden sich noch im Entwicklungsstadium[58].
Anders als die Grünen Gentechnik ist die Weiße Gentechnik bei der industriellen Herstellung von Lebensmitteln bzw. deren Zusatzstoffen in manchen Bereichen[59] nicht mehr wegzudenken. Dabei sollen die Methoden unter Einsatz künstlich hergestellter GV-Mikroorganismen ökonomisch, ökologisch oder qualitativ besser als Traditionelle sein.[60]
Unter Betrachtung all dieser gentechnischen Methoden und ihre Einsatzgebiete soll zusammenfassend noch einmal klar definiert werden, was GV-Lebensmittel sind. GV-Lebensmittel sind Lebensmittel, die selbst GVO sind[61] oder aus solchen bestehen[62], also alle Lebensmittel, die gentechnisch veränderte Gene oder Spuren dieser enthalten. Des Weiteren sind Lebensmittel gemeint, die mit Hilfe von GVO hergestellt wurden,[63] aber keine Transgene mehr enthalten bzw. bei denen der Nachweis von signifikanten Spuren der gentechnischen Veränderung nicht mehr möglich ist.[64]
Das Inverkehrbringen von GVO
International[65]
Seitdem die ersten Felder im Jahr 1996 mit transgenen Kultursorten bewirtschaftet wurden, stiegen die Anbauflächen im globalen Vergleich kontinuierlich an (siehe Abb. 2). Im Jahr 2012 erstreckt sich diese Fläche auf ca. 170,3 Mio. ha weltweit[66], was gut das Hundertfache im Vergleich zu 1996 (1,7 Mio. ha) ist. Dabei pflanzten mehr als 15 Mio. Bauern in den Entwicklungsländern 52% der weltweiten transgenen Pflanzen an. Im Vergleich wurde die übrige Fläche (48%) in den Industriestaaten von knapp 2 Mio. Landwirten mit GV-Saatgut bestellt.[67] Im Jahr 2011 waren, gemessen an der weltweiten Anbaufläche, 73% des Sojas, 74% der Baumwolle, 31% des Maises und 25% des Rapses gentechnisch verändert (siehe Abb. 3). Diese vier GV-Pflanzenarten wurden im selben Jahr auch fast ausschließlich auf der gesamten weltweiten GVO-Anbaufläche bewirtschaftet (siehe Abb. 4). Dabei weisen die angebauten Events hauptsächlich die zwei Merkmale Herbizid- und/oder Insektenresistenz auf (Stand 2010/siehe Abb. 5).
USA
Die USA nehmen auch im Jahr 2012 mit einer GVO-Anbaufläche von knapp 70 Mio. ha die Position des globalen „Spitzenreiters“, vor Brasilien (mit insg. 43,7 Mio. ha), ein.[68] Zurzeit sind 93 Events von den US-Behörden zum Anbau zugelassenen und weitere 20 befinden sich im Zulassungsverfahren.[69] Dabei zeigt sich, dass die mit Abstand meisten zugelassenen Events dem US-amerikanischen Gentechnik-Unternehmen Monsanto zuzuordnen sind (siehe Abb. 6).
In den USA beherrschen manche GV-Nutzpflanzenarten fast den gesamten Markt, wie z.B. GV-Zuckerrüben (mit 95%), GV-Soja (mit 93%) oder GV-Mais (mit 88%).[70] So ist es nicht von der Hand zu weisen, dass Schätzungen zufolge jeder US-Bürger jährlich durchschnittlich etwa 80 Kilogramm GV-Lebensmittel verzehrt,[71] da theoretisch vier von fünf Lebensmitteln GV-Zutaten im signifikanten Maße beinhalten.[72]
EU[73]
In der EU sind derzeit ausschließlich drei GV-Pflanzen für den Anbau auf dem Feld zugelassen.[74] Den EU-Behörden liegen 18 weitere Anbauanträge zur Zulassung vor. Von den drei Zugelassenen wird im Anbaujahr 2013 nur der seit 1998 zugelassene GV-Mais „Mon 810“ in einigen EU-Mitgliedsstaaten angepflanzt.[75] Dabei ist Spanien, mit einem Anteil von ca. 85% der gesamten GVO-Anbaufläche in der EU (Stand 2012),[76] dass wohl „einzige Land der EU, in dem [transgene] Pflanzen im großen Stil angebaut werden.“[77] Trotz dieser im internationalen Vergleich gering ausfallenden Anbauflächen sind transgene „Pflanzen in der EU nicht mehr wegzudenken.“[78] Infolge des internationalen Handels mit Ländern, die GVO breitflächig anbauen, gelangen viele Mio. Tonnen an transgenen Pflanzen in die EU. Von diesen dürfen 47 Events für den Verwendungszweck als Lebens- und/oder Futtermittel bzw. für die Produktion dieser in die EU importiert werden.[79] Dabei ist die Sojapflanze bzw. sind ihre Bestandteile (Sojaschrot, Sojabohne) speziell für die Futtermittelproduktion aufgrund ihres hohen Eiweißanteils von besonderer Bedeutung.[80] So wurden im Jahr 2012 12 Mio. t Sojabohnen und ca. 21 Mio. t Sojaschrot aus den weltweit wichtigsten Soja-Exportländern[81] in die EU verschifft.[82] Da diese Sojarohstoffe dort aus ca. 88-100% GV-Soja gewonnen werden,[83] sind bei der Ernte, der Lagerung sowie dem Transport in die EU „zufällige, technisch unvermeidbare GVO-Gehalte kaum zu vermeiden.“[84] Eine ähnliche Situation lässt sich auch bei den fünf anderen zugelassenen Pflanzenarten[85] sowie den daraus hergestellten Lebens- bzw. Futtermitteln beobachten.[86] Dabei gibt es, anders als in den USA, in den europäischen Supermarktregalen bisher keine Lebensmittel, die selbst GVO sind (Bsp. siehe FN 61). Auch nur sehr selten stößt der EU-Konsument auf Nahrungsmittel, die aus diesen hergestellt wurden und noch einen signifikanten GVO-Anteil aufweisen (Bsp. siehe FN 62). Sehr häufig kommt der EU-Verbraucher hingegen mit Lebensmitteln, die mit Hilfe von GVO hergestellt wurden, in Kontakt. Wobei diese Nahrungsmittel keine oder einen nur sehr geringen Anteil gentechnisch veränderte DNA enthalten (Bsp. siehe FN 63).[87] Daher kommen, laut einigen Schätzungen, zwischen 60-80% aller Lebensmittelprodukte des EU-Marktes während ihrer Herstellung in Kontakt mit GVO.[88]
Grüne Gentechnik: „Segen oder Fluch?“
Der ökonomische Nutzen von GVO
Viele Vorteile, die aus der Grünen Gentechnik (zukünftig) resultieren, wurden in den vorhergehenden Punkten angedeutet. Dabei sind, wissenschaftlich gesehen, die gentechnischen Methoden den konventionellen sozusagen einen Schritt bei der beliebigen Veränderung von Pflanzen voraus.
In der Diskussion um den Nutzen dieser Technologie teilen sich sowohl die politisch-gesellschaftlichen Meinungen als auch die fundierten wissenschaftlichen Ergebnisse verschiedener Untersuchungen voneinander. Die Befürworter, vor allem aus den Reihen der Industrie, der Politik oder der Wissenschaft, weisen auf verschiedene Vorteile der Grünen Gentechnik hin.[89] Demnach fallen auf der Homepage des größten Gentechnik-Konzerns Monsanto Schlagwörter wie: „improving agriculture – improving lives“[90], „sustainable agriculture“[91] und „global food security”[92]. Diese suggerierten „Versprechungen“ seitens der Industrie sollen, laut des ISAAA Bericht (2012), sogar teilweise erfüllt worden sein.[93] Wobei eine kritische Betrachtung solcher Ergebnisse, laut der biowissenschaftlichen Expertin Heike Baron, angebracht erscheint.[94] Ob es mit Hilfe der Grünen Gentechnik wirklich möglich ist, nachhaltig das Problem der Welternährung nicht nur in den Industrie- sondern auch in den Entwicklungsländern zu lösen, oder ob die Gentechnik-Industrie durch solche Propaganda nur von den problembehafteten sozioökonomischen und politischen Fragen abzulenken versucht, bleibt hierbei fraglich.[95]
Neben diesen kontroversen Vorteilen der Grünen Gentechnik geht es bei dem Einsatz von GVO bisher um kommerzielle Interessen der Landwirte. Dass die neuen transgenen Kultursorten größtenteils Vorteile für die Landwirte bringen, ist durch verschiedenste Studien, wie etwa die von Brookes und Barfoot (2012)[96] oder Carpenter (2010)[97], bewiesen worden. Der einzige Indikator, der den globalen wirtschaftlichen Erfolg dieser Technologie ggf. teilweise widerspiegelt, ist der, dass der weltweite Anbau transgener Pflanzen seit Jahren immer weiter ansteigt. Da eine Gesamtbetrachtung aller ökonomischen Effekte allerdings kaum realisierbar ist, werden häufig stets Einzelfälle betrachtet.[98] Hierbei werden von Kritikern der Grünen Gentechnik, wie z.B. Benbrook (2003; 2009; 2012)[99], auch negative ökonomische Folgen dargestellt. Neben diesen zumeist in den USA durchgeführten Untersuchungen, gibt es auch vereinzelt Studien bezüglich der ökonomischen Effekte in der EU.[100] Dabei zeigen diese, dass EU-Landwirte, welche auf GV-Saatgut setzen, zumeist geringere Einsparungen als US-Farmer einfahren.[101] Das liegt daran, dass EU-Landwirte beim Einsatz dieser transgenen Pflanzen gewisse finanzielle Risiken eingehen, welche in den USA entweder überhaupt nicht existieren oder bedeutend geringer ausfallen. Hierzu zählen etwa Kosten zur Einhaltung bestimmter Sicherheitsstandards beim Anbau bzw. Lagerung und Transport, Schadenersatzkosten oder aber Ernteeinbußen infolge der Zerstörung der Felder durch Umweltaktivisten.[102] Neben den GVO-anbauenden Landwirten haben auch die Lebens- und Futtermittelindustrie finanzielle Einbußen, aufgrund der scharfen europäischen GVO-Regulierungen[103] und der geringen Akzeptanz der EU-Bürger[104].
Aufgrund der intensiven Forschung im Bereich der Grünen Gentechnik werden allerdings in naher Zukunft auch potentielle qualitative und finanzielle Vorteile für den Endverbraucher prognostiziert.[105] Diese könnten auch in der EU zu einer besseren Akzeptanz und somit zu geringeren finanziellen Einbußen auf der GVO anbauenden bzw. verarbeitenden Seite führen.[106]
Die Risiken von GVO
Neben den aufgeführten (eventuellen) Vorteilen von GVO besteht auch immer ein gewisses Risiko[107], sobald der GVO das Labor verlässt. Auch wenn bisher noch kein eindeutiger Fall eines direkten Schadens durch GVO aufgetreten ist, bleibt die Diskussion um mögliche Risiken weiterhin brisant. Aus diesem Grund sind präventive Maßnahmen wie Risikobewertungen[108] für neue Organismen unabdingbar, um die Natur, andere Lebewesen und den Menschen selbst zu schützen. Von der Expertenseite wird der Einsatz gentechnischer Methoden per se nicht als gefährlich angesehen, so wie es häufig von den Medien oder der „unaufgeklärten Bevölkerung“ gemutmaßt wird. Vielmehr muss die Bewertung von den Risiken im Einzelfall betrachtet werden.[109]
Gesundheitliche Risiken für den Menschen
Der menschliche Organismus hat sich während der Evolution perfekt an seine Umwelt angepasst und reagiert, mittels bestimmter Abwehrmechanismen, auf Substanzen und Organismen. Sind diese nicht in seiner natürlichen regionalen Umwelt anzutreffen, kann er sich gegen diese unter Umständen auch nicht wehren. Somit können unbekannte Organismen und Stoffe den menschlichen Organismus Schaden zufügen oder zu allergischen Reaktionen führen.
GV-Lebensmittel können solche fremden, den menschlichen Abwehrmechanismen unbekannten Stoffe enthalten, da ihre Bestandteile in der Natur nicht in der Form vorkommen.[110] Zudem können nicht vorhersehbare unbeabsichtigte Eigenschaften transgener Pflanzen als Nebeneffekt bei der „Herstellung“ nicht ausgeschlossen werden.[111] Mögliche Risiken für die Gesundheit des Menschen können bei GVO eintreten durch: „schädliche Inhaltsstoffe oder Stoffwechselprodukte […]; eine andere Nährstoffzusammensetzung mit der Folge schlechterer Verdaulichkeit; negative Auswirkungen auf die Darmflora; Veränderungen der Proteinzusammensetzung, [welche] allergene Wirkungen verursachen“[112] können sowie bestimmte Substanzen transgener Pflanzen, welche eine toxische Wirkung haben können.[113] Um solche teilweise unkalkulierbaren Risiken für den Menschen zu minimieren bzw. ganz auszuschließen, werden die GVO vor der Zulassung als Lebens- oder Futtermittel ausgiebig untersucht. Da für die bisher unbekannten Zusammensetzungen solcher GVO direkte Testverfahren fehlen, wird bei der Risikobewertung meist das Prinzip der „substantiellen Äquivalenz“[114] angewendet. Neben diesem Verfahren werden die GVO auch im Labor an Versuchstiere verfüttert. Diese Fütterungsstudien werden einerseits vom Hersteller des GVO und andererseits häufig von unabhängigen Forschungseinrichtungen durchgeführt.[115] Wird bei solchen Untersuchungen ein mögliches gesundheitliches Risiko für den Menschen prognostiziert, werden diese GVO auch nicht als Lebens- oder Futtermittel für den Markt zugelassen.[116] Trotz dieser Maßnahmen zur Risikominimierung kann es auch nach der Freigabe bestimmter GV-Lebensmittel für den Markt zu negativen gesundheitlichen Effekten kommen (das sog. Restrisiko).[117] In den fast zwei Jahrzehnten, in denen verschiedenste GV-Lebensmittel für den Markt zugelassen sind, konnten allerdings nie tatsächliche toxische oder allergische Reaktionen bei Verbrauchern beobachtet werden.[118] Andere Darstellungen, wie etwa vom französischen Wissenschaftler Gilles-Eric Seralini[119], konnten „einer wissenschaftlichen Prüfung nicht standhalten.“[120]
Ökologische Risiken
Neben dem gesundheitlichen Risikopotential in Bezug auf den menschlichen Organismus könnten transgene Pflanzen auch erheblichen Schaden auf Ökosysteme anrichten. Die bisher prognostizierten potentiellen Risiken für die Umwelt sind vielfältig (siehe Abb. 7).[121] Beispielsweise könnten sich bestimmte Eigenschaften transgener Pflanzen, wie z.B. die Herbizidresistenz, auf andere Pflanzen übertragen. Durch diese Art der unbeabsichtigten Kreuzung mittels sogenanntem „vertikalen“ bzw. „horizontale Gentransfer“ besteht die Möglichkeit, dass Unkräuter, die eigentlich durch Herbizide vernichtet werden sollen, ungewollt immun gegen diese werden.[122] Zudem existiert das Risiko der unkontrollierten Verbreitung (Auswilderung) dieser transgenen Pflanzen und ihrer veränderten Erbinformation. Somit können durch den Pollenflug nicht nur angrenzende Felder[123], sondern auch, über weite Strecken, benachbarte Ökosysteme mit diesen transgenen Pflanzen „kontaminiert“ werden. Durch die „Nichtrückholbarkeit“ von einmal freigesetzten transgenen Pflanzen sowie der „Verschiedenartigkeit und der Komplexität der zugrunde liegenden naturwissenschaftlichen Prozesse [ist die] Bandbreite und [das] Ausmaß“[124] potentieller Umweltrisiken nicht vorhersehbar.[125]
Die zuständigen Sicherheitsbehörden versuchen dieses Risiko zu minimieren, wobei ein gewisses Restrisiko nicht ausgeschlossen werden kann. Demzufolge müssen alle Events vor dem Ausbringen in die Umwelt, sei es für den kommerziellen oder experimentellen Anbau, zugelassen sein. Um zugelassen zu werden, müssen diese transgenen Pflanzenlinien unterschiedliche Risikobewertungsverfahren durchlaufen, wie z.B. die Kultivierung mit anderen Organismen in geschlossenen Systemen.[126] Selbst nach der Zulassung gibt es, gerade in der EU, verschiedenste Sicherheitsmaßnahmen[127], um mögliche Gefahren für die Flora und Fauna zu minimieren bzw. die Koexistenz[128] von GVO- und konventionellem Anbau zu gewährleisten.
Der öffentliche Diskurs im transatlantischen Vergleich
EU
Als Ende der 1970er Jahren die ersten Gentechnik-Forschungslaboratorien in Schweden ihren Betrieb aufnahmen,[129] begann ein bis jetzt nicht enden wollender Konflikt über die Gentechnologie und ihre Anwendungen in der EU-Bevölkerung. Dabei kam es in den darauffolgenden Jahren eher zu einer Entspannungsphase in Europa.[130] Die BSE-Krise Mitte der 1990er Jahre erschütterte das Konsumentenvertrauen in die Lebensmittelindustrie und den EU-Regulierungsstandards.[131] Schnell beherrschten Themen bezüglich „Lebensmittelsicherheit, Etikettierung, freie Wahl des informierten Konsumenten […] die öffentliche Diskussion“[132]. Als kurz darauf die ersten transgenen Pflanzen in der EU angebaut bzw. in die EU importiert wurden, kam es zu heftigen öffentlichen Reaktionen mit einer beachtlichen Resonanz von Seiten der Medien, Politik und den NGOs, die bis heute nicht abgebrochen ist.[133] Dies könnte als ein möglicher Grund für die im internationalen Vergleich so gering ausfallenden europäischen GVO-Anbauzahlen gedeutet werden. Schließlich ist es der Verbraucher, der mittels seiner Nachfrage auch das Angebot bestimmt. Warum die Nachfrage nach GV-Lebensmitteln in der EU „gegen Null“ geht, kann aufgrund verschiedenster Verbraucherstudien erklärt werden. Laut den Ergebnissen der Eurobarometer-Umfragen aus dem Jahr 2010 (siehe Abb. 8), fühlen sich 61% der EU-Befragten bei dem Gedanken unwohl, dass gentechnischen Verfahren bei der Lebensmittelproduktion eingesetzt werden. Ebenfalls 61% wollen keine Zunahme von GV-Lebensmitteln auf dem EU-Markt. Diese Ergebnisse spiegeln die geringe Akzeptanz und somit auch die geringe Kaufbereitschaft[134] von GV-Lebensmitteln bei den EU-Verbrauchern wider. Laut der Eurobarometer-Umfrage von 2005 (siehe Abb. 9), bewerteten die EU-Befragten die Grüne Gentechnik (GM Foods) im Vergleich zu der Roten Gentechnik (Pharmacogenetics/Gene therapy) als bedeutend risikobehafteter, weniger nützlich und moralisch nicht akzeptabel. Aus dieser Untersuchung lassen sich auch die wichtigsten Gründe für die geringe Akzeptanz in der EU ableiten.
Laut Prof. Dr. Wolfgang van den Daele, Direktor der Abteilung Zivilgesellschaft und transnationale Netzwerke am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, findet das „Unbehagen einen legitimen Ausdruck im Risiko“[135]. So erwartet der EU-Verbraucher, dass zugelassene Lebensmittel, anders als z.B. Pharmaka, keine gesundheitsgefährdenden Nebenwirkungen haben.[136] Laut der überwiegenden Mehrheit der wissenschaftlichen Experten sind die Risiken von GV-Lebensmitteln zwar vorhanden, aber bis jetzt noch nie verbraucherschädigend aufgetreten.[137] Diese eher positive Bewertung der Experten wird von der EU-Bevölkerung meist anders oder gar nicht wahrgenommen. In der psychologischen Forschung geht man davon aus, dass die Risikowahrnehmung durch den Verbraucher (Laien) nicht zu vergleichen ist mit der eines Experten.[138] Zudem wird die öffentliche Wahrnehmung durch falsche oder überspitzte Darstellungen in den Medien oder von Seiten der Gegner der Grünen Gentechnik stark beeinflusst. Dabei schüren unseriöse Studien, wie etwa die von Seralini (siehe FN 119), die überall in den Medien reißerisch in Szene gesetzt werden, nur noch die Angst vor GV-Lebensmittel in der EU-Bevölkerung. Durch dieses Informationsdefizit beim Bürger schenkt eine Vielzahl eher den unseriösen Berichten über negative Folgen Glauben.[139] Schließlich stehen die „zahlreichen Studien, die [die] Unbedenklichkeit [von GVO] für Gesundheit und Umwelt bescheinigen, […] häufig unter dem Generalverdacht, im Interesse der Industrie erstellt worden zu sein“[140].
Neben den Medien verzerren auch die Anti-Gentechnik-Kampagnen von NGOs, allen voran Greenpeace, das Bild, dass sich der „Otto Normalverbraucher“ von der Grünen Gentechnik macht. So versucht Greenpeace durch öffentliche[141] oder mediale[142] „Aufklärungs-Kampagnen“ den Verbraucher gegen die Grüne Gentechnik zu mobilisieren. Zudem wirken die unterschiedlichen Meinungen einzelner Akteure nationaler Parteien in der politischen Gentechnik-Kontroverse auf den Verbraucher verunsichernd. So erreiche man, laut des derzeit amtierenden deutschen Bundesministers für Wirtschaft und Technologie Philipp Rösler, Wachstum und Wohlstand nur durch eine aufgeschlossene Haltung gegenüber der Gentechnik.[143] Hingegen erkenne die derzeitige deutsche Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Ilse Aigner, keinen größeren Nutzen dieser Technologie für Europa.[144]
Neben der Unsicherheit bezüglich der Risiken der GV-Lebensmittel spielen auch ethische Bedenken hinsichtlich der Grünen Gentechnik in der EU-Bevölkerung eine übergeordnete Rolle. Dabei berühren die unterschiedlichen ethischen Fragen verschiedene „Bereichsethiken […], [wie] etwa die Natur- oder Ökoethik, die Wissenschaftsethik, Technikethik, Sozial- und Gesellschaftsethik oder die Wirtschaftsethik.“[145] Viele sehen die wissenschaftlichen Methoden, bei denen Pflanzengenome gentechnisch manipuliert werden, als „unnatürlich“ und somit als ethisch verwerflich an.[146] Diese öffentlichen Bedenken, wie mit der „unberührten Natur“ umgegangen wird, schildert der Biochemiker Erwin Chargaff, der durch seine Forschung im Bereich der DNA-Entschlüsselung wichtige Grundlagen für die heutige Gentechnologie legte. Er beschreibt die Natur in der heutigen Zeit, als „ein Feind, den man belagert, überlistet, den man abbaut, verändert, indem man ihm eine Nase einsetzt, die Ohren abschneidet oder sonst etwas.“[147]
Diese Veränderung der Natur durch die Methoden der Grüne Gentechnik wird zudem nur von einigen weinigen „Mega-Konzernen“ betrieben (Oligopol).[148] Dabei ist das öffentliche Image des marktführenden Unternehmens Monsanto durch unzählige Berichte über Skandale[149] in den Medien angeschlagen. Neben dem Missfallen über die Verfahren und Herstellungsmethoden von transgenem Saatgut, geht es dem Verbraucher auch um die Bedenken über die Art und Weise, wie „heutzutage“ Landwirtschaft betrieben wird bzw. welche Verfahren bei der Nahrungsmittelherstellung angewendet werden. So wurden die Gentechnologie und ihre „Produkte“ (GVO) zum Symbol für die Kritik an der modernen Landwirtschaft bzw. Lebensmittelherstellung in der gesamtgesellschaftlichen Debatte in Europa.[150]
Alles in allem spiegelt die ablehnende Haltung zur Gentechnik nur die Unsicherheit der EU-Verbraucher, ausgelöst von medialen Einflüssen, ethischen Bedenken oder schlichten Informationsdefiziten, wider. Der daraus resultierende öffentliche Diskurs über die Grüne Gentechnik in der EU wird dabei hauptsächlich auf der Grundlage subjektiver Anschauungen und nicht auf Basis wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse geführt und kann somit tatsächlich mit einem „Glaubenskrieg“ verglichen werden.
USA
Auch wenn die US- genau wie die EU-Bürger eine eher ablehnende Haltung zu GV-Lebensmittel haben,[151] fällt auf, dass die US-Konsumenten GV-Lebensmittel als nützlicher für die Gesellschaft, risikoärmer und moralisch vertretbarer ansehen.[152] Gründe, warum die Skepsis gegenüber GV-Lebensmitteln bei den US-Amerikanern nicht so ausgeprägt ist wie bei der EU-Bevölkerung, können vielfältig sein. Vergleicht man allein schon die Anzahl an zugelassenen Events, die Anbauzahlen von transgenen Pflanzen oder die Fülle an GV-Lebensmitteln in den US-Supermarktregalen,[153] so kann man sagen, dass der US-Verbraucher durch seine langjährige Erfahrung diese wahrscheinlich gelernt hat zu akzeptiert. Dass in den letzten zwei Jahrzehnten, trotz der breiten Vermarktung von GV-Lebensmitteln in den USA, keine negativen gesundheitlichen Folgen durch den Verzehr von GV-Lebensmitteln beobachtet werden konnten,[154] erzeugt bei dem US-Verbraucher keinen Zweifel bei seiner Kaufentscheidung.
Die Risikowahrnehmung der US-Verbraucher in Bezug auf zugelassene GV-Lebensmittel ist zudem bedeutend geringer als bei EU-Verbrauchern.[155] Das könnte daran liegen, dass fast zwei Drittel der US-Bevölkerung ein hohes Maß an Vertrauen in die politischen Kontrollsysteme zur Lebensmittelsicherheit haben.[156] Zudem ist die US-Bevölkerung deutlich aufgeschlossener gegenüber dem Einsatz neuer Technologien in der Lebensmittelherstellung. Laut einer Umfrage der IFIC im Jahre 2012 finden 40% der US-Befragten den Einsatz gentechnischer Verfahren bei der Lebensmittelproduktion gut.[157] Zudem wird möglichen Chancen der Grünen Gentechnik eine höhere Bedeutung von der US-Bevölkerung beigemessen, als es bei den Europäern der Fall ist. So würden laut der o.g. IFIC Umfrage 71% der US-Befragten zukünftige GV-Lebensmittel mit besseren ernährungsphysiologischen Eigenschaften[158] kaufen.[159]
Die Kennzeichnung von GV-Lebensmitteln
Angeknüpft an die im ersten Kapitel der Arbeit vorgestellten Grundlagen für die Diskussion über eine Kennzeichnung von GV-Lebensmitteln, schließt sich im folgenden zweiten Kapitel der (rechtliche) europäische und der amerikanische Umgang in Bezug auf die o.g. Kennzeichnung an. Dabei werden – soviel sei vorweggenommen – aufgrund von unterschiedlichen politischen bzw. öffentlichen Anschauungen in Bezug auf die Gentechnik, erhebliche konzeptionelle Differenzen deutlich.
Kennzeichnung in der EU
Unter anderem wegen der zuvor beschrieben Ablehnung von GV-Lebensmitteln in der EU-Bevölkerung sowie den möglichen Risiken der GVO entwickelten sich in der EU verschiedene (rechtliche) Standards und Vorschriften.[160] Im nachfolgenden wird das Augenmerk auf GVO-spezifische Kennzeichnungsvorschriften von Lebensmitteln gelegt. Dabei werden nicht nur die EU-weite VO zur Positivkennzeichnung von GVO („Food with GMO“), sondern auch nationale Vorschriften am deutschen Beispiel der Negativkennzeichnung von „Gentechnikfreien“ Lebensmitteln („Food without GMO“) vorgestellt und unter kritischen Gesichtspunkten beleuchtet.
Gründe für die Kennzeichnung
Grundsätzlich ist die Kennzeichnung von Lebensmittelprodukten eine staatliche verbraucher(schutz)politische Maßnahme, die die Grundrechte der Verbraucher sichern und stärken soll. Zu diesen Grundrechten zählen „das Recht auf Sicherheit, das Recht auf Information, das Recht auf Wahlfreiheit und das Recht, Gehör zu finden“[161], welche schon im Jahr 1962 von dem damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy benannt wurden.[162]
Um die Sicherheit in Bezug auf die Gesundheit des Verbrauchers zu garantieren, durchlaufen alle GV-Lebens- und Futtermittelprodukte verschiedenste staatliche Kontrollen und Risikobewertungen in der EU. Dabei kann das bereits erwähnte Restrisiko und etwaige Bewertungsirrtümer nicht ganz ausgeschlossen werden. So könnten also GV-Lebensmittel trotz ihrer Zulassung immer noch ein geringes gesundheitliches Risikopotential für den Verbraucher besitzen. Diese Restrisiken können „trotz der staatlichen Schutzpflichten in Kauf genommen werden, [wenn diese] als sozialadäquat“[163] in einer Risiko-Nutzen-Analyse eingestuft werden.[164] Trotzdem sollte es für den Konsumenten möglich sein, sich über das Vorhandensein von GVO in Lebensmitteln zu informieren.[165]