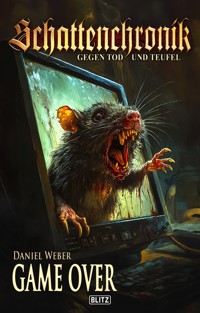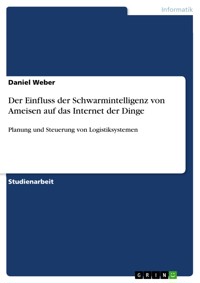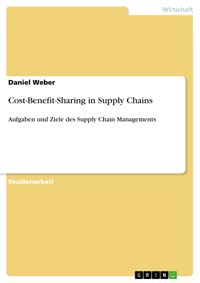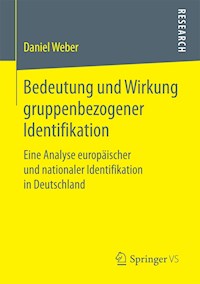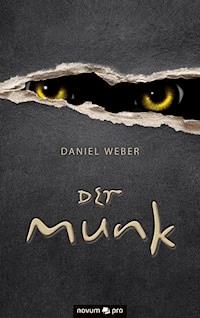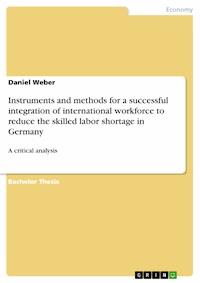Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Grusel Thriller
- Sprache: Deutsch
Stefan und Raphael jagen Doktor Phillip Ost, der vielleicht der Schlüssel ist, um den verschollenen Großonkel zu finden. Um gegen das verrückte Universalgenie zu bestehen, müssen die beiden eine Allianz mit fast ebenso schrecklichen Mächten eingehen. Doch Stefan spürt, dass mit ihm selbst irgendetwas nicht stimmt. Phillipsdorf - Bezirk des Wahnsinns (3. Roman)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen
3401 Jörg Kleudgen & Michael Knoke Batcave
3402 Ina Elbracht Der Todesengel
3403 Jörg Kleudgen & E. L. Brecht Der Fluch des blinden Königs
3404 Thomas Tippner Heimkehr
3405 Melanie Vogltanz Die letzte Erscheinung
3406 Jan Gardemann Die Seltsamen
3407 Jörg Kleudgen & E. L. Brecht Höllische Klassenfahrt
3408 Daniel Weber Phantasmagoria Park
3409 Jan Gardemann Die Rache der Seltsamen
3410 Daniel Weber Die zweifelhafte Erbschaft
3411 Daniel Weber Die unerwartete Zeugin
3412 Daniel Weber Das zerfallende Genie
3413 Daniel Weber Die andere Welt
Das zerfallende Genie
Phillipsdorf - Bezirk des Wahnsinns No. 03
Grusel-Thriller
Buch 12
Daniel Weber
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2024 BLITZ-Verlag
Hurster Straße 2a, 51570 Windeck
Redaktion: Eric Hantsch
Titelbild: Mario Heyer
Umschlaggestaltung: Mario Heyer u.V. der KI Software Midjourney
Vignette: iStock.com/Hein Nouwens
Satz: Gero Reimer
Gedruckt in der EU
Alle Rechte vorbehalten
www.blitz-verlag.de
3412
ISBN: 978-3-7579-8019-1
Inhalt
Prolog
Erster Teil: Erinnerungen an Phillip Ost
Zweiter Teil: Bekenntnisse eines Assistenten
Dritter Teil: Das zerfallende Genie
Epilog
Danke!
Anmerkungen
Über den Autor
Mein Name ist Stefan Hanns.
Ich bin verrückt.
* * *
Prolog
Mein Leben hatte sich verändert, verkompliziert, aber es gestaltete sich faszinierend. Was definitiv nicht für meinen Geisteszustand spricht.
Ich lebte nun schon über ein halbes Jahr in Phillipsdorf, im Haus meines verschwundenen Großonkels Josef Zeilner. Er hatte es mir vermacht. Adresse: Meyrinkgasse 3.
Meine Großcousine, seine Tochter, Helena, die pubertierende Halb-Ghoula, hielt mich auf Trab – beispielsweise weiß ich seit dieser Zeit, wie viele Tierhandlungen es in Wien und Umgebung gibt. Ich brauchte ja schließlich Nahrung für sie in Form von Mäusen, Ratten, Hamstern, Hasen und manchmal auch Katzen. Mein Nachbar, Pavel Gheorghe, der freundliche Vampir, besuchte uns regelmäßig und brachte oft Geschenke: Nahrung für Helena, Whisky für mich (meistens Blue Label).
David Grau, Josef Zeilners ehemaliger Arbeitgeber und zweifelhafter Freund, begegnete ich selten seit unseren Anfangsschwierigkeiten. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass er nicht fern war. Und mit ihm die Gefahr.
Darum war es umso beruhigender, Raphael an meiner Seite zu wissen. Raphael Kurzhaus, von dem ich erst kurz nach meinem Einzug erfuhr, dass er sich freiberuflich um spezielle Probleme kümmerte. Der Kofferraum seines Ford Ka barg ein Arsenal gegen jedwede übernatürliche Macht.
Meine Freundin, oder sollte ich besser sagen: meinen Schwarm, Fabia, hatte ich kürzlich über meine Situation informieren müssen. Da Markus Krankl, der heimliche Verehrer Helenas, wieder einmal eine Leiche als Blumenersatz vor unserer Haustür abgelegt hatte. Fabia hatte sie gesehen. Seither musste sie ihre Gedanken ordnen.
Und ja, stimmt, dann war da noch die Alte. Die (un)tote Hexe, die seit einiger Zeit mehr oder weniger meine Untermieterin war. Sie hatte sich in einem Kellerraum eine Ecke eingerichtet, einen Winkel – bitte fragen Sie mich nicht Näheres –, durch den sie aus ihrer Dimension oder anderen Existenzebene in der Welt der Lebenden ein- und ausgehen konnte. Sie hatte Informationen über den Verbleib von Josef Zeilner und hatte mit uns, Raphael und mir, eine Allianz gegen David Grau geschmiedet, ihren Bruder. Sie war seine jüngere Schwester, Salome Grau.
Was sich hier wie die verstockten Verwicklungen eines romantischen Romans liest, ist mein Leben. Ich glaube, dass mich einzig das Schreiben darüber halbwegs bei Verstand hält. Was nun anstand, war, den Aufenthaltsort meines vermeintlich verstorbenen Großonkels ausfindig zu machen. Und dazu mussten wir zuerst an den einzigen in Phillipsdorf praktizierenden Arzt herankommen: Dr. Phillip Ost.
Dieser war allerdings zurzeit auf Reisen und würde erst im Jänner 2016 wiederkommen. Es war Dezember 2015. Die düsteren Gassen von Phillipsdorf waren mit matschiger Schneeschlacke bedeckt und die dürren Bäume an den Straßen reckten ihre Äste wie Knochenfinger in den Himmel.
Von Weihnachtsstimmung konnte man hier wirklich nicht reden.
Erster Teil: Erinnerungen an Phillip Ost
Einnerungen an Phillip Ost – Teil 1
Raphael fand die erste Spur Mitte Dezember. Nicht in Phillipsdorf, sondern in unser beider Heimatort: Bachbrunn im Weinviertel, wo er nach wie vor in seinem Elternhaus wohnte. Alleine.
Die letzten Wochen hatte er damit verbracht, über Phillip Ost zu recherchieren. Der Doktor war kein unbeschriebenes Blatt. Bekanntes über ihn datierte bis in die frühen 2000er-Jahre, dann brachen die Informationen ab. Raphael fand heraus, dass er an der Universität Wien studiert hatte: Medizin, Physik und Chemie. Zumindest fand er Diplomarbeiten in diesen Disziplinen in der Bibliothek.
Seine ihn betreuenden Professoren konnten allerdings wenig über die Person selbst sagen. Er sei gescheit gewesen, genial, ein Workaholic. Gegen Ende seiner Laufbahn an der Universität sei er aber verfallen, wie sich zwei von ihnen ausdrückten, körperlich, geistig und seelisch. Gutes Zureden ignorierte der Student, und bald nach seinen Abschlüssen verschwand er aus deren Sichtfeld.
Ob er enge Kontakte gehabt hätte, die Näheres über ihn wüssten, fragte Raphael.
Ja, sagte einer der Professoren, er habe einen einzigen engen Freund gehabt. Dr. Andreas F. (auf Bitten von F. verschweige ich seinen wahren Namen).
„Der Dr. Andreas F.?“, fragte Raphael. „Der eine Praxis in Bachbrunn hat?“ Er zeigte ihnen auf seinem Smartphone Bilder aus dem Internet.
„Ja. Woher kennen Sie ihn?“
„Er ist mein Hausarzt.“
Jetzt saß er im Warteraum der kleinen, aber heimeligen Ordination. Dr. F. war unlängst von einem Kassen- zu einem Privatarzt geworden, weil er schlicht überfordert mit den unzähligen Patienten aus dem Ort gewesen sei, wie es hieß. Viele waren daraufhin zu anderen Ärzten gewechselt, Raphael war ihm treu geblieben – er konnte es sich leisten, und oft war er ja nicht krank. Sein Psychotherapeut zog ihm da schon mehr Geld aus der Tasche, aber darüber redete er nur kryptisch.
Er wurde von der Rezeptionsdame aufgerufen und betrat das Ordinationszimmer 2, ein kleiner, beinahe quadratischer Raum, ausgestattet mit Liege, Schreibtisch, Waschbecken und einem Behandlungsbereich für Kinder. Über Letzterem waren Stofftiere auf einem Wandregal aufgereiht.
Raphael setzte sich auf einen Stuhl neben den Schreibtisch und wartete.
Von der Verbindungstür zum anderen Ordinationszimmer hörte er dumpf das Gespräch zwischen dem Arzt und seinem gegenwärtigen Patienten. Es ging, wie er heraushörte, um einen unangenehmen Ausschlag.
Die Stimme des Dr. F. war tief, ein volltönender Bass, sodass man meinen konnte, der Doktor müsse beim Sprechen Gesicht und Hals vibrieren spüren. Dabei war er gar kein korpulenter Mann. Dr. Andreas F. war schlank, hielt sich mit Laufen fit, und hatte einnehmende, fast jungenhafte Züge. Das Gesicht in Verbindung mit dem beruhigenden Brummen seiner Worte machten ihn zu einem Menschen, dem man von vornherein vertraute.
Und er war ein guter Allgemeinmediziner.
Nach ein paar Minuten hörte Raphael, wie sich Dr. F. verabschiedete. Es dauerte keine zehn Sekunden, da öffnete sich schon die Verbindungstür und F. kam in den Raum, ein Bubenlächeln im Gesicht, das auch seine klaren Augen ausstrahlten.
„Herr Kurzhaus!“ Er reichte ihm die Hand. „Was kann ich für Sie tun? Wieder Einschlafschwierigkeiten?“
„Nein.“ Raphael winkte ab. „Bei den Kopfsachen bin ich bei Ihrem Kollegen gut aufgehoben. Ich bin nicht als Patient hier, Herr Doktor.“
Dr. F. lachte auf, als er sich an den Computer setzte und Raphaels Akte aufrief. „Sie werden ja wohl kaum gekommen sein, um zehn Minuten alleine mit mir in diesem Zimmer zu sein. Das wäre ein teurer Spaß.“
„Ich will nicht viel drumherum reden. Es geht um einen alten ... Freund von Ihnen. Dr. Phillip Ost. Sie haben mit ihm studiert?“
Eine Veränderung ging in Andreas F. vor. Seine Hand, mit der er gerade die Maus bedient hatte, verharrte. Die klaren Augen wurden starr, das Lächeln schwand, und aus den Wangen traten die Muskeln hervor, als würde er die Zähne zusammenbeißen. Er atmete mehrmals tief ein und aus.
„Was haben Sie gesagt?“, fragte er leise.
„Sie kennen Phillip Ost offenbar.“
F. antwortete nach einer Pause: „Ja.“
„Und haben keine guten Erinnerungen an ihn?“
Der Doktor schnaufte. „Ich weiß nicht, woran ich mich erinnere.“
„Würden Sie es mir erzählen?“
Dr. F. erhob sich abrupt, sodass der Schreibtischsessel nach hinten rollte und gegen die Liege knallte. Seine Stimme blieb gepresst und leise. „Ich versuche jetzt schon zehn Jahre, diesen Namen und diese Person zu vergessen. Was wollen Sie von mir, Herr Kurzhaus? Woher ... woher kennen Sie überhaupt diesen ... diese Kreatur?“
Raphael horchte auf. Er erhob sich ebenfalls, bemüht um eine offene Körperhaltung. Er sah seinem Hausarzt in die Augen. Und er sah darin Angst. „Herr Doktor. Ich möchte Ihnen keine Unannehmlichkeiten bereiten. Die Sache ist, dass ein Freund, dass wir ... Probleme mit Ihrem ehemaligen Kommilitonen haben.“
Dr. F. kniff die Augen zusammen. „Ich verstehe nicht.“
„Phillip Ost betreibt in Phillipsdorf eine eigene Praxis und ...“
„Das ist mir bekannt.“
„Gut.“ Raphael mahnte sich zur Vorsicht. Die Stimme des Doktors war zwar leise und sein Blick voll Angst, aber er war sichtlich kurz davor, den vermeintlichen Patienten hinauszuschmeißen. „Dieser Freund, Stefan Hanns, wohnt in Phillipsdorf. An Ihrer Reaktion, Herr Doktor, erkenne ich, dass Sie eine Vorstellung davon haben, was das bedeutet. Unser gegenwärtiges Problem heißt Phillip Ost. Um Stefan zu helfen, muss ich so viel über diesen Menschen herausfinden, wie ich kann. Bitte, helfen Sie mir.“
Andreas F. beruhigte sich. Die Schultern entspannten sich, die Augen klarten ein wenig auf, er atmete tief durch. Als er sprach, nahm sein Ton wieder die brummende, volltönende Qualität an. „Was werden Sie mit diesen Informationen tun?“
Raphael antwortete nicht gleich. „Ich will ehrlich sein. So, wie Sie auf den Namen ihres Kollegen reagiert haben, erwarte ich nichts Gutes. Wenn es sein muss, werde ich ihn umbringen.“
Dr. F. lachte auf, stockte aber. „Das war ein Scherz. Oder?“
„Ich scherze nicht.“
„Aber Sie ... Hören Sie ...“ Er fuhr sich durchs ergrauende braune Haar. „Und ich dachte, ich sei verrückt.“ Er blickte Raphael in die Augen. „Sie wissen nicht, was Sie da reden. Sie sollten sofort Dr. ...“
„Sie haben recht. Ich weiß zu wenig über Ost, als dass ich gegen ihn vorgehen könnte. Aber dass ich gegen ihn vorgehen muss, das haben Sie mir gerade gezeigt.“ Raphael machte einen Schritt auf ihn zu. „Herr Doktor. Kann es sein, dass Sie etwas verschweigen, weil Sie denken, dass Ihnen niemand glauben würde?“
Wieder presste F. die Kiefer aufeinander. Dann nickte er.
Raphael kramte aus der Tasche seine Karte heraus. „Das ist die Nummer für mein Diensthandy.“ Es war eine weiße Karte, wo nur eine Nummer aufgedruckt war, sonst nichts. „Ich will Sie nicht drängen, aber ich muss Sie bitten, mir alles zu erzählen, was Sie über Phillip Ost wissen. Rufen Sie mich an. Wir machen einen Treffpunkt Ihrer Wahl aus, wo Sie sich am wohlsten fühlen, darüber zu reden. Bitte.“ Er legte die Karte auf den Schreibtisch und verließ das Ordinationszimmer. An der Rezeption wartete er auf die Rechnung für eine Patientenberatung.
Es kam keine.
Dazwischen
„Schmeckt’s?“, fragte ich.
Helena riss mit den spitzen Zähnen das kleine Köpfchen einer weißen Ratte ab, die einen Augenblick zuvor noch gezappelt hatte. Blut tropfte von ihren Lippen auf den Teller. Sie sah mich an. Ohne die blauen Kontaktlinsen waren ihre Iriden gelb und die Pupillen schmale Schlitze. „Mhm.“ Sie lächelte mit blutverschmiertem Mund, bevor sie sich eine schwarze Strähne aus der Stirn wischte. Sie schluckte. „Pavel kennt wirklich gute Tierhändler. Die sind viel saftiger als die, die du mir immer bringst.“
Ich schluckte den Bissen Schnitzel hinunter und trank vom Bier. „Der Herr Nachbar hat wahrscheinlich eine bessere Nase für so was.“ Der steht ja auch auf Lebendnahrung. Obwohl er nur das Blut trinkt.
Ich hatte mich an die Essgewohnheiten meiner Großcousine bereits gewöhnt. Und da ich ein Mensch bin, der alleine nicht gerne isst, hatten wir eingeführt, dass wir zusammen speisten. Helena hatte das überrascht, denn ihr Vater hatte ihr anscheinend nie erlaubt, bei Tisch ein Tier zu reißen.
Das war natürlich verständlich. Aber mein Drang nach Gesellschaft beim Essen war größer als der Ekel vor Helena.
Ich deutete auf ihre Halskette. Ein großes, goldenes Kreuz. „Sag, warum trägst du das sogar dann, wenn Johnny nicht da ist?“
Sie wurde schlagartig rot im grau-braunen Gesicht. Dass sie in Max verliebt gewesen war, auch ein Freund von mir, hatte ich schon als anstrengend genug empfunden. Aber jetzt musste es unbedingt Johnny sein, der Hardcore-Katholik in meinem Freundeskreis. Helena war immer bei den Spieleabenden bei uns zu Hause dabei, natürlich als ganzer Mensch verkleidet. Daher kannte sie meine Freunde schon recht gut, die nun auch ihre Freunde geworden waren.
Sie stammelte: „Ich ... nun ... Vielleicht habe ich ja zu Gott gefunden.“
Ich zog die Brauen hoch. „Kannst du überhaupt das Vaterunser?“
„Ähm ...“ Sie biss sich auf die Unterlippe. Es war immer wieder verwunderlich, wie sie es schaffte, sich mit diesen scharfen Zähnen nicht selbst zu verletzen. Aber die Haut von Ghoulen ist robust. „In Religion haben wir das schon ein paar Mal gebetet.“
„Und du hast mitgemacht?“
„Ich hab die Lippen dazu bewegt.“
Das brachte mich zum Lachen. Helena stimmte mit ein. Sie war eine gute Schülerin. Es war erstaunlich, wie viel ihr Josef Zeilner beigebracht hatte, als sie noch versteckt unter dem Keller gehaust hatte. Sie hatte ein paar gleichaltrige Freundinnen, mit denen sie sogar öfter etwas unternahm. Sorgen machte ich mir keine. Na gut. Eigentlich schon. Aber nicht um sie, sondern um die Idioten, die glaubten, sie könnten ihr was antun. Das machte mich ein bisschen unruhig.
Helena vergrub ihre Zähne erneut in dem Rattenleib, als das schrille Kreischen der Hausglocke ertönte. Immer wieder fuhr ich hoch bei diesem Geräusch. Und immer wieder schwor ich mir, bald eine neue anzuschaffen, aber bisher hatte ich nur welche gefunden, die sich wie die Pausenglocken von Schulen anhörten.
Ich ging in die Küche und spähte durchs Fenster zum Vorgartentürchen. Grau in Grau starrte mir die Meyrinkgasse entgegen, Schlacke auf der Straße, die nie geräumt wurde. Ein paar Schneeflocken fielen.
Neben dem Pfeiler zum Vorgartentürchen stand Karl Kirchmaus, einer meiner besten Freunde, eingehüllt in eine Lederjacke mit warmem Fellkragen. Die behandschuhten Hände rieb er und hüpfte von einem dünnen Bein aufs andere. Und sah ich richtig? Das musste er mir erklären.
Als ich auf dem Weg zur Eingangstür am Esstisch vorbeikam, sagte ich: „Es ist Karl. Bitte versteck ... räum dein Essen weg und wasch dir das Blut ab.“
Helena gehorchte, ohne etwas zu sagen. Sie lag mir seit Wochen damit in den Ohren, wann sie mit den Freunden endlich Klartext reden könnte. Und mit meinen Eltern. Da das mit Fabia ja so gut funktioniert hätte, sagte ich immer darauf, vermutlich niemals.
Während sie die Kellertür hinter sich schloss, öffnete ich die Haustür. Karl hob eine Hand zur Begrüßung und kam die Stiegen herauf. „Grüß dich, Stefan!“
„Komm rein.“
Er schob sich an mir vorbei und ich schloss die Kälte wieder aus. In Phillipsdorf waren die Temperaturen noch grausiger zu spüren, mit ein Grund, warum ich so wenig rausging. Ich kramte Gästeschuhe aus einem Kasten und legte sie vor Karl auf den Boden.
„Was macht die Kunst?“, fragte er, als er sich die Schuhe auszog.
„Die Manuskripte schreiben sich leider nicht von selbst.“ Ich verzog das Gesicht. In dieser Jahreszeit fiel es mir schwer, Motivation zum Schreiben aufzubringen. „Was ist mit dir? Wieso hast du das getan?“ Ich spielte Bestürzung und zeigte auf seinen Kopf.
Die beinahe hüftlangen braunen Haare waren einem Undercut gewichen, der allerdings nicht allzu breit war auf beiden Seiten. Die restlichen Haare mochten auf vielleicht fünf bis zehn Zentimeter gekürzt sein und waren schneidig nach hinten frisiert, mit Haarcreme oder Schaumfestiger, denn Gel hätte mehr geglänzt. Der fehlende Rahmen aus braunem Haar zeichnete seine Gesichtszüge deutlicher. Die mandelförmigen Augen hinter der Brille wirkten etwas größer, die allgemeine Gesichtsform allerdings männlicher. Er grinste, wobei mir auffiel, dass auch dieses Grinsen breiter wirkte und so aussah, als wolle es bis hinten zu den markanten Kieferecken reichen.
„Veränderung, Mann“, sagte er gespielt. „Nein. Als Bi-bliothekar muss man sich ein bisschen adäquater geben.“
„Du meinst spießiger?“ Ich schüttelte den Kopf. „Na wenigstens hast du den Ziegenbart verschont.“
„Ohne den sähe ich aus wie ein Volksschüler.“
Da hatte er recht.
Ich führte ihn zum Esstisch und bot ihm Kaffee an. Wir setzten uns hin, jeder mit einer Tasse, und zündeten uns Zigaretten an.
„Wo ist denn Helena?“, fragte er.
„Unten. Ich glaube, sie hat sich ein bisschen hingelegt.“ Wenn sie mit ihrer Ratte fertig war und sich gewaschen und verkleidet hatte, würde sie bestimmt heraufkommen. „Was führt dich her?“
„Na ja.“ Er aschte in den Aschenbecher. „Ich wollte dich fragen, ob ich mich durch die Bücher deines Großonkels wühlen darf. Da sind ja ein paar schöne Stücke dabei. Die ja eigentlich in eine Bibliothek gehören würden.“
„Die nicht, denke ich. Die sind vollgekritzelt mit verrückten Anmerkungen.“ Dass diese Anmerkungen großteils von Josef Zeilner stammten, musste ich ihm ja nicht auf die Nase binden.
Karl verzog das Gesicht wie im Schmerz. „Noch mehr Argumente dafür, dass du sie an die Nationalbibliothek übergibst. Vielleicht lässt sich da noch was retten bei einer Restauration. Du lagerst sie ja nicht einmal fachgerecht.“
Ich schüttelte den Kopf. „Das haben wir schon mehrmals besprochen, Karl. Die Antwort bleibt Nein. Es sind die Bücher meines Großonkels, also sind es meine.“ Meine Sammelleidenschaft für Bücher. „Aber du kannst sie gerne durcharbeiten, wenn du möchtest.“
Er zuckte die Achseln in seiner typisch abgehackten Art.
Erinnerungen an Phillip Ost – Teil 2
Wenige Tage nach Raphaels Besuch bei Dr. Andreas F. hatte dann wirklich sein Diensthandy geläutet. F. lud ihn für Samstagnachmittag zu sich nach Hause ein. Seine Frau und Kinder seien an diesem Tag nicht da, was ihnen genügend Zeit gäbe, alles zu besprechen.
Jetzt stand er vor einem modernen Einfamilienhaus in Bachbrunn, das einem Klotz glich, dem zur Verschönerung grüne Streifen aufgemalt waren. Flachdach natürlich, weil Öko, und statt eines Vorgartens sah es aus, als züchte die Familie F. hier einen rechteckigen Naturschutzflecken, der nicht gemäht werden dürfe. Die verschiedenen Gewächse, jetzt braun und verschrumpelt wegen der Temperaturen, hingen lustlos über dem Mäuerchen.
Raphael läutete.
Andreas F. öffnete ihm beinahe sofort, als hätte er hinter der Haustür auf sein Kommen gewartet. Er war angetan mit Jeans und legerem Hemd, hatte Ringe unter den jetzt wässrigen Augen, und seine grau melierten Haare waren ungekämmt. Er begrüßte den Gast fahrig, wobei er die sonst so einnehmende Jungenhaftigkeit vermissen ließ.
Raphael kommentierte seinen Zustand nicht, sondern erwiderte schlicht die Höflichkeiten. Er ließ sich durch den kleinen Vorraum über den Essplatz zu einem Wohnzimmer führen. Alles hier drin war eine Mischung aus klinischer Sauberkeit, penibler Ordnung und sinnbefreiten Dekorationsgegenständen. Purer Kitsch, wie Raphael sich mir gegenüber ausdrücken sollte. Vermutlich eine Strategie, dem Chaos entgegenzutreten, das F. verfolgt.
F. bot Raphael Kaffee an, den er dankend annahm. Und es war noch Kuchen da, den seine Frau unlängst gebacken hatte. Den lehnte er ab. Er aß fast nie Süßes.
„Entschuldigen Sie meine Nervosität“, sagte F., als sie sich schließlich gegenübersaßen. Seine Hände zitterten. „Ich hätte nur nicht erwartet, dass ... Es ist einfach schon lange her.“
Raphael kostete vom Kaffee. Er war zu dünn. „Wie haben Sie Phillip Ost kennengelernt?“
„Wir haben beide Medizin studiert. Schon bei der Infoveranstaltung haben wir zufällig nebeneinandergesessen.“
„Das heißt, vorher haben Sie nie etwas von ihm gehört?“
„Nein. Wie auch?“
„Wissen Sie etwas über seine Vergangenheit?“
„Darüber hat er nie gesprochen. Er lebte alleine in einer kleinen Studentenwohnung, aber ich wüsste nicht, dass er gejobbt hätte ...“ F. schüttelte den Kopf. „Ist schon komisch, dass Phillip Ost in Phillipsdorf eine Praxis hat. Kommt Ihnen das nicht auch seltsam vor?“
„Ein Zufall. Wir suchen uns die eigenen Namen nicht aus. Und Ortsnamen entstehen aus den abstrusesten Gründen.“
„Wahrscheinlich haben Sie recht.“ F. biss von einem Stück Kuchen ab. „Darf ich fragen, warum Sie sich für Ost interessieren? Inwiefern wollen Sie gegen ihn vorgehen?“ In den letzten Worten lag so etwas wie unterdrückte Hoffnung, wenn Raphael den Unterton richtig deutete.
„Ost weiß vermutlich, wo sich eine gewisse Person aufhält, die wir suchen. Sie war bei ihm Patient. Aber wir wissen, dass er ...“ Raphael zögerte. Wie viel konnte er diesem Arzt sagen? Wie viel wusste dieser selbst?
„Nicht normal ist?“ Trotz des abgehetzten Ausdrucks rang sich F. ein Lächeln ab. „Sie haben angedeutet, dass Sie mir glauben würden, Herr Kurzhaus, deswegen gestehen Sie mir bitte zu, dass ich ebenfalls offen bin. Sehen Sie es als fairen Handel. Beweisen Sie mir, dass Sie mir wirklich glauben werden. Was wollten Sie sagen?“
Raphael nickte. „Wir wissen, beziehungsweise vermuten stark, dass er mit Mächten im Bunde steht, die über das menschliche Fassungsvermögen hinausgehen.“
F. stand auf und ging zu einem Fenster. Es blickte hinaus auf einen kleinen Garten, der in den wärmeren Jahreszeiten sicherlich ein kleines persönliches Idyll darstellte. Mit verschränkten Armen seufzte er und fuhr sich dann durch die Haare. „Ich weiß nichts von irgendwelchen Mächten ... aber es überrascht mich auch nicht.“
„Was wissen Sie?“ Raphael beugte sich nach vorne und zückte seinen Notizblock.
„Möchten Sie einen Drink?“ F. öffnete die Klappe einer Minibar, die mit Dutzenden Flaschen und Gläsern gefüllt war. „Ich brauche einen, wenn ich Ihnen die Geschichte dieser Freundschaft erzählen soll.“
* * *
Als er sich wieder hingesetzt hatte, begann er zu erzählen, manchmal unterbrochen von Fragen Raphaels. Es war ein langes Gespräch, das mein Freund gewissenhaft protokollierte – er beherrscht die Stenografie, genau wie ich jetzt auch, nachdem ich das Protokoll in Reinschrift übertragen habe. Ich verzichte im Folgenden auf Anführungszeichen. Es spricht meistens F. Zwischenfragen von Raphael setze ich kursiv:
Phillip Ost hätte eine glänzende Zukunft vor sich gehabt. Auf der Universität werden sich sicher noch einige an ihn erinnern. Die Kommilitonen betrachteten ihn zu gleichen Teilen mit Neid und Ehrfurcht.
Niemand von damals weiß, was aus ihm geworden ist. Wenn sie es wüssten, würden sie vermutlich leugnen, je etwas von diesem Menschen gehört zu haben. Ich kann das nicht, ich versuche, es zu verdrängen. Aber ich habe sein Labor gesehen. Ich habe seine Forschung ... kennengelernt.
Und ich wühle es wieder auf. Tut mir leid.
Ich wusste, dass mich diese Geschichte irgendwann einholen würde.
Wie ich bereits sagte, lernten Ost und ich uns in unserem ersten Jahr auf der Universität kennen. Schon damals war klar, dass der Mann ein Genie war. Ich studierte Medizin. Er ebenso, aber neben vielen weiteren Fachgebieten, derer ich mich gar nicht mehr genau entsinnen kann. Biologie, Chemie und Physik waren mit Sicherheit darunter, ob Sie es glauben oder nicht.
Ich habe in der Universitäts-Bibliothek einige seiner Diplomarbeiten gefunden.
Dann sind Sie besser unterrichtet als ich. Ich hatte genug mit meinem Abschluss um die Ohren, als dass ich Zeit gehabt hätte, mich mit seinen Arbeiten zu befassen.
Ost war ein naturwissenschaftliches Phänomen, sage ich Ihnen. Die Professoren hielten mit ihrem Staunen nicht hinter dem Berg. Und die anderen Studenten ... keiner konnte ihm auch nur im Mindesten das Wasser reichen. Er strahlte so eine Leichtigkeit bei allem aus. Hätte er vor 200 Jahren gelebt, hätte er vermutlich als Universalgenie gegolten. Er besuchte auch Vorlesungen in geistes- und kulturwissenschaftlichen Fächern. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste er auch akademische Grade in Philosophie und Anthropologie besitzen, nageln Sie mich aber nicht darauf fest.
Aber – das ist nur meine Interpretation seiner Psyche – ihm fehlte der kühle, objektive Verstand, den ein Wissenschaftler benötigt. Ost war ein Träumer, ein Phantast. Er interessierte sich bald für abseitigere Dinge. Fremde Religionen und Aberglauben, Geheimgesellschaften, Sekten. Er konnte stundenlang über religiöse Rituale von beispielsweise irgendeinem Stamm in Afrika schwadronieren, genauso wie über die Hexenverbrennungen. Fragen Sie mich nicht, wie er all dieses Wissen in sich aufsaugen konnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mensch je mehr als vier Stunden pro Nacht geschlafen hat in seinem Leben – was auch die dunklen Ringe erklären würde, die immer seine Augen umrandeten.
Interesse an solchen Sachen ist ja nicht verkehrt. Aber Ost steigerte sich da hinein, ab unserem dritten oder vierten Semester. Er bewegte sich übrigens in allen seinen Studiengängen planmäßig in der Mindeststudienzeit – das war herausragend.
Aber wie gesagt. Er begann, abzudriften, was sich dadurch äußerte, dass er Parallelen zwischen Naturwissenschaft und Geheimlehren entdeckt haben wollte. Zwischen Mathematik und Magie, wie er sich mir gegenüber ausdrückte.
Wie haben Sie darauf reagiert?
Wie hätte ich reagieren sollen? Ich war der Einzige, mit dem er über solche Dinge sprach. In den ersten Jahren auf der Universität waren wir eng befreundet. Ich sagte ihm deshalb, dass ich seine Theorien für weit hergeholt hielte. Solche Dinge hätten in der phantastischen Literatur Platz, aber ein Wissenschaftler könne sich mit solchen Aussagen seinen Ruf ruinieren.
Er lächelte mich nur an. An dieses Lächeln kann ich mich gut erinnern. Halb mitleidig, halb wissend, aber ganz und gar überlegen. Er wisse meine Sorgen zu schätzen, versicherte er mir, aber sie seien unnötig. Außerdem plane er für den Sommer eine Bildungsreise, wie er es nannte, zu verschiedenen Universitäten und Bibliotheken auf der ganzen Welt, wo Wissen aus vergangenen Zeiten aufbewahrt würde, das er für seine Forschungen benötige. Und er deutete an, dass ihn seine Forschungen vielleicht auch an unbekannte, dunklere Orte führen würden.
Hat er Ihnen Einzelheiten verraten? Städte, in die er wollte? Oder Länder?
Nichts. Ich hatte Angst um ihn. Um seine geistige Gesundheit.
Ich glaube, das alles war Anfang 1995, ein Jahr plus oder minus. Ich versuchte mehrmals, ihn von dieser Reise abzubringen. Vergebens. Am Beginn der Sommerferien trat er sie an. Ich war mir sicher, er würde sich zur Witzfigur machen, wenn er seine abstrusen Ideen weiterverfolgte. Naturwissenschaften und Geheimwissenschaften in Verbindung zu bringen, wie er es vorhatte, würde seine Karriere beenden, bevor sie überhaupt begonnen hätte.
Ich werfe mir heute manchmal vor, dass ich damals nicht mehr unternommen habe. Aber was hätte ich tun sollen? Ich wollte meinen besten Freund nicht verlieren. Der verständlichste, aber auch dümmste Grund, nichts gegen gefährliche Entwicklungen im Geist eines Menschen zu unternehmen.
Ich glaube nicht, dass Sie viel hätten ausrichten können. So wie sich mir die Sache bisher darstellt, wäre jeglicher Versuch dahin gehend abgewehrt worden.
Vielleicht haben Sie recht.
Jedenfalls hatte ich im folgenden Sommer fast keinen Kontakt zu Ost. Es kamen zwar unregelmäßig Briefe von ihm, aber ich konnte sie nicht beantworten. Ich wusste nie, wo er sich gerade befand. Er wechselte seinen Standort fast jede Woche.
Der erste Brief kam schon Anfang Juli, aus einer Universitätsstadt in Massachusetts, in den USA. Ich habe mir den Namen der Stadt nicht gemerkt.
Arkham?
Könnte sein, aber nageln Sie mich nicht darauf fest. Das ist schon so lange her und ich habe nicht so genau darauf geachtet.
Er schrieb mir aus dieser Stadt, dass er in der dortigen Universitätsbibliothek auf wichtige Bücher gestoßen sei. Die wichtigsten für seine Forschungen vielleicht, oder die grundlegendsten, wie er sich ausdrückte. Genaueres war von ihm nicht zu erwarten. Er fotokopierte dort alles, was er kopieren durfte, den Rest schrieb er teilweise ab. Er musste die Nächte durchgearbeitet haben, wie mir beim Lesen dieses Briefes schien, denn es handelte sich offenbar um eine Menge Schriftwerk.
Ein zweiter Brief kam dann einen Monat später aus Ägypten, mit ähnlichem Inhalt. Und dann noch zwei aus England und Italien.
Ich bezweifle, dass es ein System hinter der Reihenfolge seiner Aufenthaltsorte gab. In den USA und Ägypten verweilte er am längsten, soweit ich es beurteilen konnte, jeweils drei Wochen oder etwas länger. England und Italien waren dagegen nur Stippvisiten von ein paar Tagen. Ich vermute, dass dort weniger Stoff lagerte, der für ihn wichtig war.
Als sich die Sommerferien dem Ende zuneigten und der Oktober in greifbare Nähe rückte, rückte genauso das Datum des Wiedersehens mit meinem Freund heran. Leider kann ich nicht sagen, dass ich mich noch darauf freute. Ich machte mir einerseits große Sorgen um Ost, und andererseits ... hatte ich Angst vor ihm ...
Warum?
Keine Ahnung. Ich schiebe das gerne auf seine Briefe. Nicht unbedingt auf deren Inhalt, obwohl er verstörend genug, weil wirr und unwissenschaftlich war. Es war die Art, wie er schrieb. Immer gehetzter, das Schriftbild wurde enger, manchmal zittrig, unleserlicher. Dabei hatte er eine Schrift wie von Frauenhand geschrieben. Gänsehaut überzog mich jedes Mal, wenn ich an ihn dachte.
Ich schämte mich dafür.
Und ich schob diese irrationalen Empfindungen beiseite. Ich redete mir ein, dass noch nichts verloren war. Vielleicht würde Ost ja zurückkommen und seine Irrwege einsehen. Und wenn nicht, dann war es meine Pflicht als Freund, ihn aus diesen Wahnideen herauszuhauen.
Dachte ich. Dann aber sah ich ihn wieder.
Dazwischen
Ich saß im Wohnzimmer auf der Couch und las den Zauberberg. Ich hatte in den letzten Wochen wieder Lust darauf bekommen – vielleicht war es ein Stück Vergangenheit und Vertrautheit, das ich brauchte, um mich von meiner immer noch neuen Situation abzulenken. Außerdem war die Ausgabe, die ich in den Regalen Josef Zeilners gefunden hatte, eine sehr schöne und sehr alte. Die Seiten waren vergilbt, an ihnen haftete der Geruch von in die Jahre gekommenem Papier. Es war irgendwie ein ganz anderes Gefühl als sonst, zu lesen, Hans Castorp führe auf drei Wochen hinauf zum Sanatorium Berghof, um seinen Vetter zu besuchen. Und aus diesem dreiwöchigen Besuch werden dann schließlich sieben Jahre.
Die Atmosphäre hält ihn fest. Auch natürlich ein Hang zur Hypochondrie. Und Personen, denen er dort begegnet, nehmen ihn unwillkürlich ein. Ich las diesen Roman in meinem neuen Zuhause nun mit anderen Augen und vergaß, wie immer, darüber die Zeit.
Als ich den Ruf Karls hörte, war es schon dunkel draußen, und die Uhr zeigte an, dass es kurz vor zehn Uhr abends war.
Ich reckte den Kopf und hörte, wie Karl die Stiegen vom ersten Stock herunterkam.
„Stefan?“, rief er. „Stefan!“
„Was ist?“ Ich kam ihm entgegen.
Er blieb im Rahmen der Verbindungstür stehen, die Augen rot geädert, die Hände etwas zittrig. Nebenerscheinungen, die langes Schmökern in den speziellen Büchern meines Großonkels bewirkten. Ich überlegte, seine Aufenthaltserlaubnis in der Bibliothek zu beschränken. Aber mit welcher Begründung? Sei vorsichtig. Diese Schriften bergen Mächte, die über den menschlichen Verstand hinausgehen, und können dich wahnsinnig machen. Das würde einen rational denkenden Menschen nicht überzeugen.
„Ich hab oben ein Buch gefunden, das dein Großonkel aus der Phillipsdorfer Bibliothek geliehen hat.“ Er bedeutete mir mit dem Kopf, ich solle mit nach oben kommen.
Ich folgte ihm. „Und?“
„Es ist seit über einem Jahr überfällig.“
Ich musste unwillkürlich schmunzeln. Mein Großonkel hatte anscheinend einen Spleen dafür besessen, geborgte Bücher nicht zurückzugeben.
In der oberen Bibliothek, die gleichzeitig mein Arbeitszimmer mit Schreibtisch und Laptop darstellte, fand ich auch Helena, die mit einem Buch in dem Ohrensessel kauerte. Sie hatte ein schlabberiges Shirt und Leggings an, war aber menschlich geschminkt und hatte ihre blauen Kontaktlinsen eingelegt.
„Was machst du hier oben?“ Ich hatte gar nicht gemerkt, dass sie raufgegangen war. „Und was liest du da? Die Bibel?“
„Mir war unten langweilig.“ Sie sah mir nicht in die Augen.
Karl zuckte die Achseln. „Sie hat mich über christliche, vor allem katholische Literatur ausgefragt.“
Jetzt wusste ich, woher der Wind wehte. Ich konnte nur froh sein, dass ich keinen Satanisten in meinem Freundeskreis hatte, in den sie sich verlieben konnte. Allerdings wäre das, genau genommen, keine große Sache mehr gewesen in Anbetracht ihrer Natur. Ich revidierte und dachte: Wenigstens hab ich keine Junkies als Freunde.
„Also. Um welches Buch geht’s?“, fragte ich.
„Dieses da.“ Karl nahm einen schmalen Band aus dem Regal und reichte ihn mir.
„Ansichten zu den pnakotischen Manuskripten. Von Michael Dorfer.“ Ich schlug den Einband auf. „Ausgeliehen im August letzten Jahres. Das ist überfällig. Wo ist das gewesen?“
„Hinter ein paar anderen Büchern. Ziemlich versteckt. Sind die Überziehungsgebühren in der Phillipsdorfer Bibliothek hoch?“ Karl begann damit, Bücher, die er bei seinem Stöbern durcheinandergebracht hatte, zu sortieren.
„Keine Ahnung. Ich war noch nie drinnen.“ Das Büchlein hatte vielleicht 200 Seiten. Es war nicht einmal recht alt. Erschienen im Eigenverlag, ohne ISBN.
„Die pnakotischen Manuskripte sagen mir was. Irgendwo hab ich schon mal was davon gehört.“ Karl klang etwas abwesend, wie immer, wenn er sein Gehirn durchforstete.
„Du hast doch von fast allen Büchern schon mal gehört.“
„Irgendwas mit Okkultismus und Geheimlehren.“
„Was du nicht sagst.“ Ich nickte zu den Büchern, die er sortierte.
„Kannst du mir die Bibliothek mal zeigen?“
„Klar.“ Ich blätterte die Ansichten langsam durch. „Morgen? Oder musst du arbeiten?“
„Nein. Zeitausgleich diese Woche und dann Urlaub bis Silvester. Zu viele Überstunden.“ Er grinste.
„Perfekt, dann ...“ Ich stockte, als zwischen den Seiten ein zusammengefaltetes Stück Papier herausglitt und auf den Boden flatterte.
Ich bückte mich danach und faltete es auf.
Karl schaute mir über die Schulter. „Was ist das?“
„Ich weiß nicht.“ Stirnrunzelnd erkannte ich die Handschrift Josef Zeilners am oberen Rand. „Sieht aus wie eine Karte. Handgezeichnet.“
„Von Phillipsdorf?“ Karl fasste an eine Ecke des Blatts.
Jetzt wurde auch Helena neugierig. Sie legte die Bibel weg und kam zu uns. Ihr schwarzes Haar glänzte im Schein der Deckenleuchte.