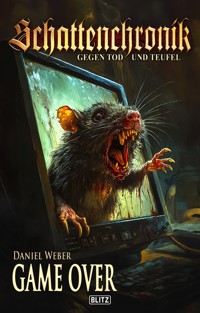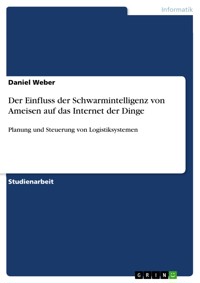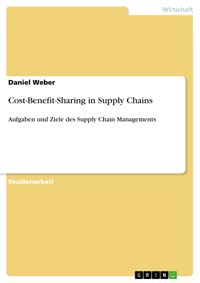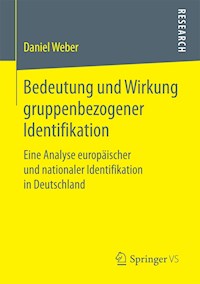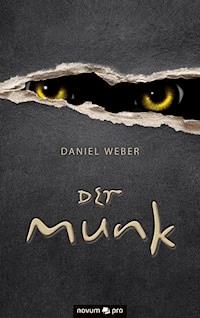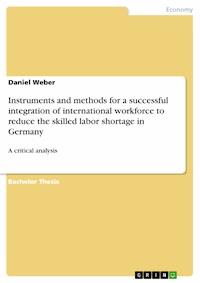Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Grusel Thriller
- Sprache: Deutsch
Die Suche nach seinem verschollenen Großonkel führt Stefan und seine Freunde in eine andere Welt, in der die uns bekannten Naturgesetze nicht zwingend gelten. Eine Welt am Rande des Kosmos, bevölkert von Kreaturen, die jeder Beschreibung trotzen. Und sie werden von einem bekannten Feind gejagt. Phillipsdorf - Bezirk des Wahnsinns (4. Roman)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen
3401 Jörg Kleudgen & Michael Knoke Batcave
3402 Ina Elbracht Der Todesengel
3403 Jörg Kleudgen & E. L. Brecht Der Fluch des blinden Königs
3404 Thomas Tippner Heimkehr
3405 Melanie Vogltanz Die letzte Erscheinung
3406 Jan Gardemann Die Seltsamen
3407 Jörg Kleudgen & E. L. Brecht Höllische Klassenfahrt
3408 Daniel Weber Phantasmagoria Park
3409 Jan Gardemann Die Rache der Seltsamen
3410 Daniel Weber Die zweifelhafte Erbschaft
3411 Daniel Weber Die unerwartete Zeugin
3412 Daniel Weber Das zerfallende Genie
3413 Daniel Weber Die andere Welt
Die andere Welt
Phillipsdorf - Bezirk des Wahnsinns No. 04
Grusel-Thriller
Buch 13
Daniel Weber
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2024 BLITZ-Verlag
Hurster Straße 2a, 51570 Windeck
Redaktion: Eric Hantsch
Titelbild: Mario Heyer
Umschlaggestaltung: Mario Heyer u.V. der KI Software Midjourney
Vignette: iStock.com/Hein Nouwens
Satz: Gero Reimer
Gedruckt in der EU
Alle Rechte vorbehalten
www.blitz-verlag.de
3413
ISBN: 978-3-7579-8369-7
Inhalt
Prolog
Paradoxe Chronologie
Das Medium
Der Schöne und das Biest I
David Grau I
Unsere illustre Truppe
Der Schöne und das Biest II
Das Tor, das keines ist
David Grau II
Allein im Irrgarten
Raphael I
Georg I
Der Schöne und das Biest III
Durch den Irrgarten
Georg II
David Grau III
Der Schöne und das Biest IV
Raphael II
Die Flucht
Georg III
Der Schöne und das Biest V
Raphael III
Die Wesen, deren Köpfe nur aus Augen bestehen
Georg IV
Der Schöne und das Biest VI
Ein neuer Anfang
David Grau IV
Wieder vereint, aber machtlos
Die Macht des Josef Zeilner
Der Schöne und das Biest VII
Durch die Korridore
David Grau V
Die Geschichte Josef Zeilners
Die verlorene Mutter
David Grau VI: Alte Freunde
Der Bluthund
Kampf gegen den Bluthund
Der Weg nach draußen
Zurück in der Meyrinkgasse 3
Epilog: Der unerwartete Gast
Danke!
Anmerkungen
Über den Autor
Für Nora,
weil Du als Erste David Graus
Geheimnis erraten hast.
Mein Name ist Stefan Hanns.
Ich bin verrückt.
* * *
Prolog
Dies ist meine neue erste Erinnerung meines neuen alten Lebens:
Ich kauere auf dem Boden, benommen, mein Schädel dröhnt und mir ist übel, als hätte ich die schlimmen Migräneanfälle meines Vaters geerbt. Vor mir, in der engen Gasse zusammengedrängt, sich gegenseitig beschattend, dräuen die Kreaturen, deren Köpfe nur aus Augen bestehen, und glotzen mich an.
Hinter mir, nur einen Schritt entfernt, beginnt die Ewige Treppe, die ich gerade hinaufgegangen bin, die aber jetzt wieder hinaufführt, zwischen schwarzen Mauern, die sich aufeinander zuneigen wie dunkle Liebhaber, erstarrt in dem Moment direkt vor dem Kuss.
Experimentelles Schreiben ist ja eigentlich Georg Bürgers Sache. Meine nicht, war es nie. Aber ich bin nicht mehr der Autor, oder besser: Ich fühle mich nicht mehr als der Autor zumindest dieser Geschichte. Ich bin aufgestiegen, transzendiert. Vom einfachen Ich-Erzähler zum allwissenden Erzähler. Ich sehe durch die Augen meiner Freunde, nehme ihre Gefühle wahr, als wären es die meinigen, höre ihre Gedanken, als würde ich sie denken, und spüre ihre Schmerzen, als würde ich sie ... So viel Schmerz.
Raphael brüllt Blut.
Helena kauert unweit von ihm, die Arme über den Kopf zusammengeschlagen wie ein Kind.
Pavel ... Ich habe Pavel verloren.
Georg Bürger verschwindet im Himbeer-Nebel seiner E-Zigarette.
David Grau hetzt, geführt von seinem schnüffelnden und schnaubenden Diener Wolf, den ich bis dato noch nicht gekannt habe, durch den verwinkelten Irrgarten dieser falschen Realität und uns hinterher. Er jagt uns.
Karl und Emily, die im Schatten der Nacht ein unförmiges Ding über die Brüstung der Ashtonbrücke wuchten. Das Ding bewegt sich. Es lebt.
Und Caroline ... starrt mich an. Und mit ihr die Augen der Kreaturen, deren Köpfe nur aus Augen bestehen. Sie steht zwischen ihnen, als würde sie zu ihnen gehören, und ihre immer müde scheinenden Augen starren mich nieder. Unbarmherzig und leer, als wäre eine der rastlosen Seelen, mit denen sie immerzu in Kontakt steht, in sie eingezogen und hätte ihr Herz erkalten lassen.
Paradoxe Chronologie
Meine Erinnerung schnalzt zurück. Im einen Augenblick starren mich die namenlosen Augen nieder, im nächsten finde ich mich als Dreijähriger wieder, der wie ein Irrer plärrt, weil er gerade die Szene aus Superman 3 gesehen hat, wo eine Frau, schrecklich entstellt, in irgendeinem Metalltubus frittiert wird – fragen Sie mich nichts Genaueres, denn mich hat diese Szene als Kind so verstört, dass ich mir nie wieder auch nur einen einzigen Superman-Film angeschaut habe (also weiß ich auch nicht, ob meine Angaben hier korrekt sind).
Das war eine meiner früheren ersten Erinnerungen, und da kommen noch mehr. Viel mehr. Man sagt, dass das eigene Leben vor dem inneren Auge vorbeiziehen würde, wenn man stirbt, aber ich sterbe nicht, das ist mir klar. Das war mir klar. Beides ist schon Vergangenheit, die Erinnerung und das Erinnern, aber manchmal bin ich mir immer noch nicht sicher, ob wir es aus dieser falschen Realität wirklich herausgeschafft haben.
Meine Erinnerungen schnalzen weiter. Erster Schultag. Schnalz. Platzwunde im Mund, nachdem mein Kiefer die Tischkante geküsst hat. Schnalz. Erster Tag Gymnasium. Das Mobbing. Raphael, der an meiner Seite ist, immer. Schnalz. Oberstufe. Bestandene Matura. Schnalz. Beginn der Bibliophilie, Start des Studiums. Schnalz. Bachelor-Abschluss. Schnalz. Erhalt des Briefes meines Großonkels. Begegnung mit Helena. Die Weißen, die uns ans Leder wollen. Die Alte. Phillip Ost und das Ding, zu dem er geworden war. Schnalz. Schnalz. Schnalz.
Binnen eines Wimpernschlags fetzen die Bilder und Erinnerungen an mir vorüber, bis ich an dem Zeitpunkt anlange, wo zumindest diese Geschichte begonnen hat. Vermeintlich. Aber eigentlich hat sie schon viel früher begonnen. Wahrscheinlich bei meiner Geburt. Wer kann das schon sagen?
Ich schreibe wirr. Sollte mich in der Retrospektive eigentlich zusammenreißen können und alles kohärent wiedergeben, aber das würde meine Wahrnehmungen und Gedankengänge zum Zeitpunkt des irren Erinnerns verfälschen. In der Tat waren sie noch wirrer, als ich sie mir hier wiederzugeben getraue.
Jedenfalls muss ich einen Anfangspunkt wählen, um zumindest diese Geschichte hier zu beginnen. Ich glaube, am besten fange ich an dem Abend an, da ich Caroline Kühl kennengelernt habe:
* * *
Karl Kirchmaus, angetan mit schwarzem Hemd und schwarzer Lederhose – wie er diese bei den frühsommerlichen Temperaturen tragen konnte, blieb mir schleierhaft –, winkte uns von meinem Gartentürchen noch zum Abschied. Emily hakte sich in seinen Arm. Ihre grün-blau-gräuliche Haut – je nach Blickwinkel und Lichteinfall – wirkte durch das leise Türkis ihres neuen Kleids (ein Geschenk Karls) dezenter als sonst. Zusammen gingen sie die Meyrinkgasse ein Stück hinunter, wo Karl seinen klapprigen roten MC Polo geparkt hatte. Sie beide hatten mir noch einen kurzen Besuch abgestattet, bevor Karl seine Freundin das erste Mal hinaus aus Phillipsdorf führen sollte – direkt zu einem Theaterbesuch. Nestroys Lumpazivagabundus wurde im Volkstheater gegeben.
Es war ein halbwegs freundlicher Tag im April 2016, zumindest im grauen Phillipsdorf. Außerhalb hatte es wirklich frühsommerliche Temperaturen, wie ich von jenen, die außerhalb lebten, wusste.
Raphael, der hinter mir im Türrahmen stand – auch er hatte mich heute aus anderem Grund besucht; wir waren von Karl und Emily quasi überrascht worden –, sog an einer Zigarette. Die Brauen hatte er tief zusammengezogen.
Ich grinste schief und nickte zum wegtuckernden Polo. „Der Schöne und das Biest.“
„Ich habe immer noch ein mieses Gefühl bei Emily.“ Raphael verzog das Gesicht, als hätte er einen sauren Geschmack im Mund, und ging ins Vorzimmer. Die makabren Gemälde in meinem Haus würdigte er schon lange keines Blickes mehr.
Ich schloss die Haustür. „Ach komm. Du hast Emily auch schon lieb gewonnen. Gib’s zu.“
Flott, der untote Kleine Münsterländer, kam schwanzwedelnd auf Raphael zu und stieß den Kopf an dessen Knie. Sein Herrchen tätschelte ihn, gab mir aber die hochgezogene Augenbraue.
Während ich mir selbst eine Zigarette anzündete, sagte ich: „Ich seh doch, dass du deine Hand nicht mehr dauernd hinter dir in Hosenbundnähe hältst, wenn sie da ist.“
„Ich trage mein Messer schon länger an der Hüfte.“ Er schlug den Zipfel des Sakkos zurück und ich sah das Messerholster an seinem Gürtel.
Jetzt gab ich ihm meine Augenbraue. Sicherlich nicht so gut wie seine.
Er zuckte die Achseln. „Ist angenehmer beim Sitzen. Seit du hier eingezogen bist, muss ich das Ding ja fast ununterbrochen tragen.“
Wir setzten uns wieder auf Couch und Fauteuil im Wohnzimmer, jeder ein geöffnetes Bier vor sich, um unser vorhin begonnenes Gespräch fortzusetzen. Wir hatten seit Februar darauf gewartet, dass Raphaels Wunden geheilt und seine Gesundheit vollkommen wiederhergestellt waren, bevor wir unsere nächsten Schritte einleiten wollten. In der Zwischenzeit hatten wir Nachforschungen angestellt, die allerdings keine wirklich neuen Erkenntnisse gebracht hatten, aber wir hatten Vermutungen. Was uns einige Sorgen machte, war, dass wir nach wie vor unbehelligt geblieben waren. Wenn wir uns David Grau mit der Vernichtung Dr. Osts und seines Gezüchts wirklich zum Feind gemacht hatten, dann ließ uns das der scheinbar ewig junge Herr nicht wissen. Aber wer konnte schon Genaues über die Beweggründe dieser Kreatur sagen? Um Grau würden wir uns auch noch kümmern müssen, das war mir nur allzu bewusst – ich hatte schließlich den Pakt mit der Hexe geschlossen, ihren Bruder auszuschalten, woran mich zu erinnern, Raphael nicht müde wurde.
Vorerst hatten wir jedoch dringlichere Probleme, die wir nun anzugehen gedachten.
„Hast du Erfahrungen mit Parallelwelten?“ Ich lehnte mich, Bierflasche in der Hand, in die Couch.
„Bin ich ein Slider?“
Ich legte den Kopf schief. „Ein was?“
„Sag nicht, gerade diese Serie kennst du nicht? Du kennst doch sonst jeden Trash, der irgendwann mal im Fernsehen gespielt wurde.“
„Ich hab nur meine Lieblingsserien“, verteidigte ich mich.
Raphael verdrehte die Augen. Nach einem großen Schluck Bier sagte er: „Na ja. Ich glaube zumindest nicht, dass wir es im Geistergassenviertel mit einer Paralleldimension zu tun haben werden, wie wir sie vielleicht aus Literatur und Film kennen. Ich fürchte, die Sache könnte hier komplexer liegen. Wir müssen uns wahrscheinlich auf etwas gefasst machen, das Osts unterirdischem Komplex ähnlich ist.“
„Also wieder kosmisches Irgendwas?“
„Meine Datenbanken geben nichts her. Ich habe in den letzten Monaten alles durchforstet, worin ich meine Nase stecken konnte.“ Er drückte die Zigarette aus. Der Aschenbecher quoll schon beinahe über. „Nichts. Hast du noch irgendwas in den Bibliotheken deines Großonkels gefunden?“
Ich schüttelte den Kopf. „Leider. Nur die Karte des Viertels. Und die gibt Helena nicht mehr aus der Hand.“
„Als Druckmittel, damit sie mitkommen darf.“ Raphael lächelte fast amüsiert. „Weil du auch immer alles herumliegen lässt. Aber gut. Vermutlich hat sie wirklich ein Recht darauf, mitzukommen.“
Ja, das dachte ich auch. Schließlich mutmaßten wir, dass wir auf unserem nächsten Abenteuer – insofern man unsere Erlebnisse so euphemistisch beschreiben darf – Josef Zeilner finden würden. Zumindest bereiteten wir das Unternehmen extra aus diesem Grund vor.
„Wo ist sie eigentlich? Die Schule muss doch schon längst aus sein.“ Raphael sah auf die Uhr. Kurz vor sechs Uhr Abend.
„Heute ist Freitag. Da geht sie nach der Schule auf den Friedhof.“
„Immer noch?“ Raphael zog die buschigen Brauen hoch. Ein überraschter Ausdruck wollte nicht in das harte dunkle Antlitz passen.
Ich trank mein Bier aus. „Sie hofft, dass ihre Mutter auftaucht. Sie gibt es nicht zu, aber es geht ihr nahe, das sehe ich. Sehr. Aber sie will nicht darüber reden.“
Mein Freund nickte nur, schwieg aber. Solche Themen behagten ihm nicht. An seinem verdüsterten Blick erkannte ich auch den Groll gegen Helenas Mutter. Nicht nur, weil sie eine Ghoula und also im Prinzip sein natürlicher Feind war, sondern vor allem, weil sie ihre mütterlichen Pflichten arg vernachlässigte. Als Mensch, der seine Eltern mit achtzehn verloren hat, reagiert er auf so etwas sehr sensibel. Zumindest für seine Begriffe.
Ich wechselte das Thema. „Übrigens sieht sie dort öfter diese weiße Katze. Es dürfte wirklich die sein, die immer mal wieder blutüberströmt durch Phillipsdorf stolziert. Du erinnerst dich daran, wie wir sie einmal aus dem Friedhofstor haben kommen sehen? Wir vermuten, dass sie irgendwie mit den Ghoulen am Friedhof befreundet ist.“
„Wieder eines deiner Gefühle?“ Erwartung glitzerte in den dunklen Augen.
Ich senkte den Kopf. „Nein.“ Nach der Sache mit Ost und meiner Erfahrung mit dem Apparat zur sphärischen Phasenverschiebung hatte ich scheinbar meine übersinnlichen Fähigkeiten verloren. Ich wusste immer noch Dinge, aber das waren nur Bruchstücke der Bruchstücke von den Erkenntnissen, die ich gewonnen hatte. Beispielsweise über die wahre Natur Emilys. Ich war seltsam frustriert, obwohl ich die Explosionen im Kopf und die darauffolgenden hämmernden Schmerzen nicht vermisste. Im Nachhinein glaube ich, dass dies einfach nur eine Schutzfunktion meines Geistes war. Wahrscheinlich, um mich auf das Bevorstehende vorzubereiten.
Ein weiß-dunkles Ding sprang neben Raphael auf die Sessellehne und er schreckte hoch wie in den Hintern gestochen. Er verschüttete ein bisschen Bier – und dabei hatte ich gestern erst den Boden gewischt.
„Ich hasse dieses Zombievieh“, zischte er.
Maxi, meine untote Katze, stakste von der Lehne auf die Sitzfläche, streckte sich, gähnte (obwohl sie keinen Atem hatte) und legte sich hin. Ihre Augen glitzerten durch die halb geschlossenen Lider.
„Du bist wirklich unverbesserlich.“ Ich erhob mich ebenso und beugte mich zu Maxi. „Sie wird immer braver. Und schau, sie knurrt mich auch nicht mehr ...“ Ein tiefes Grollen entstieg ihrer Kehle, als ich die Hand zu ihr führte. „... fast nicht mehr an.“
Ein fragendes Quietschen von unter dem Esstisch weiter vorne zeigte Flott an, der auf das Grollen reagierte.
„Untote Hunde kann man wenigstens erziehen“, ätzte Raphael.
Ich streckte Maxi die Zunge heraus, bevor ich antwortete: „Leicht gesagt für den Hundeflüsterer.“
Raphael trank den letzten Schluck seines Biers und nahm dann auch meine leere Flasche. Er trug sie in die Küche. „Wir sollten dann gehen. Caro ist zwar selten pünktlich, aber wenn doch, kann sie ziemlich unangenehm werden.“
Ich blickte noch mal zur Wanduhr. Fast halb sieben. Wir waren um Punkt sieben verabredet. Caroline Kühl. Eine von Raphaels ... Kolleginnen? Wenn ich es richtig verstanden hatte. Ich war gespannt, eine weitere Person kennenzulernen, die seiner Profession nachging. Und mehr als nur ein bisschen nervös. Er hatte mir schon viel von ihr erzählt ...
Das Medium
Caroline Kühl erwartete uns am südöstlichen Ende der Meyrinkgasse. Sie stand zwei Schritte vor dem Haken in der Straße, der sozusagen einen von den zwei Eingängen zum Geistergassenviertel bildet. Dieser Eingang, gleichsam eine Grenze, ist offensichtlich für Auge und Geist. Direkt bei dem Haken rücken die Köpfe der Gebäude näher zusammen, als lehnten sie sich wie sehnsüchtig gegeneinander. Die Sonne stand schon tief, aber Phillipsdorf lag an sich trotzdem noch in einem halbwegs freundlichen Zwielicht, zumindest aus der Perspektive eines hier Ansässigen wie mir. Ab der Grenze aber, ab dem Punkt, wo sich die oft zweistöckigen, abrissreifen Häuser gegeneinander schoben, herrschte Dunkelheit. Es war, als würde man auf eine alte, bereits ausgebleichte Fotografie einer grob vernachlässigten Gasse bei Nacht sehen. Die blinden Fenster der Gebäude sind fast alle mit Brettern vernagelt – in Phillipsdorf grundsätzlich nichts Außergewöhnliches, aber in der Menge schon erstaunlich. Dass der Putz abbröckelt, Regenrinnen unter den Dachrändern wie verwirrte Haarsträhnen kreuz und quer ragen, und dass ein dickerer Nebel als im restlichen Ort über den Boden wabert, der einem Miasma gleich aus den Eingeweiden unter der Erde zu kommen scheint, kommt mir beinahe überflüssig zu erwähnen vor.
Raphaels Bekannte stand davor. Ich sah sie, als wir die Meyrinkgasse hinuntergingen, zuerst nur von hinten und hielt sie für ein Kind. Sie war außerordentlich klein, nicht einmal einssechzig, und hatte schlabberige Skaterkleidung an – ein Umstand, der Raphael und mich wieder overdressed erscheinen ließ. Zumindest hatte ich unter dem Sakko ein Shirt an, auf dem Asterix, Obelix und Idefix abgebildet waren, und kein Hemd wie mein Freund.
Carolines dichte schwarze Haare verbargen den Hals über den breiten Schultern. Ihre Arme hingen schlaff an den Seiten herunter.
„Caro!“, sagte Raphael laut, als wir fast bei ihr waren. „Du bist überpünktlich.“
Sie reagierte nicht.
„Caro!“
Wir blieben drei Schritte entfernt von ihr stehen, doch es war, als würde sie uns nicht hören. Raphael versuchte es ein drittes Mal, diesmal sehr laut: „Caroline! Hallo! Wir sind da! Hörst du mich?“
Nach wie vor rührte sich die kleine Frau keinen Zentimeter.
Raphael verdrehte die Augen. „Himmelherrgott, diese Frau!“ Zwei ausgreifende Schritte brachten ihn an Caroline Kühls Seite. Er packte sie mit beiden Händen an den Schultern und schüttelte sie. „Caroline! Wir sind da! Komm zu dir!“
Flott hielt sich im Hintergrund. Er lag auf dem Gehsteig, den Schwanz eingezogen, und blickte immer wieder scheu in die Dunkelheit, vor der wir standen.
Ein Rucken ging durch Carolines kleinen Körper. Die Schultern hoben und senkten sich, in Arme und Rücken kam Spannung. Das Erste, was ich von ihr richtig wahrnahm, sprich was mir Eindruck machte, war ihre Stimme. Weiblich, sanft, aber doch irgendwie kratzig, fast kehlig. Nicht unmenschlich, das schloss ich gleich aus. Sie sprach etwas gedehnt, aber nicht langsam: „Raphi. Du sollst mich doch nicht so aus der Trance schütteln.“
Seine Augenbrauen zogen sich noch tiefer zusammen. „Und du sollst mich nicht so nennen. Wie oft muss ich dir das noch sagen?“
Ich stand vor ihnen und verstand mit jedem Augenblick weniger. Deshalb räusperte ich mich dezent.
Raphael blickte entschuldigend zu mir. „Ich hab dir ja gesagt, Caroline ist ein Medium. Ein sehr aufnahmefreudiges. Sie ist immer mit der Geisterwelt, sozusagen, verbunden. Und manchmal kippt sie rein und verliert sich einige Stunden darin. Oder Tage.“ Die letzten Worte waren mit beinahe vorwurfsvollem Unterton in ihre Richtung gesprochen.
Endlich machte auch Caroline Anstalten, sich umzudrehen. „Das war ein einziges Mal. Ich wäre schon nicht verhungert“, sagte sie dabei ätzend.
Dann wurde ich ihrer Front ansichtig.
Ich kann mich erinnern, dass ich früher einmal davon gesprochen habe, dass Schmetterlinge im Bauch ein fürchterlicher Euphemismus sind, und habe dann dieses Verliebtheitsgefühl mit Schraubenschlüsseln verglichen, die den Magen malträtieren. Nun, ich hörte diese Stimme, sah dieses Gesicht, blickte in diese Augen und eine Tausendschar von rostigen Schraubenschlüsseln, vielleicht auch ein paar spitze Zangen, schlugen sich in meinen Magen, drehten ihn um, verkrampften und quetschten und verknoteten ihn. Unnötig zu sagen, dass alle Gedanken an Fabia wie weggeblasen waren von einer Sekunde zur nächsten. (Sie hatte sich übrigens wirklich nicht wieder bei mir gemeldet.)
Noch nie zuvor (oder danach) habe ich ein so faszinierendes Gesicht gesehen, von wildem, welligem, schwarzem Haar eingerahmt, das an Frauenfrisuren aus amerikanischen Filmen der 1980er erinnerte. Nur Ideen der kleinen Ohren schimmerten durch. Das Erste, was für mich aus dem Rahmen fiel, war ihre Kieferpartie. Sie ist selbstbewusst, aber nicht unfraulich, mehr weich als hart. Der Mund, dessen Winkel immer einen Millimeter nach unten gezogen scheinen, ist schmallippig und breit. Darüber eine Stupsnase und zwei dunkle, tiefgründige Augen, halb geschlossen, als würde der Schlaf sie übermannen wollen, mit zwei dicken, aber ebenmäßigen Brauen. Eine hohe blasse Denkerstirn bildet den Abschluss.
Ihre übrige Gestalt schien auch von vorne betrachtet eher kindlich. Aber das täuschte. Unter dem weiten Skater-Shirt zeichneten sich faustgroße Brüste ab. Eine schlanke Taille wurde durch den Faltenwurf suggeriert und frauliche Hüften und Oberschenkel spannten die enge Jeans darunter. Ich schätzte sie auf ungefähr unser Alter, also zwischen vierundzwanzig und siebenundzwanzig.
„Das ist mein Freund, Stefan Hanns, von dem ich dir erzählt habe“, stellte Raphael vor.
Sie blickte mich mit den dunklen Augen durchdringend an, als würde auch sie einen ähnlichen Eindruck von mir wie ich von ihr haben. Die Schraubenschlüssel machten noch ein paar Umdrehungen in meinen Eingeweiden. Ihr Mund schien leise zu grinsen, fast hochmütig.
Ich schluckte und musste mich anstrengen, um zu antworten: „Sehr erfreut.“ Ich streckte ihr die Hand hin.
Sie achtete nicht darauf. „Dieser Ort ist sehr chaotisch.“
Mein Herz sank, als ich erkannte, dass sie mich gar nicht angeschaut, sondern durch mich hindurch geblickt hatte in irgendwelche Sphären. Ich zweifelte sogar kurz daran, dass sie mich überhaupt wahrgenommen hatte. Mutlos ließ ich die dargebotene Hand sinken.
Raphael zog die Brauen wieder zusammen. „Du hast dir schon ein Bild gemacht?“
„Deswegen war ich schon früher da.“ Sie nickte langsam, als würde sie halb schlafen. „Ich wollte Ruhe haben und allein sein. Phillipsdorf an sich ist aufgeladen. Ich war noch an keinem anderen Ort mit so vielen ... verwirrten Seelen. Aber dieses Geistergassenviertel ... Wenn du da wirklich rein willst, brauchen wir mehr als nur meine und deine Fähigkeiten, um überhaupt eine Chance zu haben, wieder rauszukommen.“
Diese gedehnte, kratzige Sprechweise machte mich auf mehreren Ebenen unruhig. Ich trat von einem Bein aufs andere. Ich wagte noch einmal einen Blick über die Grenze zur Dunkelheit, wandte ihn aber schnell wieder ab, da ein solcher Blick auch gewöhnliche Menschen ohne erweiterte Sinne gefangen nehmen kann. Ich sagte: „Was heißt das genau?“
Endlich zuckten ihre Augen in meine Richtung. Endlich sah sie mich deutlich an und legte ihren Kopf schief wie eine Katze. „Das ist ... eine schwierige Frage.“
Noch ein Schaudern ging durch alle meine Poren bei diesen Worten, die noch gedehnter und noch kratziger waren als alle zuvor. Hintergründig, unheimlich, und, ich gestehe es, wahnsinnig erotisch.
„Brauchst du eine Pause?“ Raphael beugte sich leicht zu ihr.
Sie nickte.
Eine halbe Stunde später saßen wir wieder in meinem Wohnzimmer. Caroline hatte die Beine auf der Ledercouch untergeschlagen und starrte auf eines der vielen Gemälde, die noch von Josef Zeilner stammen. Eine rot-schwarz-violette Landschaft mit Schemen darin, die wie geflügelte Dämonen aussehen. Sie sprach langsam, während sie zu ihrer Bierflasche griff: „Ein Spätwerk von Richard Upton Pickman. Sehr beeindruckend. Die Aura ist enorm.“
Ich machte einen Schluck von meinem Bier und betrachtete das Bild genauso. Von den meisten Gemälden in meinem Haus hatte ich keine Ahnung. Viele sind nicht signiert, und wenn doch, dann kann ich die Signaturen nicht entziffern. Sie alle zeigen düstere Horrorszenerien, faszinierend in der Ästhetik des Grauens. Helena hatte sich nie dafür interessiert, und den Einzigen, der mir mehr über die Gemälde hätte sagen können, David Grau, konnte ich schlecht fragen. Ich glaubte mich aber zu erinnern, dass auch Grau in seiner Villa Gemälde dieses Pickmans hängen hatte, die ähnlich grässliche Motive zeigten.
Caroline wandte sich an mich. Langsam gewöhnte ich mich an ihren abwesenden, immer schläfrigen Blick. „Dein ganzes Haus ist voller Energien und Auren, Stefan. Sie sind aber nicht bedrängend. Die Kräfte, die hier wirken, scheinen dich und das ganze Haus zu mögen.“ Sie runzelte ein wenig die Stirn. „Bis auf die ruhelosen Seelen in deinem Garten. Sie sind schwach, aber sehr zornig. Sie schimpfen, ich kann es spüren. Du hast ein paar Leichen dort hinten vergraben, zusammen mit deiner Großcousine.“
„Ähm, ja, das stimmt leider.“ Ich kratzte mich verlegen im Nacken. „Das waren die Blumen für Helena, die uns Markus Krankl immer mal wieder vor die Haustür legt. Er ist in sie verliebt. Helena und ich versuchen, die meisten Leichen irgendwie in die Kanalisation oder auf den Friedhof zu schaffen, für die Ghoule, aber manchmal bringt Krankl die Körper zu den unmöglichsten Tageszeiten und wir müssen sie verscharren, weil sie sonst das ganze Haus verstinken.“ Ich sah meine wie auch immer gearteten Chancen bei dieser Frau schon sinken, eingedenk der Tatsache, dass der Bruch mit Fabia ja mit einem von diesen Blumenbuketts eng zusammenhing.
„Das ist nett von dir, auch an die Ghoule zu denken“, sagte sie. (Und ich spürte meine Chancen wieder steigen.)
Raphael verzog das Gesicht. „Wie man’s nimmt.“ Er zündete sich eine Zigarette an. „Kannst du uns jetzt erzählen, was du für einen Eindruck vom Geistergassenviertel hast?“
Caroline öffnete die Augen ein Stück weit mehr. Sie nickte wieder und beugte sich ein wenig vor, stützte die Ellbogen auf den Oberschenkeln ab. „Es ist ein machtvoller Ort, der nur zu einem ganz kleinen Teil in dieser Welt existiert. Wenn wir da reingehen, verlassen wir die irdische Welt, wie wir sie kennen.“
„Wir?“, fragte ich.
Raphael machte Rauchringe. „Wir brauchen jede Unterstützung, die wir kriegen können, fürchte ich. Georg Bürger hat ja auch angedeutet, dass er uns begleiten wird, wenn es so weit ist. Pavel muss auch mit. Helena wird sich ebenfalls nicht abhalten lassen. Aber ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ich kenne einige andere Jäger oder diverse Spezialisten. Aber den meisten von ihnen müssten wir zu viel erklären, warum wir mit Vampiren und Ghoulen und anderen Wesen verkehren, ohne ihnen sofort den Garaus zu machen. Caro ist die Einzige, die frei von jeglichem Vorurteil ist.“
„Jedes Wesen hat ein Recht, zu existieren, Raphi. Die meisten scheinbar bösen Kreaturen haben genauso viel Angst vor den Menschen, wie wir vor ihnen“, sagte sie ruhig.
Raphael verzog den Mund bei der verhassten Verballhornung seines Namens. „Wir nehmen dich das nächste Mal mit, wenn wir wieder mal einen Irrgarten betreten wie den, den wir unter Osts Haus gefunden haben.“
Bei der Nennung dieses Namens sprang Maxi wie aus dem Nichts auf die Couch neben Caroline. Sie schnupperte kurz, dann stieg sie auf ihren Schoss und legte sich von jetzt auf gleich hin, den Kopf in die Vorderpfoten vergraben. Caroline lächelte verträumt und streichelte sie.
Der Stachel des Neids berührte mein Herz. Neid auf Caroline, aber auch auf Maxi.
„Also, was ist es jetzt?“, nahm ich den Faden wieder auf, um meine Gedanken ab- und das Gespräch wieder aufs Thema zu lenken. „Wieder ein Tor zum Kosmos? Eine Paralleldimension? Was?“
Caroline streichelte abwesend die untote Katze und sprach wie zu sich selbst. „Nichts davon. Und alles. Es ist ein machtvoller Ort. Ich glaube, er existiert außerhalb der uns geläufigen Raum und Zeit. Naturgesetze werden darin teilweise entweder nicht gültig oder bis zur Unkenntlichkeit verzerrt sein. Und ich habe Dinge darin gespürt. Mit Bewusstsein. Willen. Nichts davon menschlich, vieles davon gefährlich und blutdurstig.“
„Also business as usual.“ Ich zündete mir ein Zigarillo an.
„Ihr glaubt, dass dieser Josef Zeilner da drin ist?“, fragte sie plötzlich.
Raphael antwortete: „Wir haben zumindest zwingende Hinweise darauf.“
„Warum wollt ihr ihn finden?“
„Er ist mein Großonkel“, sagte ich etwas unwirsch.
„Außerdem brauchen wir Informationen von ihm.“ Raphaels Miene verdüsterte sich. „Unser lieber Stefan hat einen Pakt mit einer Hexe geschlossen. Wir müssen verhindern, was auch immer ein gewisser David Grau vorhat, und ihn zur Strecke bringen. Josef Zeilner war ein enger Bekannter von Grau, später offenbar sein Widersacher. Wir tappen im Grunde noch vollkommen im Dunkeln.“
Wieder ein langsames Nicken von Caroline. „Das erinnert mich an die Zeit, als wir uns kennengelernt haben, Raphi. Da hast du auch noch nichts von Tuten und Blasen verstanden, wolltest aber trotzdem schon bei den Großen mitspielen.“
„Nicht jeder hat das zweifelhafte Vergnügen, mit deinen Fähigkeiten geboren zu sein“, versetzte Raphael.
„Aber nicht jeder ist dumm genug, einfach auf gut Glück einen Poltergeist vertreiben zu wollen.“ Caroline schaute ihn an.
Raphael drückte die Zigarette aus. „Ich hatte alles unter Kontrolle.“
„Du bist quer durch den Dachboden geschleudert worden, als ich raufkam.“
„Ich hätte schon ...“
Raphaels Verteidigung wurde vom lauten Schlagen der Haustür unterbrochen und von der leicht gutturalen, aber freudigen Stimme Helenas: „Stefan! Bist du schon zu Hause? Ist Raphael auch da?“
Ich sprang auf. „Das ist Helena. Meine Großcousine. Du weißt über sie Bescheid?“
Caroline nickte. Ich glaube, ich strahlte richtig. Weil ich mich für Helena freute. Endlich würde sie noch einen Menschen kennenlernen, dem sie ihre wahre Natur offenbaren konnte. Nachdem sie ihre Mutter heute sicher wieder nicht hatte treffen können, würde sie jeden Trost brauchen.
Der Schöne und das Biest I
Am gleichen Abend, wie gesagt, besuchten Karl Kirchmaus und Emily Sargent das Volkstheater. Der Lumpazivagabundus wurde gegeben, ein heiteres Stück in guter Besetzung. Karl bevorzugte zwar genau wie ich Off-Produktionen, aber das Volkstheater konnte man vor allem bei Nestroy-Vorstellungen noch ohne Bedenken besuchen.
Ich wechsle also hier zum ersten Mal die Perspektive, ohne dass mir jemand die Ereignisse so detailliert erzählt oder dass ich davon gelesen hätte. Ich betone dies. Ohne meine jüngste Bewusstseinserweiterung, wenn ich das so bezeichnen kann, wären mir nämlich Geschichte und Umstände des jungen Paars weitgehend verborgen geblieben. Ich setze hier nun ein, weil es einen adäquaten Ausgangspunkt darstellt für jene Geschehnisse, die Karl und Emily erlebten, während wir, also Raphael, ich und die anderen, sagen wir: anderweitig beschäftigt waren.
Das Volkstheater zeichnete sich hoch und erhaben vor dem Nachthimmel ab. Sterne waren nicht zu sehen wegen der hellen Beleuchtung, die jeder Großstadt zu eigen ist. Die Theatergäste strömten aus den Frontportalen, belustigt und erheitert. Natürlich sah man unzufriedene Mienen, denn kein Künstler, und ist er noch so gut, kann es jedem dahergelaufenen Möchtegern-Kritiker recht machen.
Karl und Emily schoben sich zwischen den anderen durch. Karl merkte es nicht, aber viele Leute, an denen sie sich vorbeischoben, beäugten Emily mit einem gewissen Ekel, zumindest mit dezentem Abscheu, aber auch mit Neugierde. Die Berührung, als sie sich an ihnen vorbeischob, war ihnen sichtlich unangenehm, obwohl sie wahrscheinlich nicht sagen konnten, warum und wieso. Eine unbewusste Abneigung war es vermutlich gegen die unnatürlich aussehende Hautfarbe und die Glupschaugen, die selten oder nie zu blinzeln schienen.
Kurz darauf aber standen sie beim U-Bahn-Abgang der Station Volkstheater nahe beisammen. Viele der anderen Gäste liefen bereits die Stiegen hinunter, andere kehrten noch im Café Raimund gleich vis-à-vis ein. Der Verkehr war gegen elf Uhr nachts beinahe genauso rege wie am Tag, und so rauschten auf der mehrspurigen Fahrbahn Autos und Busse vorbei und untermalten die Stimmung mit unregelmäßigem Motorengebrumm.
Karl, eine Hand in der Hosentasche, rauchte eine Zigarette. „Na, wie hat’s dir gefallen?“
„Wundervoll!“ Emily strahlte über beide Ohren. Die Glupschaugen drängten noch stärker aus den Höhlen und auf den blau-grün-grauen Wangen war ein nebeliger Rotton erblüht. „Es war wundervoll. So schön. Ich ... ich kann’s gar nicht glauben!“ Sie stammelte in ihrer Freude. Der kehlige Unterton in ihrer Stimme war beinahe nicht zu hören. Sie fasste Karl an den Schultern und stellte sich auf die Zehenspitzen, um ihn zu küssen. Dann sagte sie leiser: „Danke, dass du mich mitgenommen hast.“
Karl, verlegen, grinste schief. „Sicher. Ich meine, ich ... also wir wollen ja Zeit miteinander verbringen ... Und du ... Und du warst wirklich noch nie vorher außerhalb von Phillipsdorf?“
„Nein.“ Sie senkte den Kopf. Ihre Hände krallten sich in das Kleidchen, das ihre Figur vorteilhaft betonte. „Das ist heute das erste Mal, dass ich aus Phillipsdorf raus bin. Ich ... ich bin immer noch nervös, weißt du?“
Er lachte auf. „Das brauchst du nicht sein. Was soll denn passieren?“
„Merkst du es nicht, wie mich die anderen Leute anschauen?“
Karl runzelte die Stirn.
„Die Frau im Theater neben mir hat mir immer so böse Blicke zugeworfen. Und sie hat sich gar nicht weit genug auf die Seite lehnen können, um mir nicht nahe sein zu müssen.“
„Hast du dich deswegen so zu mir gelehnt?“ Koketterie war keine von Karls Stärken, eigentlich, aber Emily brachte neue Seiten an ihm hervor.
Sie blickte verlegen lächelnd zu ihm auf, den Kopf immer noch gesenkt. „Nicht nur deshalb.“
Er küsste ihre Stirn. „Mach dir keinen Kopf. Die Leut sind halt deppert. Davon lassen wir uns den Abend nicht vermiesen. Wollen wir auch noch ins Café Raimund gehen? Ich hätt Gusto auf Gulasch und Bier. Magst du auch was zu essen?“
Emily biss sich auf die Unterlippe. Sie verlagerte ihr Gewicht von einem Bein aufs andere, krallte sich wieder in ihr Kleidchen. „Ich ... ich habe Mutter versprochen, vor Mitternacht zu Hause zu sein.“
(Man muss dazu sagen, dass Emily immerhin erst neunzehn war, also sieben Jahre jünger als Karl. Da wäre es auch für eine normale Mutter natürlich gewesen, wenn sie sich Sorgen um ihre normale Tochter gemacht hätte.)
Karls Lächeln schwand. „Ich frage mich, wann ich sie endlich mal kennenlernen darf. Dann muss sie sich nicht so große Sorgen um dich machen.“
„Darum geht’s nicht“, nuschelte Emily.
„Worum denn dann?“ Karl ließ die Hände gegen seine Schenkel klatschen. „Normalerweise wäre es mir ja egal, wenn du mir deine Mutter nicht vorstellen wolltest, aber ...“
„Aber was?“ Sie klang ängstlich und presste die Lippen zusammen.
Karl warf den Zigarettenstummel auf die Straße – ein Zeichen seiner tiefen Bewegung, denn ansonsten benutzte er die öffentlichen Aschenbecher. „Aber ich würde halt schon gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Ich hätte alles für ein gemeinsames Frühstück morgen eingekauft, weißt du?“
Emily brauchte ein paar Sekunden, bis sie begriff, worauf Karl heute Abend gehofft hatte. Als die Zahnräder in ihrem Hirn einschnappten, wandte sie sich ruckartig um und klatschte die Hände gegen das Gesicht. „Du meine Güte!“ Ihre Stimme klang piepsig.
„Emily!“ Karl streckte die Hand nach ihr aus. „Bitte versteh mich nicht falsch, ich ...“
Sie begann, leise zu weinen. Ihre Schultern zitterten.
„Es tut mir leid, wenn ... Emily?“
Von einer Sekunde auf die andere hing sie in einer stürmischen Umarmung an ihm. Sie grub das Gesicht in die Beuge zwischen Hals und Schulter, küsste diese Partien auch ab, während er ihre Tränen spürte. „Dir muss nichts leidtun“, wisperte sie. „Ich ... ich bin glücklich. Das sollst du wissen. Du machst mich wirklich glücklich. Aber ich ... Ich kann’s dir nicht erklären.“
Karl begriff, dass er hier einem tiefgreifenden Problem auf die Spur gekommen war, konnte aber nicht einmal ansatzweise ahnen, was dahintersteckte. Er hielt sie fest und fragte ebenso leise: „Was kannst du nicht erklären? Versuch’s zumindest. Ich ... ich bin doch für dich da. Ich mein’s ernst mit dir.“
„Das weiß ich ... Ja, das weiß ich ... Und deswegen ... Deswegen ...“ Wieder ein heftigeres Schluchzen. „Deswegen hab ich nicht auf Mutter gehört und mich trotzdem mit dir getroffen. Ich mag dich, Karl. Sehr. Sehr, sehr. Aber ich ... ich kann nicht mit dir kommen, heute oder irgendwann. Ich glaube, das geht nicht, auch wenn ich es mir wünsche.“
Die Verwirrung in Karl war grenzenlos. Auch in seinem Magen waren Schraubenschlüssel am Werk, aber nicht nur aus Verliebtheit, sondern auch vor Enttäuschung, Gram und dem Gefühl, etwas grundfalsch gemacht zu haben. „Ich verstehe das nicht. Was soll das denn heißen?“
Sie schüttelte den Kopf, immer noch an ihn gepresst. „Zumindest mal, dass ich jetzt heimfahren werde ... Ansonsten ... Ich weiß es nicht ... Wir telefonieren, ja?“
„Kann ich dich begleiten?“
„Wir haben doch eh denselben Weg, zumindest für ein Stück.“ Sie löste sich jetzt von ihm und blickte ihm beinahe hündisch in die Augen. (Karl wohnte unweit des Mühlwassers im 22. Bezirk in einer Kleingartensiedlung.)
„Ich meinte, ganz zu dir ...“, versuchte er es noch einmal.
Sie schüttelte den Kopf. „Nein, tut mir leid, das geht nicht.“ Sie nahm sein Gesicht in beide Hände, stellte sich dafür wieder auf die Zehenspitzen. „Und jetzt reden wir nicht mehr davon, ja?“ Die Tränen waren getrocknet. „Lass uns die Heimfahrt noch gemeinsam genießen. Und lass mich dich küssen, in Ordnung?“
Karl nickte nur, bevor er einen langen, einen endlosen Kuss genoss, der ihn seine Zweifel für einige Augenblicke vergessen ließ. Die Wahrhaftigkeit ihrer beider Gefühle füreinander war für beide spürbar. Karl hatte es noch nie erlebt, dass eine Frau ihn so gemocht, ihn mit so viel Zärtlichkeit behandelt hatte – darum war es für ihn nur umso verwirrender, dass es Grenzen gab, die es in dem Stadium ihrer Beziehung heutzutage längst nicht mehr geben dürfte. Er glaubte zu wissen, dass sie für ihn genauso fühlte wie er für sie. Aber irgendetwas war falsch. Irgendetwas verheimlichte sie ihm.
Natürlich sah er, dass sie anders war. Dass sie etwas anderes als ein Mensch sein könnte, kam ihm natürlich niemals in den Sinn. Vielleicht hatte sie irgendeine Krankheit? Nein, dafür schien sie zu vital und lebensfroh. Hatte es etwas mit ihrer Mutter zu tun? Sehr wahrscheinlich. Oder gar mit dem Ort, an dem sie lebte?
Aber Karl kannte Phillipsdorf nun auch schon recht gut, er war ja oft genug bei mir zu Besuch und außerdem traf er sich noch öfter mit Emily, obwohl er natürlich noch nie die Hausbesorgerwohnung von innen gesehen hatte. Er war mit ihr Stammgast im Café Bernhard, flanierte regelmäßig mit ihr durch den Oscar-Park. Sie schauten oft bei mir vorbei, dann gab’s Brettspiel-Abende zu viert, oder zu fünft bis sechst, wenn Raphael und/oder Pavel ebenfalls kamen. (Natürlich war Emily auch schon in den weiteren Freundeskreis eingeführt und fühlte sich wohl darin.)
Nichts gab ihm Hinweise darauf, was hinter ihrer Zurückhaltung stecken mochte. Er war der Verzweiflung nahe. Mir gegenüber sagte er seltsamerweise nichts. Es war eine latente Angst davor, wie ich reagieren könnte. Ganz unsensibel war selbst Karl nicht gegen die ungesunden Einflüsse Phillipsdorfs und seiner Bewohner. Irgendetwas in ihm spürte, dass an Emily und ihrem Umfeld etwas nicht in Ordnung war. Er wollte das ergründen, aber wollte gleichzeitig nicht aktiv werden (was er geworden wäre, hätte er mich offen darauf angesprochen). Es passte zu ihm, dass er abwarten wollte, wenn ihm das auch seelische Pein bereitete.
Mit vielen wirren Gedanken setzte er sich neben Emily in die U-Bahn. Sie küssten und liebkosten sich. Das Mädchen klammerte sich an ihn wie an einen Rettungsanker. Er wurde immer wirrer im Kopf. Mit dem nochmaligen Versprechen, zu telefonieren, verabschiedeten sie sich endlich. In Emilys letztem Blick lag etwas, das Karl glauben machte, dass bald irgendetwas passieren musste. Vielleicht sogar sehr bald.
Und ich kann nur sagen: Zum Glück war Raphael, als es dann wirklich passierte, mit mir unterwegs. Der Jäger ertrug Ghoule, Vampire, Geister und sogar Hexen als Freunde oder Verbündete. Aber ich fürchte, was hier auf Karl zukam, hätte Raphaels Toleranzgrenze dann doch massiv überschritten ...