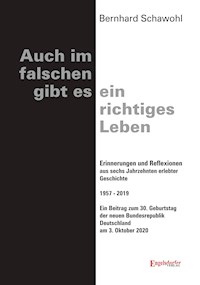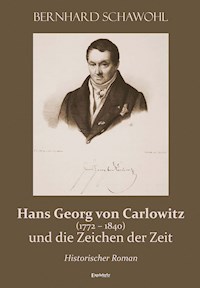
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»In erster Linie ist aber Carlowitz als Urheber der sächsischen Verfassung zu nennen, Lindenau in zweiter.« (Otto Eduard Schmidt) Der Platz vor dem Landesparlament in Dresden ist nach Bernhard v. Lindenau als Schöpfer der ersten sächsischen Verfassung von 1831 benannt. Mit ihr wird das Tor zur bürgerlichen Gesellschaft und industriellen Revolution in Sachsen aufgestoßen. Der entscheidende Anteil des Hans Georg v. Carlowitz an diesem epochalen Dokument ist in unserer Erinnerungskultur verschwunden. Carlowitz ist Zeitgenosse dreier Revolutionen: Erstens die der Aufklärung, Romantik und klassischen deutschen Philosophie. Zum anderen sind es die industrielle in England und die politische Revolution in Frankreich 1789, die ihn beeinflussen. Humanistische Gesinnung, Nächstenliebe und Tatmenschentum prägen den Menschen Carlowitz, dessen politisches Leben und Handeln im vorliegenden Roman nachgezeichnet wird. Erzählt wird von seinen Bemühungen um eine allgemeine Bildung der Landeskinder, seinem Einsatz für die deutsche Einheit als sächsischer Gesandter am Bundestag und seinem Engagement für die wirtschaftliche Entwicklung Sachsens, das in seiner Unterstützung für den Bau der ersten deutschen Ferneisenbahnstrecke Dresden-Leipzig gipfelt. Carlowitz ist der Einzige aus den Reihen des progressiven Adels, der »ZWISCHEN DEN ZEITEN« von Feudalismus und bürgerlicher Gesellschaft trotz ständiger Rückschläge immer »Baumeister am großen Steinbruch sächsischer Verhältnisse« blieb. So würdigt ihn O. E. Schmidt mit den Worten: »Sein Wesensbild zählt zu den anziehendsten und schönsten, die der obersächsische Adel hervorgebracht hat.« Hans Georg von Carlowitz würde 2022 seinen 250. Geburtstag feiern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Georg von Carlowitz 1772 – 1840
und die Zeichen der Zeit
Für Pauline zur Jugendweihe
Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir?
Was erwarten wir?
Was erwartet uns?
Ernst Bloch
Das Wirken dreier Vertreter der Familie v. Carlowitz ragt in besonderem Maße heraus:
Georg (1471-1550) wurde als Berater der Herzöge Georg und Moritz, dem späteren Kurfürsten, zum Spiritus Rector der Fürstenschulen St.Afra (Meißen), Schulpforta (Naumburg) und St. Augustin (Grimma). Sein revolutionäres Schulkonzept verhalf begabten, aber mittellosen Knaben zu einer exzellenten Ausbildung.
Hans Carl (1645-1714) prägte den Begriff der „Nachhaltigkeit“ im Umgang mit der Natur. Damit trug er uns auf, sie nicht einer „florirenden Commercia“ zu opfern.
Mit dem „Carlowitz Congresscenter“ würdigt ihn Chemnitz heute im Herzen der Stadt.
Die Sächsische Hans-Carl-von-Carlowitz-Gesellschaft e. V. pflegt sein Andenken und hat mit ihrem Wirken internationale Ausstrahlung erlangt.
Hans Georg (1772-1840), dessen 250. Geburtstages wir 2022 gedenken, hatte entscheidenden Anteil an Sachsens Entwicklung zu einem parlamentarischen Rechtsstaat und bedeutenden Industrieland.
In Anerkennung seines Wirkens um den „Mitteldeutschen Handelsverein“, der die Zollschranken in großen Teilen Deutschlands beseitigte, ist Carlowitz Ehrenbürger der Städte Frankfurt a. M. und Bremen.
Felicitas und Johannes v. Carlowitz
Bernhard Schawohl
Hans Georg von Carlowitz 1772 – 1840
und die Zeichen der Zeit
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2022
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Copyright (2022) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
Gedruckt auf FSC®-zertifiziertem Papier
www.engelsdorfer-verlag.de
VORWORT
Hans Georg von Carlowitz verfolgt mich seit fast vier Jahrzehnten.
1986 legte ich an der Fakultät für Philosophie und Kulturwissenschaften der Technischen Universität Dresden meine Diplomarbeit vor: „Die Herausbildung von Wertorientierungen der Persönlichkeit – dargestellt am Beispiel des sächsischen Adligen Hans Georg von Carlowitz“.
Als verantwortlicher Redakteur der DRESDNER HEFTE, der ich 1983-1990 war, regte ich anlässlich des 200. Jahrestages der Französischen Revolution das Heft „1789 – Zeichen der Zeit“ an. Darin findet sich auch ein kleiner Aufsatz zu Carlowitz.
Danach haben wir uns etwas aus den Augen verloren.
Im März 2021 gab er mir den Wink, dass er 2022 seinen 250. Geburtstag feiern würde und erinnerte mich an den Brief, den er im September 1831 an seinen Bruder Carl Adolf geschrieben hatte:
„Es wird eine Zeit kommen, wo man sich meiner mit Anerkennung erinnern wird, aber diese gehört dann nicht mehr in die Geschichte meines Lebens.“
Konnte ich das anders verstehen als eine Aufforderung? Ihr nachzukommen, schien mir möglich. Denn Otto Eduard Schmidt hatte in seinem Buch „Drei Brüder Carlowitz“ von 1933 das „Wesensbild“ meines Helden „zu den anziehendsten und schönsten, die der obersächsische Adel hervorgebracht hat“ gezählt und es in einer Fülle originaler Briefzitate dokumentiert. Darin finden sich viele Hinweise darauf, mit welchen Menschen Carlowitz in Kontakt stand, welche Ideen der Zeit sein Denken beeinflusst haben. Derart beflügelt, bin ich vielen weiteren Quellen gefolgt, um ein möglichst authentisches Bild des Menschen Hans Georg von Carlowitz und seiner Zeit zu zeichnen. Im vorliegenden Roman können die Leserinnen und Leser das Leben meines Helden, zugleich eine Fülle von Begebenheiten in der sächsischen Geschichte vom Kursächsischen Bauernaufstand 1790 bis zur Verabschiedung der ersten Sächsischen Verfassung von 1831 verfolgen. Außer fünf handelnden Romanfiguren haben alle namentlich Genannten wirklich gelebt und werden am Ende des Buches vorgestellt. Authentische Zitate sind an der zeitgenössischen Rede- und Schreibweise zu erkennen.
Dresden im Januar 2022
Inhalt
Vorwort
Prolog
Napoleons Flucht
Der nächste Tag in Dresden – 14. Dezember 1812
Erstes Buch
Marie
Carlowitz bei Körner kurz nach Napoleons Flucht
Carlowitz’ Begegnungen auf dem Striezelmarkt 1812
Zweites Buch
Marie Louise als Magd auf Großhartmannsdorf 1789
Carlowitz als Student in Leipzig
Marie Louise schließt sich den Bauern an
Der Aufruhr der Bauern 1790
Der Anführer Geißler
Die Niederlage
Marie Louise flieht nach Meißen
Drittes Buch
Carlowitz trifft Fichte in Leipzig
Carlowitz trifft seinen Jugendfreund Novalis
Zum Landtag hin
Der Landtag 1799
Viertes Buch
Wie liegt doch alles noch so wüst
Das Denklehrzimmer
Dinters Plan
Fünftes Buch
Die Verschwörung zum Guten
Zurück zu Geißler
Der böse Mensch ist von Natur aus gut
Unter Napoleons Regiment
Audienz beim König
Der Marsch nach Russland
Sechstes Buch
Die Rückkehr des Kaisers 1813
Das Wespennest
Senffts Irrtum
Das Lazarett
Siebtes Buch
Das Treffen in Oberschöna – Advent 1813
Die Hilfskommission 1813
Die Antragsflut
Das Waisenhaus
Blühende Landschaft
Achtes Buch
Neue Fremdherrschaft 1814
Der Zorn
Man muss helfen
Neuntes Buch
Neue Welt Frankfurt 1821
Der Gesandte
Das Geständnis
Hoher Besuch
Jeanettes Heimgang
Zehntes Buch
Die Heimkehr 1827
Die Oberschönaer Punktation
Der Freischütz
Bei Carus
Funkenflug
Die Verfassung 1831
Epilog
Literatur/Quellen
Bildnachweis
Danksagung
Romanfiguren sind
Die handelnden Hauptpersonen
Der Autor
PROLOG
NAPOLEONS FLUCHT
Caulaincourt war außer sich. Die Turmuhren hatten in dieser eiskalten Dezembernacht schon Mitternacht geschlagen, als sie Dresden erreichten. Ohnehin verspätet waren sie obendrein lange kreuz und quer durch die stockdunkle Stadt geirrt, ohne die Wohnung des französischen Gesandten Baron de Serra zu finden. Dabei hatte ihnen der Bautzner Postillon, der vorn auf dem Bock schon fast erfroren war, Ortskenntnis versprochen. Endlich entdeckte Caulaincourt ein Licht und befahl gebieterisch: „Halt!“
Er sprang aus dem Schlitten und klopfte an dem weit und breit einzig erleuchteten Fensterladen. Bald öffnete der sich einen Spaltbreit.
„Was fehlt denn?“, wollte der Mann in Nachtmütze wissen. Caulaincourt bat ihn, ihm den Weg zur Wohnung des französischen Gesandten zu weisen, falls er ihn kenne.
„Ist er krank?“, kam es mürrisch zurück.
„Nein, das nicht.“ Die Nachtmütze zog den Laden zu. Der Riegel rastete laut hörbar ein.
„Diese Sachsen!“, schimpfte Caulaincourt in sich hinein. Dem Türschild neben dem Fensterladen konnte er entnehmen, dass es sich bei dem nächtlich Gestörten um einen Medicus handelte. Der fühlte sich offensichtlich nicht verpflichtet, bei dieser Kälte Leuten, die nicht krank waren, Hilfe und Auskunft zu geben. Sein Ärger entlud sich nun wieder auf den Postmeister: „Seit Überschreiten der sächsischen Grenze heute im Morgengrauen kommen wir nicht mehr voran!“, zischte er ihn an.
„Aber die Kälte, der Sturm, der Schnee“, versuchte sich der Gescholtene zu wehren.
„Schweig, Kerl! Hatte ich nicht gemeldet, in Bautzen frische Pferde zu brauchen, die sofort nach unserer Ankunft aus Görlitz anzuspannen seien? Stattdessen hatten wir auf der Poststation in Bautzen drei viertel Stunden Aufenthalt! Obendrein bekamen die Pferde vor der Einspanne noch satt zu fressen. Jeder Stalljunge weiß, dass ein vollgefressener Gaul zu kaum mehr als leichtem Trabe taugt! Aber das Füttern der Pferde unmittelbar vor der Reise ist eine dumme Angewohnheit scheinbar von euch sächsischen Postmeistern überhaupt. Es ist euch einfach nicht auszutreiben, wie ich seit Jahren konstatieren muss. Und nun – zum schlechten Schlusse – irrst du mit uns planlos durch die Stadt! Du scheinst nicht zu wissen, welch hohen Passagier du hast!?“
Der arme Postmeister wusste es wirklich nicht. Woher auch? Reisten seine beiden Gäste nicht inkognito? Wenn er in dem Manne, der in dicke Decken gehüllt, die Füße in ein Bärenfell gesteckt, den Kaiser Napoleon erkannt hätte – es wäre ihm auch nicht geholfen gewesen. Er konnte das verflixte Haus des Gesandten einfach nicht finden.
Acht Tage waren die beiden Reisenden schon unterwegs. Seit dem nächtlichen Start kurz vor Moskau am 5. Dezember hatte sie die sibirische Kälte, wie sie in diesem Winter 1812 herrschte, auch quer durch Polen und Preußen nicht verlassen. Tiefer Schnee erschwerte das Vorankommen. Namentlich in den Senken und Hohlwegen hatte ihn der Sturm derart angehäuft, dass die Vorausabteilung geeignete Umwege suchen musste. Besonders nachts gerieten Ross und Reiter dabei oft an die Grenzen ihrer Kraft. So manchem waren bereits die Zehen schwarz gefroren; in den Poststationen stöhnten die Männer vor Schmerz, als sie sich die blutlosen Hände wärmten.
Doch darauf konnte Caulaincourt keine Rücksicht nehmen. Als grand écuyer, als Großstallmeister, zu dem er 1804 berufen worden war, hatte er unter anderem für den reibungslosen Ablauf aller Reisen des Kaisers der Franzosen zu sorgen. Armand de Caulaincourt unterstand die gesamte Organisation des Kurier- und Stafettendienstes kreuz und quer durch Europa, auf die der Kaiser ganz außerordentlichen Wert legte. So waren 600 Postillione auf drei Jahre zu vier Franken Lohn am Tag angestellt, um den Briefwechsel zu befördern. Und nun das! Diese sächsische Gemütlichkeit!
„Ich kenne kein ärgeres Phlegma als das von euch sächsischen Postillionen!“, nahm er sein Schimpfen gegenüber dem armen Kerl vorn auf dem Kutschbock wieder auf.
Zum Glück stießen sie in der späten Nacht endlich auf einen Wachmann, der sie bis vor die Tür des Gesandten führte, der im Loß’schen Palais in der Kreuzgasse unweit des Pirnaischen Tores residierte.
Baron de Serra erwartete den hohen Gast mit einem Nachtmahl. Caulaincourt hatte ihn durch einen Botenreiter wissen lassen, dass seine Majestät bei ihm essen und übernachten würde. Auf der Reise nach Paris wünsche Napoleon zudem, sich in des Gesandten Wohnung inkognito mit dem sächsischen König zu treffen.
Napoleon hatte sich und seinem Begleiter Caulaincourt auf der langen Reise kaum eine Pause gegönnt, die länger als eine Stunde währte. Auch nach der Ankunft in Dresden, inzwischen war es spät nach Mitternacht geworden, ging der Kaiser sofort an die Arbeit. Er diktierte Depeschen nach Wien, dann an den König von Neapel Murat – seinen Schwager – und weitere Fürsten und versäumte nicht, auch verschiedene Befehle an die Truppen im Osten zu geben. Der König von Neapel, hoffte er, könne als Oberbefehlshaber die versprengten Truppen in Russland wieder sammeln. Nach dem Diktat speiste er und legte sich schlafen.
Wie gewohnt hatte Napoleon seine Gedanken und Befehle aufnehmen lassen, während er auf und ab schritt. Dann kreiste er um den in der Mitte des Raumes stehenden Tisch und diktierte bald einen Brieffetzen nach Wien, dann einen an Neapel und so weiter, um sich nach Vollendung der Runde wieder dem Schreiber der Wiener Depesche zuzuwenden. Die in der späten Nacht von Baron de Serra beorderten Schreiber hatten alle Mühe, dem Diktat zu folgen. Die Kunstfertigkeit, die ihre französischen Amtskollegen in einer besonderen Kurzschrift entwickelt hatten, konnten sie nicht aufbringen. Ohne Caulaincourts Hilfe, dem der Duktus Napoleons vertraut war, hätten sie den Rest ihres Lebens sicher hinter Kerkermauern verbracht. Denn der Kaiser, dem die Schriftstücke am nächsten frühen Morgen zur Zeichnung vorzulegen waren, war penibel darauf bedacht, dass sich auch die kleinste Nuance seiner Gedanken darin wiederfand.
Während Caulaincourt, stöhnend über die Unbeholfenheit der Schreiber, noch mit der Korrektur der Briefe beschäftigt war, traf der beorderte sächsische König ein. Caulaincourt weckte den Kaiser, wie ihm geheißen, und zog sich zurück, während die beiden Monarchen beieinander waren. Zugleich überließ er die unglücklichen Schreiber ihrem Schicksal. „Sollen diese Tölpel warten, bis ich ein wenig geruht habe“, dachte er.
Bevor er sich niederlegte, hatte er noch in seiner Sache verschiedene Orders zu geben. Da Napoleon wünschte, am nächsten Morgen bereits sieben Uhr nach Leipzig aufzubrechen, hatte er neben dem Abfassen der Briefe bis zur genannten Zeit ein neues Gefährt zu bestellen. Der offene Reiseschlitten des Kaisers war in Schnee und Eis zu stark beschädigt worden, als damit an ein weiteres Fortkommen zu denken war. Eilig wurde aus dem königlichen Marstall eine Kutsche bereitgestellt und auf Kufen gesetzt.
Völlig übermüdet fand Caulaincourt nach Erledigung all seiner Aufgaben keinen Schlaf. Wie wollte sein Gebieter dem sächsischen Verbündeten begreiflich machen, dass kaum eines seiner 21.200 Landeskinder, von den 7.200 fast noch wertvolleren Pferden gar nicht zu reden, aus dem Russlandfeldzug zurückkehren würde? Jedenfalls, dachte er bei sich, wird der Kaiser den armen Mann, den er zum König Friedrich August I. erhob, im heutigen Treffen wohl nicht abfällig „mon cher Papa“ nennen, wie er es bisher so oft getan hatte.
Kaum etwas eingeschlummert gellten Caulaincourt die Schreie der verwundeten und krepierenden Franzosen, Sachsen, Westfalen, Bayern, der Rheinländer, Italiener, Holländer und Belgier, nicht zuletzt der Preußen und Österreicher in den Ohren, die Napoleon in die Schlacht von Borodino dicht vor Moskau geführt hatte. Ihm träumte, er watete im Blut der gefallenen und verwundeten Soldaten. Es lief ihm in die hohen Schaftstiefel und quietschte und schmatzte darin bei jedem Schritt. Als Junge hatte er sich einen Spaß daraus gemacht, barfuß den Sog des kühlen Moores zu spüren. Jetzt aber, in seinen Stiefeln, meinte er einen widerlich warmen Schlamm aus Menschenblut und Gedärm zu spüren. Stöhnend wälzte er sich auf die andere Seite. So entfloh er den erstarrten Augen des in der mörderischsten Schlacht seit Menschengedenken gefallenen Bruders, einem der Adjutanten des Kaisers. Und doch war ihm, sein Bruder hätte mit ersterbender Stimme gewarnt: „Wenn diese Schlacht auch noch gewonnen wird – den Krieg müssen wir verlieren. Die Russen nennen ihn ihren ‚Großen Vaterländischen Krieg‘. So wird ein ganzes Volk gegen uns stehen wie ein Mann!“
Vor Caulaincourts Augen flimmerte das Bild des brennenden Moskau, wo die Armeen nach der verlustreichen Schlacht ihr Winterquartier zu finden hofften. Überall, an allen Ecken und Enden der Stadt, huschten die Russen wie unheimliche, nicht zu fassende Schatten durch die Straßen und warfen ihre Brandfackeln in jedes Haus, jedes Proviantlager. Im Wachtraum erschien ihm das fassungslose Gesicht des Kaisers, der aus den Fenstern des Kremls heraus auf das brennende Moskau sah – das in Schutt und Asche fallende Winterquartier. Wie tausend Teufel tauchten alle Augenblicke Kosaken aus dem Höllenfeuer auf, schlugen auf die Köpfe der erschöpften Truppen Napoleons ein und verschwanden, so schnell sie gekommen waren. Es half nichts – Rettung konnte nur die Flucht nach Westen bringen.
Vor Übermüdung frierend meinte Caulaincourt in seinem flachen Schlummer die Kälte des Beresina-Flusses zu spüren, der den flüchtenden Truppen im Wege lag. Er sah Menschen und Pferde im Eis versinken. Ihn überkam ein Schüttelfrost. Er sah die eilig errichtete Holzbrücke, die nur einigen tausend der zerlumpten und frierenden Gestalten, die einst die Grande Armée waren, Rettung ans andere Ufer gab. Gesichter der großen Kriegsherren, zu gräulichen Fratzen verzerrt, erschienen ihm und marterten das Hirn des müden Caulaincourt. Wie ein unheimlicher Dämon sprang der alte Kutusow ihn an. Er fühlte, wie der listenreiche Russe ihm und den seinen an die Gurgel ging. Nie war er endgültig zu schlagen gewesen. Einem Nebel gleich verschwand er in den russischen Weiten hinter Moskau. Dann, vom Gebirge im Norden und den Steppen im Süden aus, umgriffen seine Truppen wie ein mit riesigen Zangen bewehrtes Ungetüm die Große Armee, die nach Westen flüchtete. Der rettenden Beresina entgegen. Das Untier mit seinen Zangen wie die eines Hirschkäfers hetzte sie durch den eisigen Sturm und den Schnee.
Caulaincourt schreckte schweißgebadet auf. Zuletzt war ihm das Bild Napoleons erschienen, der den Befehl zur Vernichtung der rettenden Brücke gab, kurz bevor Kutusows Truppen sie erreichten. Hunderte seiner Soldaten blieben verzweifelt zurück und verschwanden im Schlund des alles zermalmenden Ungetüms, das ihnen auf den Fersen war. Zu seinem Entsetzen stellte Caulaincourt fest, dass ihm Napoleons Bild ebenso fratzenhaft, nicht anders als das der feindlichen Feldherren, erschienen war. Voller Kälte und Berechnung schoben sie ganze Armeen gegeneinander, als seien es leblose Schachfiguren.
„Die Russen“, marterten die Worte Napoleons das jetzt wieder hellwache Hirn Caulaincourts, „die Russen müssen allen Völkern als eine Geißel erscheinen. Der Krieg gegen Russland mit seinen in Leibeigenschaft gefangenen Bauern ist ein Kampf im wohlverstandenen Interesse des alten Europa und der Zivilisation. Erst wenn ich Russland, dessen Adel gemeinsame Sache mit den Engländern macht, geschlagen habe und unter Umständen bis zur englischen Kolonie Indien vorrücke, habe ich den Erzfeind England endgültig besiegt. Er weiß, Caulaincourt, dass die Engländer den Kontinent mit ihren Billigwaren überschwemmen, die sie aus ihren modernen Fabriken ziehen. Deshalb führe ich mit der Kontinentalsperre meinen Handelskrieg gegen sie.“
Doch aus den hochfliegenden Plänen des Imperators, ganz Europa nach seinem Willen und seiner Vorstellung zu gestalten und England für immer davon auszuschließen, war nichts geworden. Zar Alexander hatte ihm, dem Kaiser der Franzosen, wochenlang die Antwort auf seinen Diktatfrieden versagt. Stattdessen warf er ihm den alten Fuchs Kutusow entgegen. So war der Russlandfeldzug verloren. Napoleon eilte quer durch Europa nach Paris, um neue Truppen auszuheben.
Pünktlich sieben Uhr am Morgen des 14. Dezember jagte die auf Kufen gestellte Kutsche, mit vier Pferden aus dem königlichen Marstall bespannt, am Japanischen Palais vorbei und zum Weißen Tor aus Dresden hinaus in Richtung Meißen und Leipzig.
Nach langem, quälendem Schweigen begann Caulaincourt das Gespräch: „Wie hat der König es aufgenommen?“
„Was meint Er?“
„Die Kunde des Verlustes meine ich.“
„Er war bleich wie Wachs, der Alte. Doch ich brauche neue Soldaten – auch von ihm. Ich habe die Deutschen zu souveränen Fürsten, so manchen zum König gemacht – auch diesen Sachsen. Er ist mir treu. Doch der sächsische Adel ist nicht wie sein König. Er ist ein wahres Wespennest! Aufruhr und Verschwörung, wohin man blickt! Miltitz, Vieth, Senfft, Schönberg, Zezschwitz, Oppell, die Carlowitzens und wie die Kerls sonst noch heißen – ein wahres Wespennest, Caulaincourt! Haben sie nicht Nutzen gezogen, als ich den deutschen Fürsten mehr als die Hälfte des alten Heiligen Römischen Reiches in ihre Gewalt legte? Habe ich mit dem Rheinbund nicht eine Allianz zwischen Frankreich und diesen Deutschen geschmiedet? Zuerst, 1806, waren es sechzehn deutsche Länder, die sich mir anschlossen und das Reich verließen. Schließlich blieben nur Preußen und Österreich als jämmerlicher Rest des ‚Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation‘, die dem Rheinbund nicht angehörten! Die Fürsten Europas haben es mir zu danken, dass der Sturmflut des revolutionären Geistes, die auch ihre Throne bedrohte, Halt geboten wurde. Was sind da 120.000 Soldaten, die ich als Gegenleistung forderte?“
„Nicht jeder der Fürsten des Rheinbundes ist Euch mit Freuden gefolgt, Sire!“, wagte Caulaincourt einzuwenden. Die Huldigung, die die deutschen Fürsten dem Franzosen 1808 in Erfurt entgegenbrachten, war ihm nicht in jedem Falle als echt erschienen. Damals stand Napoleon im Zenit seiner Macht.
„Das stimmt, verdammt! Doch was sollen diese Kerle mir? Treue Vasallen haben sie zu sein, das reicht. Ich brauche ihre Liebe nicht, wenn mich nur das Volk liebt! Habe ich nicht jedem einzelnen Volk, allen von mir befreiten Europäern zugerufen: Frankreichs Armee kommt, um euch von den Ketten zu befreien, an denen ihr so lange vergeblich rütteltet? Hier Leibeigenschaft und Fron, da Inquisition wie im Mittelalter. Überall bedrängte Untertanen in Europa! Eigentum, Sitte, Religion, alles wird geachtet werden, war mein Versprechen. Besser ich mache den Völkern die Revolution, als dass sie sich zur Herrschaft aufschwingen wie die Jakobiner! Mit unerbittlicher Strenge, Er weiß es, habe ich das Prinzip der Sittenachtung zu wahren gesucht. Meint Er, Caulaincourt, es hätte mich damals in Italien nicht geschmerzt, eine Reihe von meinen Soldaten samt ihrem Korporal füsilieren zu lassen? Doch sie hatten Vasen in einer Kirche gestohlen!“
„Vasen gestohlen?“
„Ja, Vasen gestohlen! Wer heute Vasen stiehlt, scheut sich morgen nicht, einem Kinde das Spielzeug zu rauben. Und übermorgen ist ihm die Freiheit eines Volkes gleichgültig, wenn er nur selbst die Freiheit hat, es auszuplündern.“
Caulaincourt wusste hingegen von den unermesslichen Kunstschätzen, die Napoleon selbst aus Italien raubte. An der unbedingten Treue zu seinem Kaiser begann zunehmend der Zweifel zu nagen. Jetzt war wieder ein solcher Moment gekommen, in dem dieser Geselle, der der Feind der Treue ist, kräftig zubiss. Durfte es denn sein, dass ein und dieselbe Tat dem einen Ruhm und Ehre, dem anderen hingegen die Todesstrafe brachte? „Eure Strenge, Sire, ist…“, wollte er einwenden, denn ihm schien diese Strafe zu hart, ja menschenverachtend.
Doch Napoleon fiel ihm ins Wort: „Die Nation braucht einen Führer, einen durch Ruhm hervorragenden und strengen Führer! Die Franzosen lassen sich führen, wenn man ihnen nur geschickt das Ziel verheimlicht, auf das man sie zumarschieren lässt. Schon der große Preuße Friedrich wusste, dass man die Wahrheit nur mit Zurückhaltung und niemals zu ungelegenen Zeiten sagen darf.“
Bei diesen Worten Napoleons biss der Zweifel erneut in Caulaincourts Brust: „Aber das ist“, brachte er leise stotternd hervor, „halten zu Gnaden, Majestät – das ist ja Volksbetrug!“
„Ja wenn schon“ – Napoleon lachte laut auf – „er ist unabdingbar und daher nützlich! Dem Führer muss es nur angelegen sein, dass der Pöbel glaubt, zu seinem Nutzen betrogen zu werden. Die Vernunft des Volkes besteht zumeist aus Vorurteilen. Sich zu Höherem aufzuschwingen, gelingt nicht vielen. Man muss darauf bedacht sein, dass sich der Pöbel nicht selbst zu viele Vorurteile bildet. Es ist Aufgabe des Regenten, sie zu seinem Nutzen ins Volk zu streuen. Vor allem dann, wenn es um die großen Dinge in der Welt geht. Oder meint Er vielleicht, der kleine Soldat aus irgendeinem französischen Dorf wäre mir bis Moskau gefolgt? Das tat er nur, weil ich ihm sagte, der Russe sei sein Feind!“
„Doch ist der Volksbetrug auch erlaubt?“
„Erlaubt, erlaubt – er ist nützlich, Caulaincourt! Weiß Er nicht, dass schon der große Aufklärer d’Alembert die Frage, ob der Volksbetrug nützlich sei, der Berliner Akademie der Wissenschaften zur werten Beurteilung empfahl? 1780 rechnete er dem Preußenkönig vor, dass von zehn Millionen kaum 1.000 Personen nicht geistig träge, stumpf und schwachherzig sind.“
„Ich weiß es wohl, Majestät. Deshalb schrieb Friedrich das Thema als Preisfrage an seiner Akademie aus. Er wollte wissen, wie mit der großen Mehrheit des Volkes umzugehen sei.“
„Also, Caulaincourt. Welchen Sinn sollte der Wettbewerb der großen Gelehrten gehabt haben?“
„Ich bin Euer bescheidener Diener, Majestät. Es steht mir nicht an, Ihm Unterricht zu erteilen!“
„Doch wohl nur den, ob der Volksbetrug für den Monarchen, meinetwegen für die ganze Regierung, nützlich sei. Und was nützlich ist, ist auch erlaubt!“
Napoleon verschränkte die Arme vor seiner Brust. Das Gespräch mit Caulaincourt war ihm ärgerlich geworden. Er wollte ihm eine Wendung geben. Hatte Caulaincourt ihn nicht seiner Strenge wegen tadeln wollen? „Da Er am Schicksal eines Korporals und einer Handvoll Soldaten so warmen Anteil zu nehmen scheint, will ich Ihm zu bedenken geben: Ein Volk, mein lieber Caulaincourt, ein Volk darf auf den einzelnen Menschen keine Rücksicht nehmen, wenn es eine stolze und starke Nation sein will. Es hat das Gesetz am Einzelnen exekutieren zu lassen! Das einzelne Individuum hat sich dem Großen und Ganzen zu unterwerfen, auf Gedeih und Verderb! Da hatte Rousseau schon recht!“
„Nur sollte der Einzelne Einfluss darauf haben, was dem Großen und Ganzen, was dem Gesetz also, als Gedeih oder als Verderb gilt! Sprach Rousseau nicht von einem Gesellschaftsvertrag, der zwischen Bürger und Staat geschlossen werden und als oberstes Gesetz gelten soll? Und meinte er nicht auch, er solle erneuert werden – ganz wie sich die Gegebenheiten entwickeln?“
„Er träumt, Caulaincourt! Alles Papperlapapp! Hat das Land erst einmal ein Gesetz, einen Vertrag, der dem Volk als sinnvoll oder meinetwegen als von Gott befohlen erscheint, ist es Aufgabe des monarchisch regierenden Fürsten, über dessen Einhalt zu wachen. Was soll eine Republik, in der jeder jeden Tag glaubt, vernünfteln zu dürfen und auf seine Art regieren zu müssen?“
„Sire! Frankreich ist Republik! Seit genau zwanzig Jahren!“
„Mag sein. Aber sie hat einen Kaiser! Wenn auch nicht von Gottes Gnaden, so doch Gott sei Dank! Wer ist der Kaiser? Ich bin der Kaiser! Ich bin die Freiheit und das Gesetz! Man hält mich für streng, ja hartherzig. Umso besser! Dann brauche ich es nicht zu sein! Nur weil ich gegen jeden gleich gerecht oder gleich streng bin, lieben mich alle.“
Über Caulaincourts Gesicht flog der Schein eines Lächelns, das dem Kaiser nicht entging.
„Was grinst Er, Caulaincourt? Ich verstehe. Er denkt an jene, die mich einen Despoten nennen. Doch Frankreich, das kann Er nicht leugnen, wird allein durch seine Gesetze und unabhängigen Gerichtshöfe regiert und geregelt. Das allein schon straft jene Lügen, die in meiner Festigkeit Despotismus erblicken wollen. Es stimmt, dass ich einige Präfekten, viele Beamte, ja sogar Richter strafversetzt oder wenigstens gerügt habe. Doch warum? Weil sie alle nicht von ihrer Willkür lassen wollten und damit das Gesetz verletzten. Mein Regierungsgrundsatz ist es, im Rahmen des Möglichen den Schwachen vor dem Starken zu schützen. Also auch den Privatmann gegenüber der Staatsbehörde, die, im Besitze der Macht, von Natur zu Übergriffen und Willkür geneigt ist!“
„Schöne Verhältnisse. Doch fast aller alter Adel floh vor genau diesen Verhältnissen ins Ausland, Sire!“
„Was Wunder, Caulaincourt? Es wäre sicher auch sein Blut gewesen, das unter der Guillotine der Jakobiner floss. Doch die Kinder der großen europäischen Adelshäuser werden in anderen Ideen erzogen und geformt werden. Sie werden sehen, dass das, was ich ihnen biete, in unserer Zeit wertvoller ist als das, was ihre Väter zurückgewinnen möchten. Auch der letzte preußische Krautjunker, zumindest dessen Sohn, wird es schließlich als vorteilhaft ansehen, sich der neuen Zeit zu fügen. Und meine Staatsverfassung wird das Übrige dazu tun. Ich will einen neuen Adel, Caulaincourt!“
„Einen neuen Adel?“
„In der Freiheit ist allein der Tüchtige von Adel! Und nur, wer von solchem Adel ist, ist auch frei. Geburt und Herkunft adeln nicht. Ich habe Masséna in ein paar Wochen zum General gemacht. Vierzehn Jahre hatte er unter den Bourbonen gedient und es da nur zum Feldwebel gebracht, weil er einst nicht mehr als ein Schiffsjunge und Landstreicher war. Wie viele tapfere Grenadiere stiegen unter mir zum Obersten auf? Denkt an den großartigen Marschall Augerau, den Sohn einer Gemüsehändlerin. Er schlug die 20.000 Sachsen, die unter von Zezschwitz standen, bei Jena. In nämlicher Bataille, der schönsten und entscheidenden, die ich damals 1806 gegen die alte Welt schlug, vertraute ich das Regiment des linken Flügels im Zentrum der Schlacht dem Sohne eines Küfers an. Ihr wisst von Marschall Ney, dem Tapfersten der Tapferen! Viele meiner großen Marschälle, Caulaincourt, sind Söhne des einfachen Volkes und doch von Adel. Lannes – der Sohn eines Färbers, Soult – der eines Landmannes. Ihr kennt sie und sämtliche ihrer Heldentaten.“
„Wie könnte ich sie als Adjutant Eurer Majestät nicht kennen?“
„Seht Ihr, Caulaincourt. Nie hätte ich das Gut der Freiheit über die Grenzen Frankreichs tragen können, nie hätte ich mein Gesetz gegenüber den alten Legitimierten, den Erbrechten des Adels verteidigen können, hätte ich nicht eine Armee des Volkes geschmiedet! Wie jämmerlich trat uns die preußische Armee entgegen, die der große Friedrich schuf und die noch vor fünfzig Jahren glorreiche Siege errang! Hätte ich einhundert, ja tausendmal weniger Soldaten als sie gehabt, die Preußen hätte ich dennoch geschlagen! Warum? Weil in Jena und Auerstedt zwei Welten aufeinandertrafen. Der preußische Soldat war immer noch der Leibeigene wie zu Friedrichs Zeiten. Er geriet vom Stock des Gutsherrn unter die Fuchtel und Spießrute des Offiziers, der ihn mit Ohrfeigen und Fußtritten in die Schlacht treiben musste. Und die Offiziere waren sämtlich Kerls, die nur ihrer Geburt wegen zu hohem Range kamen. Nur ein Volk, das in einem Gedanken, dem Gedanken der Freiheit geeint ist, kann siegreich für die Zukunft handeln! Wie stolz und heiter zogen meine Männer in die Schlacht! Wie viele habe ich ihrer Heldentaten wegen ausgezeichnet!“
„So hängt, halten zu Gnaden, vom Willen Eurer Majestät ab, wer als adelig und frei zu gelten hat, wie der wackere Masséna und all die Marschälle, die Ihr nanntet?“
„Genau, Caulaincourt. Doch im Krieg ist der Fürst der erste aller Generale“, rief Napoleon im Brustton der Überzeugung, „für Sieg oder Niederlage ist allein er verantwortlich; nur sein Wort darf gelten! Doch bald, ich hoffe es, werde ich endlich ein Friedensfürst sein dürfen. Dann brauche ich Staatsräte, Präfekten, Ingenieure, Professoren – einen Adel des Fleißes und des Geistes. Man muss also dem Unterrichtswesen einen großen Aufschwung geben und die jungen Köpfe ein wenig mit griechischem und römischem Geist durchdringen. Ich werde mich noch mit dem Unterrichtswesen beschäftigen, und es wird meine erste Sorge im Frieden sein; denn hier liegt die Bürgschaft für die Zukunft. Das Unterrichtswesen muss öffentlich sein für alle. Ich habe ein großes Projekt darüber.“
„Euer Denken ist groß, Majestät. Ich kann es kaum glauben, dass Ihr heute, während wir bei dieser jämmerlichen Kälte nach verlorenem Krieg in diesem verdammten Schlitten sitzen, an friedlichen Zeiten plant.“
„Eine Schlacht, mein Lieber. Eine große Schlacht – zugegeben. Doch den Krieg gebe ich so wenig verloren wie den Frieden. Nur der Ängstliche hat Furcht vor der Zukunft, Caulaincourt! Am Ende siegt immer der Geist über den Säbel.“
„Das fürchte ich auch, Sire!“
Blitzschnell meinte Napoleon zu begreifen, worauf Caulaincourt anspielte. Das war zu viel! „Was will Er damit sagen?“, zischte er.
„Lasst mich warnen vor dem wachsenden Hass gegen den Säbel Eurer Majestät, den der deutsche Geist beginnt, zu seiner Nationalsache zu machen.“
„Ja, ja. Ich habe gehört von diesem Kerl aus dem sächsischen Dorf Rammenau mit seinen ‚Reden an die deutsche Nation‘. Wie hieß er doch gleich?“
„Fichte, Sire, Johann Gottlieb. Aber er ist es nicht allein. Ihr selbst erwähntet den Adel und nanntet Namen wie den von Carlowitz. Bei allen ist das nationale Gefühl im Erwachen, die Sehnsucht nach nationaler Einheit wächst bei ihnen ständig!“
„Da ist keine Gefahr, Caulaincourt. Gerade wenn Er Fichte und Carlowitz nennt, wird deutlich, wie uneins die Deutschen in ihrem Denken sind. Sollten meine Pläne von einem großen und geeinigten Europa indes scheitern, wird sich Deutschland eines Morgens auf dem Niveau des europäischen Verfalls befinden, bevor es jemals auf dem Niveau der europäischen Emanzipation, für das wir Franzosen das schönste Exempel sind, gestanden hat.“
„Dass Ihr den Dank der Völker Europas erheischt, ist mehr als recht und billig, Majestät. Doch wisst Ihr nicht, dass einige unserer Beamten in Deutschland unfähig sind und ihren beschränkten Geist durch widerwärtigste politische Inquisition auszugleichen suchen? Man hat, fürchte ich, Eurer Majestät verheimlicht, dass sich das Volk der Deutschen, namentlich seine klügsten Köpfe, von uns in ihrem nationalen Denken, in ihrer Selbstachtung verletzt sehen. Jede alte Gewohnheit, und sei sie noch so nützlich, wird unterdrückt!“
„Er ist ein Schelm, Caulaincourt! Hat Er nicht selbst noch gestern Nacht räsoniert und die sächsischen Postmeister wegen ihrer Art, die Pferde zu füttern, gescholten?“
„Majestät!“ – Caulaincourt war ungehalten – „es ist mir ernst!“
Napoleon lehnte sich zurück und ließ die Hand in der Knopfleiste seines Mantels verschwinden. Caulaincourt verstand. Die bisher gute Stimmung des Kaisers drohte umzuschlagen. Dennoch fasste er sich ein Herz und fuhr fort: „Ihr kennt, zum Exempel, Davout, Sire.“
„Will Er Marschall Davout, einen meiner Fähigsten, etwa einen unfähigen Beamten nennen, mein Lieber? Und welcher Art soll das Exempel sein?“ fiel ihm Napoleon, wieder etwas versöhnlich, ins Wort.
„Davout ist Oberbefehlshaber der in Norddeutschland stehenden Truppen und Gouverneur von Hamburg. Seine Armee hat Befehl, jede Regung der Deutschen zu beobachten, wie es nur Polizeitruppen geziemt.“
„Ist mir bekannt.“
„Was Eurer Majestät aber verheimlicht wurde, ist, dass sein Militärregiment das Volk fast mehr erbittert als die alte fürstliche Macht. Es darbt, seit der Handel in Hamburgs Häfen erlahmte.“
„Verdammt, Caulaincourt“, brauste Napoleon auf. „Die Handelssperre gegen England ist ein Krieg, den ich ohne Bataillone führe. Er bringt unserer, der deutschen und überhaupt aller Wirtschaft des Kontinents großen Aufschwung und Gewinn. Davout hat von mir strengsten Befehl, nicht eine Maus in den Hafen zu lassen, die englisch spricht. Keine Baumwolle, kein Garn, keinen Ballen Stoff, keinen Kaffee, keinen Zucker, nicht ein einziges Gramm indischer Gewürze – absolut nichts! Möge das Volk einer einzelnen Stadt auch jammern! Und meinetwegen deren Pfeffersäcke dazu, die ihren Gürtel enger schnallen müssen!“
Caulaincourt, der seinen Kaiser achtete und liebte, wollte gerade jetzt nicht schweigen. So erwiderte er dem Aufgebrachten: „Wohl lässt sich Davout nicht zu gemeinen Schuftereien, gar persönlicher Bereicherung hinreißen, doch gilt er vielen als kalt, bissig und kleinlich.“
„Ob kalt, bissig oder kleinlich – wenn Davout meinen Befehlen folgt, ist mir die Art gleichgültig, in der er es tut. Mein Gott, Caulaincourt! Hat Er noch immer nicht begriffen, was mich aus dem Bett meiner Frau hinaus ins Feldlager zwang? Gleich nach Jena und Auerstedt, schon am 21. November 1806, erließ ich mein Berliner Dekret über die Kontinentalsperre gegen England. Würden sich alle daran gehalten haben, wäre ich gern ins Bett zurückgekrochen. Aber ich musste hinaus, um es durchzusetzen. Ich dulde es nicht, wenn irgendjemand meint, mit meinen Dekreten seine Wand tapezieren zu dürfen! Schon gar nicht die eines Zarenpalastes!“
„Ich erinnere mich, Sire. Fast wörtlich weiß ich noch den ersten und zweiten Paragraphen herzusagen: ‚Jeder Handel und jegliche Beziehung mit den Britischen Inseln sind verboten.‘“
„Genau, Caulaincourt. Und warum bestimmte ich so? Weil unsere Wirtschaft angesichts der billigen Waren der Engländer daniederlag. England musste in die Knie gezwungen werden! Man musste ihm seinen Markt versperren. Also scheltet Davout nicht, wenn ich bitten darf! Davout achtet in Hamburg und den anderen Städten der Hanse auf mein Dekret. Schilt Er Davout, muss Er auch mich schelten! Denn mein ganzer Kampf in Europa, schließlich der gegen Russland, gilt nichts anderem als der Durchsetzung meiner Weisung und damit der Wohlfahrt Europas! Sind die Grundlagen unserer Verwaltung nicht überhaupt groß, erhaben, freiheitlich? Angepasst an die Ideen des Jahrhunderts und auf die wirklichen Bedürfnisse des Volkes eingestellt? Und also das Gesetz der neuen Zeit?“
„Wohl wahr“, suchte Caulaincourt den Kaiser zu besänftigen, während er sich die in die Stirn gerutschte Mütze geraderückte. „Es ist nicht zu leugnen, dass die Ideen des Jahrhunderts, die Euer Majestät beseelen und die Ihr von Frankreich nach Europa hinaustragt, erhaben sind.“
„Doch Ideen allein sind nicht einmal ein Rauchfähnlein im Wind, Caulaincourt. Man muss sie zum Gesetz machen. Das habe ich getan! Was heißt Freiheit? In meinem Gesetz steht es: Alle Menschen sind Bürger, jeder gleich vor dem Gesetz. Das Gewissen ist frei. Keiner soll denken müssen, was ein oberer Herr von ihm erheischt. Glaubt der Mensch an Gott, ist es gut. Glaubt er nicht, soll ihn die Inquisition nicht dafür strafen dürfen. Doch darf die Freiheit nicht grenzenlos sein. Man muss sie mit dem Gesetz einhegen und streng darauf achten, dass dieses befolgt wird. Der Wilde braucht wie der Zivilisierte einen Herrn und Meister, einen Zauberer, der seine Fantasie in Schach hält, ihn einer strengen Zucht unterwirft, an die Kette legt, verhindert, zur Unzeit zu beißen, ihn durchprügelt und auf die Jagd führt: gehorchen ist seine Bestimmung. Er verdient nichts Besseres! Was heißt Gleichheit? Ich sage es: Niemand darf zum Exempel das Privileg haben, von der Steuer frei zu sein. Und sei er von noch so hohem Geblüt, von uraltem Adel. Jeder soll seinem Stande und Vermögen nach an allen Lasten und Pflichten, die der Staat ihm auferlegt, gerecht beteiligt sein. Und diese auferlegte Last, Caulaincourt, darf nicht niederdrückend sein. Der Einzelne muss sicher gehen, dass ihm auch morgen noch die Luft zum Atmen bleibt. Der Staat zieht aus der Last, die er seinen Bürgern durch die Steuer auferlegt, die Kraft für die Brüderlichkeit. Soll heißen, die Kraft der allgemeinen Fürsorge, Bildung und Hygiene für das Volk. Und diese Pflichten dem Volke gegenüber zu erfüllen, darf der Staat für sich selbst nur sittsam wenig Geld in Anspruch nehmen. Gerade so viel, wie zu seiner Funktion unabdingbar.“
„Es sind das alles gute Regeln, die Majestät zu einem Code civil geschmolzen haben. Das Gesetzbuch wird Euren Ruhm auf ewig in die Zeit tragen. Vielleicht mehr als die Zahl der siegreichen Schlachten, die Eure Majestät geschlagen.“
Napoleon lächelte: „Mag sein, Er hat recht, Caulaincourt. Bis auf die Preußen und Österreicher handeln die Europäer nach dem Geiste meines bürgerlichen Gesetzes. Sogar die Türken!“
„Doch meint Ihr nicht, Sire, das Beispiel hätte Schule für ganz Europa machen können, auch ohne Krieg? Stattdessen ist viel Blut geflossen – vom Rhein bis an die Beresina.“
„Ja hat Er denn ganz vergessen, Caulaincourt, dass sich die alten Mächte Europas gegen uns, unsere Revolution verschworen? Dass sie Koalitionen gegen Frankreich bildeten und drei Kriege führten, dabei schon kurz vor Paris standen, um unserer Revolution ein Ende zu bereiten?“
„Natürlich nicht, Sire.“
„Na also. Dann schwätzt nicht so dummes Zeug, Caulaincourt. Wenn ich die Revolution in Reiterstiefeln bin, wie mancher geneigt ist, mich zu sehen – allen voran der große Philosoph Hegel –, wurden mir Letztere aufgezwungen. Oder meint Er vielleicht, ich würde aus reinem Pläsier den weichen Pfuhl an der Seite eines Weibes gegen das Feldbett, den Palast gegen ein zugiges Biwak getauscht haben? Doch jetzt, da wir auf dieser elenden Reise sind, sage ich es Euch als einem meiner engsten Diener im Vertrauen, Caulaincourt: Ich wollte Europa zu einem Grand Empire machen. Unsere Freiheit, meinte ich, muss auch in den Weiten der russischen Steppe verteidigt werden. Nun aber, nachdem Alexander meinen Friedensbedingungen die Stirn bot und mir den alten Kutusow entgegenwarf, ist mir hin und wieder danach, den Becher mit Schierling zu trinken. Ich werde immer sagen, es sei der sibirische Winter gewesen, der meine Armee vernichtete. Die Wahrheit aber ist: Kutusow, der vor lauter Fett und Alter kaum noch auf dem Pferde zu sitzen vermag, schlug mich. Wenn auch durch List. Aber er schlug mich! Gegen seine Taktik der verbrannten Erde war ich machtlos. Zudem führte er Truppen an, die das Wort vom ‚Großen vaterländischen Krieg‘ auf der Zunge und in ihrem Herzen trugen. Ein Volk mit vaterländischer Gesinnung, das seines Glückes eigener Schmied sein will, kann man schlagen und unterjochen. Besiegen kann man es nie! Und sei es auch nur ein kleines Bergvolk wie die Tiroler. Als Tirol ein Teil des Rheinbundlandes Bayern wurde, mischten sich die Bayern in die kirchlichen Angelegenheiten des Landes ein. Sie nahmen keine Rücksicht auf die Traditionen des konservativ denkenden und tiefgläubigen Gebirgsvolkes. Die Mitternachtsmesse zu Weihnachten wurde verboten, bäuerliche Feiertage abgeschafft, Glockenläuten zu Feierabend unter Strafe gestellt, Bittgänge und Prozessionen verboten. Was Wunder, dass sie sich erhoben? Doch dulden wollte ich den Aufstand nicht. Vor zwei Jahren ließ ich ihren Anführer Andreas Hofer erschießen. Was war die Folge? Er wurde zum Helden in ganz Europa. In Spanien und vielen anderen Ländern begann sich der Widerstand gegen mich zu regen. Mit dem spanischen Volksaufstand wurde mir sogar die Macht auf der iberischen Halbinsel genommen! Nur mit größter Härte gelang es mir, sie zurückzuerobern.
Man kann ein Volk, das fest in seinen Traditionen steht, nicht mit Gewalt besiegen. Und sei es noch so gut gemeint, was man ihm bringen will. Das ist meine bittere Erkenntnis, Caulaincourt! Zudem kommt eine so gewaltige militärische Niederlage, wie ich sie noch nie erlebt habe. Sie gab mir Anlass, mein politisches Testament zu diktieren.“ Napoleon zog das Dokument aus seinem Revers und las:
„Man zählt in Europa mehr als dreißig Millionen Franzosen, fünfzehn Millionen Spanier, fünfzehn Millionen Italiener, dreißig Millionen Deutsche. Ich hätte gern aus jedem dieser Völker ein ganzes gemacht und sogar einen nationalen Körper. Es wäre schön gewesen, mit einem solchen Nationengefolge in die Nachwelt zu schreiten und in den Segen der Jahrhunderte. Ich hielt mich eines solchen Ruhmes für würdig.
Wie das nun auch sein mag, dieser Zusammenschluss wird früher oder später durch die Gewalt der Umstände kommen: der Anstoß ist gegeben, und ich glaube nicht, dass nach meinem Sturz und nach dem Verschwinden meines Systems in Europa ein anderes großes Gleichgewicht möglich ist als die Vereinigung und die Konföderation der großen Völker.“
„Halten zu Gnaden, Majestät! Aber ist es für ein Testament nicht zu früh? Jedenfalls zeugt es von Eurer Größe, wenn Ihr ein Scheitern Eures Kampfes nicht ausschließt.“
„Ich bin Soldat, Caulaincourt!“
„Ihr seid weit mehr, Majestät! Es wird die Aufgabe der Geschichte sein, Euch nicht nur als genialen Feldherrn in Erinnerung zu behalten, sondern als großen Europäer!“
„Noch gebe ich meinen Kampf nicht auf, Caulaincourt! Es gibt, das meine ich fest, keinen anderen Weg, als ein starkes système continental zu schaffen. Gelingt dies nicht, werden uns die Türken überrennen. Ihr wisst, sie standen einst schon bis vor Wien! Und gelingt es nicht, den billigen englischen Waren die Einfuhr auf den Kontinent sicher zu verwehren, wird es einen großen Zusammenbruch geben. Ihr wisst, Caulaincourt, wie kräftig sich die Wirtschaft entwickelte, seit ich die Sperre der Wareneinfuhr aus England über den ganzen Kontinent verhängte. Namentlich in Sachsen, wo wir gerade sind.“
Napoleon hatte sich die Felldecke bis ans Kinn gezogen und schwieg. Bald fiel er in einen unruhigen Schlaf. Caulaincourt meinte den Traum, den sein Kaiser hinter zuckenden Lidern träumte, deuten zu können. Doch er ahnte, dass die alten Mächte ihn niemals zum Friedensfürsten Europas werden lassen würden.
Es begann bereits dunkel zu werden. „Wie dem Tag die Dunkelheit folgt, folgt dieser wieder ein heller Tag“, dachte er.
In der Abenddämmerung tauchten die Tore Leipzigs auf.
DER NÄCHSTE TAG IN DRESDEN – 14. DEZEMBER 1812
Erschöpft von der anstrengenden Reise und er Schelte, die er durch Caulaincourt erfuhr, lenkte der Postmeister seinen Schlitten der Heimat zu. Während er die Pferde mit lockerem Zügel in leichtem Trabe am Ufer der Elbe entlang gehen ließ, stopfte er sich eine Pfeife und zündete sie an. So kam er etwas zur Ruhe und versuchte, die erschöpften Tiere durch freundliches Schnalzen mit der Zunge zu wenigstens etwas schnellerem Gang zu bewegen. Schließlich war es noch weit bis zum „Alten Fuchs“, der Poststation auf halbem Wege nach Bautzen. Bis dahin, hatte er sich vorgenommen, wollte er in dieser Nacht noch kommen. Gleichzeitig gingen ihm die Ereignisse der letzten Stunden durch den Kopf.
Wer, zum Teufel, könnten seine heimlichen Passagiere wohl gewesen sein? Hatte er sie nicht zum Hause des französischen Gesandten bringen sollen? Und war es nicht die königliche Sänfte, die während der Zeit, da er die Pferde fütterte und in der Küche des Palais einen Becher nahm, durch das spärlich beleuchtete Tor des Loß’schen Hauses getragen wurde? „Wen“, dachte er, „wen würde der König höchst selbst in so später Nacht wohl besuchen? Noch dazu im Hause des französischen Gesandten?“ Vor Schreck hörte er auf zu summen, die Pfeife fiel ihm aus dem Mund. „Napoleon!“
Er war sich sicher: Es konnte nur Napoleon gewesen sein, der in Begleitung des ihm wohl bekannten Großstallmeisters Caulaincourt sein Passagier gewesen war. Jetzt brauchte er einen guten Branntwein. Vielleicht auch zwei!
Gerade hatte er die Höhe der Saloppe erreicht, die zu dieser Zeit nicht mehr als eine bretterne Bude war. Vor dem alten Weinhaus brannte noch eine Laterne. Der Postmeister beschloss, seine Reise zu unterbrechen und auf ein Glas einzukehren. „Brrrr!“ befahl er den Gäulen, die nur allzu gern gehorchten. Der Postmeister stieg, ganz steif vor Frost und Müdigkeit, unbeholfen vom Bock. Den Pferden hing er die Heusäcke vor, bevor er auf die Tür zu stakte, die zu dieser nächtlichen Stunde freilich verschlossen war. Nach lautem Klopfen öffnete sich die kleine Fensterlade neben der Tür. Im spärlichen Licht der Laterne am Portal erkannte der Postmeister das mürrische Gesicht des Wirtes. „Was willst du mitten in der Nacht?“ kam es von drinnen, „längst ist die Polizeistunde vorüber!“
„Ich habe Neuigkeiten“, erwiderte der Postmeister. „Gewähre mir Eintritt!“ Er wusste, dass der Wirt der Bretternen Saloppe stets auf Neuigkeiten aus war. Sein Weinhaus war allabendlich bis zum letzten Platz gefüllt. Nicht nur der willfährigen jungen Mägde wegen zog es niedere, aber auch wohlhabende Bürger in die Schänke. Wer sich hier niederließ, konnte stets von den neuesten Ereignissen erfahren, die die Welt in diesen Tagen bewegten. Der eine wusste dies, der andere das zu berichten. So öffnete der Wirt dem Postmeister geschwind und geleitete ihn an den Eichentisch, der in der Nähe des Ofens stand. „Erzähle!“ forderte er seinen Gast auf, während er ihm einen Krug und einen Becher aufstellte. Obwohl sich niemand außer ihm und dem Wirt in der Schänke befand, blickte sich der Postmeister prüfend im Raum um, bevor er zu sprechen begann.
„Napoleon ist in Dresden“, fing er an.
„Unmöglich!“, hielt der Wirt ungläubig entgegen.
„Ich weiß es genau. Er war mein Gast in dieser Nacht. Das ist sicher. Er hat beim französischen Gesandten, dem Baron de Serra, logiert.“
„Du musst dich irren!“
„Ach, täte ich es nur.“ Der alte Postmeister, erschrocken über sein Plappermaul, nahm einen kräftigen Schluck Wein. Doch nun konnte er nicht zurück. Der Wirt, bereits in Nachtmütze, war hellwach. Mit aufgerissenen Augen lehnte er sich über den Tisch auf den Postmeister zu und fragte noch einmal, fast flüsternd: „Und du kannst dich nicht irren?“
„Nein! Mit ihm reiste Caulaincourt. Außerdem traf der König ein, kurz nachdem wir de Serras Quartier erreicht hatten.“
„Dann stimmt es. Das verheißt nichts Gutes!“ Der Wirt schlurfte zur Theke, um den Krug neu zu füllen. Obendrein schenkte er für sich und seinen Gast einen kräftigen Becher Branntwein ein. Am Balken neben der Theke hing noch die Bekanntmachung des Rates zu Dresden, die er bisher noch nicht entfernt hatte. Er stellte die mit einem Korken verschlossene Kruke voller Branntwein vor den Postmeister hin und schlurfte zurück zur Theke. Leise murmelnd begann er zu lesen:
„Da auf allerhöchsten Befehl Sr. Königlichen Majestät,
unseres allergnädigsten Königs und Herrn,
zur Feier der bisherigen glorreichen Fortschritte
der Kaiserlich-Königlich-Französischen und alliierten Waffen
und insonderheit des am 7. dieses Monats
an der Moskwa in Borodino über das russische Heer
erfochtenen entscheidenden Sieges
auf bevorstehenden Sonntag, als den 27.d.M.,
die ganze hiesige Stadt erleuchtet werden soll;
so wird solches den hiesigen Bürgern und Einwohnern
zur Nachachtung andurch bekanntgemacht,
und haben die Hausbesitzer gewärtige Bekanntmachung
bei ihren Mietleuten herumzugeben.
Dresden, am 25. September 1812.“
Er riss den Zettel vom Balken, warf ihn in den Ofen und setzte sich zu dem Postmeister. Die beiden Männer leerten ihre Becher mit einem Zuge und sprachen die nächste Stunde kein Wort.
Wie ein Lauffeuer hatte sich die Nachricht in der Stadt verbreitet, Napoleon sei in der Nacht mit dem König zusammengetroffen und in aller Eile, im frühen Morgengrauen, weitergereist.
Hans Georg von Carlowitz traf die Nachricht wie ein Donnerschlag. Er ahnte, was die nächtliche Durchreise des Kaisers zu bedeuten hatte. Niemals, war er sich gewiss, hätte der verhasste Korse die alliierten Armeen verlassen, wäre da nicht eine grauenvolle Katastrophe geschehen. Schlagartig verließ ihn das beschwingte Hochgefühl, das er in diesen Tagen empfand.
Gerade vor drei Tagen hatte er seinen 40. Geburtstag gefeiert. Es war ein schönes, trotz aller Bescheidenheit fast rauschendes Fest. Seine geliebte Jeanette, von der er seiner Ämter wegen seit Jahren getrennt leben musste, war gekommen. Sie war seinen Gästen, unter denen ihm die Freunde des Körner’schen Kreises besonders vertraut und lieb waren, wie immer eine liebreizende und kluge Gastgeberin gewesen. Ebenso sicher wie auf dem gemeinsamen Gut empfing sie die Gäste hier in der bescheidenen Bürgerwohnung ihres Mannes, gab dem Personal kurze und präzise Anweisungen, um sich sogleich wieder den Gästen zu widmen. Kurz nachdem er seine Frau heute Morgen verabschiedet und guten Weg nach ihrem gemeinsamen Gut Oberschöna gewünscht hatte, erhielt er die Nachricht von Napoleons Durchreise.
Carlowitz war tief bestürzt. Nach Stunden der Unruhe trat er ans Fenster und öffnete es weit. Tief atmete er die kalte Winterluft ein. Unten auf der Straße waren an diesem Nachmittag viel mehr Menschen versammelt als zu dieser Stunde gewöhnlich. In größeren und kleineren Gruppen debattierten sie erhitzt, bald schrien sie wild durcheinander. Ein kräftiger Mann sprang auf einen Fuhrwagen und gebot der Menge mit fuchtelnden Armen Ruhe. „Warum“, rief er, „schleicht Napoleon in der Nacht wie ein Dieb durch die Stadt? Warum durften wir ihm unser ‚Vive l’empereur!‘ nicht zurufen? Warum keine Feuerwerke und Böllerschüsse zu Ehren des Kaisers? Ich sage euch, Bürger, der Krieg ist verloren!“ Nur einige Wortfetzen konnte Carlowitz bei dem Tumult, der sogleich wieder entstand, aufschnappen. Ein Marktweib, noch jung an Jahren, fiel ihm besonders auf. Es war hochgewachsen, keine Schönheit im eigentlichen Sinne. Dazu standen ihre strahlenden Augen eine Spur zu eng beieinander. Ihr Mund war eine Nuance zu klein, um die Sinnlichkeit auszustrahlen, die Männer so anziehend finden. Ihr straff um den Kopf gebundenes rötlich blondes Haar gab eine hohe Stirn frei, um dann in wild kräuselnden Locken weit über die Schultern zu fallen. Um sich trug das Mädchen ein dickes wollenes Tuch, in dem es an seiner Brust ein Kind vor der Kälte verbarg. Ein Junge, er mochte etwa vier Jahre alt sein, war in ihre Rockschöße gekrochen, so dass sie sich straff um ihre Schenkel spannten. Dem Kleinen mit seinem kohlrabenschwarzen Haar blitzten ebenso schwarze Augen aus dem vor Kälte blassen und etwas spitzen Gesicht. „Was soll aus mir und meinen Kindern werden, wenn Max nicht mehr nach Hause kommt?“, rief sie dem Mann auf dem Wagen zu. „Wovon soll ich die Schulden bezahlen und noch dazu meine Kinder ernähren?“
„Das arme Weib“, dachte Carlowitz. „Nicht genug, dass ihr Mann wohl nicht aus Russland zurückkehren wird. Zudem hat sie, wie es scheint, noch an dessen Uniform abzuzahlen.“ Im Februar, so konnte er sich erinnern, waren auch die jüngeren Bürger zum Feldzug gegen Russland ausgehoben worden. Sie erhielten Befehl, sich binnen zehn Tagen auf eigene Kosten zu uniformieren. Wer dies nicht konnte, dem sollte eine Uniform angeschafft werden, die monatlich sukzessive abzuzahlen war. Er trat zurück und schloss das Fenster. Unruhig lief er im Raum umher. Carlowitz wusste, dass er die junge Frau nicht kennen konnte. Und doch glaubte er sie zu kennen. Sah sie in ihrer hohen und stolzen Gestalt nicht aus, wie die junge Magd Marie Louise auf dem Majorat Großhartmannsdorf, deren Haare ebenso wild und unbändig wie die des Mädchens da unten gewesen waren? Noch einmal trat er ans Fenster, um sich seines Irrtums zu vergewissern. Doch er konnte die Frau mit ihren Kindern, die dem Bild der Magd aus seinen Jugendjahren bis aufs Haar glich, in der Menge nicht mehr entdecken. Carlowitz trat an das Pult neben dem Fenster und schrieb an seinen Bruder Carl Adolf, um Näheres über die Ereignisse in Russland zu erfahren.
ERSTES BUCH
MARIE
Marie hatte sich auf den weiten Weg nach Dresden gemacht, weil sie sich auf dem weihnachtlichen Striezelmarkt einen wenigstens bescheidenen Verdienst sichern wollte. Dass ihr das gelänge, war lebensnotwendig. Denn es war so ziemlich die einzige Gelegenheit im Jahr, ein wenig Geld zu verdienen. Darauf war sie dringend angewiesen, um sich und den Kindern Kleider oder sogar auch ein Paar neue Schuhe kaufen zu können. Außerdem musste die Uniform, die sie im Januar für ihren Max gekauft hatte, bevor er nach Russland zog, noch abbezahlt werden. Zum Glück hatte sie für sich und die Kinder Unterschlupf in dem Haus des Seilermeisters Geißler, in dem die Mutter wohnte, gefunden. So hatte sie wenigstens freies Logis.
Das Haus lag unmittelbar am Fuße des Burgberges in Liebstadt. Den steilen Felsen krönte Schloss Kuckuckstein, das seine mittelalterliche Herkunft allen Ankommenden stolz präsentierte. Ganz gleich, ob sie aus dem Tale des Molchgrundbaches, des Seidewitz Tales oder anderer Täler, die sich hier vereinigen, der Burg zuwanderten. Ganz in der Nähe führte ein alter Handelsweg vorbei, der die Residenz mit Böhmen verband. So konnte Marie hoffen, dass sie den weiten Marsch nach Dresden nicht vollständig zu Fuß bewältigen musste. Die beiden Kinder, glaubte sie, würden vielleicht einen der Fuhrmänner erbarmen.
Marie plante, wieder bei dem freundlichen Bäcker Lorenz Werl unterzukommen, der ihr im vorigen Jahr Arbeit gab. An seinem Stand war es schön warm. Der findige Bäcker hatte ihn mit einem kleinen Ofen versehen, um frische Leckereien zu backen und Mandeln zu rösten. Zudem hatte er ein weiches Herz und gab ihr ein wenig Geld für die Apfelstrudel, die sie mitgebracht hatte. Frisch ausgebacken und warm verkauft, machte er sogar einen guten Gewinn damit. Auf eigene Rechnung, hatte der Bäcker zugestanden, durfte Marie an seinem Stand ihre Pflaumentoffel verkaufen. Die lustigen Männlein, die wie kleine Schornsteinfeger aussahen, waren schon im vorigen Jahr außer jeder Konkurrenz. Nicht nur, dass ihr die Backpflaumen vom Baum im Garten der Mutter besonders gut gelungen waren. Nein, sie waren denen an den anderen Ständen auf dem Markt weit überlegen. Denn Marie hatte sich überlegt, dass die Köpfe ihrer Toffel aus Marzipan gemacht werden könnten, den der Bäcker fertigt. Der war sogleich begeistert von ihrer neuen Idee. Zudem nahm er die zwar nicht auffallend hübsche, doch auf eigentümliche Art anziehende junge Frau noch aus einem anderen Grund gern an seinen Stand. Denn seit sie bei ihm war, kamen die jungen Herren der besseren Gesellschaft oft sogar mehrmals vorbei, um Striezel, etwas Gebäck oder auch Pflaumentoffel zu kaufen.
Trotz all dieser guten Verbindungen aus dem vorigen Jahr war sich Marie nicht sicher, ob der Bäcker zu diesem Weihnachten nicht vielleicht doch einer anderen, die hübscher als sie selbst war, den Vorzug geben würde. Daher hatte sie sich aufgemacht, um ihren Platz rechtzeitig zu sichern. Auf das weiche Herz des Mannes vertrauend, hatte sie den kleinen Anton mit auf den weiten Weg genommen. Mit ihm, war sie gewiss, würde sie zwei Tagesmärsche planen müssen. Bei einer Freundin in Röhrsdorf, deren Mann ebenfalls im Felde war, würde sie auf halbem Wege Quartier für eine Nacht nehmen können. Neben Anton hatte sie noch einen zweiten Trumpf, den sie dem Bäcker gegenüber ausspielen wollte: Katharina. Sie war kaum vier Wochen alt und musste daher ohnehin mit auf den weiten Marsch. Es vergingen kaum zwei Stunden Ruhe, bis sich das Kind ungestüm bemerkbar machte, um der warmen Brust der Mutter habhaft zu werden.
Über den Tumult in den Straßen der Stadt war Marie erschrocken. Bevor sie die Wirtschaft des Bäckers in der Nähe der Hofkirche erreichte, bemerkte sie einen Mann, der auf einen Fuhrwagen gesprungen war. Um den völlig erschöpften Kleinen etwas zu wärmen, verbarg sie ihn im Rock zwischen ihren Schenkeln. Fast wäre sie bei dem, was sie von dem Manne auf dem Fuhrwagen hörte, zusammengebrochen. Müde, vor Kälte und aus Verzweiflung zitternd, erreichte sie Bäcker Werls Laden. Da es schon später Nachmittag war, hatte er bereits einige Stunden guten Schlafes hinter sich. Immer, wenn er früh am Morgen die Regale im Laden mit frischem Brot und Kuchen gefüllt hatte, legte er sich in der Nähe des Backofens aufs Ohr.
Lorenz Werl war ein zufriedener Mann. Vor Jahren, als er auf Wanderschaft war, kam er nach Dresden. Schon von Weitem, er hatte die Grenzen der Stadt längst noch nicht erreicht, fielen ihm die beiden gewaltigen Kirchen ins Auge. Die eine, bemerkte er beim Näherkommen, entsprach ganz seinem Geschmack. Noch nie hatte er ein so prächtiges Bauwerk des italienischen Barock nördlich der Alpen gesehen. Außer in seiner Heimatstadt München natürlich. Nur waren die Werke dort kompakter, nicht so grazil wie diese Hofkirche. Hatte er sich in seinem Handwerk schon immer besonders für die Zuckerbäckerei begeistert – hier stand leicht und luftig in Stein, was selbst dem größten Meister der Zuckerbäckerkunst nicht gelingen mochte. Hier musste er bleiben! Zudem war Werl ein praktisch denkender Mann. Nie, war ihm bewusst, hätte er es in München so schnell zum Meister bringen können wie hier in Dresden. Also hatte er sich das Haus Nr. 13 im Italienischen Dörfchen gekauft, um heimisch zu werden. Es lag gleich neben der bewunderten Hofkirche, unweit der Elbbrücke und dem Zwingergraben zu. In dem Dörfchen, das seinen Namen wegen der einstmals dort wohnenden italienischen Erbauer der Kirche trug, hatten sich viele Handwerker, aber auch Hofbedienstete und Künstler des Theaters angesiedelt. So konnte der Bäcker, der am Abend auch eine kleine Wirtschaft mit bayerischem Bierausschank betrieb, auf ein gutes Auskommen hoffen. Von den sechzehn öffentlichen Brauhäusern, die es in der Stadt gab, war ihm natürlich das Bayerische Brauhaus in der Friedrichstadt das liebste. Von da bezog er einen besonders edlen Gerstensaft, der den Dresdnern wegen seines guten Hopfens besonders gut schmeckte.
Plötzlich hörte er, wie ihn sein Weib von vorn aus dem Geschäft aufgeregt zu sich rief. „Komm schnell, Lorenz, Marie ist gekommen!“ Noch ein wenig schlaftrunken richtete er sich auf. „Wo, zum Teufel, hat diese verfluchte Katze meine Filzpantoffel wieder hingeschleppt?“ grollte er, während er aufstand. Er stopfte das staubige Bäckerhemd, so gut es ihm gelang, in die Hosen und zog die Hosenträger über den dicken Bauch. Trotz ihres Kummers musste Marie angesichts des Bäckers lachen, der schlaftrunken und in Socken auf sie zutrat. Er liebte diese Socken besonders, denn sie waren aus Hundewolle gestrickt. Marie hatte sie ihm im vorigen Jahr als Dank für die Aufnahme an seinem Weihnachtsstand geschenkt.
„Gib dem Kleinen ein Paar Kuchenränder!“ wies der Bäcker seine Frau in urbayerischem Dialekt an, „aber sei nicht so geizig und schneide so, dass er einen Streifen von den Pflaumen und Äpfeln erwischt.“
Die Bäckersfrau warf ihm einen bösen Blick zu. Als sei sie je geizig gewesen. Noch dazu, wenn es um einen so reizenden Knirps wie diesen Anton ging.
Lorenz nahm die junge Frau an ihrer schlanken Taille und führte sie in die warme Backstube. „Was verbirgst du da unter dem Tuch?“ wollte er wissen. Marie wickelte ihr Kind aus und legte es auf die warme Bank am Ofen.
„Mon dieu! So einen kleinen Wurm schleppst du von Liebstadt bis hierher?“
„Was sollte ich machen, sehen Sie her!“ Marie gab der Kleinen die Brust, legte das zufrieden glucksende Kind nach einigen Minuten auf ihre Schulter und klopfte ihm zärtlich auf den Rücken. Danach legte sie es wieder auf die warme Ofenbank und befreite es von allen Windeln. Dem Bäcker schlug ein so kräftiger Geruch entgegen, wie er ihn seit Jahren nicht mehr in der Nase hatte. „Ein Mädchen!“ entfuhr es ihm, „wie niedlich es ist!“ Marie sah sich kurz vorm Ziele. Bestimmt konnte sie den Bäcker dafür gewinnen, ihr einen Platz an seinem Stand zu gewähren. Doch sie hatte sich zu früh gefreut.
„Ich hatte gehofft, du würdest auch in diesem Jahr an meiner Seite auf dem Markt stehen“, fing der Bäcker an. „Doch wie stellst du dir das vor mit Anton und obendrein der Kleinen?“
„Ich dachte“, änderte Marie blitzschnell ihren Plan, „statt meiner könne in diesem Jahr meine Mutter Marie Louise kommen?“ erwiderte sie, nicht ohne den Bäcker mit allem, was ihr an weiblichem Ausdruck zu Gebote stand, zu bezirzen.
„Ausgeschlossen! Du weißt, dass die jungen Herren nicht nur der Striezel und Pflaumentoffel wegen gut bei uns kauften. Was soll ich da mit einer alten Frau am Stand?“
„Aber sie ist gerade vierzig Jahre, Meister!“
„Dann ist sie alt genug, dass sie keiner mehr in Arbeit haben will“, brummte der Bäcker.
„Sie sollten sie neben mir sehen“, brach Marie sein Brummen ab. „Sie würden meinen, zwei Schwestern würden in Ihrer Stube stehen. Zudem ist sie äußerst charmant.“
„Besonders gefährlich“, brummte der Meister weiter. „Dann keift mein Weib vielleicht noch lauter. Du bist zu jung, um Eifersucht bei ihr zu wecken. Doch ein Weib in den besten Jahren? Obendrein eines, das dir ähnelt wie eine Schwester? Vielleicht ist sie ebenso schlank und hoch aufgewachsen? Hat sie gar das Haar so reizend üppig und wild wie du?“
Marie spürte, dass es jetzt auf alles ankam. Sie musste den Einwänden des Bäckers begegnen, ihm zugleich schmeichelnd um den Bart gehen. „Am besten“, dachte sie, „rede ich mit ihm wie mit einem Hochwohlgeborenen.“ Und sie begann: „Wollt Ihr, mein Herr, einem dummen Ding wie mir vielleicht erklären, was Er unter einer Alten in den besten Jahren versteht?“
Der Bäcker druckste herum und suchte nach einem Ausweg aus der Falle, die er sich selbst gestellt hatte: „Schließlich bin ich Geschäftsmann!“, wollte er ausweichen.
„Eben deshalb kann Euch meine Mutter ebenso nützlich sein wie ich. Denkt nur, wie gewandt ein Weib in den besten Jahren im Umgang mit verschiedensten Geschäften ist. Einem solchen Weibe – und meine Mutter steht dafür – wird es eine Lust sein, die jungen Gecken zum Kauf bei Euch zu bewegen.“
„Gecken?“ schniefte der Bäcker zornig wegen der schnippischen Bemerkung der jungen Frau.
„Verzeiht, Meister. Ich wollte Eurer Kundschaft nicht zu nahetreten. Aber was sind diese Müßiggänger, die genügend Geld haben, um nur zum Spaße mehr Kräpfeln, Striezel oder sonst etwas zu kaufen, als sie jemals essen können gegen Euch? Ihr seid ein Bürger, der mit seiner Hände Kraft täglich etwas Gutes schafft!“ Ungewollt hatte Marie ihr fein gewebtes Gespinst, mit dem sie den Bäcker einwickeln wollte, auch noch mit einem Reim gekrönt. Gespannt wartete sie die Wirkung ihrer Rede ab.
Der Meister wusste nicht aus noch ein. „So ein listiges Luder“, dachte er. „Wenn sie die Gewitztheit von ihrer Mutter hat und ich sie statt Marien anstelle, kann ich auf guten Gewinn sicher sein. Oder auch nicht. Marie hat ja recht damit, wenn sie die jungen Kerls ‚Gecken‘ nennt. Aber weiß ich, wie viele von denen einfach aus Spaß an einem netten Wort, vor allem aber wegen eines Zipfels Busen, den sie mit einem Blick erhaschen können, zum Kaufen kommen? Beides können sie auch von Mariens Mutter haben. Nun gut. Aber nein, nein, das ist es nicht. Wer von den jungen Kerls kauft schon zwei, ja sogar drei Mal am Tag nur wegen einem Auge voll eines Zipfels Busen? Und sei er noch so schön – vierzig Jahre alt darf er nicht sein. Nein, das ist es nicht. Geil sind diese Laffen auf Marie! Das ist es! Ich würde dem armen Ding schon gern helfen, aber Geschäft ist Geschäft!“
Welchen Einwand konnte er nur vorbringen, um die junge Frau abzuweisen? Plötzlich fuhr es ihm wie ein Blitz durch den Kopf: „Wie heißt denn die Kleine?“
„Katharina. Aber was hat das mit meinem Anliegen zu tun?“
„Sie ist ja blond wie du, hat ebenso störrische Locken, so jung sie auch ist. Und Anton, der kleine schwarze Teufel da draußen ist ihr Bruder?“