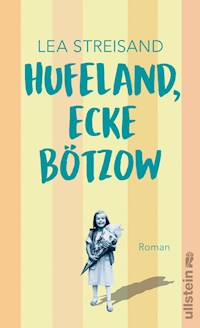15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Sie werden keine Kinder bekommen.« Lea Streisands mutiger Roman erzählt tabulos davon, wie es ist, ein Kind zu wollen, aber keines zu bekommen. Kathi und Effi sind seit Ewigkeiten beste Freundinnen. Beide wollen Kinder. Doch mit Mitte 30 geht der Wunsch nicht mehr so leicht in Erfüllung: Kathi erfährt, dass sie unfruchtbar ist. Also Adoption: In den kommenden zwei Jahren ziehen Kathi und ihr Mann sich vor den Familienbehörden bis auf die Unterhosen aus, füllen Papierberge aus und erdulden VHS-Kurse – und Effi wird tatsächlich schwanger. Sie kämpft in der Folge gegen übergriffige Ratschläge, die eigenen Übelkeitsattacken und die ständige Sorge um das Ungeborene. Und Kathi wartet immer noch auf den Anruf, der sie zur Mutter macht. Eine Freundschaft durch dick und dünn, vom Jugendamt bis in den Kreißsaal. Falls irgendwer noch dachte, Familie wäre privat: Dieser Roman zeigt das Gegenteil.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Hätt' ich ein Kind
Die Autorin
Lea Streisand, geboren 1979 in Berlin, studierte Neuere deutsche Literatur und Skandinavistik. Sie schreibt für die taz und hat eine wöchentliche Hörkolumne auf Radio Eins. "Hätt' ich ein Kind" ist der dritte Roman der Autorin, der bei Ullstein erscheint. Sie lebt mit Mann und Kind in ihrer Heimatstadt Berlin.
Das Buch
Kathi und Effi sind seit Ewigkeiten beste Freundinnen. Beide wollen Kinder. Doch mit Mitte 30 geht der Wunsch nicht mehr so leicht in Erfüllung: Kathi erfährt, dass sie unfruchtbar ist. Also Adoption: In den kommenden zwei Jahren ziehen Kathi und ihr Mann sich vor den Familienbehörden bis auf die Unterhosen aus, füllen Papierberge aus und erdulden VHS-Kurse – und Effi wird tatsächlich schwanger. Sie kämpft in der Folge gegen übergriffige Ratschläge, die eigenen Übelkeitsattacken und die ständige Sorge um das Ungeborene. Und Kathi wartet immer noch auf den Anruf, der sie zur Mutter macht.Eine Freundschaft durch dick und dünn, vom Jugendamt bis in den Kreißsaal. Falls irgendwer noch dachte, Familie wäre privat: Dieser Roman zeigt das Gegenteil.
Lea Streisand
Hätt' ich ein Kind
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© 2022 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Cornelia Niere, MünchenTitelabbildung: © Sergiy BykhunenkoE-Book Konvertierung powered by pepyrus.comISBN 978-3-8437-2734-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Danke
Literatur
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1
Widmung
Für F und I und T und H
Motto
Es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab …
1
»Sie werden keine Kinder bekommen.« Praxis für Fertilitätsmedizin. Großzügiges Behandlungszimmer, helles Holz, Kunstdrucke an den Wänden. Der Satz glitt durch die Luft wie ein geschliffenes Messer, direkt in mich hinein. Die Worte durchbohrten meine Ohren, drangen in meinen Kopf, mein Mund schmeckte Metall, mein Atem stockte, mein Magen krampfte sich zusammen – mein nutzloser Bauch, der nicht fähig war, ein Kind auszutragen.
Die Ärztin sah mich über die Breite ihres gigantischen Schreibtisches hinweg an. Sie war so alt wie ich. Mitte/Ende dreißig. Ihre Augen schwammen hinter runden Brillengläsern. Fang jetzt bloß nicht an zu heulen, dachte ich.
»Nicht mit den Methoden, die wir hier anwenden können«, fügte sie hinzu und erzählte von Eizellenspenden, die in Deutschland illegal seien.
David und ich schüttelten gleichzeitig den Kopf. Mit solchem Quatsch wollten wir gar nicht erst anfangen.
Ich weinte nur kurz.
Als wir die Kinderwunschpraxis verließen, fiel draußen der erste Schnee. Es war kurz vor Weihnachten.
»Dann Adoption«, sagte ich, als wir auf die Straße traten. Ich wollte das so nicht auf mir sitzen lassen. Ich wollte etwas tun, die Fäden in der Hand behalten. Heiligabend würde ich der kugelrunden Frau meines Cousins im flackernden Schein der Christbaumkerzen gegenübersitzen. Ich wollte eine Antwort auf die Frage haben, die das ganze Fest über wie ein Fallbeil über mir schweben würde. Wann es denn bei uns so weit wäre. David und ich seien doch schon so lange zusammen. Die Frau meines Cousins erwartete ihr drittes Kind. Wir nannten sie heimlich nur noch »die Maschine«.
»Können wir bitte erst mal nach Hause fahren!«, murmelte David auf der Straße im Schnee. Er sah müde aus.
Ich wurde wütend. »Deine Schuld ist es ja nicht«, schimpfte ich, wobei ich lauter wurde. »Deine Truppen sind gut aufgestellt.«
Das hatte der Urologe in Lichtenberg gesagt, bei dem David sein Sperma hatte testen lassen. Dreimal musste er hin, weil beim ersten Mal irgendwelche Geräte ausgefallen waren und beim zweiten Mal seine Spende verloren ging. Weg. Vom Erdboden verschluckt. Versickert. Gestohlen.
»Entweder war’s so schlecht, dass sie es für wissenschaftliche Studien im Labor behalten haben«, spekulierte meine Freundin Effi. »Oder von so herausragender Qualität, dass sie es direkt verkauft haben. Meistbietend. In die USA. Oder nach Prenzlauer Berg.«
David und ich wollten seit Jahren ein Kind. Also ich wollte ein Kind, und er wollte mich, deshalb wollte er mir meinen Wunsch erfüllen. Aber es klappte einfach nicht.
Ich wurde nicht schwanger.
»Probieren Sie es erst mal so«, hatte Frau Doktor Fuchs gesagt, meine Gynäkologin, eine Frau wie ein Kugelblitz, eins fünfzig, Hackenschuhe, Turmfrisur, undefinierbares Alter, die die Angewohnheit hatte, ihre Patientinnen abwechselnd zu duzen und zu siezen. Je nachdem, wie intim es gerade war. Meine Mutter ging zu ihr, meine Tante Regine, ich selbst, schon meine Großmutter war bei ihr in Behandlung gewesen.
»Dit wird schon«, hatte Frau Doktor Fuchs gesagt und meine Wade getätschelt, während sie mich zwischen meinen Knien hindurch ansah. »Soll ja ooch Spaß machen, dit Unternehmen hier.« Sie nickte in Richtung ihrer Arbeitsstelle und nahm ihr Besteck zur Hand. »Jetzt probierta erst mal ’n Jahr.« Sie beförderte den Abstrich in die Petrischale. »Und denn sehn wa weiter.«
Also probierten wir. In allen erdenklichen Positionen. Waschmaschine, Spülmaschine, Dielenboden. Mein Bauch blieb flach.
»Ihr müsst mal in Urlaub fahren«, empfahl meine Mutter.
Wir fuhren. Sommerurlaub, Winterurlaub, Wochenendurlaub. Nichts half.
»Andere Frauen gehen nur mal hintern Busch, um zu pinkeln, und kommen schwanger wieder raus«, beschwerte ich mich bei Effi. »Nur bei mir klappt das nicht.«
Ich ging wieder zu Frau Doktor Fuchs.
»So«, sagte sie und trocknete sich die Hände ab. »Als Allererstes, bevor wir hier irgendwat starten, schicken wir mal den Mann zum Urologen. Ick mache den Job jetzt vierzig Jahre. Was glauben Sie, wie viele Frauen ick hier schon sonst was für Verrenkungen hab machen sehen, um ein Kind in die Welt zu setzen? Und am Ende hat der Mann einfach zu viel gesoffen, und die Spermien waren alle blau. Soll er erst mal zeigen, was er kann. Und denn sehn wa hier weiter.«
Also ejakulierte David zu Hause in einen Plastikbecher, schraubte den Behälter zu, klemmte ihn sich vorsichtig in die Achselhöhle, damit es die Samenzellen schön warm hatten, und fuhr mit der U-Bahn nach Lichtenberg.
»Die Truppen sind gut aufgestellt«, beschied ihm der Urologe nach dem im dritten Anlauf endlich erfolgten Spermiogramm, »und ausreichend Munition ist auch vorhanden.«
David kam sich vor wie im Feldlazarett. »Der Arzt war sympathisch«, erzählte er mir später, »gar nicht feldwebelartig. Aber außer mir saßen da nur Anabolika-Boys im Wartezimmer. Denen kannst du nicht einfach sagen, ›Junge, du hast prima Sperma‹. Sonst denken die, du denkst, sie seien schwul. Dann lieber über Zeugungsfähigkeit reden wie über Ego-Shooter-Spiele, das ist unverfänglicher.«
Seitdem nannte ich ihn »Sperminator«. Aber insgeheim war uns beiden auch schon vorher klar gewesen, dass nicht sein Körper das Problem sein würde, sondern meiner.
»Vorzeitige Wechseljahre« hieß die Diagnose, mit der wir schließlich in die Kinderwunschpraxis gekommen waren. Vielleicht die Folge einer unentdeckten Geschlechtskrankheit. Genaueres wisse man nicht.
»Kann es was mit einer Essstörung in der Vergangenheit zu tun haben?«, hatte ich gefragt, und die nette Ärztin mit dem Fachgebiet Reproduktionsmedizin hatte mich angelächelt: »Möglich ist alles. Sie sollten sich da nicht die Schuld geben.«
Einen Monat lang hatte ich Hormone eingenommen. Doch meine müden Eierstöcke hatten nicht einmal gezuckt. Als hätte man Düngemittel auf verdorrte Pflanzen gekippt. Ich kam mir schmutzig vor. Ein Gefühl, das ich von früher kannte.
»Hätte ich nur besser auf mich aufgepasst«, jammerte ich, als wir später zu Hause ankamen. »Hätte ich gesünder gelebt, weniger Sex mit ekligen Typen gehabt …«
»Hätte, hätte, Fahrradkette«, erwiderte David und schloss die Wohnungstür auf. Wir wohnten seit drei Jahren zusammen. Für mich war gleich klar gewesen, dass er der Mann war, mit dem ich alt werden wollte. Er war der Erste, der mich wie einen Menschen behandelte. Ich war weder Prinzessin für ihn noch Fußabtreter, sondern eine Person, der er auf Augenhöhe begegnete. Er hatte Literaturwissenschaft studiert wie ich. Jetzt arbeitete er als Systemadministrator am Institut für Neuere und Neueste Geschichte. Wir sprachen dieselbe Sprache. Er hörte zu, er nahm mich ernst. »Vielleicht könntest du dann trotzdem nicht schwanger werden«, sagte er jetzt. »Du kannst nicht alles beeinflussen. Das solltest du doch wissen.«
»Ich will aber!«, rief ich und stampfte mit dem Fuß auf wie das Rumpelstilzchen, wütend auf die Welt, das Schicksal, die Medizin, die uns auch nicht hatte helfen können. Die letzte Hoffnung der Hoffnungslosen.
»So was darfst du nicht sagen«, sagte Effi, als ich ihr später am Telefon von meinem Scheitern berichtete. »Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Das klappt schon. Ich kenne jemanden …«
»Lass es!«, unterbrach ich sie. »Ich will’s nicht wissen. Ich kann keine Geschichten mehr hören über mirakulöse Schwangerschaften von Paaren, wo der Mann keine Hoden und die Frau keinen Unterleib hatte und die trotzdem eines schönen Tages gesunde Drillinge in die Welt setzten. Ohne jedes Zutun. Nachdem sie schon jede Hoffnung aufgegeben hatten. Einfach, indem sie sich entspannten. Ich will meine Hoffnung endlich begraben dürfen. Es ist zu anstrengend, sie am Leben zu halten, und eine Tortur für alle Beteiligten. Ich werde auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen. Das hat die Ärztin im Aquarium in aller Deutlichkeit gesagt. Jetzt versuche ich, mich damit abzufinden. Versuch du es bitte auch.«
Im Wartezimmer der Praxis hatte ein riesiges Aquarium gestanden. David und ich hatten es fasziniert begutachtet. Daneben eine Trinkwasserzapfsäule und – groß wie ein Raumschiff – eine gigantische Espressomaschine.
»Soll die Vermehrungsbehinderten vermutlich in Stimmung versetzen«, hatte ich gewitzelt, um die Stille zu übertönen.
Die Maschine sah unberührt aus. Vermutlich wurde sie eher betrachtet als benutzt. Das Aquarium war fest verschlossen.
»Damit niemand Espresso hineinkippt«, spottete David. »Als Optimierungsversuch. Fische auf Speed.«
Ich trat an die Scheibe und sah mich Auge in Auge mit einem blau schillernden Kiementier.
»Na, du Riesenspermium«, gurrte ich.
Dann wurden wir aufgerufen.
»Es tut mir leid, dass ich so deutlich werden muss«, sagte die Ärztin, »aber ich kann Ihnen nicht helfen. Es gibt auch nach der Hormontherapie keinerlei Aktivität in Ihren Eierstöcken. Es wäre verantwortungslos, mit der Behandlung fortzufahren.«
Als ich später noch einmal in die Praxis fuhr, um unsere Papiere abzuholen, bedankte ich mich bei der Ärztin für ihre Ehrlichkeit.
2
Warum wollen wir denn unbedingt Kinder?«
Einen Monat nach dem Scheitern des Unternehmens »Fortpflanzung« stand meine beste Freundin Effi auf einen Besen gestützt inmitten des Schlachtfeldes, das einst ihr Wohnzimmer gewesen war, und stellte mir die Gretchenfrage.
Es war der 6. Januar 2015, Effis 35. Geburtstag. Die Gäste waren fort. Benutztes Geschirr stapelte sich auf allen Oberflächen des Raumes. An einem der bodentiefen Fenster klebte eine Scheibe Salami. Draußen ging das Grau eines verregneten Tages in Anthrazit über. 16 Uhr. Sonnenuntergang.
»Eitelkeit?«, überlegte ich laut, während ich mit einem Müllsack in der Hand durch die Wohnung tänzelte, um die Trümmer der Party zu beseitigen. »Sehnsucht nach Unsterblichkeit? Langeweile?«
Effi stützte seufzend den Kopf auf die Hände. Die Besenborsten spreizten sich unter der Last wie die Beine eines erschöpften Tausendfüßlers. Meine Freundin war eine starke Frau. Sie aß, trank und rauchte gern, erzählte schlechte Witze und amüsierte sich nachher über meine Empörung. Sie schien so klar, so ehrlich, so klug und so absolut frei von Komplexen. Außer einem. Ihrem Alter.
»Früher haben wir um die Zeit noch nicht mal angefangen zu feiern«, jammerte meine Freundin. »Und jetzt ist schon alles vorbei.«
»Früher hast du um die Uhrzeit kotzend überm Klo gehangen«, erwiderte ich und pflückte die Salami von der Fensterscheibe.
»Da hätte die Party letzte Nacht stattgefunden, und hier würden die Schnapsleichen mit dem Gesicht im Aschenbecher liegen.«
Effi nickte versonnen und murmelte: »Wo sind eigentlich meine Zigaretten?«
Sie behauptete seit Jahren, mit dem Rauchen aufhören zu wollen, doch sobald sich die Gelegenheit bot, verflüchtigten sich die Vorsätze.
»Bestimmt auf einem Schrank«, meinte ich. »Außer Reichweite von Kindern.«
Effi schüttelte den Kopf und erklärte: »Ich muss die vor Micha verstecken.« Sie ließ sich auf die Couch fallen, hob ein Sofakissen an, schob eine Hand hinter die Polster und fügte hinzu: »Nur manchmal vergesse ich wo.«
Micha war Effis Verlobter. Nie hätte ich für möglich gehalten, dass ausgerechnet Effi sich einmal verloben würde. Noch dazu mit einem Versicherungsmakler, der Zigaretten in vorzeitig verstorbener Lebenszeit rechnete. Der Party heute war er ferngeblieben. Er wollte nicht zusehen, wie seine Wohnung in einen Schadensfall verwandelt wurde.
Effi war es recht. Sie hatte sowieso eine Mädchenparty machen wollen.
»Wie früher«, hatte sie erklärt. »Mit Kiffen und Saufen und Auf-den-Tischen-Tanzen.«
Was Effi nicht einkalkuliert hatte: Die meisten der früheren Mädchen waren unterdessen berufstätige Mütter, die statt Schnaps und Marihuana ihre Kinder mitbrachten.
Nun hob Effi den Blick zu einem gerahmten Foto, welches über dem Sofa an der Wand hing. Micha und sie auf Fahrradtour. Er mit Warnweste, Helm und Fahrradhandschuhen. Sie in Shorts und Flipflops. Effi erhob sich aus den Kissen, nahm das Bild von der Wand und drehte es um.
Mit einem zufriedenen Brummen zeigte sie mir drei selbst gedrehte Zigaretten, die fein säuberlich aufgereiht an der Rückseite des Bildes auf dem unteren Rahmen lagen.
»Genial«, murmelte ich anerkennend.
Effi grinste, griff sich eine Wolldecke vom Sofa und verzog sich auf den Balkon.
Die wilden Feten unserer Zwanziger gehörten längst der Vergangenheit an. Noch zehn Jahre zuvor hatten Effi und ich zwischen Anfang Dezember und Ende Januar kaum das Tageslicht gesehen, weil wir nachts lebten und tagsüber schliefen. Zu Hause oder in der Uni.
Ich studierte Germanistik damals, sie Medizin.
Heute war meine Freundin Kinderärztin auf der Neonatologie, der Neugeborenenstation eines Krankenhauses in der Provinz. Sie hatte das Kinderkriegen zum Beruf gemacht. »Wir hatten heute wieder eine Tüte Mehl auf Station«, erzählte sie mir manchmal. Mehltüten nannte sie Frühchen mit einem Körpergewicht unter tausend Gramm. Eine Handvoll Mensch. Sie trug so viel Verantwortung in ihrem Beruf, während ich auf einer befristeten, aus Drittmitteln finanzierten Stelle über meiner Promotion verzweifelte.
Mittlerweile schmissen wir keine Partys mehr, sondern gaben Empfänge, gesellschaftliche Interaktionen erwachsener Arbeitnehmer mit vergleichbaren Einkommen, die vornehmlich sonntagvormittags stattfanden, damit wir abends alle früh ins Bett kamen. Es wurde kaum Alkohol getrunken, stattdessen viel Kaffee. Und Muttermilch.
Effi hatte die ganze Feier über versucht, den Müttern Prosecco einzuschenken. Mit mäßigem Erfolg. Eine Freundin wurde wütend, weil Effi nicht aufhören wollte, ihrem dreijährigen Sohn heimlich Schokolade zuzustecken, was dazu führte, dass das Kind, das sonst nur Vollkornprodukte und Fruchtsüße gewohnt war, im Zuckerrausch wie aufgezogen durch die Wohnung gerast war und nicht unerheblich zu dem Zustand beigetragen hatte, in dem sie sich nun befand. Die Wohnung. Effi auch.
Sie rauchte jetzt. Ich räumte auf. Machte ich gerne. Wenn es sich um das Chaos anderer handelte, gelang mir das mit Leichtigkeit. Die Lösungen für die Probleme der anderen lagen mir stets offen. Man musste die Dinge nur ansehen, dann sagten sie einem, wo sie hingehörten. Teller in die Spülmaschine, T-Shirts in den Schrank, Arschlöcher vor die Tür.
»Ich verstehe nicht, warum du das mit dir machen lässt«, hatte ich zu Frauke gesagt, die sich ununterbrochen über ihren Ehemann beschwert hatte.
»Der macht gar nichts«, hatte Frauke erzählt. »Ich gehe genauso arbeiten wie er, versorge zusätzlich die Kinder und schmeiße den Haushalt allein. Er bringt höchstens mal den Müll runter oder geht Getränke holen, und dafür soll ich ihn dann auch noch loben.«
»Klingt so, als hättest du drei Kinder«, hatte ich kommentiert. »Vielleicht wärst du ohne ihn besser dran.« Woraufhin Frauke beleidigt schwieg und sich bald darauf verabschiedete.
Dabei war es so einfach. Die Dinge verlangten nach Ordnung. Und wenn ein Ding seine Funktionalität verloren hatte, war es Müll.
Ich warf die Scherben eines zerbrochenen Tellers in den Abfalleimer. Der Teller gehörte mir nicht, ich war taub für seine Geschichte. Ich wusste weder, wo er gekauft, noch, welche Speisen auf ihm serviert worden waren. Er war mir egal. Und nun war er kaputt.
»Jetzt bin ich alt«, teilte Effi mir mit, als ich auf den Balkon trat, in jeder Hand einen Becher Milchkaffee. Irgendeine Kirchturmuhr schlug zur Viertelstunde.
»Gibt’s keinen Schnaps?«, fragte Effi.
»Erst mal Kaffee«, erwiderte ich und reichte ihr einen Becher. »Du bist jetzt Mitte dreißig.«
Meine Freundin betrachtete vorwurfsvoll das Heißgetränk und nickte bitter: »Jetzt gehe ich auf die vierzig zu. Wenn ich nun schwanger werde, gelte ich als Spätgebärende. Dann entspreche ich endgültig meinem eigenen Feindbild!«
Wir hatten doch keine Latte-macchiato-Mütter werden wollen, keine Schabracken. Wir wollten junge Mütter sein und trotzdem sexy bleiben, Party machen und Karriere und die Kinder nebenbei aufziehen. Genauso, wie es die Gesellschaft, zu der wir uns zugehörig fühlten, von uns erwartete.
»Immerhin giltst du nicht als unfruchtbar«, murmelte ich tröstend.
Effi lächelte mich mitleidig an und schnippte ihre Zigarettenasche in die erfrorenen Petunien. Der Gedanke machte ihr Angst. Sie wich dem Thema aus.
»Manchmal denke ich, wir spielen nur, dass wir erwachsen sind«, sagte sie. »Irgendwann erwischen sie uns, die echten Erwachsenen, in unseren Wohnungen, mit unseren Berufen und sagen: So, Schluss mit dem Zirkus. Zähne putzen und dann ab ins Bett.«
»Ach, na ja.« Ich wärmte meine Hände an der Kaffeetasse. »Dieses Hochstaplergefühl hatte ich früher viel stärker. Wie oft ich mich früher nach Partys vor mir selbst geekelt habe. Mit wem ich alles ins Bett gegangen bin, weil ich dachte, jeder könnte der Letzte sein!«
Ich hatte mich selbst so hässlich gefunden. Gott, ich bin zwanzig, hatte ich gedacht. So schön wie jetzt werde ich nie wieder. Und wenn ich jetzt schon so hässlich bin, wo soll das erst hinführen. Irgendwann werden die Leute schreiend weglaufen, wenn sie mich sehen.
Nun hatte ich einen Freund und eine Doktorarbeit. Aber mit der Promotion kam ich nicht vorwärts, die Beziehung stagnierte. Kinder zu bekommen wäre der nächste logische Schritt. Doch woher nehmen, wenn nicht stehlen?
»Hast du gesehen, wie Caro mit ihrem Baby umgeht?«, murmelte Effi und zündete sich eine neue Zigarette an der alten an. »Die heilige Caroline. Würde mich nicht wundern, wenn das Kind die Milch schon in der Lunge hat.«
Effis ehemalige Kommilitonin Caro hatte ihren sechs Monate alten Säugling wortwörtlich am nackten Busen mit sich herumgetragen. Egal, wo man hinsah, ständig war eine Brust im Bild.
Effi verstellte die Stimme und imitierte die andere. »›Er trinkt so langsam‹«, piepste sie, »›und wenn ich ihn ablege, schreit er sofort.‹« Sie schnaubte. »Ich verstehe nicht, was an einem schreienden Baby schlimm sein soll. Babys schreien eben. Ist gut für die Lunge.«
Wir lachten selbstzufrieden. Zwei alte Tanten auf dem Balkon. Wir wussten genau, welche Art Mütter wir sein würden. Und welche nicht.
»Wie sie sich sonnen in der Aufmerksamkeit ihrer Kinder«, stimmte ich in die Schimpftirade mit ein. »In ihrer Reproduktionsleistung, dem Spiegel ihrer selbst. Lassen Sie mich durch, ich bin Mutter! Ich habe meinen Zweck erfüllt und ein Lebewesen ausgepresst. Aus mir heraus. Der Gipfel der Kreativität.« Mein Kaffee schwappte in der Tasse.
»Und wieso schminkt sich keine von denen mehr?«, fügte Effi hinzu. »Wir lassen uns doch auch nicht so gehen.«
Wir waren so erschöpft von der Party, erschlagen von der Zärtlichkeit, die in dieser Wohnung zirkuliert hatte, ohne uns zu gelten. Wir fühlten uns wie Zaungäste auf unserer eigenen Veranstaltung. Wie in der Ferienlagerdisco. Langsame Runde. Und Effi und ich waren die Einzigen, die niemanden zum Kuscheln hatten.
Vor fünf Jahren hatte meine Freundin die Stelle in dem Provinzkrankenhaus angenommen. Der Weg war weit, der Oberarzt ein Idiot, die Arbeit anstrengend. Aber sie wusste, im Schwangerschaftsfall wäre sie abgesichert. Wenn sie nur schwanger würde!
»Und ihr wollt diese Adoptionssache wirklich durchziehen?«, getraute sie sich nun doch zu fragen. Wir hatten uns warmgeschimpft, einen Konsens in unserem Urteil über die anderen gefunden, jetzt erst konnten die wichtigen Fragen gestellt werden.
»Na, schwanger werden kann ich nicht«, erwiderte ich lakonisch. »Wenn ich ein Kind will, muss ich es mir woanders besorgen.« Ich konnte noch nicht darüber reden. Nicht mit Effi. Wir erklommen denselben Berg von verschiedenen Seiten. Wir konnten uns nicht verstehen.
»Sag mal, blutest du?«, fragte Effi plötzlich.
Ich blickte irritiert an meiner Hose herunter. Ich dachte an Menstruationsblut. Ein Symptom der prämaturen Menopause waren neben Hitzewallungen und Stimmungsschwankungen nämlich Blutungen zu den unmöglichsten Zeitpunkten. Manchmal hatte ich meine Periode alle vierzehn Tage, manchmal erst nach sieben Wochen. Unregelmäßig hatte mein Uterus mein ganzes Leben gearbeitet, seit ich mit fünfzehn das erste Mal meine Tage bekommen hatte, aber dieses Level war selbst für mich neu.
Meine Mutter hatte mir damals schon prophezeit, dass es schwierig für mich werden könnte, Kinder zu bekommen. Meine Tante nahm empfängnisfördernde Medikamente, bevor sie meine Cousins bekam. Mit Anfang zwanzig.