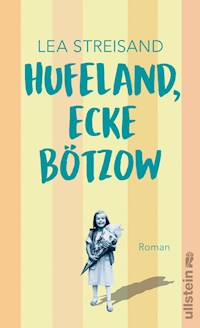12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wo die strahlende Lea ist, da ist das Leben – bis sie plötzlich, mit gerade dreißig, schwer erkrankt. Während ihre Freunde Weltreisen planen, aufregende Jobs antreten, heiraten, Kinder kriegen, kreisen ihre eigenen Gedanken um Krankheit und Tod. Als sie fast die Hoffnung verliert, muss Lea an ihre Großmutter Ellis denken. Ellis Heiden war Schauspielerin und Lebenskünstlerin, "eine Frau wie ein Gewürzregal", lustig, temperamentvoll und furchtlos. In den 1940er Jahren etwa schummelte sie ihren Bräutigam, einen "Halbjuden", in einer abenteuerlichen Aktion nach Berlin und rettete ihm damit das Leben. Auch die Nachkriegswirren, Mauerfall und Wendezeit meisterte sie mit einer umwerfend unkonventionellen Haltung zum Leben. Die Erinnerung an diese besondere Frau stärkt Lea in einer schweren Zeit den Rücken. Mit leichter Feder, Herz und Humor erzählt Lea Streisand die Geschichte zweier unverwechselbarer, starker Frauen. "Schwierig, dieses Buch zu lesen und sich nicht in diese Frau zu verlieben, für ihre knallharte Herzlichkeit und all den schönen Trotz. Welche Frau, fragen Sie, die Erzählerin oder die Großmutter, über die sie schreibt? Gute Frage. Beide." Margarete Stokowski "Sehr nah und unerschrocken blättert Lea Streisand ihre Hauptfiguren auf. Während man mit ihnen wächst, wachsen sie einem ans Herz. Große Themen wie Krieg und Krebs, Theater und das Schreiben: alles handelt letztendlich von der Liebe." Kirsten Fuchs "Locker und lässig wirbelt Lea Streisand die Geschichte der Autorin als beinahe Sterbender und ihrer Großmutter als beinahe Unsterblicher zu einem Teppich zusammen, auf dem wir Leser fliegen können." Jakob Hein
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Fröhlich und vergnügt bewegt sich Lea auf der Bühne ihres Großstadtlebens, als sie plötzlich schwer erkrankt. Während ihre Freunde in neue Abenteuer aufbrechen, muss sie Angst haben, womöglich zu sterben. In dieser schwierigen Zeit bewahren sie die sagenhaften Geschichten ihrer Großmutter Ellis davor, den Verstand zu verlieren. Ellis Heiden war Schauspielerin und Lebenskünstlerin, »eine Frau wie ein Gewürzregal«, lustig, temperamentvoll und furchtlos. In den 1940er Jahren etwa rettete sie ihren Bräutigam, einen »Halbjuden«, in einer abenteuerlichen Aktion aus einem Arbeitslager der Nazis. Auch die Nachkriegswirren, Mauerfall und Wendezeit meisterte sie mit einer umwerfend unkonventionellen Haltung zum Leben. Die Erinnerung an diese besondere Frau gibt Lea die Kraft, dem Schicksal die Stirn zu bieten. »Locker und lässig wirbelt Lea Streisand die Geschichte der Autorin als beinahe Sterbender und ihrer Großmutter als beinahe Unsterblicher zu einem Teppich zusammen, auf dem wir Leser fliegen können.« Jakob Hein »Schwierig, dieses Buch zu lesen und sich nicht in diese Frau zu verlieben, für ihre knallharte Herzlichkeit und all den schönen Trotz. Welche Frau, fragen Sie, die Erzählerin oder die Großmutter, über die sie schreibt? Gute Frage. Beide.« Margarete Stokowski
Die Autorin
Lea Streisand
Im Sommer wieder Fahrrad
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweise zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1435-8
© 2016 © der deutschsprachigen Ausgabe 2016 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Covergestaltung: Cornelia Niere, München Coverabbildung: © Foto: Ellis Heiden, © Karl Weiser (Pusteblume) Trotz aufwendiger Recherchen war es dem Verlag nicht möglich, den Rechteinhaber der Illustration auf dem Cover ausfindig zu machen. Wir bitten ihn, sich ggf. beim Verlag zu melden.
E-Book (2): L42 AG, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Für meine Mutter
Prolog
Mütterchens Sofa hatte weiße und rote Streifen. Von oben nach unten. Eine Sechziger-Jahre-Couch zum Ausklappen. Damit man auch darauf schlafen konnte. Falls Enkel zum Übernachten kämen. Ich weiß noch, wie wir immer da saßen. Ich auf der Couch, sie in ihrem Sessel, dieser Kommandozentrale aus Holz und Polstern und Stoff und Scharnieren und geheimen Tischchen und angehängten Mülleimern. Von ihrem Sessel aus hatte Mütterchen eine Aussicht wie Captain Kirk aus dem Cockpit der Enterprise. Neubauwohnung am Tierpark. Zwei Zimmer, Küche, Bad, zwölfter Stock, alle Fenster nach Westen. Die Sonnenuntergänge waren phänomenal. Im Sommer wurde es in der Bude heiß wie in einem Affenkäfig. An solchen Tagen lief meine Großmutter nur mit Hemd und Schlüpfer bekleidet durch die Wohnung. Der Rücken krumm, die Beine dürr, ein Gespenst aus Haut und Knochen. Auf dem Kopf trug sie einen selbstgebastelten Sonnenschutz aus einem zurechtgeschnittenen Kalenderblatt und einem Gummiband. Und wenn sie dann in ihrem Sessel saß und Kreuzworträtsel löste, blitzte manchmal eine Ecke Van-Gogh-Gelb oder Monet-Blau unter ihrem Haaransatz hervor.
Mütterchens Sessel war wie sie selbst. Eine Fortsetzung ihrer Person. Einladend, patent, Geborgenheit vermittelnd. Ein Zuhause.
»Lea-Kind«, sagte Mütterchen eines sonnigen Herbstnachmittags vor zwanzig Jahren, diesmal gekleidet in ihren Lieblingstrainingsanzug, den blauen mit den gelben Streifen. »Lea-Kind«, wiederholte sie, während sie sich ein Stück Toast mit Marmelade in den Mund schob, »über deine Liebhaber könnste ooch’n Roman schreiben!«
Ich hatte ihr gerade von Christoph erzählt, dem Gitarristen der Schülerband, in der auch der Freund meiner besten Freundin Schlagzeug spielte. Ich war fünfzehn und würde niemals wieder einen anderen lieben, das wusste ich genau.
»Und was ist mit dem von letzter Woche?«, wollte Mütterchen wissen. »Janus oder wie der hieß.«
»Jakob, Oma!«, sagte ich. »Jakob hieß er. Nee, mit dem habe ich Schluss gemacht. Der klammerte so schrecklich.« Jeden Tag hatte er angerufen, mir Geschenke gemacht und gesagt, ich sei für ihn der wichtigste Mensch auf der Welt. Sechs ganze Wochen lang! Das war mir zu heftig. Anhimmeln gern – aber vergöttern? Es war doch nur ein Spiel. Mit Kribbeln und Knutschen und Fummeln und Beatles-Schallplatten-Hören. Die Tragödien spielten sich in Büchern und Filmen ab, nicht in meinem Liebesleben. Zumindest damals nicht.
Drei Monate zuvor hatte ich überhaupt zum ersten Mal geknutscht. Mit Jens. Er war achtundzwanzig und Student, der Cousin meiner Freundin Katrin. Nach einer Woche beendete ich die Sache. Zu alt. Den hätte ich doch nirgendwo mit hinnehmen können.
Jetzt hatte ich Christoph, und Christoph hatte eine Gitarre und die schönsten blonden Locken der Welt. Ich war verliebt. Die Frage war nur, wann er das merkte.
Seit drei Wochen schon tauchte ich jeden verdammten Dienstag bei der Bandprobe im Kulturhaus im Ernst-Thälmann-Park auf. Rein zufällig. Und die arme Frieda musste immer mit. Aber sie fand die Idee einer Quartettbeziehung ja schließlich auch gut. Wenn die beste Freundin mit dem besten Freund des Freundes … Das wär’s doch.
»Aber warum macht er denn nichts?«, fragte ich meine Großmutter, »Denkst du, er mag mich nicht?«
»Quatsch«, meinte Mütterchen. »Der mag dich sicher, er traut sich nur nicht.«
»Aber warum traut er sich denn nicht?«, rief ich aufgebracht. »Denkst du, er hat Angst vor mir? Manchmal glaube ich, die Jungs haben Angst vor mir, weil ich zu krass bin, oder so. Da fühlen sie sich untergebuttert. Vielleicht bin ich zu toll für die!«
Mütterchen sah mich an, ein Lächeln spielte um ihre Lippen. »Also, ich weiß nicht, so besonders toll find ick dich eigentlich janich!«
Rums! Bodenhaftung wiederhergestellt.
»Lea-Kind«, sagte sie dann. »Lea-Kind, über deine Liebhaber könnste ooch’n Roman schreiben.«
»Ach Quatsch!«, rief ich. »Über deine Liebhaber kann man Bücher schreiben! Über das Theater, den Film … Über dein Leben! Willst du nicht mal dein Leben aufschreiben, Omi?«
»Um Gottes willen«, gab Mütterchen zurück und warf die Hände über den Kopf. Ihre Lieblingsgeste.
»Aber du hast so viel erlebt!«
»Mag sein, aber ich habe gar keine Lust, das alles aufzuschreiben. Ich hab’s ja schon erlebt.« Sie nahm einen Schluck Kaffee, stellte die Tasse auf das Tablett neben sich, das exakt die Größe des ausklappbaren Tischchens hatte, das an ihren Sessel montiert war. Dann verschränkte sie die Hände über ihrem kleinen Kullerbauch, schob ihr Gebiss im Mund einmal von rechts nach links und sah mich an. »Du kannst das doch machen«, schlug sie vor.
*
Und nun sitze ich hier. Zwanzig Jahre später. Schneeregen treibt vor dem Fenster, die Straßen sind glatt. Ich weiß immer noch nicht, wo ich anfangen soll. Wo ist der Anfang bei einem runden Ding? Ein Leben verläuft ja nicht linear. Es ist keine Zwirnsrolle, die man abspult von vorn nach hinten, und das war’s dann. Das Leben gleicht eher einer Kartoffel, die wächst und größer wird und Beulen bekommt, die irgendwie unförmig ist und dreckig. Wenn man Kartoffeln durchschneidet und in die Erde legt, wachsen neue nach. Und wenn man eine Kartoffel ausgräbt und gründlich abwäscht, dann schimmert sie golden.
1
Vielleicht erzähle ich einfach davon, wie Mütterchens Geschichten mich bei Verstand hielten in dem Jahr, als ich dachte, ich müsse sterben.
Oder noch anders. Ich fange mit dem Koffer an.
Mütterchen behauptete immer, es gebe zwei Sorten von Menschen: die ordentlich Unordentlichen und die mit der unordentlichen Ordnung.
»Die einen legen immer alles auf Kante und finden nachher nichts mehr wieder. Bei den anderen ist es zwar nicht wie geleckt, aber gut organisiert.« Sich selbst zählte meine Großmutter eindeutig zur letzteren Kategorie.
Mütterchen war Jahrgang 1912, sie gehörte einer Generation an, die zwei Weltkriege erlebt hatte und mehr als eine Mangelwirtschaft. Sprich: Mütterchen warf nichts weg. In ihrem Schlafzimmer stand eine Truhe, die war groß wie ein Sarg und bis oben hin voll mit Stoffresten. Als ich in die Pubertät kam und beschloss, nur noch Secondhandkleidung aus den Siebzigern zu tragen, war diese Flickentruhe der Schlüssel zu meinem Erfolg. Die Flicken waren älter als meine Jeans – und meine Jeans waren schon älter als ich! Begeistert machte ich mich über Mütterchens archäologische Textilschätze her. »Schal Krümel Weihnachten 74«, stand auf einer ausgewaschenen DDR-Toastbrot-Tüte, in denen drei Fussel der roten Wolle steckten, aus der Mütterchen meiner Mutter seinerzeit den roten Schal gestrickt hatte, den ich Jahrzehnte später erbte, als ich Hippie wurde. Ich trage den Schal bis heute. Er ist drei Meter lang, rostrot und watteweich.
»Mit Mütterchens Näh- und Strickerzeugnissen ist es wie mit den Gedichten von Johannes R. Becher«, sagte meine Mutter immer. »Jedes zehnte ist richtig gut.«
Mütterchens Nähmaschine war eine Singer, alt, aber elektrisch, und sie hütete sie wie ihren Augapfel. »Himmel, Arsch und Zwirn!«, fluchte sie jedes Mal, wenn sie davorsaß. Und das tat sie oft. Die Worte waren mit den Jahren zu einem einzigen zusammengeschmolzen. »Himmelarschundzwirn!«, brüllte sie, und bei jedem Einfädeln hielt sie die Lupe über die Nadel und murmelte: »Komm vor, mach Faxen!«
Meine Großmutter war eine leidenschaftliche Schneiderin, auch wenn über ihr Talent geteilte Ansichten herrschten – ihre eigenen und die der potentiellen Nutznießer ihrer Kunst. Deshalb ging ich auf Nummer sicher und setzte mich lieber selbst an die Nähmaschine. Und da meine alten Hosen oft so fadenscheinig waren, dass praktisch jede Woche ein neuer Flicken nötig war, damit Mütterchens Prophezeiung »Die Buchse wird dir irgendwann vonne Beene fallen!« nicht wahr wurde, saß ich sehr regelmäßig mit meiner Großmutter zusammen in ihrem Wohnzimmer in der Neubauwohnung am Tierpark. Während ich an meinen Hosen herumstichelte, redeten wir über Männer, über Mütterchens Zeit am Theater, ihre Rollen beim Film und über viele andere wichtige Dinge.
»Was ist denn in dem Koffer da oben?«, fragte ich sie einmal, als ich in ihrer Rumpelkammer etwas suchte, einem kleinen Kabuff neben dem Badezimmer, gerade mal einen Quadratmeter groß, alle Wände verstellt mit bis unter die Decke vollgestopften Regalen. Es gab keine Nagelgröße und keine Schnipsgummidicke, die nicht in einer der tausend Schachteln und Schächtelchen, die dort lagerten, zu finden gewesen wäre. Und ganz oben lag der Koffer.
»Ach«, rief Mütterchen aus der Küche, »nur altes Zeug, Briefe und so.«
»Was denn für Briefe?«
»Alte Briefe … Komm her, die Eierkuchen sind fertig!«
Mütterchen backte die besten Eierkuchen der Welt, mit steif geschlagenem Eischnee, den sie unter den Teig hob, damit sie ganz dick wurden und nach Sahnebaiser schmeckten. Die Eierkuchen wurden in Butter gebraten und brannten immer auf mindestens einer Seite an. Das lag an dem alten Elektroherd aus DDR-Zeiten, dem »blöden Scheißteil«, wie Mütterchen sagte, auf dem man nie ordentlich die Temperatur regeln konnte. »Wenn der aus ist, kannst du eine halbe Stunde später noch einen Ochsen drauf braten.«
Ich liebte ihre Eierkuchen. Noch heute, wenn ich sie selber backe, lasse ich sie immer auf einer Seite ein bisschen anbrennen.
Als Mütterchen ins Pflegeheim kam, im sagenhaften Alter von zweiundneunzig Jahren, lösten meine Mutter, meine Tante, mein Cousin und ich ihre Wohnung auf. Mütterchens Nähmaschine wanderte zu mir, ich war die Einzige, die mit dem Gerät umgehen konnte.
»Was ist mit den Drehbüchern?«, fragte meine Mutter, als sie einen Wandschrank voller Manuskripte öffnete.
»Nehme ich«, rief ich. War schließlich alles Archivmaterial für den Jahrhundertroman, den ich schreiben wollte.
»Programmhefte«, seufzte meine Tante, als sie ein Fach der Kommode öffnete, auf der Mütterchens Fernseher gestanden hatte.
»Die nehme ich auch«, sagte ich.
Und irgendwann räumten wir die Kammer aus.
»Was ist eigentlich in diesem Koffer?«, wunderte sich meine Mutter.
Ich stand gerade in der Küche und sortierte Konserven aus, auf denen man das Verfallsdatum nicht mehr lesen konnte. »Briefe oder so«, sagte ich zerstreut und überantwortete eine halbverrostete Dose Hering in Tomatensoße dem Mülleimer.
»Klong!«, machte die Dose, und gleichzeitig drang ein Rumpeln aus der Kammer, begleitet vom Ächzen meiner Mutter, einem dumpfen Aufschlag und dem Ausruf: »Ach, du kriegst die Tür nicht zu!«
»Mama!«, rief ich. »Alles klar?«
Meine Mutter stand in Küchenschürze und Haushaltshandschuhen vor dem braunen Pappkoffer, der bei dem Sturz aufgesprungen war und nun wie ein weit offener Schlund seinen Inhalt offenbarte: Fotoalben, vergilbte Briefe, Reisetagebücher, Zeugnisse und noch mehr Theaterprogrammhefte und Drehbücher. Mütterchens Nachlass.
»Ich will den Koffer!«, stieß ich hervor.
Doch meine Mutter wiegelte gleich ab. »Der Koffer kommt zu mir. Und du«, sie drehte sich halb zu mir um, »du machst erst mal dein Studium fertig!«
*
Vor dem Panoramafenster des Arztzimmers stoben die Schneeflocken von links nach rechts. Es war Anfang Januar, ein kalter Wintertag. Die Lungenärztin, eine gesund aussehende Frau Mitte vierzig, ernst, kompetent, saß vor Paul und mir und redete irgendwas. Dabei machte sie dieses Gesicht. Sie sah nur Paul an, meinem Blick wich sie aus. Paul sog ihre Worte förmlich auf, all die sachlichen Worte. Er wollte verstehen, wollte einen Überblick haben. Ich wollte nur Trost. Und dann sagte sie dieses eine Wort.
Krebs.
Das Zimmer war nicht groß. Links Schränke, geradeaus eine Fensterwand, davor der Schreibtisch, schräg in den Raum gestellt wie ein Schutzwall, hinter dem die Ärztin in Deckung gehen konnte. Rechts eine Pritsche für Untersuchungen und eine Lichtwand für die Röntgenaufnahmen.
Die Ärztin redete und redete, ich glaube, sie hörte sich selbst gar nicht zu. Zwischendurch stand sie auf, ging zur Lichtwand hinüber, schaltete das Licht an, betrachtete die Röntgenbilder, ging zum Schreibtisch zurück, setzte sich, stand wieder auf, schaltete das Licht aus, nahm die Aufnahmen, ging zum Schreibtisch, hielt die Bilder gegen die Schreibtischlampe. Wie ein Tiger im Käfig. Ich sah zu Paul, er sah die Ärztin an. Er wirkte wie ein Jäger mit erhobenem Speer, ruhig und hochkonzentriert. Er wartete auf die gute Nachricht.
Sie schickte uns zum CT. Computertomographie. Auf der Überweisung stand »Pneumonie« – und dieses andere Wort. Wir fuhren direkt zum Krankenhaus, das CT sollte noch am selben Abend gemacht werden. Im Taxi brach ich in Tränen aus.
»Es tut mir so leid!«, schluchzte ich.
»Was tut dir leid?«
»Ich will nicht sterben!«
Paul hielt mich fest. Der Taxifahrer blickte stumm auf die Straße.
Der Computertomograph sah aus wie ein weißer Sarkophag. Eine junge Assistenzärztin führte mich in eine Kabine von der Größe einer Telefonzelle.
»Sie können sich schon mal frei machen«, sagte sie.
Normalerweise habe ich kein Problem damit, mich auszuziehen. Nacktheit ist ein wundervoller Zustand. Man kann schöne Sachen machen, wenn man nackt ist. Baden gehen, sich massieren lassen, vögeln. Ich mag die Nacktheit in Gemeinschaftsumkleidekabinen, beim Sport, in der Sauna. Wichtig ist, dass alle gemeinsam nackt sind. Im Krankenhaus ist aber immer nur einer nackt: der Patient, die Patientin. Die da. Die einsame Nacktheit entblößt. Nie zuvor hatten so viele Fremde meine Brüste gesehen, meinen Bauch, meine Beine, mich angefasst, mich abgetastet. Nie habe ich mich so entkörpert gefühlt wie 2011, in dem Jahr, als ich Krebs hatte.
»Kommen Sie bitte«, sagte die Radiologin. Es war kalt im Untersuchungsraum, ich hatte Gänsehaut auf meinen Knochen, so dünn war ich geworden. Der Computertomograph stand in der Mitte des Raums, weiße Pritsche, weißes Laken, weißer Torbogen. Ich sah die Radiologin an. Das Licht war grell, die Flächen glatt. Ich hatte Angst. »Na, kommen Sie, so schlimm wird es schon nicht werden.«
Ich wusste nicht, ob sie die Untersuchung meinte oder deren Ergebnis. Es war mir egal. Der Trost in ihrer Stimme tat gut.
»Legen Sie sich bitte auf den Rücken«, sagte sie dann. »Sie müssen ganz ruhig liegen, sonst verwackelt die Aufnahme. Ich gehe jetzt raus, dann kommt über Lautsprecher die Ansage, was Sie machen sollen. Dauert nicht lange.«
Ich lag auf der Pritsche wie ein bloßes Hühnchen beim Fleischer in der Auslage. Ein sehr mageres Hühnchen. Ich schloss die Augen und versuchte, mich nicht zu bewegen, versuchte, das Zucken meiner Beine zu unterdrücken, das Zittern meines Körpers. Eine blecherne Frauenstimme hallte durch den Raum: »Bitte einatmen.« Ich atmete ein. »Luft anhalten.« Ich hielt die Luft an. Unendlich langsam fuhr die Pritsche, auf der ich lag, unter dem Torbogen durch. Vielleicht fuhr der Torbogen auch über mich, ich weiß es nicht mehr. Ich kam mir ausgeliefert vor, so bewegt im schlechten Sinne, so mitgenommen. Der Torbogen machte Maschinengeräusche. Das Licht veränderte sich. Wie ein Zug auf einem Rangierbahnhof, dachte ich und musste grinsen. Nicht lachen!, befahl ich mir selbst und stellte mir vor, wie die Röntgenstrahlen auf meine Brust prasselten, die Haut durchdrangen, die Knochen, Sehnen, Nerven, das Blut und die Eingeweide. Ich stellte mir vor, dass jeder Strahl ein kleiner Stachel wäre, der in mich eindrang und durch mich hindurchschoss, eine Schneise hinterließ, eine Wunde, tausend kleine Löcher, die nur mühsam wieder zuwachsen und heilen würden, von tausend kleinen Nadeln, die mich durchsiebten. Tränen schossen mir in die Augen, der Sauerstoffvorrat in meiner Lunge war verbraucht, der Raum um mich herum begann sich zu drehen, die Stimme sagte: »Weiteratmen.«
Am nächsten Tag saßen wir wieder in dem kleinen Sprechzimmer vor dem Riesenschreibtisch der Lungenärztin. Meine Mutter war auch dabei. Blass und aufgeräumt saßen wir da, ich in der Mitte, Paul hielt meine linke Hand, ich hielt die Hand meiner Mutter. Das Gesicht der Ärztin war wie versteinert. Sie räusperte sich mehrere Male, als hätte sie etwas Großes im Hals stecken. Auch ihr Schreibtischstuhl schien plötzlich zu Stein geworden zu sein. Sie rutschte nervös darauf herum, bis sie endlich eine Position gefunden hatte, in der sie ein wenig Ruhe fand.
»So«, sagte sie, räusperte sich wieder und drehte den Bildschirm ihres Computers zu uns herum. Meine Mutter runzelte die Stirn. Das, was aussah wie ein Rorschachbild, seien meine Beckenknochen, erklärte uns die Ärztin und führte uns an ihrem Bildschirm auf eine imaginäre Reise durch meinen Körper. Ich sah nichts weiter als weiße und schwarze Flecke. »Hier, das sieht alles unauffällig aus«, meinte sie und scrollte weiter.
»Unauffällig«, murmelte meine Mutter.
»Unauffällig ist gut«, sagte Paul.
Die Ärztin nickte abwesend und scrollte weiter bis zum oberen Ende der Wirbelsäule. »Aber hier, sehen Sie, hier ist etwas.« Sie deutete mit dem Cursor auf ein schwarzes Loch.
Meine Mutter quetschte meine Hand und fragte: »Was denn?«
Die Ärztin rückte erst die Brille auf ihrer Nase und dann ihren Hintern auf dem Schreibtischstuhl zurecht, atmete tief ein und sagte schließlich sehr schnell und sehr leise: »Es kann aufgrund der vorliegenden Bilder nicht eindeutig festgestellt werden, aber die Vermutung liegt nahe, dass die Hypothese zugelassen werden kann, dass …«
»Ist es wirklich Krebs?«, unterbrach ich sie.
Die Ärztin starrte mich an, und ihre Augen füllten sich mit Tränen. Das ist jetzt nicht wahr, dachte ich. Sie erhob sich und hielt sich die Hand vor den Mund.
»Entschuldigen Sie«, setzte sie mit zittriger Stimme an. »Es tut mir sehr leid, es ist was in meiner Familie, hat nichts mit Ihnen zu tun.«
Okay, das war’s, dachte ich. Wenn deine Ärztin vor dir heult, dann ist es aus. Den Rest der Zeit war ich nur noch körperlich anwesend. In Gedanken ordnete ich bereits meinen Nachlass. Wer sollte meine Wohnung übernehmen? Wer meine Bücher erben? Und das Wichtigste: Was würde aus Mütterchen werden? Ich wollte doch ihre Geschichte aufschreiben! Die Geschichte meiner Großmutter. Das hatten wir so besprochen. Vor einer halben Ewigkeit schon.
2
Mütterchen war höchstens zwölf, als sie mit dem Rauchen anfing, wahrscheinlich sogar jünger, und sie klaute auch keine einzelnen Zigaretten aus den herumliegenden Schachteln ihrer Eltern, wie ich es als Teenager getan hatte, sie klaute die Kippen gleich stangenweise.
Ihre Mutter Marie war eine von vier Millionen »Kriegerfrauen« im Deutschen Reich gewesen, die eine staatliche Stütze bekamen, solange ihre Männer an der Front waren. Mit einem Kind erhielt eine Kriegerfrau je nach Region, in der sie lebte, Zuschüsse von zusammengerechnet etwa 45 Mark. Männer verdienten in Friedenszeiten aber pro Monat mindestens 120 Mark. Marie und Mütterchen verfügten zwischen 1915, als der Vater Max eingezogen wurde, und 1921, als er aus der französischen Kriegsgefangenschaft wieder nach Hause kam, also über lediglich ein Drittel dessen, was sie sonst zum Leben hatten. Das Geld reichte vorn und hinten nicht. Deshalb beschloss die kluge Marie, »in Vaters guter Stube« einen Tabakladen zu eröffnen – er sei ja nicht da gewesen und habe das Zimmer eh nicht nutzen können, meinte meine Großmutter. Sie selbst musste helfen, die Zigarettenlieferungen vom Grossisten abzuholen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!