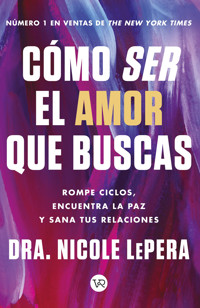21,99 €
Mehr erfahren.
Sich in Beziehungen gesehen, wertgeschätzt und geliebt fühlen - das wollen wir alle. Tun wir das nicht, suchen wir die Fehler häufig bei unserem Gegenüber. Doch wie »Holistic Psychologist« Nicole LePera betont, können wir uns nicht auf andere verlassen, wenn es darum geht sich wertvoll und verbunden zu fühlen – dies muss aus uns selbst kommen. Auf Basis der faszinierenden Erkenntnisse der Mind-Body-Medizin zeigt sie, wie die Beziehungen zu unseren frühesten Bezugspersonen unsere Verbindungen als Erwachsene prägen und wie wir uns aus diesen Mustern befreien können: indem wir selbst Verantwortung übernehmen für unsere ungestillten Bedürfnisse, frühkindliche Wunden und Konditionierungen erkennen und für ein Gefühl der Sicherheit in Körper und Geist sorgen. Erst dann können Beziehungen wirklich gelingen.
Mit vielen wirkungsvollen Übungen und Impulsen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Beziehungen waren schon immer wichtig für das menschliche Überleben. Und doch sind sie oft die Ursache für tiefstes Leid. Während unsere Herzen auf Verbindung eingestellt sind, sind unsere Nervensysteme – die all unsere vergangenen Verletzungen und Enttäuschungen speichern – auf Bedrohung und Negativität programmiert. In ihrem neuen Buch zeigt die Autorin, deren integrativer, ganzheitlicher Ansatz der Psychologie ein internationales Millionenpublikum begeistert, einen neuen Weg zur Heilung: Durch das Erkennen unerfüllter Bedürfnisse aus früheren Beziehungen und dysfunktionalen Bindungsmustern können wir schmerzhafte Zyklen durchbrechen und anderen wieder mit Wertschätzung und Mitgefühl begegnen. Anhand neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse zeigt LePera, wie wir Sicherheit im eigenen Körper und Geist schaffen, unerfüllte Bedürfnisse identifizieren, emotionale Widerstandsfähigkeit entwickeln und tiefe emotionale Verbindungen aufbauen. Mit kraftvollen Mind-Body-Übungen, die das Nervensystem beruhigen und uns mit der Weisheit des Herzens verbinden.
Autorin
Nicole LePera studierte Psychologie an der Cornell University in New York, der Philadelphia School of Psychoanalysis und The New School for Social Research. Als Psychologin in eigener Praxis empfand sie die limitierten Möglichkeiten der klassischen Psychotherapie oft als frustrierend. Deshalb entwickelte sie eine ganzheitliche Philosophie für körperliche, mentale und spirituelle Gesundheit, die hochwirksame Elemente zur Selbstheilung vermittelt. Nicole LePera ist die Gründerin des #SelfHealers-Movements sowie der Instagram-Plattform »The Holistic Psychologist« und hostet den Podcast »SelfHealers Soundboard«.
Nicole LePera
Warum stabile
Partnerschaften erst
gelingen, wenn unsere
inneren Wunden
geheilt sind
Aus dem amerikanischen Englisch
von Elisabeth Liebl
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel »How to Be the Love You Seek: Break Cycles, Find Peace, and Heal Your Relationship« bei Harper Wave, New York, USA.
Published by Arrangement with Juniortine Productions LLC.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Originalausgabe März 2024
Copyright © 2024 Arkana, München in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2023 Nicole LePera
Lektorat: Anne Nordmann
Umschlaggestaltung: ki 36 Editorial Design, München, Daniela Hofner
Umschlagmotiv: Daniela Hofner
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
CC ∙ CF
ISBN 978-3-641-30472-0V001
www.arkana-verlag.de
Heile. Deine. Beziehungen.
Warum stabile Partnerschaften erst gelingen, wenn unsere inneren Wunden geheilt sind
Dr. Nicole LePera
Ebenfalls von Nicole LePera:
Heile. Dich. Selbst. Warum auch kleinste seelische Verletzungen große Folgen haben – und wie du dich davon befreien kannst.
Erkenne. Dich. Selbst. Tägliche Mini-Schritte, die das Denken und Fühlen für immer verändern. Das Workbook zu Heile. Dich. Selbst.
Inhalt
Einführung: Du bist der Wandel
1 Die Macht deiner Beziehungen
2 Erkunde dein verkörpertes Selbst
3 Die Neurobiologie von Traumabindungen
4 Erkunde dein konditioniertes Selbst
5 Wie du dir die Weisheit deines Körpers zunutze machst
6 Veränderung durch geistiges Gewahrsein
7 Wie du die Kraft deines Herzens entfesselst
8 Wie du die Liebe wirst, die du suchst
9 Selbstbestimmte Beziehungen
10 Die Verbindung mit der Gemeinschaft
Nachwort: Die unerwartete Wahrheit meines Herzens
Danksagung
Anmerkungen
Stichwortregister
Personenregister
Für meine Mutter und alle Menschen, die uns vorausgegangen sind: Mögen sie im grenzenlosen Frieden der Liebe ruhen.
Für uns alle, die geblieben sind: Mögen wir unseren Schmerz verwandeln und unsere Herzen heilen.
Einführung: Du bist der Wandel
Vermutlich liest du dieses Buch, weil es in deinem Leben eine Beziehung gibt, die dir Stress bereitet. Ob es nun um einen Liebespartner geht, um Vater oder Mutter, um Geschwister, Kinder, Freundinnen oder Kollegen: Du wünschst dir, dass sich die Dynamik zwischen dir und dieser Person verändert. Und wenn du so bist wie die meisten von uns, dann sollen sich die Dinge so schnell wie möglich ändern. Vielleicht bist du dir nicht mal sicher, ob du weiterhin an dieser Beziehung arbeiten möchtest, ob sie die Mühe wert und eine Heilung überhaupt möglich ist. Oder du hast ganz allgemein Schwierigkeiten damit, dauerhafte Beziehungen aufzubauen und hast Angst vor einer Zukunft in Isolation und Einsamkeit.
Ich verstehe das. In den mehr als zehn Jahren, die ich als klinische Psychologin tätig bin, habe ich mit vielen Klientinnen und Klienten gesprochen, die sich nach dauerhafter Liebe sehnen, wiederkehrende Konflikte lösen und hinderliche Gewohnheiten ablegen wollen. In unzähligen Einzel-, Paar- und Familientherapien begegnete mir immer wieder das gleiche Muster: Trotz bester Absichten und Bemühungen konnten die meisten Menschen die Beziehungen, die sie sich wünschten, weder eingehen noch aufrechterhalten, sodass sie am Ende frustriert und voller Groll waren.
Der Großteil der Menschen, die zu mir kommen, hatte Beziehungsratgeber gelesen und die neuesten Strategien ausprobiert in der Hoffnung, dass irgendetwas davon helfen würde. Viele kannten das Konzept der »Sprachen der Liebe«, das zurückgeht auf Dr. Gary Chapmans Buch Die fünf Sprachen der Liebe (Marburg 1994). Chapman empfahl, die geliebte Person zu bitten, seine oder ihre Liebe auf andere Weise auszudrücken – durch Zärtlichkeit, Zeiten der Zweisamkeit, Geschenke, Worte der Anerkennung oder Hilfsbereitschaft (zum Beispiel, indem man das Bett macht oder das Abendessen zubereitet). Seiner Ansicht nach vertieft dies die Verbundenheit.
Dieser Ansatz, der auf äußere Veränderungen abzielt, also mit der Erwartung verbunden ist, dass eine andere Person ihr Verhalten ändert, um unsere Bedürfnisse zu erfüllen, ist Teil der meisten Paartherapien. Die Strategien, die zu diesem Zweck eingesetzt werden, variieren je nach Therapeuten, Büchern oder Ideologien, aber die grundlegende Botschaft bleibt dieselbe: Wir müssen uns ändern, um die Bedürfnisse unseres Gegenübers besser zu erfüllen, und umgekehrt.
Theoretisch scheint es ein guter Plan zu sein, den anderen zu bitten, sein Verhalten zu ändern, wenn wir uns in einer Beziehung nicht unterstützt oder verbunden fühlen. Im realen Leben aber geht dieser Schuss häufig nach hinten los. Wir können andere Menschen nicht verändern. Die Erwartung, dass sie unseretwegen tief verwurzelte Beziehungsmuster aufgeben, funktioniert für gewöhnlich nicht, zumindest nicht für lange. Äußere Veränderungen erreichen zu wollen, verstärkt oft noch die Spannungen und damit den Konflikt zwischen zwei Personen, was beiderseits zu Unzufriedenheit und negativen Reaktionen führt. Das ist ein Rezept für lebenslangen Groll und entsprechende Geringschätzung.
Jetzt fragst du dich vermutlich (und zu Recht), was du dann tun sollst. Wenn es nicht funktioniert, vom Gegenüber zu erwarten, dass er/sie ändert, wer er/sie ist, damit sein/ihr Verhalten besser zu dem passt, was wir sind, was dann? Diese Frage habe ich mir selbst jahrelang gestellt.
Als junge Erwachsene hatte ich Schwierigkeiten, die Beziehungen zu finden, nach denen ich mich sehnte. Obwohl mir viele therapeutische Instrumente zur Verfügung standen, war ich in den meisten Beziehungen unzufrieden. Und das, obwohl ich mir die größte Mühe gab, meine Selbstreflexion, mein Selbstgewahrsein und meine Kommunikation ständig zu verbessern. Ich fühlte mich immer allein, selbst wenn ich von Menschen umgeben war: an Feiertagen von der Familie, zu meinem Geburtstag von Freundinnen und Freunden oder von Liebespartnerinnen im Urlaub. In solchen Momenten wollte ich eine tiefe Verbundenheit spüren (oder erwartete sie sogar), fühlte mich aber trotzdem einsam und ungeliebt. Gleichgültig, was ich sagte, wie ich es sagte oder was andere Menschen für mich zu tun versuchten, ich fühlte mich immer noch von allen durch einen tiefen Graben getrennt und allein. Je verzweifelter ich versuchte, auf andere Menschen zuzugehen, desto ferner schienen sie mir und desto heftiger wurde mein Schmerz.
Bis dann jenes Weihnachtsfest kam, als ich zwar immer noch in diesen wenig erfüllenden, aber vertrauten Gewohnheiten feststeckte, aber endlich begriff, wie meine Beziehungsmuster aussahen. Ich war damals mit Sara liiert (von dieser Beziehung wirst du in Kapitel 1 noch mehr hören). Wir waren seit mehreren Jahren zusammen und teilten uns eine Wohnung im East Village. Da jede von uns den ersten Weihnachtsfeiertag normalerweise mit ihrer Familie verbrachte, hatten wir es uns zur Gewohnheit gemacht, Weihnachten zu zweit vorab zu feiern. In jenem Jahr hatte Sara den Wunsch geäußert, diesmal nur für uns zu feiern. Das widersprach unseren üblichen Gewohnheiten. Sara war ein ausgesprochen sozialer Mensch. Unsere Beziehung hatte sich jahrelang auf Partys und bei Essen mit Freunden abgespielt. Ich war tief berührt, dass sie diesen Tag nur mit mir allein verbringen wollte und hoffte, dass diese Geste unsere Bindung stärken würde.
An jenem Morgen wachten wir in unserem geschmückten Appartement auf, und ich bereitete ein fantastisches Frühstück zu, bevor wir unsere Geschenke austauschten. Ich war hingerissen, als ich den Umschlag öffnete, den Sara mir über den Tisch schob: zwei Karten für den Cirque du Soleil – den ich liebte –, eine Vorstellung für den gleichen Tag. »Sie will mehr Zeit mit mir allein verbringen! Sie hat sich erinnert, wie begeistert ich vom Cirque du Soleil bin. Sie liebt mich!« Dachte ich. Das war ein zutiefst romantisches Geschenk. Doch als wir uns fertig machten, um loszugehen, spürte ich wieder dieses nagende Gefühl der Unverbundenheit.
Einige Stunden später, als ich neben ihr in einem dunklen, voll besetzten Theater saß, war das Gefühl nicht verschwunden. Ich fühlte mich sogar noch einsamer als beim Frühstück. Wir unterhielten uns nicht miteinander, wir sahen uns nicht in die Augen. Statt das unsichtbare Band der Liebe zu spüren, das meiner Ansicht nach unausgesprochen zwischen uns hätte existieren sollen, hatte ich den Eindruck, neben einer Fremden zu sitzen. Um dieses unangenehme Gefühl zu überdecken, bestellte ich ein Bier. Ich trank während der ganzen Vorstellung, in der Hoffnung, dass dadurch die Wand verschwinden würde, die zwischen uns stand.
Zu jener Zeit war ich im zweiten Jahr meiner Arbeit als klinische Psychologin und war selbst in Therapie. Ich arbeitete an mir, um mir meiner selbst bewusster zu werden – zumindest dachte ich das – und meine gelernten Einsichten mit anderen Menschen zu teilen. Das stärkte nur meine Überzeugung, dass das Problem in meiner Beziehung zu Sara ihre mangelnde Bereitschaft oder Fähigkeit war, Verbundenheit zwischen uns herzustellen.
Je länger ich in meiner vertrauten Einsamkeit und dem Gefühl der Isolation vor mich hin schmorte, desto öfter fragte ich mich, ob mein Unglück nicht vielleicht etwas mit mir zu tun hatte. Möglicherweise fühlte ich mich mit Sara und vielen anderen Menschen vor ihr allein, weil ich – auf emotionaler Ebene – allein war. Es tat mir weh zu sehen, dass ich für mein schmerzlichstes Leid selbst verantwortlich war. Allerdings flammte so auch ein Funke Hoffnung auf, dass ich als Urheberin diese Zyklen auch durchbrechen konnte.
Wie viele der Beziehungsmuster, die wir als Erwachsene ständig wiederholen, nahm meine emotionale Einsamkeit ihren Anfang, als ich noch sehr jung war. Sie war das Ergebnis meiner frühesten Beziehungen zu meiner Familie. In der Kindheit hatte ich nicht gelernt, mich emotional auf andere Menschen einzulassen, weil das bei uns niemand tat. Auch die Menschen um mich herum hatten nie gelernt, wie das geht. Jahre später entdeckte ich dann, dass wir, um uns emotional auf andere Menschen einlassen zu können, zunächst einmal eine emotionale Verbindung zu uns selbst herstellen müssen. Und um emotional auf uns selbst eingehen zu können, müssen wir die Fähigkeit besitzen, unsere Gefühle authentisch zu spüren und auszudrücken. Wenn wir dazu in der Lage sind, werden wir von anderen Menschen gesehen, erkannt und unterstützt – was zu den grundlegenden Bedürfnissen gehört, die wir alle teilen.
Weil ich für meine Beziehungsprobleme immer andere verantwortlich machte und erwartete, dass sie sich für mich änderten, konnte ich die Rolle nicht sehen, die ich bei meinem Unglück selbst spielte. Ich hatte nicht erkannt, wie sehr ich von meinem Selbst getrennt war, von meinen Wünschen und Bedürfnissen. Ich arbeitete zwar schon lange daran, mich selbst besser zu verstehen, aber ich war mir nicht im Klaren darüber, wie ich in Beziehungen auftrat. Wie viele meiner Klientinnen und Klienten erwartete ich von anderen, dass sie sich auf meine Emotionen einstellten, damit ich mich besser fühlte. Ich wusste nicht, wie ich das für mich selbst tun konnte. Beseelt von dem Glauben, die »Richtige« würde irgendwie »einfach wissen«, wie sie meine tief verwurzelten Einsamkeitsgefühle lindern oder mich gar davon befreien konnte, war ich stets enttäuscht, gleichgültig was die Person tat oder wer sie war. Von anderen zu erwarten, meine Bedürfnisse zu erfüllen, würgte meine Zufriedenheit mit der Beziehung ab. Und doch behielt ich diese Verhaltensweisen bei, und zwar nicht nur in Liebesdingen, sondern auch in sämtlichen anderen Beziehungen.
Langsam gelangte ich zu der Einsicht, dass ich die einzige Konstante in meinen Beziehungen war. Und ich merkte, dass ich nie würde kontrollieren können, was andere taten oder nicht taten. Und schon gar nicht, wie schnell, effektiv oder umfassend sie meine Bedürfnisse unterstützen konnten oder wollten. Damit stellte sich auch die Erkenntnis ein, dass wir uns am Ende beide ungeliebt fühlen würden, wenn die eine ständig versuchte zu ändern, wer die andere war oder wie authentisch sie sich ausdrücken durfte. So geliebt zu werden, wie wir wirklich sind, ist ein universelles menschliches Grundbedürfnis – das ich meinen geliebten Menschen nicht verwehren wollte.
Was ich weder in meiner Familie noch in meiner Ausbildung zur Psychologin gelernt hatte, war: Um zu verändern, wie wir mit anderen Menschen in Beziehung treten und unsere Beziehungen erleben, müssen wir zuerst ändern, wie wir zu uns selbst in Kontakt treten und uns erleben. Die Beziehung zu unserem Erwachsenenselbst aber wird geprägt von unseren frühesten Beziehungen. Waren unsere Bezugspersonen unberechenbar und launisch oder haben sie sich nicht zuverlässig um uns gekümmert, als wir noch klein waren, haben wir die Grundüberzeugung gewonnen, dass wir es nicht wert sind, richtig versorgt zu werden oder unsere Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Da wir uns also grundlegend wertlos fühlten, fingen wir an, unseren Selbstausdruck und die Art, wie wir auf andere Menschen zugehen, zu verändern. Mit der Zeit haben wir damit begonnen, anderen nur unsere »annehmbaren« Teile zu zeigen, indem wir bestimmte Rollen spielten: die ich hier in diesem Buch als konditioniertes Selbst bezeichnen werde. Wir haben so versucht, uns zu schützen und uns an unser frühes Umfeld anzupassen. Als Erwachsene treibt uns dann immer noch unsere tief verwurzelte Angst um, wertlos zu sein, weshalb wir diese Gewohnheitsmuster in unseren Beziehungen wiederholen.
Doch diese vertrauten Rollen halten uns fest in einem Zustand, in dem wir von unserer Einzigartigkeit, von unserer individuellen Art, mit anderen zu sein, getrennt sind. Und so fühlen wir uns in unseren Beziehungen immer nicht genügend wertgeschätzt. Um uns in Gegenwart anderer Menschen authentisch auszudrücken, müssen wir uns sicher fühlen. Um uns in Gegenwart anderer sicher zu fühlen, müssen wir zuallererst ein Gefühl der Sicherheit im eigenen Körper entwickeln. Bedauerlicherweise können viele Menschen dieses Gefühl nicht herstellen, weil ihr Körper keinen Zugang dazu findet. Deshalb bleiben unsere Bedürfnisse chronisch unerfüllt, was unser Nervensystem in einen dauerhaften Stresszustand versetzt. Dies wiederum hält uns im Überlebensmodus fest, in dem wir physiologisch nicht in der Lage sind, uns in Gegenwart anderer Menschen sicher zu fühlen.
Diese Erkenntnis öffnete mir die Augen. Wenn ich mich in meinem Körper nie wirklich sicher fühlte, woher sollte dann die Offenheit kommen, jene Augenblicke der Freude, Leichtigkeit und Verbundenheit zu spüren, die authentische Liebe mit sich bringt? Wenn ich mich ständig nur darauf konzentriere, wie ich die Maßstäbe anderer Menschen beziehungsweise der Gesellschaft erfüllen kann und dabei meine authentischen Bedürfnisse und Wünsche unterdrücke, wie sollen dann die Menschen in meinem Umfeld je Gelegenheit bekommen, mit meinem wahren Ich in Kontakt zu treten? Wenn ich selbst nicht alles an mir kenne und liebe, wie kann ich dann von jemand anderem erwarten, mich in meiner Gesamtheit zu sehen und zu lieben?
Ich erzähle hier meine Geschichte, weil sie recht verbreitet ist. Auch wenn allen Geschichten Aspekte eigen sind, die sie einzigartig machen, haben sie eines doch fast immer gemeinsam: Nur wenige Menschen fühlen sich wertvoll und liebenswert, ohne dafür die Bestätigung oder Anerkennung von anderen zu brauchen. So wie damals als Kinder blicken wir ständig zu anderen, damit sie uns ein Gefühl der Sicherheit geben. Wir unterdrücken jene Anteile unser selbst, die wir als beschämend erlebt haben, und das bestätigt unsere tief verwurzelten Ängste, dass diese Anteile tatsächlich so unwürdig sind, wie man uns das eingeredet hat. Wenn wir unseren authentischen Selbstausdruck vermeiden, leugnen oder verbiegen, steigt unser Stressniveau an, ebenso wie unser Ärger über andere Menschen. Davon überfordert, schreien wir schließlich irgendwann unsere Liebsten an, wenn sie nicht fragen, wie unser Tag war. Wir gehen schwierigen, aber wichtigen Gesprächen mit der Familie aus dem Weg oder machen dicht, wenn unsere Freunde versuchen, uns zu helfen. Das sind klassische Verhaltensmuster, die viele von uns ausbilden, weil wir ständig die Bewältigungsstrategien unserer Kindheit wiederholen, obwohl sie uns heute Schmerz und Leid verursachen.
Wenn wir uns wieder mit unserem authentischen Selbst, dem uns innewohnenden Wert verbinden, passiert etwas Wunderbares – und nicht nur mit uns. Je sicherer wir in unserem Selbstausdruck werden, desto eher können wir auch anderen Menschen die Sicherheit geben, sich authentisch auszudrücken und ihre Verletzlichkeit zu zeigen. Erst als ich Zugang zu meinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen fand, konnte ich mit anderen Menschen tatsächlich ich selbst sein und ihnen jene Liebe schenken, von der ich zuvor nur gedacht hatte, ich würde sie geben. Um meine Wünsche und Bedürfnisse zu erkennen, musste ich mich auf meinen Körper einlassen, erkunden, wie es ihm im jeweiligen Moment ging.
Als ich stärker in Kontakt mit meinem Körper kam und lernte, seine Empfindungen zu erkunden, konnte ich mit stressigen und belastenden Erfahrungen besser umgehen. Und ich konnte meine Gefühle offen zeigen, statt abzudriften oder dichtzumachen, wie ich das jahrelang getan hatte. Da ich mich besser auf meine Gefühle einlassen konnte und in meinem Selbstausdruck sicherer wurde, konnte ich das Unbehagen eher annehmen, wenn ich mich anderen gegenüber emotional verletzlich zeigte. Mit der Zeit merkte ich, wie ich mich anderen Menschen offener zeigen konnte, auch wenn ich sie gerade erst kennengelernt hatte. Und da ich in Beziehungen meine eigenen Empfindungen besser kannte, konnte ich angesichts der emotionalen Erfahrungen anderer präsent und mitfühlend reagieren.
Tatsächlich musste ich mir selbst erst beibringen, mich in meinem Körper so sicher zu fühlen, dass ich mein Herz öffnen und die Liebe, nach der ich mich sehnte, geben und empfangen konnte. Damit aber begann eine lebensverändernde Reise, auf der ich auch heute noch lerne, wie tief, erfüllend und umfassend Liebe sein kann. Eine Reise, die mir gezeigt hat, dass das Ziel nicht etwa ist, Liebe bei jemandem oder etwas außerhalb unser selbst zu finden. Es geht vielmehr darum, alle Schutzwälle zu beseitigen, die wir gegen die Liebe errichtet haben. Wie ich gelernt habe, heißt Liebe nicht, das wir uns auf eine bestimmte Weise geben, sondern dass wir dieses Gefühl in unserem gesamten Tun verkörpern und auch andere Menschen darin unterstützen, ganz sie selbst zu sein.
In diesem Buch werde ich all die Informationen und Werkzeuge mit dir teilen, die du auf deiner Reise zurück zu deinem Herzen brauchst. Du wirst entdecken, wie du dich mit allen Teilen von dir verbinden kannst: Körper, Geist und Seele. Und du wirst erfahren, wie du die verschiedenen Anteile deines konditionierten Selbst erkennst, die du in Beziehungen lebst. Und schließlich, wie du den Druck schwieriger Emotionen lindern kannst, sodass du Zugang findest zur angeborenen Fähigkeit deines Herzens, grenzenlos zu lieben. In diesem Buch geht es um deine Heilreise, darum, die Verbindung zu deinem eigenen Herzen ebenso wie zu den Herzen der Menschen um dich herum zu heilen. Wie auch du erfahren wirst, können wir keine echte Verbundenheit zu den Herzen anderer herstellen, wenn wir nie gelernt haben, uns um unser eigenes Herz zu kümmern.
Dich wieder mit der grenzenlosen Weisheit und Intuition zu verbinden, die in deinem Innersten lebt, wird dich Entscheidungen treffen lassen, die dir Freude und Erfüllung schenken, in deinen Beziehungen und darüber hinaus. Deine Reise wird dir helfen, Liebe um dich herum zu verbreiten. So kannst du in Verbindung treten mit deinem höchsten Potenzial als Mensch, als Teil eines Paares, einer Familie und einer Gemeinschaft, zum Segen des gesamten Planeten. Wie auch du erfahren wirst, ist das größte und heilsamste Geschenk, das wir uns selbst, unseren Mitmenschen und unserer gemeinsamen Welt machen können: die Liebe zu sein, die wir suchen.
Dein Herz hat die Kraft, deine Beziehungen zu verändern und mit ihnen alles um dich herum. Die Liebe, die in jedem von uns lebt, ist die wahre Quelle aller Heilung.
1
Die Macht deiner Beziehungen
Wir sehen Beziehungen meist als etwas, »das uns widerfährt«, und nicht als etwas, das mit uns oder sogar wegen uns geschieht. Wir »verlieren unser Herz« und lassen uns in die Leidenschaft oder Macht eines anderen Menschen hineinziehen. Wir entscheiden uns immer wieder für die falschen Menschen, übersehen ständig die Alarmsignale, auch wenn wir glauben, es mittlerweile besser zu wissen. Wenn die Beziehung dann scheitert oder auseinanderkracht, geben wir der anderen Person die Schuld und glauben, sie sei nicht willens oder nicht fähig gewesen, uns glücklich zu machen.
Häufig fällt es uns schwer zu erkennen, dass wir in unseren Beziehungen eine aktive Rolle spielen. Dazu gehört auch, dass wir unsere Liebsten instinktiv aus bestimmten Gründen auswählen. Viele von uns verlieben sich in jemanden, nicht weil diese Person die tiefsten Sehnsüchte unseres Herzens weckt, sondern weil sie Bedürfnisse erfüllt, die zu haben uns nicht einmal bewusst ist. Wir umgeben uns unbewusst mit Menschen, die es uns ermöglichen, vertraute zwischenmenschliche Verhaltensmuster auszuagieren, deren Wurzeln in unseren frühesten Beziehungen liegen.
Wir fühlen uns in Beziehungen häufig ohnmächtig, weil wir den Großteil unserer Zeit und Energie auf etwas konzentrieren, was wir nicht beeinflussen können: andere Menschen. Auch wenn du dich im Moment hilflos und hoffnungslos fühlst, was die Veränderung deiner Beziehungen angeht, so ist es doch ermutigend zu erkennen, dass du tatsächlich aktiv etwas bewirken kannst. Wir alle können das. Wir können gesunde und glückliche Beziehungen finden und aufbauen. Wir alle können die Liebe sein, die wir suchen, unabhängig davon, was andere Menschen tun oder was um uns herum vorgeht.
Meine Rolle in meinen Beziehungen
Bis in meine frühen Dreißiger habe ich mich in Liebesbeziehungen häufig ohnmächtig und passiv gefühlt. Ich flatterte von Partner zu Partnerin und gab jedem von ihnen die Schuld dafür, dass ich mit der Beziehung unweigerlich unzufrieden war. Ich glaubte, das Problem in den Griff zu bekommen, wenn ich nur jemanden fände, der oder die »besser zu mir passte«. Das ging schon los, als ich sechzehn war und mit Billy ausging. Er war mein erster Freund, und ich war unendlich verliebt – zumindest glaubte ich das.
Wie bei allen Teenagern bestand auch unsere Beziehung darin, am Wochenende gemeinsam fernzusehen, mit Freunden abzuhängen und ins Kino zu gehen. Meine Familie kannte Billy und fand es gut, dass wir zusammen waren. Trotzdem redete ich mit meiner Familie nie über ihn. Wenn meine Mutter oder meine Schwester nach ihm fragten, grummelte ich nur irgendetwas vor mich hin oder beschwerte mich, wenn er etwas getan hatte, was mich ärgerte. Ich redete auch mit meinen Freundinnen nicht über diese Beziehung; nicht weil ich Billy nicht mochte oder keine starken Gefühle für ihn hatte, eher im Gegenteil: Ich dachte, ich sei total in ihn verliebt. Aber in meiner Familie sprach man nun mal nicht über Gefühle, Ärger oder Sorgen einmal ausgenommen. Und ich setzte dieses Muster fort: Ich sprach nur über Billy, wenn er mich verletzt oder geärgert hatte. (Eigentlich tat ich nichts anderes, als mich über ihn zu beschweren.)
Nach eineinhalb Jahren trennten Billy und ich uns. Ich war am Boden zerstört. Ein Grund für die Trennung war, dass wir im folgenden Herbst an zwei verschiedene Unis gehen würden, die mindestens dreizehn Autostunden voneinander entfernt lagen. Ein anderer Grund aber war, dass Billy meinte, ich sei »emotional nicht erreichbar«. Dieser Vorwurf hat sich bis heute in mein Gedächtnis eingebrannt. Damals war ich geschockt: Ich hatte nicht den Eindruck, emotional nicht erreichbar zu sein. Ich hatte im Gegenteil das Gefühl, Billy sehr zu lieben. Ich war sehr stolz darauf, mir schon als junges Mädchen Gedanken über andere Menschen zu machen und ein guter, fürsorglicher Mensch zu sein.
Nach einem Jahr an der Uni stellte ich zu meiner Überraschung fest, dass ich die Möglichkeit, Frauen zu daten, höchst aufregend fand. Mit einem Schlag sah ich die ganze Billy-Geschichte in einem anderen Licht. »Natürlich war ich emotional nicht erreichbar!«, dachte ich. »Ich bin schließlich gay!« Katie, meine erste Freundin, lernte ich beim Sport kennen. Wir hatten denselben Freundeskreis und die gleichen Interessen und waren viel zusammen, beim Training, auf der Fahrt zu unseren Spielen und beim Ausgehen mit den Mannschaftskameradinnen. Das war das Fundament unserer Beziehung: Nähe und Ähnlichkeit. Wir verbrachten viel Zeit mit gemeinsamen Aktivitäten, aber ich wurde das nagende Gefühl nicht los, dass etwas fehlte. Obwohl ich mir eine tiefere Verbundenheit wünschte, ließ ich Katie – oder andere Menschen – doch nicht so recht in meine Gefühlswelt ein. In Wahrheit war ich emotional nämlich tatsächlich nicht offen oder erreichbar. Doch da mir immer noch nicht klar war, was ich zu dieser mangelnden Verbundenheit beitrug, und ich den berühmten Funken vermisste, trennten wir uns nach eineinhalb Jahren, und ich begann, mich mit Sofia zu treffen.
Sofia und ich waren bis zum Ende des Studiums in einer On-Off-Beziehung. Nachdem wir unseren Abschluss gemacht hatten, beschlossen wir, in die gleiche Stadt zu ziehen. Sofia unterschied sich von Katie in vielerlei Hinsicht, aber die Beziehungsdynamik, die sich zwischen uns entwickelt hatte, erlaubte mir immer noch, emotional Distanz zu halten, um keine tiefe oder authentische Gefühlsverbindung eingehen zu müssen. Und ich wusste das. Oder vielmehr wusste es mein Unbewusstes – jener Teil des Gehirns, der all unsere instinktiven, automatischen Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen steuert. In diesem tief in uns eingebetteten Teil unserer Psyche speichern wir unsere Erinnerungen – auch jene, an die wir uns nicht explizit erinnern –, ebenso wie unsere unterdrückten Gefühle, schmerzlichen Kindheitserfahrungen und grundlegenden Überzeugungen.
Sofia war von einer emotional überreagierenden Mutter aufgezogen worden, die regelmäßig explodierte und Sofia angeschrien, kritisiert und niedergemacht hatte. Unsere Beziehung bestand noch nicht lange, da begann Sofia schon, mich auf die gleiche Weise zu behandeln: Sie schrie mich an, wenn sie nicht einverstanden war mit dem, was ich sagte oder tat. Sie beschimpfte oder verurteilte mich, wenn sie nicht mochte, wie ich mich verhielt oder zurechtgemacht hatte. Da ich wusste, was sie in der Kindheit erlebt hatte, entschuldigte ich ihr Verhalten, indem ich mir einredete, sie würde ja nicht meinen, was sie sagte oder wie sich mich behandelte, sondern nur frühere Verletzungen ausagieren. Und obwohl das stimmte, fand ich es unglaublich schwierig, klare Grenzen zu setzen im Hinblick darauf, was und wie viel ich mir von ihr bieten lassen wollte. Da ich weder für mich eintreten noch ihr klarmachen konnte, wie sehr sie mich immer wieder verletzte, verspürte ich ihr gegenüber bald einen wachsenden Groll.
Ich machte Sofia für mein Unglück verantwortlich, ohne zu merken, was wirklich falsch lief: dass ich wütend war auf mich selbst, weil ich meinen Schmerz wegerklärte und für ihr verletzendes Verhalten immer wieder Entschuldigungen fand.
Nachdem Sofia und ich uns endgültig getrennt hatten, lernte ich eine Frau namens Sara kennen, mit der ich die nächsten vier Jahre zusammen war. Sara war ein unbeschwerter Mensch. Sie liebte Partys und wollte Spaß haben, was mich unbewusst anzog. Mit Sara gab es so viel zu erleben, dass dadurch meine Aufmerksamkeit von allen negativen Gefühlen abgelenkt wurde. Da sie immer so sorglos war, schämte ich mich beinahe, wenn ich mich nicht fröhlich und unbekümmert fühlte. Ich fing an, mit ihr auf Partys zu gehen, und übernahm ihren von ständiger Geselligkeit ausgefüllten Terminkalender. Den stärker werdenden Schmerz und die Leere, die ich angesichts des Mangels an tieferer emotionaler Verbundenheit verspürte, versuchte ich zu betäuben. Mein Unbewusstes setzte weiter auf die eingefleischten Muster, und so hielt ich mich beschäftigt und konsumierte alles Mögliche, um so Trost zu finden. Obwohl Sara nie Unzufriedenheit über unsere Beziehung äußerte, war sie oft gemein zu mir, vor allem wenn sie trank, und das tat sie häufig. Doch wie bei Sofia fand ich auch für Saras Verhalten rationale Erklärungen. Ich sagte mir, dass sie eben zu viel getrunken hatte oder nicht wirklich meinte, was sie sagte oder tat. In diesen Augenblicken unterdrückte ich meine eigene emotionale Erfahrung, um sie zu besänftigen oder ihr zu gefallen. Ich nahm ihre Gefühle wichtiger als die meinen. Aus den gemeinsamen Monaten wurden Jahre, und wie mit Sofia verspürte ich einen wachsenden Groll Sara gegenüber. Wieder einmal gab ich Sara die Schuld, dass sie mir nicht genug Aufmerksamkeit widmete und dass meine Gefühle ihr gleichgültig waren. Schließlich war auch diese Beziehung am Ende.
Nachdem Sara und ich uns getrennt hatten, bezog ich mit einer Frau namens Vivienne eine gemeinsame Dreizimmerwohnung. Vivienne war älter als ich und so viel reifer als die Frauen, mit denen ich bisher eine Beziehung gehabt hatte. Wir wurden schnell Freundinnen und dann ein Paar. Ihre Unabhängigkeit und ihre emotionale Selbstgenügsamkeit faszinierten mich. Unsere Beziehung funktionierte über gemeinsame Interessen und Neigungen, und mit der Zeit teilten wir auch unsere Sorgen und Ängste miteinander, was unsere Verbindung vertiefte.
Wie meine anderen Partnerinnen war auch Vivienne in einer aufreibenden, instabilen Familie aufgewachsen, aus der sie schon als Teenager geflohen war. Vivienne war stolz darauf, dass sie niemanden brauchte und machte vom ersten Tag unserer Beziehung an klar, dass sie nicht der »Ehetyp« sei. Als sie einige Jahre später doch vom Heiraten sprach, fühlte ich mich als etwas ganz Besonderes: »Sie ist nicht der Typ für die Ehe, aber mich will sie trotzdem heiraten«, schwärmte ich. Wir buchten einen Flug nach Connecticut, wo unsere gleichgeschlechtliche Beziehung legal war, und kein Jahr später zogen wir als verheiratetes Paar zurück in meine Heimatstadt.
Bald nach unserem Umzug änderte sich meine Sicht auf Liebesbeziehungen. Ich hatte gerade an der New School for Social Research in New York meinen Doktor in Psychologie gemacht und sammelte die nötigen Stunden Praxiserfahrung, um meine Zulassung als Psychotherapeutin zu erhalten. Das war ein Vollzeitjob und reich an intensiven Erlebnissen. Zwei Jahre lang nahm ich an psychoanalytischen Einzel- und Gruppensitzungen teil. Im analytischen Zweig der Psychologie untersucht man die Art und Weise, wie unser Unbewusstes unsere Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen und Beziehungen beeinflusst.
Diese der Zulassung vorausgehende Phase ist sozusagen ein Durchlauferhitzer in Sachen Selbstanalyse und -beurteilung. In der Einzeltherapie erkundete ich meine unbewussten Gedanken und Gefühle – was ich vorher noch nie getan hatte, und in der Gruppentherapie spürte ich meiner Art nach, zu anderen Menschen (in diesem Fall den Mitlernenden) in Beziehung zu treten. Innerhalb weniger Wochen wurde mir klar, dass zwischen Vivienne und mir ein gewaltiger emotionaler Abgrund klaffte. Wir redeten nie über unsere tieferen Gefühle oder über das, was in unserer Beziehung passierte, während ich gleichzeitig mit völlig fremden Menschen in der Therapie darüber sprach. Bald stellte ich fest, dass ich in meiner Beziehung wieder einmal nicht glücklich war, dass sie mir nicht die emotionale Verbundenheit schenkte, nach der ich mich so sehr sehnte.
In unserer neuen Stadt hatten wir keinen großen Freundeskreis so wie zuvor, was hieß, dass unsere Welt sich jetzt nur auf uns zwei beschränkte. Ohne Ablenkung durch gesellschaftliche Ereignisse trat die Dynamik in unserer Beziehung stärker zutage. Sie blubberte an die Oberfläche wie Luftblasen von jemandem, der viel zu lange unter Wasser gelegen und den Atem angehalten hat.
Ich beschwerte mich regelmäßig bei Vivienne, dass ich mich nicht mit ihr verbunden fühlte, und fand, unserer Beziehung fehle es an der emotionalen Tiefe, die ich suchte und brauchte. Ich gab ihr die Schuld dafür, weil sie so unabhängig war. Ich sagte ihr, sie sei der Grund dafür, dass wir nicht auf einer tieferen Ebene in Verbindung treten könnten. Das war der Auftakt zu unseren Konflikten, die sich sodann zyklisch wiederholten. Wenn ich heute auf diese Beziehung zurückblicke, ist mir das äußerst unangenehm. Wie bei meinen früheren Beziehungen erkannte ich auch hier nicht, was ich dazu beitrug, dass unsere Partnerschaft so wenig zufriedenstellend und oberflächlich blieb. Ich stand meinen Gefühlen immer noch so fern, dass ich sie nicht würdigen konnte. Ich wusste ja noch nicht einmal, was ich empfand.
Während ich immer unglücklicher wurde, begann Vivienne, für unsere Ehe zu kämpfen. Ihre Entschlossenheit erschreckte mich. Und als ich merkte, dass ich die Scheidung wollte, war ich wie gelähmt: Zum ersten Mal in meinem Leben wollte ich etwas, was den Wünschen eines Menschen, der mir etwas bedeutete, entgegengesetzt war. Ich kämpfte monatelang mit mir, um einen Weg zu finden, wie ich sie um die Scheidung bitten konnte. Solange ich noch nicht wusste wie, stieß ich sie durch mein Verhalten von mir. Als ich dann endlich meine wahren Gefühle ausdrücken konnte, fühlte ich mich gleichzeitig panisch und stark: Ich hatte zum ersten Mal in einer Beziehung meine eigenen Wünsche wichtiger genommen als die meiner Partnerin.
Meine Scheidung war auch der Punkt, an dem ich anfing, meine aktive Rolle in einer Beziehungsdynamik zu erkennen, die weder mir noch meinen Partnerinnen dienlich war. Meine unbewusste Gewohnheit, meine Bedürfnisse zu ignorieren, meine Gefühle zu unterdrücken und den Wünschen anderer immer den Vorrang zu geben, hatte mich zu der Überzeugung verleitet, ich sei ein »guter« und »selbstloser« Mensch. Aber diese Gewohnheiten machten weder mich noch jemand anderen glücklich. In Wirklichkeit vergrößerte ich immer nur die emotionale Distanz zwischen mir und anderen, weil ich meine wahren Gefühle kaum je äußerte, ja mir meist nicht einmal erlaubte, sie zu haben. Andere Menschen wichtiger zu nehmen als mich selbst war nicht selbstlos – ich ließ mich vielmehr völlig im Stich. Zutiefst unzufrieden, war ich häufig wütend oder empört. Ich fing über alltägliche Kleinigkeiten an zu streiten, was die Verbitterung zwischen Vivienne und mir noch verstärkte.
Zu jener Zeit konnte ich meine Rolle in diesen sich wiederholenden Konflikten immer noch nicht klar erkennen, weil meine Beziehungsgewohnheiten seit Kindertagen in meinem Unbewussten verankert waren. Sie waren Teil meiner instinktiven Herangehensweise, wenn es darum ging, mich mit anderen Menschen zu verbinden. Ich hatte diese Gewohnheiten in meinen frühesten Beziehungen entwickelt: in denen mit meiner Familie.
Deine frühesten Beziehungen prägen deine Zukunft
Von außen betrachtet mag es so wirken, als wäre ich in einer glücklichen und gesunden Familie aufgewachsen. Und ich hätte dir dasselbe gesagt – als Kind ebenso wie während eines Großteils meines Erwachsenenlebens. Ich hatte immer genug zu essen. Man hielt mich dazu an, in Schule und Sport etwas zu leisten. Körperlichen oder seelischen Missbrauch gab es in meiner Familie nicht. Aber wie ich mittlerweile gelernt habe, heißt die Abwesenheit von offensichtlichem Missbrauch nicht, dass es keine emotionale Vernachlässigung und die damit einhergehenden Bindungstraumata geben kann.
Als Kind war ich umgeben von Stress und Krankheit. Meine ältere Schwester erlebte als Kind eine lebensbedrohliche gesundheitliche Krise, und meine Mutter litt jahrelang unter gesundheitlichen Problemen und chronischen Schmerzen, worüber in der Familie nicht offen gesprochen wurde. Auch über Gefühle redeten wir nicht, ob es nun um Glück oder Trauer ging oder darum, einem anderen Familienmitglied zu sagen, wenn man wütend oder verletzt war. Wir waren doch eigentlich glücklich, oder nicht? Warum sollten wir da groß diskutieren oder jemanden zur Rede stellen?
Statt auf einer emotionalen Ebene eine Verbindung einzugehen, war unser aller gemeinsamer Nenner Angst und Stress. Wenn es wieder mal eine gesundheitliche Krise gab oder der Alltag belastend war, dann hielten wir in aller Sorge zusammen, bis das Problem gelöst war. Jeder kümmerte sich um die »dringenden« Bedürfnisse desjenigen Familienmitglieds, das gerade krank beziehungsweise gestresst war oder sonst wie unter Druck stand, und vergaß darüber ganz die eigenen Bedürfnisse.
Diese Muster wurden ständig wiederholt. Dabei lernte ich, dass meine Bedürfnisse und Gefühle nicht so wichtig waren wie die der Menschen um mich herum. Ich wusste zwar, dass meine Familie mich liebte und ich ihr wichtig war, aber ich fühlte diese Liebe oder Aufmerksamkeit nie im emotionalen Sinn. Wenn mich irgendetwas belastete – was bei allen Kindern mal der Fall ist –, hätte ich es gebraucht, dass man mir zuhört und mich seelisch beruhigt oder tröstet. Da meine Eltern aber ihre ganze Aufmerksamkeit immer auf die gerade aktuelle Krise richteten, fing ich an, immer weniger von dem, was in mir vorging, mit ihnen zu teilen. Ich hatte Angst, dem ohnehin enormen Stresslevel der Familie noch zusätzlich etwas draufzupacken. Schließlich beherrschte ich die Kunst, meine Bedürfnisse überhaupt nicht mehr zu bemerken – zumindest versuchte ich, mir keinerlei Verletzlichkeit anmerken zu lassen, um das Gefühl der Enttäuschung darüber zu vermeiden, dass niemand für mich da war. Um mich in Sicherheit zu fühlen, koppelte ich mich von allem ab, unterdrückte meine Gefühle und zog um meine innerseelische Welt Mauern hoch. Diese Bewältigungsstrategien wurden mein Schild, mit dem ich mich auch in all den Beziehungen, die ich später führte, instinktiv davor schützte, verletzt zu werden.
Natürlich ist das meine ganz persönliche Geschichte. Deine wird anders lauten. Doch ungeachtet unserer individuellen Reise beeinflussen unsere frühesten Bindungen die Verhaltensmuster, die wir als Erwachsene mit anderen ausleben, vor allem in unseren Liebesbeziehungen. Diese Muster sind unseren Interessen meist nicht dienlich, aber sie fühlen sich vertraut, bequem und daher sicher an. Da sie in unserem Unbewussten abgespeichert sind und quasi täglich automatisch greifen, erkennen wir sie häufig nicht. Und so sehen wir auch nicht, dass wir in unserer Beziehungsdynamik eine aktive Rolle spielen.
Aber wir können lernen, diese Konditionierungen zu erkennen und neue Verhaltensweisen zu entwickeln, die unseren heutigen Bedürfnissen besser gerecht werden. Wenn wir begreifen, dass diese Konditionierung ein Überrest vergangener Erfahrungen ist, können wir die Scham ablegen, die wir deshalb empfinden. Unsere aktive Rolle zu sehen und anzuerkennen, befähigt uns dazu, unsere Beziehungsdynamik zu ändern. Denn letztlich müssen wir die Art und Weise, wie wir eine Beziehung führen, ändern, wenn es zu einem Wandel kommen soll.
Nachdem mir klar wurde, dass der rote Faden in meinen dysfunktionalen Beziehungen ich war, gab ich mir die Erlaubnis, mich im Umgang mit anderen Menschen anders zu verhalten. Ich erkannte, dass ich mich nur wohlfühlte, wenn ich meine Bedürfnisse opferte, um nicht das unangenehme Gefühl spüren zu müssen, das sich einstellte, sobald ich andere Menschen enttäuschte. Ich hatte keine klaren Grenzen – oder überhaupt je Grenzen gesetzt. Da ich keinen Zugang zu meinen authentischen Bedürfnissen und Wünschen hatte und ständig meine eigenen Grenzen missachtete, fühlte ich mich bald in jeder Beziehung emotional distanziert und voller Groll und beendete die Beziehung, um nach einer »perfekteren« Partnerin zu suchen. In Unkenntnis meiner eigenen unbewussten Gewohnheiten gab ich stets meiner Partnerin die Schuld an unseren Problemen und erwartete, dass sie sich änderte. Mit meiner eigenen Rolle in dieser wiederkehrenden Erfahrung befasste ich mich nicht.
Erst als ich begann, ehrlicher zu mir selbst zu sein, fingen meine Beziehungen an, sich zu entwickeln. Mir wurde klar, dass ich, um gesunde Beziehungen eingehen und aufrechterhalten zu können, zuerst einmal für meine eigene seelische Gesundheit sorgen musste.
Ich musste etwas tun, was sich anfangs sehr unangenehm anfühlte: für meine Bedürfnisse und Wünsche eintreten. Dazu gehörte, dass ich im Umgang mit anderen Menschen neue Grenzen zog und gleichzeitig lernte, dabei mit mir selbst geduldig und mitfühlend zu sein.
Wie frühkindliche Traumata dich heute beeinflussen
Die Wahrheit ist: In Beziehungen wiederholen wir das, was wir kennen. Wenn wir in einer belastenden oder chaotischen Umgebung aufgewachsen sind, uns keine gesunden Verhaltensweisen abschauen konnten oder emotional vernachlässigt beziehungsweise ignoriert wurden, dann wiederholen wir als Erwachsene diese Dynamik in unseren Beziehungen. Auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, ist unsere Vergangenheit, vor allem die Bindung an unsere Elternfiguren, geistig und körperlich in uns abgespeichert. Das wiederum treibt uns dazu, als Erwachsene die gleiche Art von Beziehung zu suchen und zu wiederholen. Dies sind unsere Traumabindungen, unsere konditionierten Beziehungsmuster, die unsere früheste Bindung an unsere Bezugspersonen widerspiegeln.
Bevor wir tiefer in dieses Thema einsteigen, finde ich es sinnvoll, einige Konzepte zu erklären, mit denen ich in diesem Buch immer wieder arbeiten werde.
Beginnen wir mit dem Wort Trauma. Wenn Leute diesen Begriff hören, denken sie unwillkürlich an Menschen, die schlimme Erfahrungen durchleben wie Naturkatastrophen, Kriege, Vergewaltigung, Inzest oder Missbrauch.
Obwohl all diese Erlebnisse ein Trauma verursachen können, entsteht ein solches auch durch Belastungen, die unsere Fähigkeit übersteigen, diese zu verarbeiten, denn dies sorgt für eine dauerhafte Dysregulation im Nervensystem. Dazu gehört auch der unglaubliche Stress, der auftritt, wenn wir nicht das bekommen, was wir brauchen, um uns sicher zu fühlen, zum Beispiel emotionale Unterstützung. Wenn wir uns immer wieder nicht sicher und geborgen fühlen oder wenn die Menschen, die wir für unser Überleben brauchen, für uns nicht durchgängig verfügbar sind, erfahren wir dies als Mangel an Sicherheit und Kontrolle. Dadurch wird der Stress-Schaltkreis im Körper aktiviert, den wir auch als HHN-Achse kennen, die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinde-Achse (von der wir noch mehr hören werden).1 Sie beeinflusst die Fähigkeit unseres Körpers, mit der aktuellen Situation fertig zu werden.
Aber es kann auch zu Traumata kommen, wenn wir wegen unserer Gefühle dauerhafte Beschämung erfahren oder emotional vernachlässigt werden. Auch dies aktiviert den Stress-Schaltkreis und führt zu einer traumatischen emotionalen Überforderung. Das kann in einem Augenblick passieren (was bei einigen der oben aufgeführten Erlebnissen der Fall ist) oder sukzessive, sodass sich – meist ohne dass wir es bemerken – eine traumatische Erfahrung in uns aufbaut. Wenn wir unsere emotionalen Reaktionen nicht verarbeiten können, prägen sie sich unserem Geist und Körper ein und beeinflussen schließlich auf Jahre hinaus unser gesamtes Denken, Fühlen und Handeln.
Zu dem Stress, den wir innerhalb unserer Familie erleben, kommen noch systemische, kulturelle oder kollektive Traumata, die sehr viele von uns beeinträchtigen. Auch sie verhindern, dass wir die unterstützenden Beziehungen eingehen können, die wir für unsere emotionale Sicherheit bräuchten. Ein kollektives Trauma bildet sich, wenn ein Ereignis oder eine Reihe von Ereignissen bei einer Gruppe von Menschen, einer Gemeinschaft, in einem Land oder der Welt insgesamt einen Mangel an Sicherheit hervorruft. Das ist zum Beispiel bei Naturkatastrophen der Fall, bei einer wirtschaftlichen Rezession, bei finanziellen Unsicherheiten, Kriegen, Kolonialismus oder anderen Formen rassistischer und/oder systemischer Ungleichheit, kultureller oder geschlechtsbedingter Unterdrückung, aber auch bei Pandemien. Kollektive Traumata beeinflussen die Art, wie Menschen zu sich selbst und zu anderen in Beziehung treten. Sie wirken auf jeden Menschen anders, je nachdem, wie wir konditioniert wurden und welche Bewältigungsstrategien uns die Generationen vor uns vorgelebt haben.
So wie unsere emotionalen Erfahrungen einzigartig sind, so hat jeder von uns unterschiedliche Reaktionsmuster und erlernte Bewältigungsstrategien, abhängig von unserer Konditionierung in der Kindheit – und dies auch, wenn wir keine bewusste Erinnerung an diese Zeit haben. Wenn du je eine herkömmliche Therapie gemacht hast oder dich für Verhaltensforschung interessierst, kennst du vermutlich das Konzept der Konditionierung. Damit ist der Prozess gemeint, in dessen Verlauf Überzeugungen, Verhaltensweisen und Gewohnheiten durch ständige Wiederholung von Erfahrungen in unserem Unbewussten verankert werden, wo sie dann unsere automatischen Handlungen, Interessen und Beweggründe steuern.
Natürlich können wir als Erwachsene neue Gewohnheiten ausbilden, indem wir neue Entscheidungen treffen. Der Großteil unserer Konditionierungen aber entsteht in unseren frühen Lebensjahren und hängt von der Beziehung zu unseren Elternfiguren ab. Der Begriff Elternfiguren wird dir im Buch immer wieder begegnen. Er bezieht sich auf die unmittelbaren Bezugspersonen, die für die Erfüllung deiner körperlichen und emotionalen Bedürfnisse als Säugling oder Kleinkind verantwortlich waren. Für die meisten Menschen sind Elternfiguren die biologische Mutter, der biologische Vater oder beide. Aber der Begriff kann sich auch auf Großeltern, Stiefeltern, Pflegeeltern, Geschwister, Erzieher oder andere berufliche oder private Betreuer beziehen.
Als Kinder haben wir uns instinktiv an unseren Bezugspersonen orientiert, ganz egal, wer sie waren oder ob wir zu ihnen eine »gute« oder »schlechte« Beziehung hatten. Wir übernahmen von ihnen instinktiv Informationen über uns selbst und die Welt. Wir lernten, wie wir unsere Gefühle ausdrücken (oder unterdrücken) müssen, wie wir uns zu unserem Körper verhalten sollen, wie wir uns anpassen können und soziale Akzeptanz finden (das heißt, welche Verhaltensweisen richtig sind und welche nicht) und wie wir zu anderen in Beziehung treten sollen. Wir haben all diese Gewohnheiten und Überzeugungen erlernt, indem wir die Menschen um uns herum beobachtet und ihr Verhalten nachgeahmt haben.
Alle kleinen Kinder ahmen ihre Elternfiguren nach. Das hast du vermutlich schon mal beobachtet, wenn kleine Kinder lächeln oder die Zunge rausstrecken, weil Mutter oder Vater ihnen das vorgemacht haben. Kleine Kinder kopieren den Großteil dessen, was ihre Elternfiguren tun. Wenn unsere Bezugspersonen sich für ihre Gefühle schämten oder sie unterdrückten, tun wir vermutlich dasselbe. Wenn sie ihren Körper kritisierten oder den anderer Menschen, dann kritisieren wir auch unseren. Wenn sie auf belastende Situationen mit Geschrei reagierten, machen wir das vermutlich genauso. Zogen sie sich hingegen in so einer Situation zurück und ignorierten ihr Gegenüber, dann haben wahrscheinlich auch wir gelernt, uns emotional abzukoppeln.
Um zu lernen, wie wir uns in unserer emotionalen Welt bewegen können, müssen wir uns zuerst so sicher fühlen, dass wir auszudrücken wagen, was wir wirklich denken und fühlen. Gerade diese Fähigkeit aber wird massiv davon beeinflusst, wie wir uns in unseren frühesten Beziehungen gefühlt haben. Die Bindungstheorie, 1952 aufgestellt von dem Psychoanalytiker John Bowlby, besagt, dass das Gefühl der Sicherheit, das wir im Umgang mit unseren Bezugspersonen entwickeln, für den Rest unseres Lebens bestimmt, welche Beziehungen zu anderen Menschen wir anstreben.2 Wenn unsere frühkindliche Bindung zu unseren Elternfiguren sicher war und wenn unsere körperlichen und emotionalen Bedürfnisse grundsätzlich erfüllt wurden, dann nehmen wir höchstwahrscheinlich auch als Erwachsene unsere Bedürfnisse ernst. Menschen mit einem sicheren Bindungsstil vertrauen sich selbst und anderen eher. Sie sind emotional resilient, was bedeutet, dass sie unangenehme Gefühle besser verarbeiten und sich davon schneller erholen können. Vertrauen, also die Überzeugung, dass jemand oder etwas emotional verlässlich ist, baut sich mit der Zeit auf, wenn das Handeln unseres Gegenübers widerspruchsfrei, zuverlässig und vorhersagbar ist. In einer Beziehung ist dies das Gefühl, dass du dich darauf verlassen kannst, dass dein Partner oder deine Partnerin sich auf eine bestimmte Weise verhält.
Viele von uns aber wachsen nicht mit solchen sicheren Bindungen auf, weil bereits die Bedürfnisse ihrer Elternfiguren in deren frühkindlichen Beziehungen nicht erfüllt wurden. Mit dem Ergebnis, dass auch unsere körperlichen und/oder emotionalen Bedürfnisse in der frühkindlichen Phase nicht erkannt oder erfüllt wurden. Als Erwachsene können wir dann unsere Bedürfnisse nicht erkennen oder erfüllen, weil wir das als Kinder nicht gelernt haben. Wir trauen uns selbst und anderen Menschen nicht und reagieren häufig impulsiv, weil uns die emotionale Resilienz fehlt, um mit unangenehmen Gefühlen umzugehen, ob es sich nun um ganz bestimmte Emotionen wie Stress, Trauer oder Wut handelt oder um unangenehme Gefühle im Allgemeinen. Wir lassen uns selbst immer wieder im Stich, wenn wir unsere Zeit, Energie und emotionalen Ressourcen einsetzen, um andere dazu zu bringen, für uns zu sorgen. Oder wir koppeln uns ganz von der Unterstützung durch andere Menschen ab.
Ob unsere frühkindlichen Bindungen nun sicher oder unsicher waren: Diese gewohnheitsmäßigen Beziehungsmuster prägen sich unserem Unbewussten ein und bleiben dort verankert. Fortan laufen sie automatisch und instinktiv ab und ziehen uns auch als Erwachsene ständig in eine ähnliche Beziehungsdynamik hinein.
Wie die unerfüllten Bedürfnisse deiner Kindheit dich treiben
Bevor wir unsere Bindungsmuster erkunden, sollten wir uns ansehen, was unerfüllte kindliche Bedürfnisse sein können. Diese unerfüllten Bedürfnisse können auf körperlicher oder seelischer Ebene entstanden sein; erstere sind gewöhnlich leichter zu verstehen.
Rein physiologisch gesehen funktionieren unsere Körper alle gleich. Unsere Lungen reichern unser Blut mit Sauerstoff aus der uns umgebenden Luft an. Unsere Zellen liefern uns Energie, indem sie die Nährstoffe in unserer Nahrung verwerten. Unsere Muskeln bewegen uns und ermöglichen uns, schwere Dinge zu heben oder zu tragen. Diese strukturellen Gegebenheiten sind allen Menschen gemein, mit dem Ergebnis, dass wir alle die gleichen grundlegenden körperlichen Bedürfnisse haben: Wasser, Sauerstoff, Nährstoffe und ein ausgeglichenes Verhältnis von Ruhe und Bewegung.
Wurden deine körperlichen Bedürfnisse in der Kindheit nicht erfüllt, dann hattest du vielleicht nicht genug zu essen, keine angemessene Kleidung, nicht genug Platz für körperliche Bewegung oder keine Ruhe, um dich zu erholen. Oder du hast dich aus anderen Gründen nicht sicher gefühlt, vielleicht wegen finanzieller Probleme oder rassistischer Diskriminierung. Zu diesen unerfüllten physischen Bedürfnissen gehören auch subtilere Mangelzustände, zum Beispiel, dass du nie richtig im Arm gehalten oder getröstet wurdest, weil du oft allein warst oder deine Bezugspersonen sich mit Körperkontakt nicht wohlfühlten. Oder du hast nicht genug Schlaf bekommen, weil es bei dir zu Hause laut oder chaotisch zuging. Viele Menschen haben auch als Erwachsene unerfüllte körperliche Bedürfnisse, weil ihnen die finanziellen Mittel fehlen, um angemessen für ihren Körper zu sorgen oder sich in ihrer Haut sicher und wohlzufühlen. Was auch immer die Ursache sein mag: Wenn unsere körperlichen Bedürfnisse nicht verlässlich erfüllt werden, aktiviert unser Körper eine Reaktion des Nervensystems, die uns in den Überlebensmodus schaltet und unsere emotionalen Bedürfnisse aufs Abstellgleis schiebt.
Noch häufiger als physische Bedürfnisse werden nämlich emotionale Bedürfnisse nicht erfüllt. Fast jeder Mensch, den ich kenne, ist mit unerfüllten emotionalen Bedürfnissen aufgewachsen, selbst wenn er oder sie noch so wohlmeinende Elternfiguren hatte. Das ist auch nicht sonderlich überraschend angesichts der vielen Stunden, die unsere Eltern schuften mussten, um uns finanziell zu versorgen. Wie sollte jemand, der ständig Überstunden macht, kaum Schlaf findet, sich nicht gesund ernähren kann und mit dem eigenen Stress kaum fertig wird, einen anderen Menschen emotional angemessen versorgen? Das funktioniert einfach nicht.
Dieser sozialen Realität mit all ihrer Ungerechtigkeit zum Trotz haben wir alle grundlegende emotionale Bedürfnisse, um die wir uns kümmern müssen. Das stärkste Bedürfnis, das wir alle – ob Kind oder Erwachsener – in Beziehungen haben, ist, sich sicher genug zu fühlen, um ganz wir selbst zu sein, ohne die Verbindung zu den anderen und deren Unterstützung zu verlieren. Wenn wir uns sicher genug fühlen, um ehrlich zu äußern, was wir denken und wie wir die Dinge erleben, stellt dies emotionale Nähe her. Uns emotional verletzlich und ehrlich zeigen zu können, ganz egal, was wir empfinden, heißt, dass wir uns stärker öffnen können. Nimm dir doch bitte kurz Zeit, um über die folgenden Fragen nachzudenken. Sie zeigen dir, wie sicher du dich in deinen verschiedenen Beziehungen fühlst.
Fühle ich mich auf körperlicher und emotionaler Ebene sicher mit dir verbunden?Habe ich das Gefühl, dass ich und/oder unsere Beziehung dir wichtig sind?Fühle ich mich von dir geliebt und gehalten, auch in Augenblicken der körperlichen oder emotionalen Distanz?Wenn wir uns auf emotionaler Ebene sicher fühlen, können wir uns darauf verlassen, dass unser Gegenüber uns so sieht, akzeptiert und wertschätzt, wie wir sind. Dass er oder sie uns den Raum gibt, um uns zu verändern und zu entwickeln. Und dass ihm oder ihr unser Wohl am Herzen liegt. Erleben wir diese Sicherheit schon in unseren frühesten Bindungen, entwickeln wir die Fähigkeit, auf unsere physische Verbindung zum Körper zu vertrauen, auf seine Möglichkeiten, Stress und andere schwierige Emotionen zu bewältigen. Wir fühlen uns in unserer emotionalen Welt sicher verankert und können uns anderen Menschen gegenüber authentisch zeigen. Wir haben Vertrauen in unsere Beziehungen, weil wir wissen, dass wir nach einem Konflikt oder Zeiten mangelnder Verbundenheit trotz allem wieder eine Verbindung herstellen können.
Damit eine Elternfigur einem Kind helfen kann, sich dauerhaft wertgeschätzt (gesehen, gehört und gewürdigt) und geliebt zu fühlen, muss sie selbst in der Lage sein, diese Empfindungen konsequent zu fühlen. Doch die meisten Elternfiguren können das nicht, weil sie nie die Fähigkeit erworben haben, ihre Emotionen zu regulieren – aufgrund ihrer eigenen Kindheitstraumata (und der daraus resultierenden Dysregulation des Nervensystems, mit der wir uns weiter unten beschäftigen werden). Infolgedessen haben die meisten von uns in der Kindheit nicht die emotionale Sicherheit erlebt, die sie gebraucht hätten, um ganz sie selbst zu sein oder ihr authentisches Selbst mit anderen zu teilen. Was wiederum dazu führt, dass wir uns häufig zutiefst wertlos und emotional allein fühlen.
Haben unsere Elternfiguren keine emotionale Sicherheit erfahren, konnten sie kein Umfeld schaffen, in dem wir unser authentisches Selbst hätten erkunden und ausdrücken können. Mit dem Ergebnis, dass wir uns von ihnen emotional vernachlässigt oder überbeansprucht fühlten. Wir wurden alleingelassen mit der Frage, wie wir mit unseren belastenden Emotionen und Erfahrungen zurande kommen sollen. Emotionale Vernachlässigung in der Kindheit aktiviert dieselben Schaltkreise im Gehirn, die auch für die Schmerzerfahrung zuständig sind. Das heißt, dass Körper und Geist in eine Stressreaktion verfallen, die Traumata hervorrufen kann.
Mangelnde emotionale Sicherheit in der Kindheit kann viele Gesichter haben: Wir werden ignoriert, kritisiert oder angeschrien, wenn wir unterschiedliche Emotionen ausdrücken. All das führt häufig zu der Überzeugung, dass wir einfach »zu anstrengend« sind, was unseren Selbstausdruck erschwert. Vielleicht aber verbietet man uns auch, eine Leidenschaft oder ein Interesse zu verfolgen, weshalb wir uns verunsichert fühlen und nicht einmal als Erwachsene wissen, wer wir eigentlich sind.
In der Folge findest du ein paar Situationen beschrieben, die ein Indiz dafür sein könnten, dass deine emotionalen Bedürfnisse in der Kindheit nicht erfüllt wurden – wobei diese Auflistung beileibe nicht erschöpfend ist.
Deine Elternfiguren konnten dich nicht als eigenständiges Wesen sehen und haben dich behandelt, als wärst du eine Fortsetzung ihrer selbst. Sie haben dir das Gefühl gegeben, in ihre Fußstapfen treten und ihre Überzeugungen, Emotionen, ihre äußere Erscheinung und sogar ihre berufliche Laufbahn übernehmen zu müssen. Folglich bist du als Erwachsene nie ganz sicher, wer du bist, woran du glaubst, was du empfindest oder wo deine Interessen liegen. Deine Bezugspersonen konnten dir nicht verlässlich Aufmerksamkeit widmen, entweder weil sie nicht wussten, wie sie das anstellen sollen, oder weil sie abgelenkt waren von ihrer Arbeit, ihren Beziehungen, finanziellen Belastungen oder unbewältigten Traumata. Dementsprechend legst du als Erwachsener großen Wert auf deine Unabhängigkeit, du koppelst dich von anderen ab und glaubst, keine Beziehungen oder Unterstützung von außen zu brauchen. Deine Elternfiguren nahmen vieles persönlich und wurden schnell defensiv oder ließen sich zu überschießenden emotionalen Reaktionen hinreißen. Die Schuld für ihre vielfältigen Probleme oder Konflikte gaben sie anderen Menschen, auch dir. Als Erwachsene machst du dir nun ständig Sorgen, ob auch alles in Ordnung ist. Du wendest dich anderen zu, um dich besser zu fühlen, weil du unfähig zur Selbstregulierung bist. Meist versuchst du zu beschwichtigen oder dich einzuschmeicheln, um Konflikte zu vermeiden. Deine Bezugspersonen hatten zwei Persönlichkeiten: eine für zu Hause, die dir gegenüber kritisch, beschämend oder zurückweisend war; die andere für die Öffentlichkeit, wo sie sich dir gegenüber warm, liebevoll und zugewandt gaben. Als Erwachsener stehst du unter dauernder Anspannung und kannst die Absichten oder das Verhalten der Menschen in deiner Umgebung nicht deuten, was dich noch mehr verunsichert. Deine Elternfiguren prahlten vor anderen Menschen gerne mit deinen Leistungen, während sie dich ignorierten, wenn du kein Lob oder keine guten Noten nach Hause brachtest. Als Erwachsene fühlst du dich wertlos, nicht liebenswert oder leer, wenn du von außen keine Bestätigung bekommst. Deine Bezugspersonen haben deine Ansichten oder Gefühle regelmäßig abgelehnt, nicht ernst genommen oder ignoriert. Als Erwachsener siehst du die Welt fast immer schwarz-weiß (beziehungsweise als »richtig« oder »falsch«, »gut« oder »schlecht«). Bei Konflikten wertest du die Position deines Gegenübers gerne ab oder kannst sie erst gar nicht erkennen. Deine Elternfiguren haben sich hauptsächlich um sich selbst und ihre Bedürfnisse gekümmert. Sie haben dir immer wieder unter die Nase gerieben, was sie alles für dich getan haben und welche Opfer sie deinetwegen bringen mussten. Daher fühlst du dich als Erwachsene immer in der Schuld anderer Menschen und denkst, dass es Selbstsucht ist, wenn du eigene Bedürfnisse anmeldest.Meine unerfüllten emotionalen Bedürfnisse
Obwohl mir das nicht bewusst war, bevor ich mit meiner inneren Arbeit begann, habe ich mich als Kind in meiner Umgebung nicht sicher, wertgeschätzt und um meiner selbst willen geliebt gefühlt. Meine Mutter war für mich emotional nicht erreichbar, weil sie unter chronischen Schmerzen litt. Das ging schon los, als ich noch klein war, und blieb so bis ins Erwachsenenalter. Da sie ständig im Überlebensmodus und entsprechend abgelenkt war, konnte sie nicht viele Gefühle zeigen – abgesehen von der Sorge um mein Wohlergehen und vom Lob, wenn ich wieder eine gute Leistung erbracht hatte. Später wurde mir erzählt, dass sie mit uns umging wie eine Sanitäterin. Sie fütterte und versorgte uns, ohne sich emotional auf uns einzustellen. Physisch gesehen war mein Vater sehr präsent in meinem Leben, er spielte mit mir und hielt meine rastlose Natur auf Trab, doch auch er war emotional distanziert und sprach nur selten über seine Gefühle, außer er hatte Stress oder Ärger mit anderen Leuten. Meine Schwester ist fünfzehn Jahre älter als ich und hat mich mit erzogen. Sie verbrachte Zeit mit mir, wenn meine Mutter nicht dazu in der Lage war. Aber auch sie hatte in der Beziehung zu unseren Eltern gelernt, sich emotional abzukapseln.
Alle Kinder haben geistig und emotional ein höchst aktives Innenleben. Ich war da nicht anders. Aber wann immer ich meine Gefühle zum Ausdruck brachte oder versuchte, emotionale Erfahrungen mit meiner Mutter zu teilen, zeigte sie sich besorgt und war bemüht, so schnell wie möglich das Problem zu lösen, das bei uns beiden unangenehme Gefühle verursachte. Oder sie versuchte, mein Verhalten zu kontrollieren, um ihre eigene Verwundbarkeit, ihre Wut, ihre Trauer oder Enttäuschung zu lindern. Dann sagte sie Dinge wie: »Ach, bitte, sage oder tu [x oder y] nicht, sonst bin ich traurig.« Oder: »Könntest du [x oder y] für mich tun, dann muss ich mir keine Sorgen machen.«