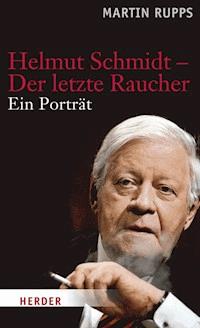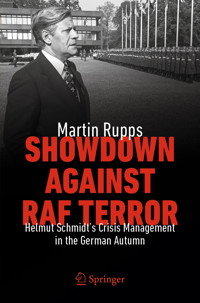Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: HERDER spektrum
- Sprache: Deutsch
Helmut Schmidt zählt zu den bedeutendsten Kanzlern der Bundesrepublik Deutschland. Für viele verkörperte er den Idealtyp des deutschen Regierungschefs: Erster Diener des Staates, unbestechlich in seiner Urteilsbildung, weltmännisch handelnd und von festen moralischen Überzeugungen getragen. Martin Rupps zeichnet das Leben des Alt-Bundeskanzlers, ZEIT-Herausgebers und bedeutenden Elder Statesman nach: Seine Erfolge, seine Niederlagen, seine persönlichsten Herausforderungen. Die Bilanz eines Lebens und die Würdigung eines der beliebtesten deutschen Politiker der Nachkriegsgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Rupps
Helmut Schmidt
Ein Jahrhundertleben
Impressum
Titel der Originalausgabe: Helmut Schmidt
Ein Jahrhundertleben
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2008, 2013
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2014
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: © dpa/picture alliance
Foto des Autors: © Felicitas von Lutzau
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN (E-Book): 978-3-451-80387-1
ISBN (Buch): 978-3-451-06682-5
Für J. Röhmin Dankbarkeit
Inhalt
Aussöhnung nach 36 Jahren
Ein wechselvolles Leben
Persönliche Bilder vom Kanzler Helmut Schmidt
Ein ernster, pflichtbewusster Mann
Durch harte Arbeit zu etwas kommen
»Politik ist nichts für euch«
Der verheimlichte jüdische Großvater
Im Krieg »irgendwie Glück gehabt«
Gewissheit im Glauben
Gelernter Sozialdemokrat
Der kommende Mann
Drei Politikfelder zur Auswahl
In einer Lebenskrise
Vier Hausapotheker
Anleihen bei einem römischen Kaiser
Schmidts kategorischer Imperativ
»Im Dienen verzehre ich mich«
Pragmatismus in sittlicher Absicht
Gesinnungsethik versus Verantwortungsethik
Plädoyer für schrittweise Veränderungen
»Ich finde Koalitionen etwas Mieses«
Tugendlehre für Politiker
Konzentration auf das Machbare
Kargheit nach dem Überfluss
Nüchternheit total
Die SPD und Helmut Schmidt – eine erbitterte Freundschaft
Andere Schwerpunkte als Brandt
Die Handschrift eines Kanzlers
Gesellschaft im Wandel
Wozu die Kirche berufen ist und wozu nicht
Jedermann sei untertan der Obrigkeit
Wie viel Orientierung braucht das Volk?
Geistige Führung durch persönliches Beispiel
Grenzerfahrungen
Eingeständnis eines Irrtums
Vom Kanzler gewarnt, aber nicht gerettet: Hanns Martin Schleyer
Die Einsamkeit des Entscheiders
Klein, aber oho!
Attacke aus Israel
Ende oder Wende!
Ein »Technokrat« auf dem Kanzlerstuhl?
Neue soziale Bewegungen
»Eindimensional, naiv, gefährlich«
Zankapfel NATO-Doppelbeschluss
Phalanx gegen eine Kanzlerinitiative
Ohne Gleichgewicht gibt es keinen Frieden
Politik machen im Geist der Bergpredigt?
Angst als Vorstellung, Angst als Erfahrung
Feldherr ohne Truppen
Die SPD rückt von ihrem Kanzler ab
Schmidt zwischen Leben und Tod
In der Weltpolitik zu Hause
Der Bundeskanzlerpräsident
Helmut Schmidt und die Menschen
Späte Genugtuung
Sinkende Qualität der Politiker
Annäherung an Brandt und Kohl
Plädoyer für eine öffentliche Moral – in Deutschland und in der Welt
Wieder ein sozialdemokratischer Kanzler
Der letzte Raucher
Ein Lotse für die Berliner Republik
Was bleibt?
Ein Wort des Dankes
Zum Weiterlesen: Bücher und DVDs von und über Helmut Schmidt – Eine Auswahl –
Personenverzeichnis
»Dahinter steht eine lebenslange gewaltige Arbeit mit sich selbst, ein Ringen mit den Konflikten des Menschen in seiner Zeit, eine Auseinandersetzung mit der Spannung zwischen Verstand und Gefühl, Leidenschaft und Disziplin, Idee und kritischer Rationalität, Interesse und Moral, Gesinnung und Verantwortung, dem großen Wurf und dem kleinen Schritt.«
Aus der Rede von Bundespräsident Richard von Weizsäcker zum 70. Geburtstag von Helmut Schmidt am 22. Dezember 1988 in Bonn
»In der SPD ist es wie früher: Am Ende hat Helmut Schmidt immer recht.«
Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel am 28. September 2012 bei der Pressekonferenz anlässlich der Berufung von Peer Steinbrück zum SPD-Kanzlerkandidaten in Berlin
»Das Rauchen ist ein harmloses Laster.«
Helmut Schmidt im Gespräch mit Giovanni di Lorenzo, ZEIT-Magazin Nr. 52/2012
Aussöhnung nach 36 Jahren
Stuttgart, 26. April 2013. Dem früheren Bundeskanzler Helmut Schmidt wird der Hanns Martin Schleyer-Preis des Jahres 2012 verliehen. Der Preis trägt den Namen des im Herbst 1977 von Terroristen der Roten Armee Fraktion entführten und später ermordeten Präsidenten der Arbeitgeberverbände und würdigt Menschen wegen ihrer »Verdienste um die Festigung und Förderung der Grundlagen eines freiheitlichen Gemeinwesens«. Hanns Martin Schleyer-Preise werden von der Hanns Martin Schleyer-Stiftung seit 1985 alle zwei Jahre verliehen. Frühere Preisträger aus der Politik waren Karl Carstens, Klaus von Dohnanyi und Helmut Kohl.
Dieses Mal ausgerechnet Helmut Schmidt – jener Politiker, in dessen persönlicher Entscheidung und Verantwortung das Handeln der Bundesregierung im Fall Schleyer und in dessen Händen damit vermeintlich das Schicksal des Mannes lag. Schleyer selbst drängte in bewegenden Videobotschaften immer wieder auf eine Entscheidung, wirkte mit jeder neuen Entführungswoche verzweifelter. Doch der Kanzler hatte sich und das politische Bonn auf eine Verzögerungstaktik eingeschworen. Die Politik musste Zeit gewinnen, damit die größte Fahndungsaktion in der deutschen Nachkriegsgeschichte Erfolg haben könnte.
Helmut Schmidt war in jenem »Deutschen Herbst«, als der diese Zeit in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingehen wird, Bundeskanzler und Vorsitzender der politischen Krisenstäbe. Als er die Nachricht von Schleyers Entführung erhält, weiß er rasch, dass er die Forderungen der Entführer nicht erfüllen, dass er hart bleiben wird – für dieses Mal hart bleiben wird. Zweieinhalb Jahre zuvor hatte er, krank und geschwächt von 40 Grad Fieber, der Freilassung von Terroristen zugestimmt, im Austausch gegen den entführten CDU-Politiker Peter Lorenz. Die freigepressten Terroristen hatten nachweislich wieder Straftaten begangen. Noch einmal würde, so war sich Helmut Schmidt seit dem Fall Lorenz sicher, eine von ihm geführte Bundesregierung nicht mehr in die Knie gehen. »Das hat man euch natürlich nicht erzählen wollen«, so Helmut Schmidt über die Kommunikationsstrategie gegenüber der Familie in einem Gespräch mit Hanns-Eberhard Schleyer, das im Juli 2013 im Magazin der Süddeutschen Zeitung erscheint.
»Der Staat muss darauf mit aller Härte antworten«, sagt Helmut Schmidt schon vier Stunden nach den Morden an Schleyers Begleitern und der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten in einer Fernsehansprache. Schmidts Ausdruck ist dabei tief ernst und entschlossen. Die meisten Deutschen finden diesen Ausdruck angemessen. Auf wenige wirkt er hartherzig, ja kalt. Bei seiner Haltung wird Helmut Schmidt bleiben.
Die Familie von Hanns Martin Schleyer, seine Ehefrau Waltrude und die vier Söhne Hanns-Eberhard (33), Arnd (28), Dirk (25) und Jörg (23) führen einen verzweifelten, einsamen Kampf. Zu ihrem Sprecher wird Hanns-Eberhard, Jurist, noch jung im Beruf, ein persönlich beherrschter, besonnener Mann. Mit Hilfe der BILD-Zeitung bringt die Familie ihre Forderung an die Öffentlichkeit, die Bundesregierung möge alles tun, um das Leben des Vaters zu retten. Hanns-Eberhard Schleyer verhandelt direkt mit den Entführern. »Wir töten Ihren Vater!«, sagen sie zu ihm am Telefon. Zweimal versucht er Geld zu übergeben, was von der Bundesregierung jeweils durchkreuzt wird. Helmut Schmidt schickt Justizminister Hans-Jochen Vogel zu Waltrude Schleyer, um ihr namens der Bundesregierung die Botschaft zu bringen: Der Staat darf nicht nachgeben. (Was so viel heißt wie: Der Staat wird nicht nachgeben.) Und Vogel, der in diesen Tagen zum Glauben zurückfindet, ergänzt ganz persönlich: Bitten Sie Gott um Hilfe. Doch die Familie will sich nicht allein auf Gott verlassen und ruft das Bundesverfassungsgericht an, vergeblich. Das Gericht stellt der Bundesregierung die Entscheidung im Fall Schleyer anheim.
Es werden qualvolle Wochen für Hanns Martin Schleyer und seine Familie, auch bedrückende für die deutsche Öffentlichkeit, die am Schicksal dieses Mannes ohnmächtig Anteil nimmt. Als palästinensische Terroristen die Lufthansa-Maschine »Landshut«, die überwiegend deutsche Urlauber von Palma de Mallorca nach Frankfurt fliegen soll, in ihre Gewalt bringen, um die Forderung der Schleyer-Entführer zu unterstützen, schöpft die Familie wieder Hoffnung, weil sie nicht glaubt, dass die Bundesregierung das Leben von Passagieren und Besatzung aufs Spiel setzen wird. Hanns-Eberhard Schleyer hofft auf einen Trick der Bundesregierung, mit dem alle Ziele – die Befreiung seines Vaters und der »Landshut«-Geiseln, die Wahrung der inneren Sicherheit – erreicht würden: Die Terroristen kommen zum Schein frei; nachdem auch alle Geiseln frei sind, werden die Terroristen wieder verhaftet. Aber diese Handlungsvariante bleibt im Bonner Krisenstab ein Gedankenspiel, sie wird nie zur ernsthaft erwogenen Option. Offenbar überwiegt die Sorge, dass eine solch komplexe, riskante Aktion scheitern könnte.
Als sich die »Landshut« in der Gewalt der Entführer befindet, spitzt sich die Lage dramatisch zu. Eine über 100 Stunden dauernde Odyssee endet am Horn von Afrika, in der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Schmidt sieht sich vor die Wahl gestellt, die Menschen in der Maschine oder Hanns Martin Schleyer zu retten. »Von dem Augenblick an, als das Flugzeug entführt worden war, waren die 87 Personen an Bord wichtiger als die eine Person«, wird Helmut Schmidt im Juli 2013 sagen. Er entscheidet, die »Landshut« von einer deutschen Spezialeinheit stürmen zu lassen. Die Geiseln, mit Ausnahme des Piloten Jürgen Schumann, der von den Terroristen bereits auf dem Flughafen von Aden erschossen worden war, kommen mit allenfalls leichten Verletzungen frei. Welch ein Wunder! Zugleich ist es das wahrscheinliche Todesurteil für Hanns Martin Schleyer. Darüber macht sich auch die Familie keine Illusionen. Sie muss glauben, dass die Bundesregierung den Ehemann und Vater aufgegeben hat. Am nächsten Tag wird die Leiche des Arbeitgeberpräsidenten gefunden. Die Familie, besonders Waltrude Schleyer, macht Helmut Schmidt persönlich für den Tod des Ehemanns und Vaters verantwortlich. Hätte er einen Austausch gegen die inhaftierten Terroristen angeordnet, wäre Hanns Martin Schleyer freigekommen. Waltrude Schleyer verhindert, dass der Bundeskanzler bei der Trauerfeier für Hanns Martin Schleyer spricht. »Wir wissen, wir sind in Hanns Martin Schleyers Schuld«, sagt stattdessen Bundespräsident Walter Scheel. Helmut Schmidt sitzt tief gebeugt neben Schleyers Witwe. Zuvor hatte er ihr kondoliert, aber dabei nicht in ihre Augen, sondern zu Boden geblickt.
Auch Helmut Schmidt wird in Reden immer wieder bekennen, am Tod von Hanns Martin Schleyer eine Mitschuld empfunden zu haben. Das nötigt der Familie Respekt ab, »ein Trost war es nicht«, so Hanns-Eberhard Schleyer im Magazin der Süddeutschen Zeitung vom Juli 2013.
Ein Jahr später sehen sich Hanns-Eberhard Schleyer und Helmut Schmidt wieder. Als Helmut Schmidt erfährt, dass Hanns-Eberhard Schleyer zur selben Veranstaltung kommt, bittet er ihn, an seinem Tisch Platz zu nehmen. Doch zwischen den beiden Männern kommt so recht kein Gespräch in Gang. »Helmut Schmidt hat sehr wenig gesagt. Er war gehemmt. Vielleicht gab es damals einfach noch nichts zu sagen«, so Hanns-Eberhard Schleyer über diese Begegnung. Weitere Begegnungen folgen, aber eine Annäherung in der Sache bleibt offenbar aus. Er habe Helmut Schmidt deutlich gemacht, »dass es eine Position der Familie gibt«, sagt Hanns-Eberhard Schleyer in einem Fernsehgespräch mit Peter Voß im Oktober 2012.
Waltrude Schleyer und die vier Kinder müssen mit dem Trauma leben lernen. Die Ereignisse der Herbsttage 1977 werden auch die politischen Entscheider weiter verfolgen. Sie lässt die Frage, ob sie richtig entschieden und gehandelt haben, nicht mehr los. Helmut Schmidt rechtfertigt sich immer wieder (er würde das Wort »rechtfertigen« zurückweisen mit dem Hinweis, er sei ja nicht angeklagt; er würde von einer Erläuterung sprechen), er rechtfertigt sich noch in dem späten Buch »Außer Dienst«, das er 2008 als fast 90-Jähriger veröffentlicht.
Waltrude Schleyer wird zur prominentesten Vertreterin der immer wieder geäußerten These, Hanns Martin Schleyer sei für die Staatsräson geopfert worden, sozusagen ein Menschenopfer für die Demonstration eines starken Staates. »Ich muss das zwar akzeptieren«, sagt Waltrude Schleyer im Jahr 1978, »aber verstehen kann ich es nicht. Wie kann man nur einen unschuldigen Menschen opfern, um stark sein zu wollen?« Es dauert zehn Jahre, bis Waltrude Schleyer erstmals Worte des Verständnisses für Helmut Schmidt findet: Sie habe seinerzeit bei ihm eine »furchtbare Last der Verantwortung« und »echte Trauer gespürt«. »Die Terroristen haben damals gemerkt, dass der Staat nicht erpressbar ist. Das würde vielleicht als einziger Sinn ein solches Opfer rechtfertigen.« Waltrude Schleyer sagt: vielleicht. Gegen Ende ihres Lebens, die Ermordung ihres Mannes jährt sich zum 30. Mal, verhärtet sich ihre Position wieder. Mit der Überzeugung, dass der Staat seinerzeit versagt habe, stirbt Waltrude Schleyer im März 2008 92-jährig in Stuttgart. Im selben Jahr sagt auch Hanns-Eberhard Schleyer noch: »Man hat uns im Grunde genommen hängen und in Ungewissheit bangen und hoffen lassen. Letzteres ist vielleicht das Schlimmste gewesen.«
Erst nach dem Tod der Mutter ist der Weg frei, dass die Familie in neuer, versöhnlicher, weil verzeihender Weise dem Entscheider von damals begegnet. Hanns-Eberhard Schleyer, der für die Familie schon 1977 die Zügel in die Hand nahm, ergreift die Initiative. Eine Rolle mag spielen, dass Helmut Schmidt sehr alt geworden ist und eine Aussöhnung noch persönlich erleben kann. Hinzukommen mag, dass Hanns-Eberhard Schleyer Schmidts unvermindertes Ringen mit diesem Thema anerkennt. »Ich sah damals, wie er mit sich gerungen hat. Es hat ihn ja noch Jahrzehnte gequält«, sagt Hanns-Eberhard Schleyer. Der Entscheider von einst begründet seine damalige Kraft, dem moralischen Druck standzuhalten, mit dem eigenen Kriegserlebnis und dem seiner Mit-Entscheider im politischen Bonn: »Der Krieg war eine große Scheiße, aber in der Gefahr nicht den Verstand zu verlieren, das hat man damals gelernt.« Doch die Entscheidungssituation von einst – zwangsläufig in Schuld verstrickt zu sein, wie immer die Entscheidung ausfällt – lässt auch den über 90-Jährigen nicht los. Noch in seinem Buch »Ein letzter Besuch« (2013) bezeichnet er die Ermordung Schleyers als »meine größte Niederlage«.
Hanns-Eberhard Schleyer fährt im Herbst 2012 zum Altbundeskanzler nach Hamburg, um ihm den nach seinem Vater benannten Preis anzutragen. Es handelt sich um nichts weniger als die Absolution der Familie. Anders als bei der Begegnung von 1978 haben sich die beiden Männer etwas zu sagen. »Dieses Treffen nun war sehr bewegend«, so Hanns-Eberhard Schleyer in der Süddeutschen Zeitung. »Wir haben miteinander gesprochen – wirklich gesprochen.« Helmut Schmidt wird in seinen Dankensworten am Tag der Verleihung sagen: Hanns-Eberhard Schleyers Besuch habe ihn »tief berührt«. Er nimmt in diesem Gespräch den Preis an.
Am 26. April 2013 kommt es im Neuen Schloss in Stuttgart zur Preisverleihung – in jener Stadt, wo die Familie Schleyer lebte und Hanns Martin Schleyer beerdigt ist. Unter den Gästen sind Protagonisten der Zeit, die nun noch einmal in Erinnerung gerufen wird: Helmut Schmidts Regierungssprecher Klaus Bölling und der damalige Kommandeur der Grenzschutzgruppe 9, Ulrich Wegener – er befehligte die Truppe, der die Geiseln in der entführten Lufthansa-Maschine »Landshut« ihre Rettung verdanken. Es sind auch Opfer des deutschen Terrorismus im Saal, Corinna Ponto, Tochter des ebenfalls 1977 von RAF-Mitgliedern ermordeten Dresdner-Bank-Chefs Jürgen Ponto. Gabriele von Lutzau ist hier, Stewardess in der entführten Maschine, tapfere Vermittlerin zwischen Entführern und Passagieren, später von der Presse zum »Engel von Mogadischu« ernannt. Und Jürgen Vietor ist da, der Copilot der entführten Maschine, der das Flugzeug während der gesamten Entführung geflogen hat, nach der Ermordung von Kapitän Jürgen Schumann sogar allein.
Dass es an diesem Freitag um eine Aussöhnung geht, um das Heilen einer offengebliebenen Wunde, wird von den Akteuren eher verklausuliert ausgedrückt. »Es schließt sich ein Kreis«, hatte Hanns-Eberhard Schleyer zuvor gesagt. Die Preisverleihung an Helmut Schmidt sei »auch ein Zeichen der Aufarbeitung des Terrors der sogenannten Rote Armee Fraktion«, erläutert Wilfried Porth, Vorsitzender der Jury, die über die Träger des Hanns Martin Schleyer-Preises entscheidet, gegenüber den »Stuttgarter Nachrichten«. Es bleibe »eine wesentliche Aufgabe unserer Gesellschaft, sich immer wieder neu mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen«.
Der frühere Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing hält die Laudatio auf Helmut Schmidt. Mit keinem Staatsmann war Schmidt während seiner Kanzlerschaft persönlich enger verbunden. Die Freundschaft wird über die politisch aktive Zeit hinaus Bestand haben. Giscard nennt Hanns Martin Schleyer und seine bei der Entführungsaktion erschossenen Begleiter »heldenhafte Menschen«. Allen hier im Saal sei bewusst, »Zeugen eines bedeutenden Versöhnungsakts zu sein«. Auch bei dieser Gelegenheit – oder gerade bei dieser Gelegenheit? – sagt er an Helmut Schmidt gerichtet einen Satz, den er in Abwandlungen oft äußert: »Sie waren ein großer Kanzler.«
Schließlich ergreift der mit dem Preis Geehrte selbst das Wort. Er spricht leise, aber deutlich. Es ist mucksmäuschenstill im Saal. Ihm sei »sehr klar bewusst«, sagt Helmut Schmidt, »dass ich – trotz aller redlichen Bemühungen – am Tode Hanns Martin Schleyers mitschuldig bin. Denn theoretisch hätten wir auf das Austauschangebot der RAF eingehen können.« Er habe die Klage durch Frau Waltrude Schleyer und ihre Kinder vor dem Verfassungsgericht sehr gut verstehen können. Allerdings hätten die Verantwortlichen in Bonn »nicht abermals zulassen können, dass freigepresste Verbrecher ihre mörderische Tätigkeit fortsetzen würden«. Helmut Schmidt beklagt, dass »immer noch und immer wieder die terroristischen Mörder im Vordergrund des öffentlichen Interesses stehen« und nennt es »unsere gemeinsame Verantwortung, dass die Opfer mit ihren Anverwandten unsere Sympathie, unser Mitgefühl und unsere Fürsorge erhalten«.
Nach der Veranstaltung zeigt sich der 94-Jährige »so gelöst wie schon lange nicht mehr« – so jedenfalls empfindet es jemand, der den Altkanzler sehr gut kennt.
Ein wechselvolles Leben
Von den drei »großen« Sozialdemokraten dieser Republik – Herbert Wehner, Willy Brandt, Helmut Schmidt – hat der letzte ein scheinbar unspektakuläres Leben geführt. Keine Brüche durch Krieg und Exil, keine persönlichen Verfemungen, kein politischer Sturz über Nacht. Um die Person Herbert Wehner wird möglicherweise Mysteriöses, nie Aufzuklärendes bleiben – ist er wirklich vom Kommunisten zum überzeugten Demokraten geworden? Welche Nähe hat er auch noch als Demokrat zu Kommunisten gepflegt? Willy Brandt ging mit seiner Ostpolitik in die Geschichte ein, dem Friedensschluss mit den Gegnern des Zweiten Weltkrieges und einer Anerkennung der Grenzen, die dieser Krieg geschaffen hat. In Erinnerung bleiben zugleich die Affäre um den DDR-Spion Günter Guillaume und der Rücktritt so kurz nach einem triumphalen Wahlsieg.
Lässt man die »Stationen« von Helmut Schmidts Leben im Zeitraffer ablaufen, dann ist es ihm scheinbar besser ergangen: Er ist zu jung, um sich für oder gegen das Nazi-Regime aussprechen zu können; er übersteht den Krieg überwiegend hinter der Front, von gefährlichen Monaten im Osten abgesehen. Er macht mit wenigen Umwegen und Verzögerungen Karriere, wird vier Jahre nach seinem Studium Bundestagsabgeordneter der SPD, später Senator in Hamburg, dann Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Minister, »Superminister«, schließlich Bundeskanzler. Von Mitte der sechziger Jahre an ist er der kommende Mann der SPD, nach der Wahl 1972 endgültig Willy Brandts Kronprinz. Schmidt regiert achteinhalb Jahre, deutlich länger als Brandt.
Die parlamentarische Abwahl schmälert keinesfalls sein persönliches Ansehen. Er ist und bleibt der Krisenmanager, dessen beherztes Handeln bei der Hamburger Flut von 1962 Tausenden von Menschen das Leben rettete, und der mit seiner harten Haltung im Deutschen Herbst 1977 zwar nicht Hanns Martin Schleyer retten, aber einen entscheidenden Schlag gegen den RAF-Terrorismus führen konnte. Zu seiner Domäne wird die Weltpolitik. Als die deutsche Wiedervereinigung kommt, wollen ihn viele Deutsche als Regierungschef zurückhaben. Wäre er gesundheitlich dazu in der Lage, würde er es sich vielleicht überlegen. Er bleibt aber Zeitungsherausgeber und Publizist und erzielt mit seinen Büchern höhere Auflagenzahlen als jeder andere schreibende deutsche Politiker der Nachkriegszeit.
Als am 11. September 2001 islamische Terroristen Flugzeuge in das New Yorker World Trade Center und das Gebäude des amerikanischen Verteidigungsministeriums lenken, bittet die Journalistin Sandra Maischberger kurzfristig Helmut Schmidt zum Gespräch. Er ordnet das Ereignis vor tief verstörten Fernsehzuschauern in einen weltpolitischen Zusammenhang ein.
Im Frühjahr 2002 ergibt eine Meinungsumfrage, dass Helmut Schmidt als der »weiseste« deutsche Politiker gesehen wird (knapp vor dem früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker). 2008 stellt eine andere Umfrage fest, Helmut Schmidt sei der »coolste Kerl« Deutschlands, wobei er Prominente wie Til Schweiger und Jürgen Vogel auf die Plätze verweist. Zum Jahresende 2010 kürt die BILD-Zeitung die »100 schönsten Deutschen« – außer Mario Adorf, Manfred von Richthofen und Monsignore Georg Gänswein ist auch Helmut Schmidt dabei.
Es fällt auf, dass Helmut Schmidt längst als Person der Zeitgeschichte gilt, aber durch seine Bücher, seine Artikel in der ZEIT und seine Fernsehgespräche eine Stimme der Gegenwart bleibt. Wer heute fünfzig und älter ist, hat eine klare, meist von Respekt geprägte Vorstellung von Helmut Schmidt. Dabei war er lange genug Kanzler, um sich auch in das Bewusstsein von Jüngeren einprägen zu können.
Willy Brandt und Helmut Schmidt haben politisch ganze Generationen von Westdeutschen geprägt. Brandt öffnete die SPD für die Achtundsechziger-Bewegung und wurde auch vielen Angehörigen der »Generation Z«, das sind die »Zaungäste« der Achtundsechziger, zu einer Leitfigur. Unter Helmut Schmidts Kanzlerschaft wurden die deutschen »Babyboomer« groß, die geburtenstarken Jahrgänge 1959 bis 1964. Wer heute zwischen Ende Vierzig und Ende Fünfzig ist, erlebte die zweite Phase der sozialliberalen Koalition bewusst mit. Viele Babyboomer entwickelten ihr politisches Bewusstsein sogar in Abgrenzung zu dieser Koalition und ihrem Kanzler – sie nahmen an Demonstrationen gegen die sogenannte Nachrüstung von Mittelstreckenwaffen teil, etwa an den kilometerlangen »Menschenketten«.
Doch auch die Generationen »Golf« und folgende, die Helmut Schmidt nicht mehr als Kanzler erlebt haben, lesen seine Artikel und zeigen Interesse an seiner Person. Als sich Helmut Schmidt im Mai 2000 einem Interview über das Internet stellt – prominente und nichtprominente Bürger mailen ihm Fragen, die er spontan beantworten muss –, ist das Echo groß, sogar so groß, dass das Projekt eine Fortsetzung findet. Im Dezember 2001 kommt Sandra Maischberger mit einer Gruppe Jugendlicher in Schmidts Haus, um ihn vor laufender Kamera über Politisches und Unpolitisches zu fragen. Daraus entstehen eine Fernsehdokumentation und ein Buch.
Von Zeit zu Zeit besucht Helmut Schmidt die Gesprächssendungen von Sandra Maischberger, Günther Jauch und Reinhold Beckmann, um jeweils ein neues Buch vorzustellen. Hohe Einschaltquoten sind garantiert! Für die Reihe »Menschen bei Maischberger« ist es jeweils die Spitzenquote eines Jahres. Was Helmut Schmidt sagt und wie er es sagt, interessiert jüngere wie ältere Zuschauer – und wie viele Zigaretten er währenddessen raucht. Mit seinem provozierenden Auftreten steht er zwar für eine andere, vergangene Zeit, aber sein unabhängiges, manchmal schnoddrig vorgetragenes Urteil über tagespolitische Fragen hat Gewicht.
Der ehemalige Hamburger Bürgermeister Ole von Beust hat einmal versucht, dieser Popularität auf die Spur zu kommen. Sinngemäß sagt er: Die Leute wissen, Helmut Schmidt ist ein besonderer Charakter, bestimmt kein einfacher Mensch. »Wir Deutsche sehen in ihm all das, was gut für uns ist.« Fleiß, Anstand, Ehrlichkeit, Fairness, aber auch eine typisch Hamburgerische Art des Charmes und des Humors. »Nicht immer unverletzend, aber klar und eindeutig.«
Die humorige Seite, auch der Humor über sich selbst, ist bei Helmut Schmidt nach seiner Kanzlerzeit stärker hervorgetreten, jedenfalls in dieser sympathischen Deutlichkeit. Das ist aber nicht zu verwechseln mit einer Milde im Urteil. In seinen Auffassungen, auch über politische Zeitgenossen, wurde Helmut Schmidt keinesfalls milder.
Dass Helmut Schmidt den Deutschen weiterhin viel bedeutet, hat nicht zuletzt mit der journalistischen Arbeit von Sandra Maischberger zu tun, die das Vertrauen von Loki und Helmut Schmidt gewinnt. Schon das Gesprächsbuch »Hand aufs Herz« gibt Privates preis – wie die Schmidts ihr Haus in Hamburg-Langenhorn eingerichtet haben, ob sie je Haustiere hatten oder wie es um die Kochkünste von Helmut Schmidt bestellt ist. Das Gespräch kommt auch auf Helmut Walter Schmidt, den gemeinsamen Sohn, der mit neun Monaten gestorben ist. Helmut Schmidt gibt erstmals seinem Schmerz darüber Ausdruck. Diese neue Offenheit – »mir lag am Herzen, persönliche Auskunft zu geben«, schreibt Schmidt im Vorwort – bringt diese Persönlichkeit näher, die sonst Distanz wahrt und von Anderen Distanz verlangt.
Von dieser Offenheit ist auch die Dokumentation »Helmut Schmidt außer Dienst« getragen, die Sandra Maischberger in den Jahren 2003 bis 2006 produziert, wobei ihr Mann Jan Kerhart die Kamera führt. Helmut Schmidt gibt wie immer politisch Auskunft, wird bei Vorträgen im Inund Ausland begleitet. Loki Schmidt spricht offen wie nie zuvor – etwa dass sie im Lauf ihres Lebens mehrere Fehlgeburten hatte, sprich der Wunsch nach einer großen Familie unerfüllt blieb. Besonders eindrucksvoll, ja anrührend, ist das Portrait darüber, wie Loki und Helmut Schmidt miteinander umgehen. Schmidts langjähriger Weggefährte bei der ZEIT, Theo Sommer, nennt die zwei in dem Film »Philemon und Baucis«, in der Bedeutung, wie Goethe das Namenspaar gebraucht hat: zwei Hochbetagte, die nicht nur bis zu ihrem Ende gemeinsam leben, sondern auch miteinander sterben wollen.
Die Anteilnahme ist groß, als Loki Schmidt am 21. Oktober 2010 stirbt. 68 Jahre lang waren Loki und Helmut Schmidt miteinander verheiratet. Besonders die Norddeutschen haben die typische Hanseatin Loki Schmidt geliebt, Sympathie und Zuneigung waren ihr gleichwohl aus allen Teilen des Landes sicher. Als Kanzlergattin trat sie nicht nur gewinnend und gewandt auf, sie war eine selbstbewusste, eigenständige Frau, die sich nicht über den Beruf und die Prominenz ihres Mannes definierte. Loki Schmidt war in Vielem den Frauen ihrer Zeit voraus. Das war einerseits ein Glück für die deutsche Politik, der sie eine fröhliche, weltoffene Note gab, andererseits ein Pech, denn in ihrem modernen Rollenverständnis als Frau und ihrem Engagement für den Naturschutz sah der damalige Bundeskanzler politische Forderungen nach Gleichberechtigung oder Umweltschutz gesellschaftlich bereits umgesetzt. Wer wollte, konnte diese Forderungen selbst verwirklichen, entsprechende soziale Bewegungen waren folglich nach Schmidts Überzeugung überflüssig. Entsprechend verständnislos begegnete Schmidt diesen Bewegungen in seinem politischen Handeln.
Der Europapolitiker und Freund von Helmut Schmidt, Jean-Claude Juncker, schrieb im Dezember 2010 im »Handelsblatt«, Helmut Schmidt habe ohne pathetisches Getöse immer erkennen lassen, dass er nicht nur aus sich selbst bestehe. »Seine in diesem Jahr verstorbene Frau gehörte cosubstanziell zu ihm.« Für die Zeit, als Helmut Schmidt in politischen Ämtern stand, galt dies noch nicht: Kanzler und Kanzlergattin traten mit jeweils eigenen Schwerpunkten unabhängig voneinander auf. Als Paar, das viele Termine gemeinsam wahrnimmt, gelangten Loki und Helmut Schmidt erst später in das Bewusstsein der Öffentlichkeit.
Bleibt zu fragen, wie man sich das Familienleben der Schmidts mit Tochter Susanne, Jahrgang 1947, vorstellen kann. Loki und Helmut Schmidt haben dieses Thema bis auf wenige Andeutungen ausgespart, und auch Tochter Susanne spricht nicht darüber: Die wenigen Andeutungen legen nahe anzunehmen: Helmut Schmidt war ein typischer Vater seiner Generation, der hart arbeitete und sich kaum Zeit für die Familie nahm. Die Erziehung von Susanne überließ er seiner Frau. Helmut Schmidt war, um es auf den Punkt zu bringen, ein nicht anwesender Vater. Eines der wenigen Details, die Loki Schmidt aus dem Familienleben preisgab: Häufig, wenn der Vater wegen politischer Termine auswärts übernachtete, durfte Susanne bei der Mutter im Ehebett schlafen.
Helmut Schmidts Arbeitswut beeinträchtigt das Familienleben von Anfang an. In den sechziger Jahren nutzt Helmut Schmidt die Parlamentsferien für Reisen in osteuropäische Länder, nach Israel und in weitere Staaten der Welt, um politische Gespräche zu führen. Gattin Loki und Tochter begleiten ihn dorthin. Auf diese Weise wird Susanne um das Sandbuddeln mit den Eltern in Italien, um die normale Urlaubserfahrung eines Kindes mit seinen Eltern gebracht. Susanne ist schon von klein auf die Tochter eines vielbeschäftigten, prominenten Politikers. Dass sich gleichwohl ein herzliches, ja inniges Verhältnis zwischen Susanne und ihrem Vater entwickelt haben mag – eine solche Vorstellung fällt schwer.
In den Dokumentationen über den prominenten Politiker Helmut Schmidt kommt Susanne kaum vor. In Thilo Kochs TV-Portrait von 1976 sieht man Susanne und Helmut, wie sie einander im elterlichen Haus begrüßen, der Vater nimmt die Tochter nicht in Arm, legt nicht einmal die Hand um sie, sondern boxt mit ihr.
Seit Mitte der siebziger Jahre macht dem Familienleben der Schmidts ein weiterer Faktor zu schaffen, die strengen Sicherheitsvorkehrungen gegen terroristische Anschläge. Dabei entsteht offenbar ein Leidensdruck. Schon während ihrer Schulzeit geht Susanne Schmidt nach London, um sich freier bewegen zu können, und weil sie wohl ahnt, dass sie in Deutschland immer nur die Tochter von Helmut Schmidt bleiben wird. Sie hat den ökonomischen Sachverstand des Vaters geerbt, arbeitet bei einer Bank und als Wirtschaftsjournalistin. Sie macht sich im Fernsehen einen Namen und publiziert. Sie führt ein eigenständiges Leben, so wie sich schon ihre Mutter – freilich auf andere Weise – ihre Eigenständigkeit gegenüber Helmut Schmidt bewahrt hat.
Helmut Schmidt sagte einmal zu Giovanni di Lorenzo, es habe »eine schwierige Phase« zwischen seiner Tochter und ihm gegeben, sprich eine Entfremdung. Auch die Schmidts erlebten einen ganz privaten Generationenkonflikt, so wie die Brandts und viele andere Politikerfamilien dieser Zeit. Susanne Schmidt hat aber schon längst das getan, was auch die Deutschen außerhalb der Familie Schmidt getan haben: Sie nimmt Helmut Schmidt, wie er ist.
Knapp zwei Jahre nach Lokis Tod wird bekannt, dass es an Helmut Schmidts Seite eine neue Frau gibt, die langjährige Vertraute der Familie und frühere Mitarbeiterin Ruth Loah. Er ist 93, sie knapp 80. Die Deutschen nehmen diese Nachricht mit Freude und Erleichterung auf, hatten doch nicht wenige befürchtet, dass Helmut seiner Frau bald nachfolgen würde, wie bei Philemon und Baucis.
Im April 2013, als ihm der Hanns Martin Schleyer-Preis verliehen wird, bekennt Helmut Schmidt, im Laufe des Lebens hätten ihn drei Erlebnisse »bis in die Grundfesten meiner Existenz erschüttert«. Als erstes Ereignis nennt er den Tod seiner Frau (weiter seinen Besuch als Bundeskanzler in Auschwitz und das deutsche Terror-Jahr 1977). »Meine Frau wollte nach mehreren Operationen nicht mehr leben, und ich habe das verstanden.«
Gälte Helmut Schmidt als Politrentner, der nur über seine aktive politische Zeit zu urteilen wüsste und der die immer gleichen Anekdoten mit den Großen der Welt erzählen sollte – man würde ihm nicht auch heute noch fortwährend solche Foren der Meinungsäußerung bieten. Doch Helmut Schmidt ist ein Politiker aus der Vergangenheit in der Gegenwart. Er hat ein selten langes, reiches politisches Leben hinter sich. Ein Jahrhundertleben, im übertragenen wie im wörtlichen Sinn des Wortes!
Aber sind – um zum Eingangsstatement zurückzukommen – sein Lebensweg, seine Politik und die Prinzipien, für die er steht, über seine politisch aktive Zeit hinaus von Bedeutung? Was daran ist zeitgebunden, und was von Helmut Schmidt wird über seine Lebenszeit hinaus wichtig bleiben?
Anders als bei der Biographie von Herbert Wehner oder Willy Brandt erschließt sich das Lesenswerte, Besondere, Faszinierende an Schmidts Leben erst auf den zweiten Blick. Helmut Schmidt ist wie kein anderer Bundeskanzler mit inneren und äußeren Herausforderungen an die westdeutsche Gesellschaft konfrontiert. Unentwegt hat er Krisensituationen zu bewältigen – sei es, dass Terroristen Staat und Gesellschaft in ihren Fundamenten erschüttern, sei es, dass der jahrzehntelange Konsens dieser Gesellschaft über sogenannte Lebensfragen, etwa die Wirtschafts-, Verteidigungsund Sicherheitspolitik, zu bröckeln beginnt. Die Terroranschläge 1977 werden zur härtesten Bewährungsprobe der deutschen Demokratie seit 1945. Doch in diese Jahre fällt auch eine Zeitenwende des Bewusstseins: Immer weniger Westdeutsche sind davon überzeugt, dass Wirtschaftswachstum, die Voraussetzung für Fortschritt und stetige Wohlstandsmehrung, der Garant für ein sinnerfülltes Dasein ist. Anfang der achtziger Jahre bringt die Debatte um den NATO-Doppelbeschluss Millionen Westdeutsche auf die Straße, so viele wie nie zuvor für ein politisches Thema. Plötzlich stehen jahrzehntelang gültige sicherheitspolitische Maximen, etwa das »Gleichgewicht des Schreckens«, in der Kritik. Umweltbewegung und neue Friedensbewegung fördern maßgeblich das Entstehen einer vierten Partei, der Grünen, die das Land friedlich umkrempelt.
Diese Ereignisse während Schmidts Kanzlerschaft verändern das Gesicht der Republik. Am Ende des von Terroranschlägen gekennzeichneten Jahres 1977 ist das Gefühl der Westdeutschen dahin, in Ruhe und Sicherheit zu leben. In dieser Zeit kommt das, was man heute die »alte« Bundesrepublik nennt, zur vollen Ausprägung, aber es gibt auch eine Zäsur. Die Auseinandersetzung um den NATO-Doppelbeschluss ist der letzte große gesellschaftliche Konflikt, bei dem, wie Werner Weidenfeld einmal geschrieben hat, »die Parteien eine Art von geistiger Führung umsetzen konnten. Bei späteren historischen Ereignissen wurde einfach machtpolitisch vollzogen – nicht mehr kulturell geprägt«. Noch zu Schmidts Zeiten gibt es in der Bevölkerung eine Sehnsucht nach Widerspruch, auch nach einem Widerspruch zu diesem Widerspruch, es gibt Bewegungen, die ein Ziel sehen und einen Auftrag spüren.
Helmut Schmidt ist heute das Symbol für ein »Bonn«, das nicht kraft seiner Größe, sondern dank seines Ansehens Gastgeber eines Weltwirtschaftsgipfels sein darf. Die Bilder, die zeigen, wie der kleingewachsene Helmut Schmidt vor den politisch Großen steht, gehen um die Welt. Ein Jahr später auf Guadeloupe erreicht ein deutscher Bundeskanzler in Klausur mit den Staatschefs der USA, Großbritanniens und Frankreichs, dass die NATO seinem Vorschlag einer sogenannten Nachrüstung von Mittelstreckenwaffen in Westeuropa folgt. Jahrzehnte später, im April 2013, wird einer der Teilnehmer von damals, Valéry Giscard d’Estaing, sagen (in seiner Laudatio auf den Träger des Hanns Martin Schleyer-Preises 2013, Helmut Schmidt): »Die symbolische Rückkehr Deutschlands in den Kreis der Großmächte kann man im Januar 1979 ansetzen, als es mit den drei alliierten Nuklearmächten USA, Frankreich und Großbritannien am Gipfel von Guadeloupe teilnahm.«
Schmidts Jahre sind die Jahre einer deutschen Normalität, allerdings einer notwendigen Normalität, nachdem Konrad Adenauer die Westbindung geschaffen und Willy Brandt spektakulär die Türen nach Osten aufgestoßen hat, und bevor Helmut Kohl die Wiedervereinigung, die höchst überraschend kommt, vollziehen wird. Voraussetzung für diese Vereinigung ist das Vertrauen in die Deutschen und ihr Land, das in den Jahren von Helmut Schmidts Kanzlerschaft weiter gewachsen ist.
Vor, während und nach seiner Kanzlerschaft ist Helmut Schmidt nicht nur der »Macher«, als der er gern etikettiert wird und als der er sich – natürlich nur im guten Sinn des Worts – auch selbst sieht. Er handelt, um ein Wort des Historikers Eberhard Jäckel zu bemühen, als »Krisenmanager mit moralischen Maßstäben«. Kein Bundeskanzler, auch darauf weist Jäckel zu Recht hin, hat sich öffentlich so häufig über moralische Maßstäbe in der Politik Gedanken gemacht wie Helmut Schmidt, keiner vor ihm und keiner danach. Von dem Politiker und zeitweiligen Kanzler Schmidt gibt es Reden über die Philosophie der Herrschaft, über Kunst, Literatur und Musik, über das Christentum und die anderen großen Religionen – keine Gelegenheitsreden, von Schreibbüros für den Augenblick zugeliefert, sondern substantielle, reflektierte Aussagen.
Wenn der fast 89-jährige Schmidt in der Alten Aula der Marburger Universität über »Gewissen und Verantwortung des Politikers« spricht und dabei Papst Benedikt XVI. für eine »selbstgerecht religiöse Gewissheit« kritisiert (es ging um eine Aussage von Kardinal Ratzinger, bevor er Papst wurde), verdient das Gehör, denn es kommt von einem, der über seinem starken politischen Gestaltungswillen nicht die Reflexion vergessen hat.
Solche Wortmeldungen machen Schmidt zwar nicht zu einem philosophischen Denker, aber doch zum seltenen Beispiel eines Politikers, der die Prinzipien seines Handelns erläutert, sodass sein Handeln an diesen Prinzipien gemessen werden kann. Dieser Mann, der das rhetorische Zeug zum Demagogen hätte, der auch bekennt, das Volk und den Einzelnen für verführbar zu halten, erzieht sich immer wieder neu zum Demokraten. Die naheliegende Frage, ob Helmut Schmidt sich selbst einmal als politisch verführbar erlebt hat, beantwortet er zeit seines Lebens mit einem klaren Nein.
Helmut Schmidt prägt die politischen Ämter, die er ausfüllt, aber sie prägen und verändern auch ihn, am meisten natürlich das Amt des Bundeskanzlers. Schneidig, besserwisserisch und hochmütig gegenüber Ansichten, die er nicht teilt, übernimmt er im Mai 1974 von Willy Brandt das Ruder. Der Kampf gegen den Terrorismus und der Protest hunderttausender, meist ernsthaft argumentierender Gegner seiner Politik, entlassen ihn im Oktober 1982 als nachdenklichen, nun auch zum Zuhören bereiten Mann.
Als er von der politischen Bühne abtritt, ist er der bei Weitem angesehenste deutsche Politiker, in der Bundesrepublik Deutschland genauso wie in der Welt. Seine Abwahl durch die Abgeordneten des Deutschen Bundestags anlässlich eines konstruktiven Misstrauensvotums wird nicht nur von sozialdemokratischen Wählern bedauert – schließlich genießt Schmidt bis weit in die Union hinein hohes Ansehen. Was für ein Werdegang, an dessen Ende politische Tragik und persönlicher Triumph so nah beieinander liegen!
Vom Spannenden, auch Spektakulären der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt, das häufig zunächst ganz unauffällig daherkommt, und natürlich vom Spannenden an Schmidts Leben, in dem sich fast ein ganzes Jahrhundert deutscher Geschichte spiegelt, handelt dieses Buch. Darüber hinaus geht es um die Funktion eines Lotsen, die Helmut Schmidt – vielleicht zu seiner eigenen Überraschung – in der Berliner Republik wahrnimmt, und um das Unvergängliche, dauerhaft Gültige von Schmidts Lebensarbeit. Das Buch liefert dabei keine klassische Chronologie der Ereignisse – 95 Lebensjahre, versehen mit dem Panorama einer aufgewühlten Zeitgeschichte, verlangen danach, Schwerpunkte zu setzen. In der Rückschau ist auch nicht jede Lebensphase gleich wichtig.
Mein Augenmerk richtet sich auf das Erwachsenwerden von Helmut Schmidt, seine Prägungen und Schlüsselerfahrungen, und seine Formung zu einer politischen Persönlichkeit. Viel Aufmerksamkeit verdient weiter die Zeit, in der Helmut Schmidt den größten Einfluss auf die deutsche Politik genommen hat. Als Bundeskanzler segelte er fast immer hart am Wind – nationale und weltweite Rezession am Anfang, der Höhepunkt des RAF-Terrorismus in der Mitte, das Anschwellen der sogenannten Friedensbewegung am Schluss. Helmut Schmidts politische Arbeit nach Ausscheiden aus dem Kanzleramt kann als weitere, eigenständige Phase seines Lebens gewertet und beschrieben werden. Noch als er in den Neunzigern steht, leistet er einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Berufung eines SPD-Kanzlerkandidaten.
Mein starkes Interesse gilt nicht zuletzt dem geistigen Weltbild von Helmut Schmidt, dem theoretischen Fundament seines politischen Handelns. Wie wenige andere Politiker im letzten Jahrhundert hat er auf zeitlos wichtige Fragen, die sich jede Politikerin und jeder Politiker stellen muss, eine Antwort gegeben und dabei Denken und Handeln miteinander zu verklammern gesucht. Ob man nun Schmidts Auffassungen teilt oder nicht – diese Prüfung von Grundsätzen am praktischen Handeln ist faszinierend und aktuell. Helmut Schmidt kann als Beispiel dafür dienen, wie sich jemand in wechselvoller Zeit eine sittliche Grundlage für politisches Tun schafft.
Helmut Schmidts Weltbild lässt sich natürlich nicht an einem bestimmten Datum festmachen, deshalb habe ich zum Beispiel die Beschreibung seiner »Hausapotheker« vor die Übernahme seines wichtigsten Amtes, dem des Bundeskanzlers, eingefügt.
Persönliche Bilder vom Kanzler Helmut Schmidt
Wer sich lange mit einem Politikerleben beschäftigt, ist als Autor erklärungspflichtig: Warum gerade diese Persönlichkeit, weshalb ausgerechnet jener historische Kontext? Ich skizziere kurz die Vorgeschichte in der Hoffnung, dass der Leser, soweit er alt genug ist, ähnliche – oder auch ganz andere – Erinnerungen an die Jahre wachrufen kann, als Helmut Schmidt hohe politische Verantwortung trug. Ich bin Jahrgang 1964, also ein Angehöriger der Babyboomer-Jahrgänge. Dass es so etwas wie Politik gibt, erfahre ich erstmals als Grundschüler: Die Lehrerin macht mit uns einen Bildungsspaziergang durch den Heimatort Stetten auf den Fildern und erklärt Plakate zur Bundestagswahl 1972. Und ich sehe noch, als sei es gestern gewesen, wie meine Mutter zwei Jahre später mittags am Küchentisch das Kofferradio (ein Nordmende »Galaxy«) lauter dreht, als die Nachricht kommt, dass Bundeskanzler Willy Brandt zurückgetreten ist. Meine Mutter wirkt betroffen, obwohl sie, glaube ich, Brandt nie gewählt hat.
Aus den ersten Schmidt-Jahren ist mir die Schwüle der Herbstwochen 1977 in Erinnerung, als die Entführung von Hanns Martin Schleyer eine gespenstische Stille und Angst über das Land legt. Auf den Straßen Panzer und viel Polizei. In irgendeiner Nacht, kurz nach zwölf, gibt Regierungssprecher Klaus Bölling über das Radio bekannt, dass die Geiseln von Mogadischu frei seien. Die Nachricht wird auch am nächsten Tag ständig wiederholt, genauso wie Fernsehbilder, auf denen sich Staatsminister Hans-Jürgen Wischnewski, in der Flughafenhalle zwischen den befreiten Geiseln sitzend, über die feuchte Stirn wischt. Ich glaube, es ist der Tag, an dem Bundespräsident Walter Scheel im Fernsehen an die Schleyer-Entführer appelliert, den Arbeitgeberpräsidenten am Leben zu lassen: »Geben Sie Hanns Martin Schleyer frei!« Alle fürchten und rechnen damit, dass Scheels Bitte die Terroristen nicht beeindrucken wird.
Dann dieses schreckliche Bild vom grünen Audi 100, in dessen Kofferraum Schleyer tot gefunden wird. Scheel hält bei der Trauerfeier eine ergreifende Rede, die ich, wahrscheinlich aus innerer Bewegung, mit meinem kleinen Telefunken-Kassettenrecorder vom Fernsehton aufnehme. Die Kassette habe ich heute noch. Helmut Schmidt sitzt steif und mit gesenktem Kopf neben Schleyers Witwe; er scheint die Not der zurückliegenden Entscheidungssituation am ganzen Leib zu spüren.
1980 klebe ich Abziehbilder von Franz Josef Strauß, dem Kanzlerkandidaten der Union, auf meinen Schulkoffer, weil mehrere meiner Lehrer offen Stimmung gegen ihn machen. Von diesen Lehrern werde ich erbost angesprochen.
Im Herbst 1982 schwänze ich die Schule, um mit dem sündhaft teuren VHS-Videorecorder, den mein Vater gerade gekauft hat, die Bundestagsdebatten zum Koalitionsbruch und zum konstruktiven Misstrauensvotum aufzuzeichnen. Ich bin innerlich gespalten, wie alle, mit denen ich in jenen Tagen spreche: Schade eigentlich, denke ich, dass der angesehene Staatsmann Schmidt abtritt, aber das monatelange Hickhack um die Koalition mit der FDP muss endlich ein Ende haben. Leute auf dem Tennisplatz, auf dem ich damals nicht wenig meiner Freizeit verbringe, sagen: Schmidt war der beste CDU-Kanzler, den die SPD je hatte.
Der Bürgerprotest gegen den NATO-Doppelbeschluss setzt während Schmidts Amtszeit ein, ungefähr 1981/82, und überdauert seine Kanzlerschaft. 1984 bin ich Wehrpflichtiger in der Pressestelle des Wehrbereichskommandos V, damals die Bundeswehrzentrale für Baden-Württemberg. Gemeinsam mit anderen Wehrpflichtigen stelle ich dem General jeden Morgen eine Pressemappe zusammen. Es gibt noch keine Computer und Scanner, wir lesen stapelweise Zeitungen und schneiden Artikel über verteidigungs- und sicherheitspolitische Fragen aus. Es fällt in diesen Tagen, da sicherheitspolitische Fragen in aller Munde sind, viel Arbeit an. Verteidigungsminister Manfred Wörner legt ein »Weißbuch« vor, in dem er die Zustimmung der deutschen Bundesregierung zur sogenannten Nachrüstung auf vielen hundert Seiten begründet. In Zeitschriften und Zeitungen wird leidenschaftlich dafür und dagegen argumentiert.
Ich lese vieles und gewinne den Eindruck, dass es hier um mehr geht als um abstrakte sicherheitspolitische Fragen, dass hier zwei Denkweisen, zwei Generationen, zwei völlig unterschiedliche Lebensentwürfe aufeinanderprallen. Und ich werde Zeuge, wie sich diese zwei Lager plötzlich ganz wörtlich gegenüberstehen: An einem Samstag im Herbst erhalte ich eine »G 3« ausgehändigt, das Standardgewehr der Bundeswehr, und werde zur Wache auf dem Stuttgarter Kasernendach eingeteilt. Alle Offiziere, Unteroffiziere und Wehrpflichtigen haben das Gelände an diesem Nachmittag vor Eindringlingen zu schützen. Um die Kaserne herum bildet sich eine sogenannte Menschenkette – friedlich demonstrierende Nachrüstungsgegner. Es gibt keine Reden, nur Transparente: »Frieden schaffen ohne Waffen«. Junge und ältere Menschen mit lila Halstüchern und Buttons halten sich an den Händen und drücken schweigend ihre Angst vor Krieg und atomarer Vernichtung aus.
Ich denke: Seltsame Welt! Einerseits soll ich als Wehrpflichtiger 15 Monate lang einen Friedensdienst leisten. Andererseits halte ich mit dem Gewehr Demonstranten in Schach, die nicht weniger davon überzeugt sind, dass ihr Engagement dem Frieden dient. Welche Seite hat recht? Die »Friedensbewegten«, wie sie im Bundeswehrjargon abschätzig heißen, halten mich – wie jeden Soldaten – für Kanonenfutter deutscher und amerikanischer Militärs. Ich selbst misstraue den vielen Zahlen und Schaubildern aus dem »Weißbuch«, finde aber, dass die Bundeswehr für ein politisches System steht, in dem Menschenketten überhaupt erst möglich sind. In der DDR oder in der Sowjetunion würden solche Aktionen im Keim erstickt. Und mich stören die Ich-Bezogenheit und die zur Schau getragenen persönlichen Empfindungen der Protestierer. Irritiert verlasse ich nach der Wache die Kaserne.
Auf der Pressestelle stoße ich zufällig auf zwei Artikel aus der ZEIT, in der zwei wichtige Stimmen dieses Landes, Pfarrer Heinrich Albertz und Ex-Kanzler Helmut Schmidt, ihre Sicht der Dinge beschreiben. »Fürchtet Euch!«, ruft der Pfarrer, in Umkehrung des Bibel-Wortes, im Sommer 1981 anlässlich des Evangelischen Kirchentags in Hamburg, der zu einer Protestkundgebung gegen die westliche Sicherheitspolitik wird. »Fürchtet euch nicht«, sagt dagegen der Politiker in seinem Artikel zu Weihnachten 1983 und verteidigt die militärische Strategie des Gleichgewichts, auf der die Nachrüstung fußt. Albertz wie Schmidt berufen sich bei ihren Haltungen auf ihren Glauben – oder genauer gesagt: Sie halten ihre Position mit dem christlichen Glauben für vereinbar. Erst wenige Wochen zuvor hatte Helmut Schmidt bei einem SPD-Parteitag in Köln leidenschaftlich davor gewarnt, mit der Bergpredigt Politik machen zu wollen. Er muss aber zusammen mit wenigen Getreuen hinnehmen, dass die SPD nicht mehr hinter dem NATO-Doppelbeschluss steht.
Ein CDU-Kanzler, Helmut Kohl, wird Schmidts Außenund Sicherheitspolitik vollziehen. Unter anderem deshalb, weil er sich in Lebensfragen der Nation in Kontinuität zu Schmidts Politik stellt, kann er die Bundestagswahlen gewinnen. Erst nach dem Ereignis, das alles verändert, der Wiedervereinigung, geht er eigene Wege, aber auch dabei profitiert er von Schmidts politischer Vorarbeit.
Im Politik-Studium denke ich über Helmut Schmidt, der sich inzwischen als Weltpolitiker versteht, weiter nach. Woran ist der bei der Bevölkerung beliebte, auch vom politischen Gegner respektierte Kanzler gescheitert? Welche politische, vielleicht auch gesellschaftliche Entwicklung hat der sozialliberalen Koalition den Todesstoß versetzt? Ich komme zu der Auffassung, dass Helmut Schmidts Politik an eine Nahtstelle zwischen altem und neuem Denken, zwischen den alten Ansprüchen auf Wohlstandsmehrung und den neuen Forderungen nach ökologisch verträglichen Lebensformen geriet. Schmidt steht dabei für die sogenannte Kriegsgeneration, die den Wiederaufbau des zerstörten Landes zu ihrer Lebensaufgabe gemacht hat. Als er auf die nächste Generation trifft, die inzwischen politisch erwachsen ist, zeigt er – nach einigem Zögern – persönlich Verständnis, ändert aber seine Politik nicht. Schmidt ist der letzte Kanzler, der für die Gründergeneration dieser Republik steht, und zugleich der erste, dessen politisches Schicksal mit den in diese Republik Hineingeborenen verknüpft ist.
Mich fasziniert diese politisch-kulturelle »Bruchstelle« so sehr, dass ich mich mit den »geistigen Grundlagen« des fünften Bundeskanzlers wissenschaftlich beschäftige und eine Dissertation darüber schreibe. Ich versuche darin zu zeigen, wie Schmidts politisches Denken und Handeln im Kanzleramt zusammenhängen – welche Prägungen und Grundüberzeugungen ihn leiten, sodass er zum Beispiel bei der Entführung von Hanns Martin Schleyer oder in Sachen NATO-Doppelbeschluss so und nicht anders handeln konnte.
Wer sich mit Schmidts Leben näher beschäftigt, erkennt – um auf das vorangestellte Zitat von Richard von Weizsäcker zurückzukommen – »eine lebenslange gewaltige Arbeit mit sich selbst, ein Ringen mit den Konflikten des Menschen in seiner Zeit, eine Auseinandersetzung mit der Spannung zwischen Verstand und Gefühl, Leidenschaft und Disziplin, Idee und kritischer Rationalität, Interesse und Moral, Gesinnung und Verantwortung, dem großen Wurf und dem kleinen Schritt«. Und Weizsäcker ergänzt, Schmidt habe nicht primär mit Reden und Handeln, »sondern mit der Kraft, diese Spannungen auszuhalten und zu verarbeiten«, seine großen politischen Leistungen vollbracht.
Jahre nach der Veröffentlichung der Dissertation werde ich von Ulrich Frank-Planitz gefragt, ob ich das Manuskript nicht zu einer politischen Biographie umarbeiten wolle. Natürlich tue ich das! Denn wie das mit einem Buch so ist – es kann niemals wirklich fertig werden. Einer der geistigen »Hausapotheker« von Helmut Schmidt, der Philosoph Karl Raimund Popper, hat leider recht, wenn er über ein Buchprojekt schreibt: »Wenn wir daran arbeiten, lernen wir gerade genug, um seine Unzulänglichkeiten klar zu sehen, wenn wir es der Öffentlichkeit übergeben.« Aber diese politische Biographie wird kein »Umschreiben« des Vorhandenen, sondern der Teig ist noch einmal neu zu kneten.
Im Lauf der Zeit mache ich mir klar, dass die drei Jahrhundertgestalten der Sozialdemokratie, Herbert Wehner, Willy Brandt und Helmut Schmidt, eigentlich zusammen zu denken sind, will man ihre Wege, auch Irrwege, ihre Erfolge und Niederlagen besser verstehen. Das Ergebnis dieses Nachdenkens ist ein Buch über die »Troika wider Willen«, die mal freiwillige, mal unfreiwillige, aber über weite Strecken gemeinsame Lebensfahrt der Drei.
»Troika« bezeichnet einen mit drei Pferden bespannten Wagen oder Schlitten. In der Troika laufen zwei Zugpferde hinter einem Leitpferd her. Bei dem Dreigespann Wehner – Brandt – Schmidt wechselte die Führung immer wieder ab, was den Schlitten häufig fast zum Kippen brachte – aber eben nur fast. Von diesem Schlitten gezogen wurden über Jahrzehnte hin die Sozialdemokratische Partei Deutschlands und zwischen 1969 und 1982 sogar der politische Führungsapparat dieser Republik.
Zum 90. Geburtstag habe ich – auf Anregung von Rudolf Walter – das Manuskript meiner politischen Biographie über Helmut Schmidt durchgesehen, um Aspekte aus »Troika wider Willen« erweitert und aktualisiert. Bereits für das »Troika«-Buch konnte ich – dank der Zustimmung von Greta Wehner und dem damaligen Geschäftsführer des Herbert-Wehner-Bildungswerkes, Christoph Meyer – den Briefwechsel zwischen Herbert Wehner und Helmut Schmidt einsehen, was auch für dieses Manuskript von großem Nutzen war.
Der neue Untertitel »Mensch – Staatsmann – Moralist« trug dem Umstand Rechnung, dass in den Jahren seit dem Ende von Helmut Schmidts Kanzlerschaft der Autor grundsätzlicher Fragen über Politik und Moral deutlich hervorgetreten ist. Für einen Biographen von Helmut Schmidt muss diese Reflexion die dritte Säule seiner Lebensbeschreibung bilden.
Mit dem »Moralisten« im Untertitel war ich übrigens nicht ganz zufrieden – aber mir ist auch kein prägnanteres Wort eingefallen. Helmut Schmidt will – unter Berufung auf Immanuel Kant, siehe das Kapitel über Schmidts »Hausapotheker« – gerade kein Moralist sein, sondern ein Politiker mit moralischen Grundsätzen. Der »Moralist« im Untertitel sollte nur ausdrücken, dass es in diesem Buch wie gesagt auch um Schmidts sittliches Fundament geht, seinen Glauben, sein Verhältnis zu den Kirchen, seine wichtigsten Philosophen, eben seine »Hausapotheker«.
Mein nächstes Buch über den Protagonisten, »Helmut Schmidt – Der letzte Raucher. Ein Porträt« geht unter anderem auf das Gespräch mit einer Kollegin zurück, die am Vorabend ein Fernsehgespräch von Helmut Schmidt mit Reinhold Beckmann verfolgt hat. »Was für ein Mann, was für eine Persönlichkeit!«, schwärmte sie über den Altkanzler, »schade, dass wir solche Politiker nicht mehr haben.« Und sie fügte an: »Haben Sie gesehen, wie viel er geraucht hat? Unglaublich, und das in diesem Alter! Wirklich ein toller Mann.«
Mir wird bewusst, dass die Verehrung für Helmut Schmidt eine emotionale Komponente hat, eine Faszination für sein starkes Rauchen, das zugleich ein Rauchen an ungebührlichen Stätten – in Fernsehstudios, in öffentlichen Gebäuden – ist. Diese Faszination für eine Untugend an dem sonst so tugendhaften Schmidt bekommt zusätzlich Aufwind durch die Verfolgung auch der deutschen Raucher, die fortan nicht mehr in Restaurants und auf Bahnhöfen nur noch in gelb markierten Quadraten rauchen dürfen. Helmut Schmidt, der letzte Raucher in einem deutschen Restaurant, Theater oder Fernsehstudio, ist nicht länger der spröde Hanseat, der am liebsten Belehrungen verteilt, sondern ein Mensch mit einer für alle sichtbaren und für die Anwesenden riechbaren Schwachstelle! Dass ein Politiker Tugenden geradezu verkörpert, aber für eine Untugend geliebt wird, dürfte ebenfalls zu den einmaligen Phänomenen rund um Helmut Schmidt gehören.
Mein nächstes Buchprojekt galt ebenfalls einem Ereignis, das in die Kanzlerschaft von Helmut Schmidt fällt, die Entführung der Lufthansa-Maschine »Landshut« durch palästinensische Terroristen (es war schon im Eingangskapitel davon die Rede). Als ich zufällig auf alte, unveröffentlichte Interviews mit früheren »Landshut«-Geiseln stieß, stellte ich mir die Frage: Was ist eigentlich aus diesen Menschen geworden? Was hat diese schreckliche Erfahrung mit ihnen gemacht? Es zeigte sich, dass Frauen, Männer und Kinder, die als deutsche Staatsbürger auf einer privaten Reise entführt wurden, von diesem Staat wenig Unterstützung erfuhren und dass viele von ihnen für ihr weiteres Leben traumatisiert wurden. Sie sind die »Überlebenden von Mogadischu«, wie auch der Titel des Buches lautet.
In den fünf Jahren, seit meine Biographie über den »Menschen, Staatsmann und Moralisten« Helmut Schmidt erschienen ist, hat sich in dessen Leben viel ereignet – genannt seien nur der Tod von Loki und Schmidts persönliche Ausrufung eines SPD-Kanzlerkandidaten. Deshalb bat mich der Verlag um eine Neufassung des Buches. Diese Neufassung sollte auch Gelegenheit geben, Helmut Schmidts Rolle in der Berliner Republik zu beleuchten und zu fragen, was von seiner politischen Lebensarbeit über den Tag hinaus Bestand haben wird. Der vom Verlag gewählte Titel »Helmut Schmidt. Ein Jahrhundertleben« erscheint mir aus zwei Gründen gerechtfertigt: Helmut Schmidt geht vital auf die »100« zu, und sein Leben umspannt tatsächlich ein Jahrhundert mit seinen politischen Höhen und Tiefen. Er ist im Ausgang des deutschen Kaiserreiches geboren und redet in der Berliner Republik politisch ein kräftiges Wort mit. Schmidt selbst macht die weite Zeitspanne gern durch einen Zahlenvergleich anschaulich: Als er geboren wurde, hätten auf der Erde zwei Milliarden Menschen gelebt, heute seien es sieben.
Ein ernster, pflichtbewusster Mann
Bei der Arbeit an meiner Dissertation bekomme ich Gelegenheit, Helmut Schmidt zu treffen. Seine Mitarbeiterin Birgit Krüger-Penski sagt mir vorher: »Reden Sie ihn nicht mit ›Herr Bundeskanzler‹ an. Sonst fragt er Sie: ›Steht Herr Kohl hinter mir?‹« Ich soll ihn auch nicht mit psychologischen Theorien konfrontieren – das komme nicht so gut an.
Mir begegnet ein zurückhaltender, höflicher, ja zuvorkommender Mann. Ich erlebe eine gewisse Scheu, von der mir andere schon berichtet haben. Zuerst fragt er, ganz Lehrer, mein Wissen ab, will prüfen, ob sich die gemeinsame Gesprächszeit lohnt. Unter welchem Motto denn seine erste Regierungserklärung gestanden hat? Wann dieses oder jenes Ereignis war? Er weiß es natürlich noch (nur bei Namen tut er sich schwer). Wenn Helmut Schmidt anfängt, über sein Metier zu sprechen, den Fragenden zu korrigieren, wie es vermeintlich oder wirklich war, wenn ihm frühere Bilder neu vor Augen treten, weicht alle Zurückhaltung und Altersmilde, er redet sich in Rage, zeigt den Schmidt, den man kennt. Dann wirkt er jung und wie »Schmidt Schnauze«, nur die Stimme ist tiefer, das Gesicht älter geworden. Die Urteile kommen klar und hart, als ob er sie in meinen Kassettenrecorder diktiert. Er formuliert mit der Macht seiner Lebenserfahrung und der genauen Kenntnis, die er als einer der Hauptakteure der deutschen Politik haben muss. Alles wirkt mächtig bei ihm – die Einschätzung von Sachverhalten (auch dann noch, wenn es Fehleinschätzungen sind), die Beschreibung der eigenen Leistungen und Irrtümer, die Charakterisierung von handelnden Personen. Wenn Helmut Schmidt sagt: »Den habe ich nicht für wichtig genommen«, ist das ein Urteil wie ein Fallbeil über das oft lebenslange politische Wirken eines Kollegen.
Dass er innerlich so gar keinen Abstand zum Erlebten findet, hält ihn, so ist zu vermuten, bis heute vital. Keine Spur von altersmilder Entrücktheit, von innerem Frieden über dieses wechselvolle Leben, wenigstens gegenüber dem Besucher nicht. Wenn er beschreibt, wie ihm von Gegnern der NATO-Nachrüstung »Ich habe Angst«-Parolen vorgehalten wurden, glaubt man, das sei gerade erst gewesen. Eindeutig sind Ton und Wortwahl für »Herrn Eppler«, den langjährigen innerparteilichen Gegenspieler, der »die Friedensbewegung angeführt« habe.
Kritisches sagt er auch über den Politiker Willy Brandt, der zugelassen hat, dass dieser Staat fast überschuldet wurde, und den dann er, Helmut Schmidt, sanieren musste. Auch private Entscheidungen von Brandt – dreimal heiraten, das macht man als Bundeskanzler einfach nicht! – stoßen auf sein Missfallen. Ich bin erstaunt, dass er dies einem Fremden sagt, das muss ihn also beschäftigen. Vielleicht sieht er sich, verglichen mit Brandt, ungerecht beurteilt.
Umgekehrt spricht er warmherzig von Menschen, die ihm wichtig sind: Marion Gräfin Dönhoff, seine inzwischen verstorbene Kollegin bei der ZEIT, oder Klaus Bölling, sein brillanter Regierungssprecher, den er – schwerer Fehler – mitten in der Kanzlerschaft hat ziehen lassen und am Ende noch einmal holte. Helmut Schmidt gibt zu erkennen, dass er sich überhaupt nur von wenigen Menschen verstanden fühlt – eben von Gräfin Dönhoff, von Bölling.
Keiner seiner bisherigen Biographen habe ihn voll erfasst. Leider kann ich Karl Wilhelm Berkhan, jahrzehntelang ein enger Freund von Helmut Schmidt, nicht mehr fragen. Er ist im März 1994 79-jährig gestorben. Als Bonner Abgeordnete haben sie zeitweise eine Wohnung geteilt. Berkhan, der unter anderem Wehrbeauftragter des Deutschen Bundestags war, hatte sein Ferienhaus am Brahmsee direkt neben dem Haus von Schmidt.
Was Eindruck auf mich macht, ist dieser Fleiß und dieses Pflichtbewusstsein, das sich der alte Mann ohne Not zumutet. Das für einen Ex-Kanzler kleine Büro, vielleicht zwanzig Quadratmeter groß, wirkt wie ein privates Arbeitszimmer – der Schreibtisch umgeben von Bücherwänden, denen man ansieht, dass die Bücher ständig im Gebrauch sind. Als Schmidt während unseres Gespräches ein Buch sucht, findet er es gleich. Es gibt nichts Schmuckes, Repräsentatives, keine für Besucher aufgeräumte Ecke. Keine rustikale Schrankwand, alles ist weiß. Wer zu Helmut Schmidt kommt, sitzt entweder vor seinem Schreibtisch oder an einem schlichten Tisch mit vier Freischwingern aus Chrom, mit Leder bespannt. Weshalb auch repräsentieren? Helmut Schmidt, Herausgeber der ZEIT, Weltpolitiker, arbeitet hier, liest, telefoniert, diktiert, führt Gespräche.
Helmut Schmidt raucht und schnupft Tabak. Wir sprechen über die persönlichen Gestaltungsmöglichkeiten eines Politikers, etwa darüber, ob es im Betrieb überhaupt Platz gibt für sittlich-moralische, vielleicht sogar philosophische Ansätze, oder ob einen die sogenannten Sachzwänge immer wieder einholen. Sachzwänge? »Das ist eine journalistische, vielleicht auch eine politologische Redensart«, sagt er, wissend, dass ich Politik studiere. »Ein schlechtes Wort.« Der Politiker kann immer zwischen mehreren Möglichkeiten wählen, was er teils instinktiv, teils aus seiner Vernunft heraus tut. Meist denkt er in der Situation nicht an den ethischen Aspekt, aber der ist nachher wichtig, wenn die Entscheidung überprüft wird. In der Politik muss einer, so Schmidt sinngemäß weiter, sein Handeln auch verständlich machen, damit er gewählt oder wiedergewählt wird.
Recht bald im Gespräch kommt ein Selbstvorwurf zur Sprache, den sich Helmut Schmidt bis heute macht: Hätte er nicht im Frühjahr 1975 der Freilassung von Terroristen zugestimmt, damit der CDU-Politiker Peter Lorenz freikommt, wäre die Rote Armee Fraktion (RAF) nicht zu weiteren Entführungen ermutigt worden. »Da war ich schwer krank und hatte 40 Grad Fieber, und da haben in Wirklichkeit andere (er meint Bürgermeister Klaus Schütz und Oppositionsführer Helmut Kohl, Anm. M. R.) an meiner Stelle die Entscheidung schon getroffen gehabt, als ich mit Hilfe von ärztlichen Kunststücken und Spritzen für kurze Zeit verhandlungsfähig gemacht wurde.« Die ganze Serie der Terroranschläge der RAF, gipfelnd in der Entführung und Ermordung Hanns Martin Schleyers, war wie die umfallende Reihe von Dominosteinen – der erste Stein löst die Kettenreaktion aus. Im übertragenen Sinn ist der demokratische Rechtsstaat bei Lorenz »umgefallen«, wie es Schmidt sieht.
Nein, sagt er weiter, geistlichen Beistand hat er in den Wochen der Schleyer-Entführung nicht gesucht, bei anderen Gelegenheiten schon. Da gab es Gespräche mit dem Kardinal und Bischof von Essen, Franz Hengsbach, dem Hannoveraner Landesbischof Eduard Lohse und dem Theologen Oswald von Nell-Breuning, der zu den Vätern der Christlichen Soziallehre im 20. Jahrhundert gehört. Eduard Lohse zum Beispiel befragt er nach seiner Abwahl als Bundeskanzler im Oktober 1982 – die SPD drängt ihn, noch einmal als Kanzlerkandidat anzutreten, aber Helmut Schmidt will nicht. Verstößt er damit gegen sein Pflichtethos? Muss er sich der Partei, die ihn zwar bei wichtigen Entscheidungen im Stich gelassen hat, der er aber die Basis für seine lebenslange politische Arbeit verdankt, noch einmal zur Verfügung stellen? Er muss nicht, wie ihm Lohse versichert. Er hat seine Pflicht getan, auch seine Gesundheit in diesem Amt verschlissen, es ist genug. Schmidt wird auf eine Kandidatur verzichten.
Ein Politiker seiner Generation kann nicht einfach keine Siegeschancen mehr sehen oder einfach keine Lust mehr haben. Einem Rückzug muss eine Gewissensentscheidung vorausgehen.
Wir sprechen über Schmidts Forderung, dass Politik schrittweise Reformen durchführen muss, keine großen Würfe versuchen soll. Ich frage, ob das nicht ein defensives Verständnis von Politik sei? »Nein, das ist es nun gar nicht. Das ist eine vernünftige Auffassung von Politik und hat mit defensiv und offensiv nichts zu tun!« Aber Sie haben doch, reagiere ich sinngemäß, abwehrend über die Rolle von Politikern gesprochen – so soll der Bundeskanzler zum Beispiel nicht der Vordenker der Nation sein! »Da habe ich mich selbst bewusst ein bisschen kleiner gemacht, als ich dachte, dass ich sei. Ich war natürlich schon auf sehr viele Weise ein Vordenker«, etwa mit dem Konzept der schrittweisen Reformen, »sehr im Gegensatz zu jenen euphorisch gestimmten Idealisten, die unter Willy Brandts Fittichen groß geworden sind«. Die Deutschen hätten besonders zu Brandts Zeiten dazu geneigt, den Kanzler »für so eine Art Überwesen« zu halten. »Und ich habe gesagt, der Kanzler ist nichts anderes als der Leitende Angestellte einer großen Firma, in diesem Falle des Staates.«
Auch die Intellektuellen, die Brandt im Wahlkampf aktiv unterstützt und Schmidt ein Theoriedefizit vorgeworfen haben, bekommen ihr Fett ab. Ich spreche Helmut Schmidt auf sein Gespräch mit den Schriftstellern Siegfried Lenz und Günter Grass (sowie dem Feuilleton-Chef der ZEIT, Fritz J. Raddatz) im Sommer 1980 an – eine in der Wochenzeitung abgedruckte Unterhaltung, in der sich Grass und Raddatz auf der einen Seite und der damalige Bundeskanzler auf der anderen nichts schenken. »Beides Leute, die keine Straßenbahngesellschaft verwalten könnten«, gibt Schmidt mir bissig zurück. Damit ist das Thema für ihn erledigt. Heute will er nicht wie in früheren Interviews einräumen, dass die beiden ihn provoziert haben.
Später komme ich auf den Glauben zu sprechen und darauf, dass Schmidt seinen Glauben in den letzten Jahren in Vorträgen und Interviews mehr und mehr offengelegt habe. Widerspruch: »Nicht in den letzten Jahren. Immer.« Aber er gehöre nicht zu den Politikern, die den lieben Gott vor sich her trügen. Ich vermute, hier denkt er an Helmut Kohl. Glauben ist Privatsache, findet er. Ich konfrontiere ihn mit einer früheren Äußerung, wonach er zwei entscheidende Fehler in seinem politischen Leben gemacht habe: dass er auf die Gefühlsäußerungen der 68er-Generation und ihrer Folgegeneration nicht angemessen reagiert und dass er neben der Kanzlerschaft nicht auch den SPD-Parteivorsitz übernommen habe. Das erste kreidet er sich nicht mehr an, das zweite schon. Als zweiten Fehler nennt er jetzt, nicht spätestens 1981 zurückgetreten zu sein. Bereits da ist ihm, versichert er, klargeworden, dass die sozialliberale Koalition auseinanderbrechen wird.
Das Gespräch läuft jetzt flüssiger, Rückfragen wie »Habe ich das irgendwo geschrieben?« kommen nur noch selten. Beim Nachdenken schaut Schmidt zum Fenster hinaus. Erst wenn er mit einer Antwort in die Zielgerade einläuft und Worte der letzten ein, zwei Sätze besonders betont, schaut er mich eindringlich an.
Schließlich spricht er über jenes Dilemma, das er sieht, aber nicht auflösen kann: dass die politische Klasse nach ihm nichts mehr hat durchstehen und erkämpfen müssen und deshalb heute für schwere Aufgaben weniger gerüstet ist. »Wir sind aus dem Dreck gekommen. Seit 1941 habe ich nicht mehr damit gerechnet, dass in Deutschland noch irgendetwas stehen bleiben würde.« Die heutige Generation der Regierungschefs hat einen normalen, durchschnittlichen Lebensweg hinter sich. Keine schicksalhaften Erlebnisse. Weder Dehler noch Erler, Schmidt, Strauß oder Barzel wollten je Karriere machen, es hat sich einfach ergeben. Die heutigen Politiker wollen es schon. Die eigene Karriere ist der Antrieb, nicht, dem öffentlichen Wohl zu dienen: »Es sind normale Zeiten, die bringen normale Menschen hervor.« Schmidt ist kritisch, auch selbstkritisch, bekennt Irrtümer, Fehler. Wirkt auch selbstgerecht, meint, dass er schon immer gewusst hat, was in dieser oder jener Frage richtig ist. Manches wird heute endlich richtig gemacht, bei anderen Themen – etwa seinem Plädoyer für das Mehrheitswahlrecht, das die FDP aus dem Bundestag geworfen hätte – hat man nicht auf ihn gehört. Seit Jahrzehnten will er das schon und rechtfertigt es noch heute, auch in unserem Gespräch.
Zwischendurch sehe ich, dass die Publikationen über ihn, angefangen mit Helmut Wolfgang Kahns Studie von 1973, hinter ihm im Regal stehen. Hier spricht eben nicht nur ein hochintelligenter, exakt – manchmal auch ausgesprochen drastisch – formulierender, schneidiger älterer Herr, sondern eine Person der Zeitgeschichte. Der fünfte Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland hat in seinem Arbeitszimmer viele Fotos und Karikaturen vor und zwischen die vielen Bücher gestellt oder aufgehängt. Sie zeigen ihn mit Politikern, über die er gern gesprochen und geschrieben hat – etwa Anwar as Sadat. Der frühere ägyptische Staatspräsident wäre ihm sicher ein persönlicher Freund geworden, hätten ihn nicht radikale Muslime 1981 umgebracht. Sadat machte Schmidt bei einer Fahrt auf dem Nil auf das Verbindende, Friedensstiftende der großen Weltreligionen aufmerksam. Diese Nil-Fahrt war für Schmidt ein Ereignis, auf das er bei vielen Gelegenheiten bis in die Gegenwart hinein zurückkommt.
Helmut Schmidt entlässt mich freundlich: »So, lieber Freund, jetzt muss ich mich hier an die Arbeit machen«, sagt er und deutet auf einen Berg gefüllter Klarsichthüllen auf der rechten Schreibtischseite. Das sagt er sehr ernst und pflichtbewusst, so gar nicht wie einer, der nach einem langen Leben, vor allem einem solchen Leben, eigentlich genug gearbeitet hat. Mit Blick auf meine Dissertation mahnt er mich noch: »Hüten Sie sich vor Schablonen!«