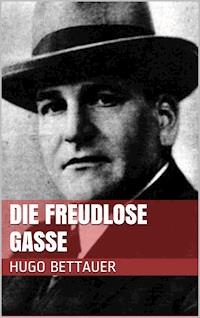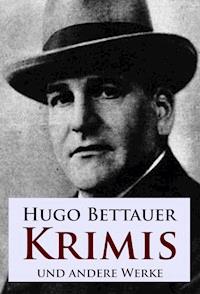Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Krimis bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Bettauer zeigt in seinem Milieu-Krimi ein Sittenbild der 1920er-Jahre auf. Was bedeutet Handeln in Krisenzeiten, wann wird man wirklich schuldig? Wie hoch muss, wie hoch kann man moralische Maßstäbe noch ansetzen? Der ehemals adlige Kolomann von Isbaregg kommt desillusioniert aus dem verlorenen Ersten Weltkrieg zurück. Seine Welt ist auf den Kopf gestellt, die Werte, die für ihn noch galten, sind nutzlos geworden, sein Stand verwirkt, sein Geldbeutel leer. Sein einziges Kapital sind seine guten Manieren und sein attraktives Äußeres. Diese Stärken nutzt er immer mehr aus, um sich seinen Weg in der Wiener Gesellschaft zu ebnen. Schließlich sind Betrug, Raub und sogar Mord allgenwärtig in seinem Alltag. Konzentriert spiegelt der Autor hier die Spannungen im Wien zwischen den Weltkriegen wieder: Aufkommender Feminismus, erzkonservative Klischees und übelster Antisemitismus treffen aufeinander. Der Autor war bekannt für seine drastische Darstellung von Sex und Gewalt, was ihn auch immer wieder in Stress mit den Zensurbehörden brachte. Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hugo Bettauer
Hemmungslos
Ein ruchloser Krimi aus dem Wien der Zwanziger
Hugo Bettauer
Hemmungslos
Ein ruchloser Krimi aus dem Wien der Zwanziger
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Müller, Wien, 1920 2. Auflage, ISBN 978-3-954184-75-0
null-papier.de/angebote
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Autor
I. Teil
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
II. Teil
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
XII. Kapitel
XIII. Kapitel
XIV. Kapitel
XV. Kapitel
III. Teil
I. Kapitel
II. Kapitel
III. Kapitel
IV. Kapitel
V. Kapitel
VI. Kapitel
VII. Kapitel
VIII. Kapitel
IX. Kapitel
X. Kapitel
XI. Kapitel
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Krimis bei Null Papier
Der Frauenmörder
Eine Detektivin
Hemmungslos
Der Mann, der zu viel wusste
Noch mehr Detektivgeschichten
Sherlock Holmes – Sammlung
Eine Kriminalgeschichte & Das graue Haus in der Rue Richelieu
Der Doppelmord in der Rue Morgue
Indische Kriminalerzählungen
Kriminalgeschichten
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Das Buch
Bettauer zeigt in seinem Milieu-Krimi ein Sittenbild der 1920er-Jahre auf. Was bedeutet Handeln in Krisenzeiten, wann wird man wirklich schuldig? Wie hoch muss, wie hoch kann man moralische Maßstäbe noch ansetzen?
Der ehemals adlige Kolomann von Isbaregg kommt desillusioniert aus dem verlorenen Ersten Weltkrieg zurück. Seine Welt ist auf den Kopf gestellt, die Werte, die für ihn noch galten, sind nutzlos geworden, sein Stand verwirkt, sein Geldbeutel leer.
Sein einziges Kapital sind seine guten Manieren und sein attraktives Äußeres. Diese Stärken nutzt er immer mehr aus, um sich seinen Weg in der Wiener Gesellschaft zu ebnen. Schließlich sind Betrug, Raub und sogar Mord allgenwärtig in seinem Alltag.
Konzentriert spiegelt der Autor hier die Spannungen im Wien zwischen den Weltkriegen wieder: Aufkommender Feminismus, erzkonservative Klischees und übelster Antisemitismus treffen aufeinander.
Der Autor war bekannt für seine drastische Darstellung von Sex und Gewalt, was ihn auch immer wieder in Stress mit den Zensurbehörden brachte.
Nun mußte es getan werden. Durch den Bruchteil einer Sekunde ließ er das Licht der Taschenlampe aufblinken. Hier saß der Kopf an dem dürren Hals des Greises. Jetzt keine Bedenken! Die Schlinge blitzschnell über den Kopf gezogen. Geiger wacht auf, hebt den Schädel schlaftrunken. Macht nichts -- zu spät! Mit beiden Händen zieht Kolo bei voller, brutaler Kraftentwicklung an den Enden der Schnur -- ein heiseres Gurgeln und kein Laut mehr!
Autor
Hugo Bettauer (* 18. August 1872 in Baden bei Wien; † 26. März 1925 in Wien; eigentlich Maximilian Hugo Betthauer ), war ein österreichischer Schriftsteller.
Maximilian Hugo Bettauer wurde als Sohn des Börsenmaklers Arnold (Samuel Aron) Bettauer aus Lemberg und dessen Ehefrau Anna geb. Wecker geboren. Sein Mitschüler Karl Kraus galt Zeit seines Lebens auch als sein schärfster Kritiker.
1890 konvertierte Bettauer vom jüdischen zum evangelischen Glauben und änderte seinen Namen von Betthauer in Bettauer.Im selben Jahr ging er als Einjährig-Freiwilliger zu den Kaiserjägern. Der Religionswechsel hängt vermutlich damit zusammen, dass es für jüdische Soldaten ohne Adel kaum möglich war, Karriere zu machen.
Unmittelbar nach dem Krieg arbeitete Bettauer als Korrespondent für New Yorker Zeitungen und startete ein Hilfsprogramm in den USA für die Wiener Bevölkerung.
Hugo Bettauer, heute beinahe vergessen, war ein ebenso unbequemer wie idealistischer Schriftsteller und Journalist. Er schrieb eine Reihe von Romanen, in denen es ihm gelang, brisante gesellschaftliche Themen in Trivialliteratur zu verpacken und so ein breites Publikum zu erreichen. 1924 gründete Hugo Bettauer die Zeitschrift »Er und Sie«, in der er die sozialen Bedingungen und die Unterdrückung von Frauen anprangerte und versuchte, ein Forum für alternative Lebensformen zu schaffen. Schon nach der fünften Nummer wurde die Zeitschrift als sittengefährdend beschlagnahmt.
Hugo Bettauer wurde 1925 von einem fanatischen Nationalsozialisten ermordet.
I. Teil
I. Kapitel
Koloman Freiherr von Isbaregg oder Kolo Isbaregg, wie er sich seit der Neuordnung der Dinge nach dem Umsturz kurz nannte, ging langsam, schlaff, schleppend über den Graben und hatte Hunger. Er spielte förmlich mit diesem Bewußtsein des Hungerns, verstrickte sich in den Gedanken, nun schon den zweiten Tag nichts gegessen zu haben, und verhöhnte sich selbst damit. »Ich Kretin, ich Trottel hungere«, sagte er in sich hinein und machte dabei ein böses, hartes Gesicht.
Immerhin, als im Menschengewühl ein schönes, blondes Mädchen, das förmlich nach Eleganz roch und eine Wolke von Anmut mit sich trug, an ihm vorbeischritt und ihn dabei unwillkürlich leicht streifte, da richtete er sich auf, straffte seine müden, ein wenig zusammengesunkenen Glieder, drehte sich um und schritt der Reizvollen nach. Aber die Gedanken kehrten zum Refrain ›Ich hungere‹ zurück und er verlor die Gestalt aus den Augen und blieb müde an der Ecke des Equitable-Gebäudes stehen, griff mit der schlanken, schmalen Hand nach der Schläfe und fühlte, wie der Hunger aus den Gedärmen und dem Magen nach oben in den Schädel kroch, wo er sich durch dumpfes Pochen und leichte Stiche bemerkbar machen wollte.
Kolo lachte so laut auf, daß Vorübergehende neugierig nach ihm starrten. Es fiel ihm ein, daß er eigentlich schon recht oft gehungert habe, länger und schmerzlicher sogar, aber doch ganz anders als heute. In den Wintertagen des Jahres 1915 war er mit seinem ganzen Regiment bei irgend einem furchtbaren Kampf um eine Karpathenhöhe drei Tage ohne Nahrung geblieben und dann wieder einmal auf der Hochfläche von Asiago und einmal bei einem Vormarsch in Albanien und ganz zum Schluß des Weltkrieges in der Höhe von fast 3000 Metern in den Tiroler Alpen. Aber was war das für ein Hunger gewesen! Ein herrlicher, heroischer Soldatenhunger und man war umgeben von Kameraden und Soldaten, die ebenso hungerten. Es war ein Hunger, dem man laut fluchen und zürnen durfte und für den man Gott und die Welt, den blöden Generalstab und vor allem das Vieh von einem Divisionär verantwortlich machen konnte! Jetzt aber war das ein schäbiges, erbärmliches, einsames Hungern, das man verbergen mußte, wollte man sich nicht zum Straßendreck legen!
Und wie er so gewissermaßen mit seinem Hunger haderte und Zwiegespräche hielt, glitt die Vergangenheit an ihm vorbei und er kaute sich die eigene Lebensgeschichte vor, wie es immer nur Menschen zu tun pflegen, wenn sie an Qualen würgen. Niemals beschäftigt man sich in den frohen und großen Augenblicken des Lebens mit der Vergangenheit.
Koloman Freiherr von Isbaregg war der letzte Sprosse eines vornehmen, alten Geschlechtes, das sich im Laufe der Jahrhunderte mit böhmischem und magyarischem, mit polnischem und sogar türkischem Blut gemischt hatte. Je seltsamer und exotischer aber die Frauen beschaffen waren, die sich den steierischen Baronen zu Isbaregg ins Ehebett legten, desto fahriger, toller und hemmungsloser wurden die nachkommenden Männer, bis Gut auf Gut, Schloß auf Schloß und Kleinod auf Kleinod ihren Händen entschwand, und schließlich von Kaiser Josefs Zeiten an die Isbareggs als tapfere Offiziere in der jeweiligen kaiserlichen Armee ihr ehrenvolles, aber karges Brot verdienten. Und da wurde denn schließlich das Blut ruhiger und dünner und von den letzten drei Isbaregg brachte es einer nach dem anderen zu hohem militärischen Rang. Kolomans Vater war sogar als Feldzeugmeister gestorben, und seine Frau, eine rötlichblonde Böhmin, konnte es gar nicht fassen, als nach dem großartigen Leichenbegängnis des Exzellenzherrn der kleine, eben zehn Jahre alt gewordene Kolo ihr mit fast wilder Entschlossenheit sagte: »Ich will nicht Offizier werden, ich will reich werden und in die Welt hinaus gehen!« Ein alter Onkel aber, der zum Vormund bestellt war, willigte kurz entschlossen ein. »Wenn ein Isbaregg mit zehn Jahren etwas will und dabei mit dem Fuß aufstampft«, meinte er, »dann ist er eben ein Isbaregg, wie sie früher gewesen sind, und man kann ihn brechen, aber nicht biegen!« Und kopfschüttelnd blätterte der alte pensionierte General in einer Mappe, die die Kopien der längst verkauften und in alle Welt verstreuten Gemälde derer von Isbaregg enthielt, so lange, bis er den kleinen Kolo in einem alten Raubritter aus dem vierzehnten Jahrhundert wieder fand. Dieselben glutvollen, schwarzen Augen, derselbe feingeschwungene, harte und energische Mund, die leichtgebogene schmale Nase und dieselbe hohe, trotzige Stirn.
So kam denn Koloman nicht in die Kadettenschule, sondern in das Theresianum, wo er einen Freiplatz erhielt, während seine Mutter sich in das billige behagliche Pensionopolis Graz zurückzog und starb, gerade als Koloman mit Auszeichnung maturierte. Der junge Herr hatte aber inzwischen seine Vorliebe für die technischen Wissenschaften entdeckt und mit Einwilligung des Vormundes verwendete er die paar tausend Kronen, die ihm die Mutter hinterlassen, um sich privat für die Realschul-Matura vorzubereiten und dann die Technische Hochschule zu absolvieren.
Isbaregg ging in der warmen Maisonne fröstelnd die Kärtnerstraße entlang, murmelte wieder wütend sein ›Ich hungere‹ in sich hinein und haspelte die vergangenen Jahre weiter ab. Kaum hatte er die Technik hinter sich, als er sich auch schon dem Leben mit offenen Armen entgegenwarf. Der Rektor, der die außerordentliche Begabung und die zähe, fast brutale Energie des jungen Mannes schätzte, verschaffte ihm eine Anstellung in einer schottischen Maschinenfabrik. Und Kolo stählte sich am Leben, arbeitete, jagte den Fußball über den Grund, lernte Boxen wie ein Matador, leistete Ersprießlichstes in seinem Beruf und -- begann zu entdecken, daß es außer Macht, Reichtum und Freiheit noch eines gab, was das Leben köstlich macht: das Weib! Der schöne schlanke Jüngling mit dem exotischen, brünetten Gesicht und den immer wie im Fieber glimmernden schwarzen Augen, die überlange Wimpern seltsam beschatteten, gefiel den jungen Mädchen und den reifen Frauen in Edinburgh wie in London, in Dublin wie in Glasgow, und mit unersättlicher Gier, der nur sein überlegener Zynismus die Balance hielt, stürzte er sich in tolle Abenteuer, aus denen er sieghaft, die Frauen mit bitterem Schmerz hervorgingen. Mit dreiundzwanzig Jahren folgte der junge Ingenieur, dessen bedeutende Befähigung in Fachkreisen bekannt wurde, einem Ruf nach Paris; dort blieb er zwei Jahre, arbeitete tagsüber wie ein Zugtier, trank, spielte und jubelte nachts wie ein privatisierender Lebemann und trat dann eine leitende Stellung in Kanada, in Toronto, an.
Dort überraschte ihn nach drei Jahren der Krieg. Und statt ruhig von stolzen Frauen geliebt, von den Männern geachtet, in Kanada zu bleiben, ließ er sich, vom furor teutonicus ergriffen, geweckt und getrieben von der Stimme seiner rauflustigen Ahnen, nicht halten, fuhr nach New York, schlug sich auf abenteuerliche Weise mit falschen Papieren nach Holland durch und konnte schon im November als Leutnant bei den Kaiserjägern die erste Schlacht in den Karpathen mitmachen. Kühnes Draufgängertum, gepaart mit kaltem, nüchternem Urteil, Todesverachtung und zähe Widerstandsfähigkeit trugen ihre Früchte, und als Koloman Freiherr von Isbaregg im Oktober 1918 als Hauptmann sein Bataillon von Italien heimwärts brachte, da schmückte seine Brust ein Dutzend der höchsten österreichischen, deutschen, bulgarischen und türkischen Tapferkeitsmedaillen.
»Und jetzt hungere ich und kann verrecken wie ein Hund oder mit Zeitungen hausieren wie ein arbeitsloser Ziegelschupfer«, murmelte Kolo halblaut und würgte den Hunger zurück, der ihm in den trockenen Gaumen trat.
Der Zusammenbruch der Monarchie war auch sein Niederbruch. Zuerst lebte er wie in dumpfer Betäubung in den Tag hinein. Ein paar Monate bekam er noch die Gage, dann die Abfertigung, dann ließ sich ein Diamantring vorteilhaft verkaufen, dann die goldene Uhr, eine Nadel, schließlich der Feldstecher und die Kamera. Bis nichts mehr zum Verkaufen da war und er eines Tages buchstäblich als Bettler in seinem möblierten Zimmer erwacht. Und nicht mehr Koloman Freiherr von Isbaregg hieß er, sondern einfach Isbaregg, denn der Adel war eben abgeschafft und verboten worden. Unmöglich, in dem verarmten, kohlen- und industrielosen Land eine Stellung zu bekommen, unmöglich, dem Käfig zu entrinnen und auszuwandern, nichts mehr an Hab und Gut als die verschlissene feldgraue Uniform ohne Distinktion, keine Verwandten, die helfen konnten, die alten Kameraden in ähnlicher Armut wie er. Allerdings -- in der aufstrebenden Tschechoslowakei hätte es für den tüchtigen Ingenieur bald Arbeit genug gegeben. Aber auch dieser neue Staat blieb ihm verschlossen, dort stand er auf der Proskriptionsliste, derer, die mehrfach tschechischen Meuterern mit der Pistole entgegengetreten waren und rasche Feldjustiz auf eigene Faust geübt hatten.
Gestern hatte ihm die Zimmervermieterin mit aufrichtigem Bedauern mitgeteilt, daß sie ihm nicht länger Kredit gewähren könne, sondern gezwungen sei, sein Zimmer anderweits zu vergeben, wenn er nicht sofort bezahlen würde. Wie ein geprügelter Hund war er davongeschlichen, als Pfand den Handkoffer mit ein paar Stücken schmutziger Wäsche zurücklassend. In der Tasche noch etliche Kronen. Die lauwarme Nacht hatte er in einem Park auf einer Bank zugebracht, die paar Kronen nach schwerem Kampf heute beim Barbier gelassen. Und nun war es Mittag, er hatte seit vierundzwanzig Stunden nichts gegessen und rief sich brutale Schimpfworte, wie Trottel, Vieh dummes, patriotischer Kretin, zu. Und dachte: »Nun habe ich zwei Möglichkeiten, entweder ich gehe in den Stadtpark und schieße mir unter einem Baum eine Kugel durch den blöden Kopf oder ich verkaufe die Pistole, esse mich satt und gehe dann zu einer Zeitung, um mich als Kolporteur anwerben zu lassen. Man soll davon leben können, besonders wenn man den ehemaligen Offizier herauskehrt. Ich kann mir das Eiserne Kreuz erster Klasse und den Leopolds-Orden anstecken, das wird Eindruck machen. Halt, das kann ich nicht, denn die Orden liegen in der Lederergasse bei meiner Wirtin und die gibt sie sicher nicht heraus, bevor ich zahle.«
Kolo schlenderte die Kärntnerstraße zurück, ging über den Graben und blieb vor der Auslage eines Delikatessengeschäftes stehen. Sardinenbüchsen, Spargel, Feigen, Mandeln, Orangen und allerlei Backwerk lagen da ausgebreitet und er fühlte, wie ihm schwarz vor den Augen wurde. »Ich könnte ja auch in den Laden treten, rechts und links Fausthiebe austeilen, Eßbares an mich reißen und mich dann verhaften lassen. Das würde Aufsehen machen und die ›Neue Freie Presse‹ würde vielleicht einen Leitartikel schreiben und sagen ›es brennt in den Eingeweiden unserer Helden‹ und eine Sammlung veranstalten. Aber ich glaube, es geht nicht, weil ich mich sehr schwach fühle und die Verkäufer mich verprügeln würden.«
Während er noch immer in die Auslage starrte und seine Augen sich an einem Topf voll Thunfisch in Öl festsaugten, verließ eine Dame, beladen mit kleinen Paketchen, das Geschäft. Eines der Päckchen entglitt ihren Händen, Kolo sprang hinzu, hob es auf und reichte es ihr. Die Dame dankte und sah ihn an und ihre feuchten, ein wenig hervorquellenden Augen blieben mit Wohlgefallen auf dem schlanken, sehnigen Körper des hochgewachsenen Offiziers haften und bekamen etwas Gieriges, als sie das scharfe, bleiche Gesicht mit dem brennenden Blick überflogen. Sie selbst war klein, vollbusig, ein wenig geschminkt und sicher gut zehn Jahre älter, als sie erscheinen wollte.
Kolo Isbaregg erwiderte den Blick mit weit weniger Wohlgefallen. »Widerliches Judenweib«, dachte er und ging. Aber sie, die vor ihm herschritt, drehte sich um und sah ihm mit dem schamlosen Blick des alternden, von unbefriedigter Sinnlichkeit verwüsteten Weibes voll ins Gesicht. Das Wort vom ›Augenwerfen‹ wurde da fast sinnfällig. Sie stielte förmlich die feuchten Augen und Kolo hatte das Gefühl, als wenn sie ihn bittend und heischend abtasten würden. Da vereinigten sich der wütende Hunger und die Einsamkeit und auch die geschmeichelte Eitelkeit und trieben ihn an, der vollbusigen kleinen Dame, die in allem das Gegenteil seines die Schlanken und Feinen verehrenden Geschmackes war, nachzugehen.
Sie schritt die Kärntnerstraße abwärts und blieb plötzlich vor einer Auslage stehen. Kolo, dicht neben ihr, fühlte ihren heißen Atem und den weichen, vollen Arm, der sich unauffällig an ihn drängte. Und da war sein Entschluß gefaßt. »Geh«, sagte er sich, »greif zu, das Weib hat Geld, wahrscheinlich viel Geld und vielleicht eine schöne Wohnung, in der du ausruhen und essen kannst.« Essen, ja essen, Himmel, der Speichel sammelte sich im Mund vor Hunger und es dröhnte ihm in den Ohren. Ja, aber, sie wird ihren Lohn verlangen, wird sich in seinen Armen wälzen und an seinen Lippen festsaugen wollen. Brr, wie grauslich! Aber essen können und ausruhen und vielleicht ein Bad nehmen und Geld, Geld ... »Zuhälter!« rief es ihm zu. »Koloman Freiherr von Isbaregg, weißt du, wie du früher über Männer, die Liebe für Geld verkaufen, gedacht hast?« »Quatsch«, antwortete Kolo sich. »Das war der Baron mit den vielen Ahnen und der großen Karriere vor Augen! Heute bin ich der obdachlose Isbaregg, der seit vierundzwanzig Stunden nichts gegessen hat und die Welt von unten aus ansieht. Essen muß der Mensch, essen und sich ausruhen und Geld haben -- alles andere ist Wurst! Geh’ mit, iß dich an und spiel’ dann den Zechpreller! Das kann lustig werden -- hui, wird die Jüdin toben!«
Kolo schmunzelte vergnügt, und die Dame, die sich immer wieder umsah, fing das Grinsen geschmeichelt auf, sie hielt es für eine Huldigung und quittierte mit einladendem Lächeln.
Bei der Oper blieb sie stehen und wartete auf eine Elektrische. Kolo geriet in Verlegenheit. Er konnte nicht mitfahren, weil er keinen Heller besaß! Aber an der Haltestelle lagen zahllose weggeworfene Umsteigkarten, die er kurz entschlossen zusammenraffte und in die Tasche steckte. Eine würde schon gültig sein und wenn nicht -- ach, was sich den Kopf zerbrechen -- er mußte ja mitfahren, er mußte essen!
Bumvoll kam der Wagen an und die Dame drängte sich mühsam hinein. Kolo dicht hinter ihr. Eng aneinandergepreßt standen sie auf der Plattform und sie wich nicht aus, sondern preßte sich gegen ihn, schmiegte den Busen an seine Hüfte. Kolo begann an dem Abenteuer Gefallen zu finden. Seine Hand glitt die feisten Hüften entlang, preßte die bebenden Schenkel, fühlte die Hitze, die aus dem dünnen Seidenrock strömte. Und die Dame schloß die Augen und lehnte sich tief atmend ganz gegen ihn.
Der Schaffner kam und Kolo reichte ihm eine ganze Hand voll zerknüllter Zettel. »Einer muß der richtige sein«, murmelte er. Er hatte Glück, gleich die erste Karte wurde für gut befunden. Die Dame vereinigte die vier oder fünf Päckchen mühsam und zitternd unter einem Arm, öffnete das goldene Täschchen, entnahm ihm eine Damenbrieftasche und dieser einen Zweikronenschein. Unwillkürlich hatte Kolo die Prozedur beobachtet und er sah in der Tasche Banknoten, viele Banknoten. Er hielt den Atem an und befeuchtete mit der Zunge die trockenen, brennenden Lippen. Und seine Hand glitt wieder abwärts und blieb an dem fetten Frauenschenkel unter der Goldtasche haften. Noch mehr Leute stiegen ein und die Frau konnte sich unauffällig noch enger an ihn drängen, er noch fester mit den Fingern das Fleisch betasten.
Der Wagen war auf dem Rainerplatz angelangt und sie traf Anstalten, auszusteigen. Sie schob sich zum Trittbrett hin und sah Kolo lächelnd und siegessicher an. »Du kommst mit, schöner Mann«, sprach ihr Auge. In Isbaregg wurde aber im Bruchteil einer Sekunde eine flüchtige Idee zum Entschluß und der Entschluß zur Tat. Er drängte nach, blitzschnell öffnete er mit zwei Fingern den Bügel der Goldtasche, der er langsam das Portefeuille entnahm. Hochrot schritt die Dame dem Brahmsplatz zu, sie merkte nicht, daß die Goldtasche offen stand, sie merkte nicht einmal, daß eines der Päckchen abermals zu Boden fiel und von einem halbwüchsigen Burschen rasch aufgehoben wurde, sie sah sich nur immer wieder nach dem schlanken, großen Mann mit den sehnigen Gliedern und der kühnen, edlen Hakennase um.
Kolo ging jetzt in respektvoller Entfernung nach, wartete, bis sie um die Ecke bog, machte kehrt und eilte mit Riesensätzen die Wiedner Hauptstraße entlang, bis ihn das Menschengewühl verschlungen hatte. Bei der Oper erst verlangsamte Kolo sein Tempo, sah sich rasch um und betrat eines der Kaffeehäuser. Er begab sich, ohne die Verbeugung des Kellners zu beachten, direkt in den Toiletteraum, verriegelte die Türe hinter sich und riß das Portefeuille aus der Hosentasche. In seinen Fingern knisterten die Scheine. Da, in diesem Fach lagen schmutzige, abgebrauchte, erbärmliche Zwanzig-, Zehn- und Zweikronenscheine, da aber wuchsen ihm Tausender und Hunderter entgegen. Und Kolo, in dessen Hand die Pistole niemals gezittert hatte, wenn er beim Angriff an der Spitze seiner Leute mit langen Sätzen hinüber zum feindlichen Drahtverhau gestürmt war, mußte sich gewaltsam zur Selbstbeherrschung aufraffen, mußte drei-, viermal beginnen, bevor er ruhig zählen konnte. Dreißig Stück Tausender, vier Hunderter und die kleinen Noten -- das war die Beute!
»Beute«, dachte er. Und es fiel ihm ein, daß vor noch gar nicht langer Zeit das Wort Beute eine ganz andere Bedeutung gehabt hatte, einen ordentlichen Amtscharakter, daß es Beutezüge, Beuteverteilungsstellen und sogar Beuteprämien gegeben. Jetzt hatte er Beute auf eigene Faust gemacht!
II. Kapitel
Nun aber essen, essen! Kolo warf dem Kellner einen Zweikronenschein zu, verließ das Café und begab sich zu Hartmann, wo er früher, wenn er in Wien auf Urlaub gewesen war, so gerne gespeist hatte. »Kellner, rasch eine Suppe und dann einen Fisch und dann irgendeinen Braten mit Salat und Kompott, nur rasch, rasch, wenn Sie ein gutes Trinkgeld haben wollen!« Und er aß langsam mit Beherrschung und trank in kleinen, vorsichtigen Schlücken den Wein und schlürfte mit unendlichem Behagen den Mokka und blies mit sybaritischer Wollust den Rauch der importierten Zigarette vor sich hin, zahlte und ging. Nicht mehr müde und gebeugt und kraftlos, sondern aufrecht, gestählt, voll Leben. Ging mit federnden Schritten den Ring entlang, freute sich unterwegs des Maiengrüns der Ahornbäume und lachte laut auf, wenn er an die vollblütige Dame dachte, der ihr Mittagmahl wesentlich weniger gut geschmeckt haben mochte als ihm.
Seine Wirtin in der Lederergasse begrüßte ihn mit verlegener Zurückhaltung, die aufrichtiger Freude Platz machte, als ihr Isbaregg frohgelaunt zurief: »Die Rechnung, liebe Frau, ich will meine Schuld begleichen und mich dann ausruhen!« Und um ihre Neugierde zu befriedigen, erklärte er leichthin: »Endlich habe ich im Kriegsministerium meine rückständigen Gebühren bekommen, nun kann man eine Zeitlang wieder existieren!«
In seinem Zimmer allein, untersuchte Kolo nochmals die Brieftasche. Aus drei gleichen Visitenkarten konnte er den Namen der getäuschten Frau entnehmen, Selma Rosenzweig, Kommerzialratswitwe. »So sieht sie aus, ganz so!« Ein Posterlagschein, eine quittierte Rechnung und da in der Ecke ein silbernes Zweikronenstück. Er lächelte: »Silbergeld, das hat man hier lange nicht gesehen, wahrscheinlich als Talisman aufbewahrt. Na, hoffentlich bringt es mir mehr Glück als der geliebten Selma!« Und er schob die Münze in die Westentasche. Das Papiergeld steckte Kolo in seine eigene Brieftasche, die der Frau Rosenzweig warf er in den Ofen, gab Papier dazu und ließ sie in Asche aufgehen.
Es wird oft und gerne behauptet, daß dieser oder jener Mensch durch die Schrecken eines Abenteuers, durch gewaltigen Schmerz, durch eine furchtbare seelische Erschütterung ganz plötzlich, über Nacht, grau wurde oder sogar innerhalb einer Stunde weiße Haare bekommen habe. Und es ist ein beliebtes Ausfluchtsmittel für Romanschriftsteller, ihre Helden eine völlige Umwandlung des Charakters erleben zu lassen, als Folge einer bösen Enttäuschung oder argen Kränkung. Beides wird so oft erzählt, daß es allgemein geglaubt wird, und doch wird sich schwerlich jemand melden können, der dergleichen selbst erlebt, erfahren oder wenigstens persönlich beobachtet hat. Und wenn sich auch solche Fälle ereignen, so wird die exakte Untersuchung immer ergeben, daß es sich eigentlich nur um die Beschleunigung eines ohnedies schon wirkenden Prozesses gehandelt hat. Der Mann, der im Urwald, von wilden Bestien bedroht, weiße Haare bekommt, wäre sicher auch ohne dieses Ereignis sehr bald weiß geworden, weil eben sein Haarboden krank war. Und die Frau, die die Untreue des Geliebten bösartig, gemein, schamlos und grausam macht, die war eben nie so sanftmütig und edel, wie es der Schriftsteller glauben machen will, sondern alle die peinlichen Eigenschaften waren längst in ihr, kamen aber nicht zum Ausbruch, weil kein Anlaß dafür vorhanden war, und die Untreue und Kränkung hat sie nicht erzeugt, sondern nur geweckt.
Auch Kolo Isbaregg, der gestern noch ein tadelloser Ehrenmann gewesen war, hätte den Taschendiebstahl des heutigen Tages sehr gut und gerne mit seiner grausamen Notlage, der Verwirrung und Erschütterung seiner Sinne durch den erlittenen Hunger entschuldigen können, wenn er ein kleiner Dutzendheuchler gewesen wäre. Er hatte aber gar keine Lust, sich vor sich selbst zu entschuldigen, sondern betrachtete seine Handlungsweise als ganz vernünftig und berechtigt, als moralisch sogar, wenn man den Trieb, sich selbst zu erhalten, als normal und zulässig anerkennt.