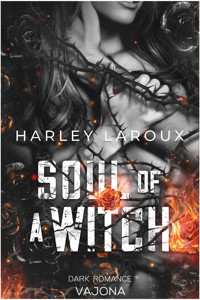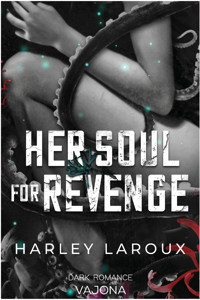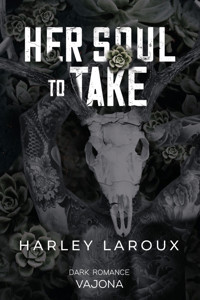
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vajona Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leon Ich habe mir meinen Ruf unter Magiern nicht umsonst verdient: Ein falscher Schritt, und du bist tot. Mörder, nannten sie mich, und das Töten ist das, was ich am besten kann. Außer bei ihr. Bei derjenigen, die ich nehmen sollte, bei derjenigen, die ich hätte töten sollen – habe ich es nicht getan. Der Kult, der mich einst kontrollierte, will sie haben, und ich werde mein neues Spielzeug nicht an sie verlieren. Rae Ich habe immer an das Übernatürliche geglaubt. Die Jagd nach Geistern ist meine Leidenschaft, aber das Herbeirufen eines Dämons war nie Teil des Plans. Monster durchstreifen die Wälder, und etwas Prähistorisches – etwas Böses – erwacht und ruft meinen Namen. Ich weiß nicht, wem ich vertrauen kann, oder wie tief diese Dunkelheit reicht. Alles, was ich weiß, ist, dass meine einzige Überlebenschance der Dämon ist, der mich verfolgt, und er will nicht nur meinen Körper. Er will meine Seele.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Harley Laroux
Her Soul to Take
Übersetzt von Madlen Müller
Her Soul to Take
© 2025 VAJONA Verlag GmbH
Übersetzung: Madlen Müller
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel
»Her Soul to Take: A Paranormal Dark Academia Romance (Souls Trilogy)«
Vermittelt durch die Agentur:
WEAVER LITERARY AGENCY, 8291 W. COUNTY ROAD 00 NS., KOKOMO, IN 46901, USA
Korrektorat: Patricia Buchwald und Susann Chemnitzer
Umschlaggestaltung: Opulent Swag and Designs
Satz: VAJONA Verlag GmbH, Oelsnitz
VAJONA Verlag GmbH
Carl-Wilhelm-Koch-Str. 3
08606 Oelsnitz
An meinen Ehemann.
Mein Licht in der Dunkelheit.
Hinweis
Dieses Buch enthält Gewaltdarstellungen und sexuelle Inhalte. Es ist nicht für Personen unter dem gesetzlichen Mindestalter bestimmt. Alle in diesem Buch dargestellten Personen sind über 18 Jahre alt. Dieses Buch ist nicht als Quelle für sexuelle Aufklärung oder als Informationsführer zu Sex oder BDSM gedacht. Die in diesem Buch dargestellten Aktivitäten sind gefährlich und die Szenen in diesem Buch sind nicht dazu gedacht, realistische Erwartungen an BDSM oder fetischbezogene Aktivitäten darzustellen.
Einige Inhalte in diesem Buch können für manche Leserinnen und Leser verstörend oder auslösend sein. Die Diskretion der Leser wird dringend empfohlen.
Die Kinks/Fetische in diesem Buch:
Einvernehmliche Nicht-Einverständniserklärung (CNC), Atemspiel/Würgen, Blutspiel, Spucken, Schlucken von Körperflüssigkeiten, Nadelspiel (Body Modification Fetisch), Schmerzspiel, Angstspiel, öffentliches Spiel, Bondage, Fesselung, Spanking/Impact Play, erotische Erniedrigung/Degradation, roher Sex/Sex ohne Kondom.
Kapitel 1
Leon
»In seinem Namen ist Blut vergossen worden. Es ist wach.«
Ich hatte die Erschütterung gespürt, bevor er sie ankündigte. Verdammte Sterbliche, die immer das Offensichtliche sagen, als ob ich nicht spüren könnte, wie der Boden zittert und die alten Wurzeln sich anspannen – anspannen, wie ein Körper, der sich auf einen Schlag vorbereitet. Als ob ich nicht das Flüstern hören könnte, das in der Dunkelheit lauter wurde, die Ranken alter, unverständlicher Gedanken, die nach Schwachstellen suchten.
Der Beton, der mich umgab – mich lebendig begrub – konnte die Störung nicht verbergen. Ich brauchte Kents aufgeblasenen Arsch nicht, der hier hereinstolzierte und Erklärungen abgab, als sollte ich bei den Neuigkeiten kriechen. Ich saß mit gekreuzten Beinen in meinem erbärmlichen Bannkreis und wetzte meine Nägel an dem Betonboden, ich warf ihm kaum mehr als einen Blick zu, als er mit seinen Kumpanen im Schlepptau den Raum betrat. Auf seine Erklärung hin grunzte ich nur, und das schien ihn kaum zu befriedigen.
»Hast du mich gehört, Dämon?«, schnauzte er, und seine Finger krallten sich in die Lederoberfläche seines Grimoires. Dieses verdammte, abgenutzte Buch war immer in seinem Griff, der Hammer, den er über meinen Kopf erhoben hatte. Ein nicht magischer Mann wie Kent konnte mich ohne sein kleines Grimoire nicht kontrollieren. »Ich habe dich gehört.« Ich seufzte schwer und lehnte mich zurück, um mit den Fingernägeln auf den Boden zu klopfen. »Entschuldige, dass ich nicht vor Freude springe, Kenny-Boy. Die Tatsache, dass du hier bist, um dich damit zu brüsten, dass dein alter Gott seine Glieder ausstreckt, sagt mir nur, dass er noch nicht genug aufgewacht ist, um dir all die köstliche Macht zu geben, die du suchst.« Sein Gesichtsausdruck verfinsterte sich gefährlich, und ich wusste, dass ich kurz davor war, ihn dazu zu verleiten, mir wehzutun.
Die Gefangenschaft war so unendlich langweilig, dass es zu einem echten Nervenkitzel wurde, zu sehen, wie weit ich meinen Meister treiben konnte, bevor es zu Schmerzen kam.
Ich zuckte mit den Schultern. »Du bist also mit einer Aufgabe hier. Du bist hier, um mich auf eine kleine Besorgung zu schicken, bevor du mich wieder im Dunkeln einsperrst. Spannend.«
Kents Fingerknöchel waren weiß geworden. Er hatte etwas Adeliges an sich; er hätte sich im viktorianischen London ebenso wohlgefühlt wie in der Geschäftswelt von Seattle. Dunkelgrauer Anzug, ein dezenter Nadelstreifen auf seiner schwarzen Krawatte, perfekt geschnittenes und gekämmtes graues Haar. Er war so zurückhaltend wie der wolkenverhangene Himmel Washingtons und ebenso unberechenbar in seinen Stimmungen.
»Ich würde deine Kraft für die bevorstehende Arbeit aufsparen, Dämon«, sagte er mit fester Stimme und kaum zu bändigender Wut. »Anstatt sie an deine kleinliche Zunge zu verschwenden. Es sei denn, du möchtest, dass ich sie dir wieder herausreiße?«
Ein Kichern kam von einer der weiß gekleideten Gestalten hinter ihm, und ich funkelte ihn an, hielt aber meinen Mund. Kent ließ sie die Umhänge und die Hirschschädelmasken tragen, aber ich wusste, dass die beiden gesichtslosen Wesen, die ihn hierher begleiteten, seine erwachsenen Ausgeburten waren. Victoria, die nach bitterem, künstlichem Vanilleduft und all den Chemikalien in ihrem Make-up roch. Und Jeremiah, der nach billigem Körperspray und Haargel stank.
»Heute Nacht um Mitternacht wirst du zum Westchurch-Friedhof gehen. Du wirst leise gehen und sicherstellen, dass dich niemand auf dem Weg dorthin entdeckt. Dort wirst du das Grab von Marcus Kynes finden. Du wirst seine Leiche ausgraben und das Grab wieder auffüllen. Dann bringst du seine Leiche nach White Pine. Ist das klar?«
Ich mochte meine Zunge lieber in meinem Mund. Sich eine neue wachsen zu lassen, war eine unangenehme Angelegenheit. »Verstanden.«
Es gab keine Uhr in diesem erbärmlichen kleinen Raum, aber ich spürte, dass Mitternacht nahte. Die Welt veränderte sich leicht, bewegte sich ein wenig näher an die Grenze, die sie von Himmel und Hölle trennte. Mitternacht gab mir immer ein gutes Gefühl, ebenso wie die Tatsache, dass ich mir endlich die Beine vertreten und den Bindungskreis verlassen konnte.
Kent hielt mich so oft in diesem Kreis, dass er ihn in den Fußboden hatte einritzen lassen. Wie sein Vater und sein Großvater vor ihm fürchtete Kent, dass ich ihm irgendwie für immer entkommen würde, wenn er mich aus seinem Dienst entlassen würde, wenn er mich nicht unmittelbar brauchte. Ein schöner Gedanke, aber ein unwahrscheinliches Ergebnis. Kent besaß das Grimoire, die einzig verbliebene Aufzeichnung meines Namens auf der Erde. Nur er allein konnte mich deshalb herbeirufen.
Ich nehme an, er befürchtete auch, dass ich in meinem beträchtlichen Hass auf ihn die Regeln brechen und mich rächen würde, indem ich ihn und seine gesamte Familie ermordete, nachdem ich aus seinem Dienst entlassen worden war. Auch das ist ein schöner Gedanke und ein weitaus wahrscheinlicheres Ergebnis. Ich würde den Zorn meiner Vorgesetzten in der Hölle riskieren, wenn ich dadurch diese ganze Familie zerstören könnte.
Aber es war über ein Jahrhundert vergangen, und in all der Zeit hatte ich der Familie Hadleigh gedient. Es war beeindruckend, ehrlich gesagt – niemand sonst war es je gelungen, mich so lange gefangenzuhalten, ohne sein Leben zu verlieren. Es gab einen guten Grund, warum es nur noch eine einzige Aufzeichnung mit meinem Namen gab. Die Beschwörer hatten im Laufe der Jahre schnell gelernt, dass ich nicht leicht zu beherrschen war, und hielten es für das Beste, mich überhaupt nicht zu beschwören.
Ich hatte eine Spur von toten Magiern hinterlassen und war begierig darauf, ein paar weitere hinzuzufügen.
Die Nacht war kalt und neblig, die Kiefern trieften vom Tau. Der Westchurch-Friedhof war von Bäumen umgeben und von der ruhigen Straße, die an ihm vorbeiführte, fast unsichtbar. Reihen von Grabsteinen, von denen einige über ein Jahrhundert alt waren, säumten den weiten, ungemähten Rasen. Ich brauchte nicht lange, um Marcus zu finden. Die aufgewühlte Erde verriet ihn, sein Grab war frisch aufgefüllt. Ein flacher, einfacher Grabstein kennzeichnete ihn.
Marcus Kynes. Einundzwanzig Jahre alt. Das ›vergossene Blut‹, das Hadleighs Gott erweckt hatte. Seltsam, dass Marcus überhaupt begraben worden war. In der Kathedrale sollte ein Opfer erbracht werden, wobei der Leichnam sofort geopfert werden sollte – oder wenn möglich, lebendig geopfert werden, damit Gott nach Belieben mit ihm spielen konnte. Die Tatsache, dass Marcus begraben worden war, schien chaotisch gewesen zu sein.
Ich brauchte nicht lange, um zu ihm hinunterzugraben, ich benutzte meine bloßen Hände und Klauen, um den losen Dreck aufzuwühlen. Der Sarg war eine einfache Holzkiste, vollkommen schlicht. In dem Moment, als ich den Deckel hochzog, stieg mir der Gestank von Formaldehyd in die Nase. Marcus war in einem billigen Anzug beerdigt worden, sein jugendliches Gesicht wachshaft, mit der Menge an Make-up, die man ihm aufgetragen hatte.
»Aufwachen, aufwachen.« Ich warf ihn mir über die Schulter, kroch aus dem Grab und legte ihn neben den Haufen Erde, den ich gerade ausgegraben hatte. »Gib mir nur eine Minute, Kumpel. Deine Mutter soll nicht wissen, dass das Grab ihres Sohnes geschändet wurde.«
Ich füllte das Grab schnell wieder auf und machte mich dann mit der Leiche über der Schulter auf den Weg nach White Pine. Das Waldgebiet und der Minenschacht, der darin lag, waren schnell genug zu erreichen, mit Marcus über meiner Schulter baumelnd aber sehr mühselig. Dennoch war es besser, mit einer Leiche durch die Bäume zu laufen als in meinem Betongefängnis zu sitzen.
Die Geisterstunde näherte sich, als ich White Pine erreichte. Es begann ein nebeliger Regen, und Marcus’ Geruch wurde von Sekunde zu Sekunde schlimmer. Aber abgesehen von seinem Gestank und dem Geruch von nasser Erde konnte ich Rauch riechen. Ein Lagerfeuer, irgendwo in den Wäldern.
Tief in den Bäumen und ein kleines Stück den Hang hinauf fand ich Kent und seine fröhliche Bande, die mich in der Nähe der Flammen erwarteten.
Sie hatten alle ihre weißen Umhänge und Hirschmasken angezogen. Mindestens zwei Dutzend von ihnen waren zwischen den Bäumen verteilt und sprachen leise unter schwarzen Regenschirmen. Es war kein Wunder, dass diese kleine Stadt mit Kryptiden-Sichtungen überschwemmt wurde. Dank Kents kleiner Sekte, die sich Libiri nannte, hatte fast die gesamte Bevölkerung von Abelaum irgendeine fantastische Geschichte über die Sichtung eines Monsters im Wald.
Sie hatten nicht ganz unrecht. Sie sahen Ungeheuer, aber von der menschlichen Sorte.
Die Einzige, die keine Uniform trug, war Everly, Kent Hadleighs uneheliche Tochter. Everly war ein paar Monate älter als ihre Halbgeschwister Victoria und Jeremiah, blond, gertenschlank und in ihr übliches schwarzes Gewand gekleidet. Die junge Hexe sah absolut versteinert aus, und als ihre blauen Augen auf mich und die Leiche fielen, die ich mitbrachte, sah sie aus, als müsste sie sich übergeben.
»Brüder, Schwestern, das Opfer kommt«, sprach Kent mit einer bizarr theatralischen Stimme, als er vor seiner Gruppe von Eiferern stand. Irgendwo zwischen einem feurigen Südstaatenprediger und einem Kindergärtner, der in seinem Garten Leichen vergraben hatte. Diese Stimme ging mir auf die Nerven, ebenso wie die Art, wie er mit den Fingern schnippte und auf den Boden zu Everlys Füßen zeigte. »Hier. Leg ihn ab.«
Ich ließ Marcus unsanft vor die Füße der jungen Hexe fallen, und ein Anflug von Schmerz zog sich über ihr Gesicht. Hatte sie ihn gekannt? Vielleicht ein Kommilitone an der Universität? Oder war ihr Herz plötzlich weich geworden, als all die Predigten ihres Vaters über die Schönheit des Todes zu einer sehr hässlichen Realität wurden?
»Zieh ihm die Kleider aus«, sagte Kent, ich zog die Leiche sofort aus und zerriss den billigen Anzug wie Papier. Als seine Brust entblößt wurde, entdeckte ich die Wunden, die kein Leichen-Make-up hätte verdecken können: Mehrere Stichwunden zogen sich willkürlich über seine Brust, und dazwischen waren die Linien und Runen der Opfergabe geritzt.
Unordentlich. Sehr unordentlich. Ungeplant, wenn ich raten müsste. Spontan sogar.
Ich hob eine Augenbraue zu Kent, eine stumme Frage, von der ich wusste, dass er sie nicht beantworten würde. Er nickte Everly energisch zu, und die junge Hexe, die kränklich blass aussah, kniete nieder und begann, die Zeichen auf Marcus’ Brust zu untersuchen.
»Sie werden funktionieren«, sagte sie schließlich. Eilig stand sie auf und wandte ihren Blick von der Leiche ab. »Die Zeichen sind grob, aber wirksam.« In einem kurzen Moment der Sorge flackerte ihr Blick durch die Menge. Sie dachte, dass das, was sie gesagt hatte, beleidigend sein könnte, und eine Beleidigung könnte Konsequenzen nach sich ziehen.
»Sehr gut«, sagte Kent leise. Dann lauter, wieder ganz theatralisch: »Lange haben wir auf diesen Tag gewartet, meine Kinder. Lange hat der Tiefste darauf gewartet, gewartet mit äußerster Geduld und Gnade. Heute geht der Erste von Dreien in seine Tiefen. Mögen zwei weitere folgen.«
»Mögen zwei weitere folgen«, murmelte die Menge, außer Everly, deren Lippen zu einer dünnen, harten Linie in ihrem hübschen Gesicht zusammengepresst waren.
»Diener, trage das Opfer zur Mine hinauf«, sagte Kent. Diener. Verdammte Hölle. Ich hätte ihn am liebsten mit seiner eigenen Zunge erwürgt. »Jeremiah wird dich begleiten. Dieses Opfer ist für ihn bestimmt.«
Eine Gestalt trat vor, die nach Körperspray stank. Jeremiah, natürlich. Dieses unordentliche, ungeplante, absolut verpfuschte Opfer war alles der Verdienst von Kents lieben Sohn. Ich verdrehte die Augen, hob aber den nackten Marcus vom Boden auf und ging, ohne ein Wort zu Jeremiah zu sagen, in die Bäume, weg vom Licht des Feuers.
Jeremiah versuchte, vor mir zu gehen, aber ich hielt mein Tempo gerade so schnell, dass er das nicht konnte. Der Junge hatte noch weniger Geduld als sein Vater.
»Verdammt noch mal, mach langsamer, Leon«, sagte er. »Oder ich schwöre, ich lasse dir nächstes Mal von Dad die Eier abreißen.«
»Ganz ruhig, ganz ruhig.« Ich schüttelte den Kopf, wurde aber langsamer. Ich würde dem Arschloch den Vortritt lassen, ihn in seinem kleinen Machttrip schwelgen lassen. Wenn ich auf seinen Hinterkopf starrte, konnte ich wenigstens darüber fantasieren, ihn aufzubrechen. »Der gehört also dir, was? Hast du ein bisschen Ärger mit ihm?«
»Der Bastard hat versucht zu fliehen«, sagte er und lachte düster. »Er ist nicht weit gekommen. Hat gequiekt wie ein Schwein. Ich glaube, ich verstehe, warum du so gerne tötest, Leon. Es ist ein verdammter Rausch.«
Ich knirschte mit den Zähnen. »Glaube nicht, dass du den Tod durch einen unordentlichen Mord verstehst. Warte nur, bis dein Gott aufwacht. Das wird dich einiges über den Tod lehren.«
Ich bin sicher, er hätte am liebsten zurückgeschnauzt, aber wir waren angekommen. Dort, im Schatten der Bäume, lag der Schacht der White Pine Mine. Seit fast einem Jahrhundert war er mit Brettern vernagelt, und das gebeizte Holz des Eingangs war mit zahlreichen Runen bedeckt: Einige geschnitzt, einige gemalt, einige eingebrannt. Ein Metallschild baumelte an einer zerbrochenen Kette vom Holz und darauf stand: VORSICHT: OFFENE MINE. NICHT BETRETEN. Der Boden war mit Moos bedeckt, und zahlreiche weißköpfige Pilze wuchsen in dicken Haufen um die Öffnung des Schachts.
Der Boden selbst vibrierte. Die Bäume waren unruhig. Ein seltsamer Geruch nach tiefem Wasser und verrottenden Algen durchdrang die Luft. Irgendwo, tief in den überfluteten Tunneln unter unseren Füßen, regte sich ein alter Gott.
Ich erschrak nicht so leicht, aber mich überlief trotzdem ein leichter Schauer.
»Nun, los geht‘s.« Ich schob Marcus in Jeremiahs Arme, der mit einem Aufschrei zurücksprang und den armen Marcus in den Schlamm fallen ließ.
»Was zum Teufel stimmt nicht mit dir?« Seine Stimme schoss in die Höhe. Er klang nicht mehr so eingebildet. »Ich will das nicht anfassen!«
»Es ist dein Opfer.« Ich zuckte mit den Schultern. »Willst du wirklich, dass ein Dämon deine Opfergabe an den Tiefsten einfordert, indem du ihn hineinwirfst?«
Jeremiah schwankte, seine Augen flackerten zwischen der Leiche und der Mine hin und her. Seine Kehle schnürte sich zusammen, als er schluckte. Es war mir wirklich scheißegal, wie die verdammte Leiche da herunterkam, aber wenn ich die Gelegenheit hatte, Jeremiah zum Zappeln zu bringen, würde ich sie nutzen.
Schließlich hob Jeremiah, mit einem angewiderten Stöhnen, Marcus in seine Arme; keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass der tote Mann fast genauso groß war wie er. Er stapfte auf die Mine zu und blieb kurz vor dem Eingang stehen, um in die völlige Schwärze dahinter zu blicken.
Wie sehr würde ich leiden, wenn ich ihn einfach rein schubsen würde? Zwei Opfer zum Preis von einem. Kent sollte es als ein echtes Schnäppchen betrachten.
Aber ich habe widerstanden. Die Rache würde kommen, eines Tages.
Oder der Tiefste würde aufwachen und mich zuerst töten.
Mit einem Grunzen warf Jeremiah Marcus in die Dunkelheit hinunter. Sein Körper schlug mit einem dumpfen Aufprall auf dem Boden auf, ein Schlurfen war zu hören, als er sich abrollte, und dann ein Platschen, als er auf das Wasser im überfluteten Tunnel unter ihm traf. Der Geruch des Meerwassers wurde intensiver, und der Wind frischte auf und ließ die Tannennadeln über mir rascheln. Mein Magen zog sich unangenehm zusammen, und Jeremiah stolperte schnell von der Mine zurück und wischte sich die Hände an seinem Umhang ab. Er sagte kein Wort zu mir, sondern marschierte einfach wieder den Hügel hinunter.
Ich blieb einen Moment lang stehen und starrte in die Dunkelheit. Meine Zehen krümmten sich bei dem Grollen unter mir, und mein Schädel vibrierte von der Kraft davon. Morgen würden die Gezeiten hoch sein. Diese Bäume würden den langen, langsamen Prozess beginnen, ihre Wurzeln aus dem Boden zu ziehen, als ob sie von dem Ding unter ihnen weglaufen könnten, das sich so falsch anfühlte.
Dann ertönte aus der Dunkelheit ein Heulen. Wie der Schrei eines Fuchses, aber in einem so qualvollen Schrei, dass sich die Haare in meinem Nacken aufstellten.
Es war Zeit, zu gehen. Ich hatte keine Lust, mich jetzt damit zu beschäftigen. Oder jemals.
Der Gott war nicht das Einzige, das erwachte.
Kapitel 2
Rae
Es hatte etwas Magisches, an einen Ort zurückzukehren, den ich seit meiner Kindheit nicht mehr betreten hatte. Diese frühen Erinnerungen fühlten sich verschwommen an, wie ein Fiebertraum, eine völlig andere Welt als die, an die ich mich in Oceanside gewöhnt hatte. Das Rauchen von Joints und das Trinken von Modelo am Strand waren meine Teenagerjahre, aber als ich klein war? Meine Welt waren diese tiefgrünen Wälder, die endlos zu sein schienen, voller Feen und Einhörner, und mein kleines Kinderhirn strotzte nur so vor Fantasie, dass mein Vater dachte, ich würde es nie schaffen, mich niederzulassen und einfach in der realen Welt existieren.
Er hatte nicht Unrecht. Die reale Welt war langweilig und beinhaltete Bürojobs, steife Blusen mit Kragen und viel zu viele unbequeme Schuhe. Es ging auch darum, sich in Spanien zur Ruhe zu setzen – deshalb fuhr ich zurück in mein Elternhaus, während meine Eltern den Verkauf ihres Hauses in Südkalifornien abschlossen, um sich an der spanischen Küste luxuriös zur Ruhe zu setzen.
Ich hätte mit ihnen gehen können, sicher. Aber die Entscheidung, zu bleiben und mein letztes Jahr an der Universität zu beenden, war verantwortungsbewusst und sehr erwachsen, wie mein Vater sagen würde, und ich musste anfangen, mich so zu verhalten, da ich kurz davor stand, keine Studentin mehr zu sein. Es war eine lange Fahrt nach Norden. Mein Hintern war wund, mein Rücken tat weh, und mein pummeliges Kätzchen Cheesecake war absolut wütend, den zweiten Tag in Folge wieder im Auto zu sitzen. Nicht einmal die Pommes frites, die ich ihm immer wieder aus meiner Fast-Food-Tüte zuwarf, konnten ihn länger besänftigen. Ich fuhr durch eine Welt, die von nassen Grautönen und aufgeweichten dunkelgrünen Farben überschwemmt war, bis ich schließlich das Willkommensschild für die Stadt Abelaum passierte, 6.223 Einwohner – oder jetzt 6.224, dank mir. Der Regenguss wurde zu einem Nieselregen, und die Aquarellwelt vertiefte ihre Farbtöne, bis der Wald Gestalt annahm: hohe Kiefern, umgeben von einem dichten Unterholz aus Farnen und jungen Bäumen, mit Pilzkappen, die blass und gespenstisch zwischen ihren Wurzeln sprießten.
Ich hätte im Haus bleiben und auspacken sollen. Stattdessen stieg ich, nachdem ich eilig meine Kisten ins Wohnzimmer geschleppt und dafür gesorgt hatte, dass Cheesecake sein Futter und Wasser bekam, wieder in mein Auto und fuhr die kurze Strecke in die Stadt, zur Main Street. Direkt im Eckladen eines dreistöckigen Backsteingebäudes traf ich meine beste Freundin seit fast fünfzehn Jahren, Inaya, im Golden Hour Books.
Ihrem Golden Hour Books. Meine beste Freundin hatte ihren Traum verwirklicht und war stolze Besitzerin des verdammt süßesten Buchladens, den ich je gesehen hatte.
»Fast fertig«, sagte sie, während ihre Finger über die Tasten ihres Laptops flogen. Ihre Hände waren mit zarten goldenen Ringen geschmückt, die hell auf ihrer dunkelbraunen Haut schimmerten. Die Ringe waren mit kleinen Bienen und Blumen verziert, die zu den süßen Blumenaufnähern auf ihrer rosa Jacke passten. Sie war der hellste Sonnenstrahl, den ich gesehen habe, seit ich San Francisco verlassen hatte, und mir wurde schon allein durch ihre Anwesenheit wärmer.
»Keine Eile, Mädchen, lass dir Zeit.« Ursprünglich hatten wir uns für später am Abend verabredet, aber ich war zu ungeduldig gewesen, sie zu sehen, und zu bereit, mich vor der lästigen Aufgabe zu drücken, mein ganzes Leben aus Kartons auszupacken, um zu warten. Jetzt fühlte ich mich schuldig, weil ich bei ihr hereingeplatzt war, als sie mitten in der Katalogisierung einer so großen neuen Bücherlieferung war.
Ich hob einen der Stapel auf, die sie fertig eingegeben hatte, und balancierte ihn sorgfältig gegen meine Brust. »Soll ich die nach hinten bringen?«
»Der Stapel ist so groß wie du!« Sie lachte. »Du musst gar nichts tun.«
Ich konnte sie bei dem Bücherstapel nicht genau sehen, und meine Brille war mir auf die Nase gerutscht. Aber ich bestand darauf. »Nach hinten?«
»Ja, da hinten ist ein gelber Wagen«, sagte sie. »Danke!«
Leider hatten die Schwerkraft und ich schon immer ein gespanntes Verhältnis zueinander – tatsächlich ein ziemlich toxisches. Zwischen meinen nicht gebundenen Schnürsenkeln, der verrutschten Brille und dem zu großen Bücherstapel stolperte ich auf halbem Weg nach hinten über meine eigenen Füße und ließ die Bücher durch die Luft fliegen.
»Alles in Ordnung!«, rief ich, als Inaya lauthals in Gelächter ausbrach. Ich krabbelte auf Händen und Knien, um die Bücher einzusammeln – bis meine Finger über den rissigen, ledergebundenen Einband eines dünnen Bandes streiften und ich erschrocken zurückwich. Das Buch war kalt.
Neugierig drehte ich es um. Der Schriftzug und das filigrane Muster auf der Vorderseite sahen aus, als wären sie in das Leder eingebrannt worden, und die Worte waren mir fremd: Latein, wenn ich raten müsste. Ich holte mein Handy hervor und tippte in der Suchmaschine eine Übersetzung ein.
Es war Latein und lautete: Magische Arbeit und Beschwörung.
»Etwas Gutes gefunden?« Inayas Stimme ließ mich zusammenzucken. In meinen Ohren war ein Geräusch wie das ferne Rauschen von Wellen in einem langen Tunnel, und mein Magen fühlte sich hohl an, wie das Gefühl, zu fallen.
»Ja, sieh dir das an. Das hier sieht wirklich alt aus.« Ich reichte ihr das Buch, und es gab einen Ruck, als es meine Finger verließ: ein winziger Anflug von Angst, der mich dazu brachte, es wieder an mich reißen zu wollen. Inaya öffnete es und runzelte die Stirn.
»Wow.« Ihre Augen wurden groß, als ihre Finger ehrfürchtig über die Seite fuhren. »Das ist kein gedrucktes Buch. Das ist handgeschrieben.«
Ich stand auf und lehnte mich gegen ihre Schulter, damit ich sehen konnte. Sie hatte das Buch in der Mitte aufgeschlagen. Auf einer Seite war die Skizze eines bizarr mutierten Zombiehundes zu sehen, zerfetzt und skelettartig. Die andere Seite war mit Zeilen von sauberem lateinischem Text bedeckt. Es erinnerte mich an das Tagebuch eines Entdeckers, wie etwas, das Charles Darwin bei seiner Erkundung der Galápagos-Inseln bei sich getragen hätte – wenn die Galápagos-Inseln voller Monster und Magie gewesen wären.
»Ich glaube, es ist ein Grimoire«, sagte ich leise. Sie sah mich verwirrt an, also erklärte ich es. »Ein Buch mit Zaubersprüchen und Ritualen, wie der Schlüssel des Salomon. Ein Original wie dieses ist selten. Wirklich, wirklich selten.«
Inaya schüttelte den Kopf, mit einem schiefen Grinsen im Gesicht, während sie das Buch vorsichtig zuklappte. »Klingt so, als ob es sich bei dir zu Hause fühlen würde. Willst du es haben?«
»Inaya, das Ding muss doch unbezahlbar sein! Ich muss dir etwas bezahlen –«
Sie ignorierte mich, als sie das Buch nach vorn zum Ladentisch trug. »Betrachte es als Teil deines Brautjungferngeschenks«, sagte sie. Mit größter Sorgfalt zog sie eine Rolle braunes Papier unter dem Ladentisch hervor und verpackte das Buch mit etwas Klebeband und einer Schleife aus Garn. »Alle diese Bücher waren Spenden der Abelaum Historical Society, also mach dir keine Sorgen ums Geld. Diese Bände haben nur im Lager gelegen.« Sie hielt es mir entgegen, und ich nahm es behutsam in die Hand, als hätte sie mir eine heilige Reliquie geschenkt. »Ein gruseliges Buch für mein liebstes gruseliges Mädchen. Ich glaube, wir könnten beide eine Pause gebrauchen. Was hältst du von einem Kaffee?«
»Sie hat dich einfach abserviert? Eine Woche vor deinem Umzug, und sie sagt einfach so: Alles Gute, viel Glück, Tschüss?« Inaya schüttelte den Kopf, ihre rosa Nägel klopften gereizt auf ihre Kaffeetasse. »Du hast wirklich die schlechte Angewohnheit, dich mit Arschlöchern zu verabreden, Rae.«
Ich nickte mit einem schweren Seufzer. Der Schmerz darüber, dass Rachel mit mir Schluss gemacht hatte, weil ich mich entschieden hatte, aus dem Bundesstaat wegzuziehen, war immer noch stark und stach mir wie ein Dorn in die Seite. Ich hatte nicht geglaubt, dass wir für immer zusammen sein würden, aber unser gemeinsames Interesse am Paranormalen und an der Erkundung der Stadt hatte es geschafft, unsere tieferen Probleme in den sechs Monaten, in denen wir zusammen waren, zu überspielen.
Inaya fügte schnell hinzu: »Aber ich liebe den Trennungs-Haarschnitt! So modisch. Sehr Sechzigerjahre. Das steht dir.«
Ich strich mit einer Hand über mein Haar und lächelte breit über das Kompliment. Es war viel kürzer und dunkler als das letzte Mal, als sie mich gesehen hatte – ich hatte mein von Natur aus rotbraunes Haar schwarz gefärbt und zu einem stumpfen Bob geschnitten, in derselben Nacht, in der Rachel mit mir Schluss gemacht hatte. Es fühlte sich gut an. Frisch. Ein Neuanfang.
»Ich fühle mich, als könnte ich mich jetzt als Bibliotheks-Goth bezeichnen«, scherzte ich und schob meine schwarz umrandete Brille noch ein Stückchen weiter auf die Nase. Inaya hob skeptisch eine Augenbraue. »Vielleicht ein Nerd-Goth?«
»Du bist immer noch mein Geistermädchen-Goth, Süße, egal, was du mit deinen Haaren machst«, sagte sie kichernd, und wir saßen für einen Moment schweigend da, während wir an unserem Kaffee nippten. Der Laden, in dem wir saßen, La Petite Baie, befand sich gleich neben dem Golden Hour Books. Die Einrichtung war eine angenehm vielseitige Mischung aus Werken lokaler Künstler, seltsamen Bronzeskulpturen und einer Vielzahl von bequemen Stühlen und wiederverwerteten Tischen. Inaya und ich hatten zwei Plätze am Fenster genommen, von wo aus wir den Wald sehen konnten, der sich dicht an die gegenüberliegende Straßenseite presste.
»Wie gefällt es dir, wieder in der Hütte zu sein?«, fragte Inaya und nahm einen Schluck von ihrem Latte. »Hast du deinen alten Geist schon gesehen? Wie haben wir ihn immer genannt?« Sie dachte einen Moment lang nach. »Oh ja, den Nacht-Cowboy!«
Ich lächelte über den Spitznamen, den wir meinem Kindheitsgeist gegeben hatten. Daran hatte ich seit Jahren nicht mehr gedacht. »Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber wir werden sehen, wie die erste Nacht verläuft.« Ich tippte mir nachdenklich ans Kinn. »Vielleicht stelle ich ein paar Wärmebildkameras auf und schaue, ob ich endlich eine Ganzkörpererscheinung aufzeichnen kann.«
»Wie läuft es denn eigentlich? Der Geister-Vlog?«
Ich kicherte über Inayas treffende Beschreibung meines ›Geister-Vlogs‹, auch wenn mich die Frage innerlich zusammenzucken ließ. »Oh, weißt du. Der Kanal wächst.«
»Hast du in letzter Zeit etwas Großes erwischt? Erscheinungen oder …«
»Hab’ einige körperlose Stimmen eingefangen. Himmelskörper.«
»Oh. Das ist cool.«
Das ist cool. Ja, diese wenig begeisterte Reaktion war genau das, was auch bald mit meinem Vlog-Publikum passieren würde. Das Internet war einfach nicht der richtige Ort für echte paranormale Untersuchungen; nicht, wenn alle anderen ›paranormalen‹ Kanäle vorgaben, den Mitternachtsmann zu beschwören, und mit Spezialeffekten und mittelmäßiger Schauspielerei ein Publikum anlockten, das nach sofortiger Befriedigung suchte. Im Vergleich dazu waren meine langen Aufnahmen und die vagen elektronischen Stimmenphänomene langweilig.
Ich brauchte etwas Großes. Etwas Schockierendes.
Ich brauchte etwas Echtes.
Aber Geister arbeiteten nach ihrem eigenen Zeitplan, nicht nach meinem, und es war frustrierend, dass ich von meinen Untersuchungen an "Spuk"-Orten immer wieder mit leeren Händen zurückkam. Die Zeit und Mühe, die ich in meine Leidenschaft gesteckt hatte, würde ich bald in einen ›richtigen‹ Job investieren müssen. Die Werbeeinnahmen vom Kanal würden nicht ausreichen, um mich allein über Wasser zu halten, nicht einmal, wenn meine Eltern die Hütte verkauften, die sie mir für ein Jahr überlassen hatten, während ich die Schule beendete.
»Ich bin mir sicher, dass du hier oben ein paar gute Orte zum Aufnehmen finden kannst«, sagte Inaya und riss mich aus meiner mentalen Verzweiflung. »All die Legenden in dieser Stadt … Mädchen, das muss eine Fundgrube für dich sein.«
Ich nickte. In Abelaum aufzuwachsen war wie von Geistern umgeben aufgezogen zu werden; nicht unbedingt von echten, aber von Geistern der Vergangenheit. Eine der lukrativsten Bergbaustätten des pazifischen Nordwestens und verriegelte Bergwerksschächte konnte man einst in den umliegenden Wäldern von Abelaum finden. Dutzende der ursprünglichen Gebäude standen noch sorgfältig restauriert und instand gehalten von einer leidenschaftlich engagierten örtlichen historischen Gesellschaft.
Hier gab es viel Geschichte zu entdecken, und mit der Geschichte kam auch die Tragödie.
»Oh Scheiße, hast du Mrs. Kathy schon gesehen? Sie wohnt von dir gleich die Straße runter«, sagte Inaya. »Erinnerst du dich, wie wütend dein Vater war, als sie uns von der ganzen Tragödie von ’99 erzählt hat?« »Mädel, diese Geschichte hat mich süchtig nach Horror gemacht, natürlich erinnere ich mich! Aber mal ehrlich, wer erzählt so eine Geschichte seiner ersten Klasse?« Ich gab mein Bestes, um unsere ehemalige Lehrerin zu imitieren, indem ich mit hoher Stimme und wedelnden Finger in einen imaginären Raum voller Kinder zeigte. »Oh, Kinder! Wollt ihr etwas über die Bergleute hören, die in der überfluteten Mine eingeschlossen wurden und sich gegenseitig aßen, um zu überleben? Wenn euch Quälgeistern Kannibalismus keine Albträume bereitet, wie wäre es dann, wenn ich euch von dem Monster erzähle, das dort unten lebt?«
»Der alte Gott.« Inaya machte mit den Fingern Anführungszeichen und schüttelte den Kopf. »Sie hat es aber geglaubt. Mrs. Kathy war verrückt.«
»Sie hat nicht …«
»Äh, doch, das hat sie. Erinnerst du dich nicht an all die Fischgräten und Silberlöffel, die sie um ihr Haus aufgehängt hat? Sie hat meiner Mutter erzählt, dass das den bösen Blick fernhält oder so einen Scheiß.« Inaya zuckte mit den Schultern und trank den letzten Schluck ihres Lattes aus. »Ich liebe diese Stadt, aber die Leute können wirklich seltsam werden, wenn sie zu lange in den Wäldern leben. Mrs. Kathy war nicht die Einzige, die an diese alten Legenden geglaubt hat.«
»Wo wir gerade von Legenden sprechen …« Ich tippte mit den Fingern auf meine Tasse und versuchte, unschuldig auszusehen. »Gibt es die alte Kirche oben immer noch? In der Nähe des Schachts, aus dem sie die letzten drei Bergleute herausgezogen haben?«
»St. Thaddeus? Ich glaube schon.« Inaya runzelte die Stirn. »Ich bezweifle, dass Mr. Hadleigh zulassen würde, dass sie sie abreißen. Er ist wirklich ein Beschützer dieser historischen Stätten.« Als sie meinen verwirrten Blick sah, sagte sie: »Kent Hadleigh ist der Leiter der Historischen Gesellschaft. Super nett, super wohlhabend. Ich bin zusammen mit seiner Tochter Victoria in einigen Kursen. Ich werde euch am Montag vorstellen.«
Auf ihre Erklärung hin formte ich ein »Oh«, denn mein Gehirn war noch immer auf das fantastische Potenzial einer hundert Jahre alten, verlassenen Kirche mit einer tragischen Vorgeschichte konzentriert. Es entging ihr nicht und sie verengte die Augen.
»Sie ist übrigens verdammt«, sagte sie trocken. »Die Kirche ist verdammt. Also nicht sicher, hineinzugehen.«
»Oh, sicher, sicher.« Ich nickte schnell. »Eine alte, wahrscheinlich verfluchte, verlassene Kirche? Würde nicht einmal daran denken, sie zu betreten.«
Inaya seufzte. »Du bist verrückt, Mädchen. Du wirst dich eines Tages noch in echte Schwierigkeiten bringen.«
Ich legte meine Hand gespielt beleidigt auf mein Herz. »Ich? In Schwierigkeiten geraten? Niemals.«
Kapitel 3
Rae
Meine frühesten Erinnerungen waren in dieser alten Hütte. Das Haus mit nur einem Schlafzimmer war groß genug für zwei frisch Verheiratete gewesen, als meine Eltern es kauften. Aber dann kam ich dazu, und das Eckbüro meines Vaters wurde zu meinem Kinderzimmer. Schließlich wuchsen wir aus dem Haus heraus, und mein Vater wollte unbedingt der Kleinstadt entkommen, in der er sein ganzes Leben verbracht hatte. Als ich sieben Jahre alt war, zogen wir nach Südkalifornien und seitdem lebte ich dort. Die Hütte wurde zu unserem Ferienhaus, und Dad vermietete sie den Rest des Jahres an andere Urlauber.
Nostalgie haftete an den hölzernen Wänden so hell wie ihre glänzende Oberfläche. Kindheitserinnerungen fühlten sich ganz anders an als meine Erinnerungen als Teenager – sie fühlten sich weicher an, reicher, wie Striche von Acrylfarbe auf einer Leinwand.
Der Wald war mein Märchenreich, die Treppe, die zum Hauptschlafzimmer hinaufführte, war der große Weg, den ich mit meiner Armee von imaginären Freunden gegangen war. Auf einer der Fußleisten, versteckt unter den Küchenschränken, hing eine kleine Skizze eines Hundes, die ich mit Rotstift gezeichnet hatte, als ich fünf war. Meine Mutter hatte sie nie gefunden, und es brachte mir immer noch einen kleinen Nervenkitzel, sie dort zu sehen, da mein inneres Kind davon überzeugt war, ein meisterhaftes Verbrechen des Vandalismus begangen zu haben.
Das Eckbüro, das zum Schlafzimmer umfunktioniert worden war, barg selbst wilde Erinnerungen. Dort hatte ich meinen ersten Geist gesehen.
»Der Nacht-Cowboy«, wie ich ihn genannt hatte. Mama sagte, ich sei erst vier gewesen, als ich ihn zum ersten Mal erwähnt hatte. Er tauchte durch die Wand auf, ging am Fußende meines Bettes vorbei, hielt inne und verschwand dann direkt neben meinem Fenster. Eine verschwommene Gestalt, als ob er aus Rauch bestünde, in Stiefeln, Jeans-Overalls und einem breitkrempigen Hut – deshalb nannte ich ihn als Kind Cowboy. Er war nicht gruselig, nur interessant.
Und mit ihm begann die Besessenheit meines Lebens.
Der Unterricht begann erst am Montag, also hatte ich das ganze Wochenende Zeit, um zu versuchen, mein Leben aus den Stapeln von Pappkartons wieder zusammenzusetzen. Der graue Himmel hatte sich verdunkelt, nachdem ich mich im Café von Inaya getrennt hatte, und der Regen klopfte in unregelmäßigen Schauern gegen die Fenster. Ich machte den Kamin an, zog alle Vorhänge zurück und genoss das fahle natürliche Licht, das sich seinen Weg durch die Wolken bahnte.
Ich konnte nicht ewig hier bleiben. Früher oder später würde ich mit der Suche nach einer Wohnung beginnen müssen, aber die Vorstellung fühlte sich entmutigend an.
Ich platzierte meine Bücher in die leeren Regale, stellte meine Sukkulentensammlung ins Küchenfenster und ließ meinen Laptop und meine Aufnahmegeräte auf dem Schreibtisch im unteren Schlafzimmer verstreut liegen. Das Organisieren war anstrengend. Ich verband mein Bluetooth mit dem tragbaren Lautsprecher auf dem Couchtisch, stellte meine Playlist auf Shuffle und tanzte durch die mühsame Arbeit zu Monsters von All Time Low.
Die Nacht war hereingebrochen, und die Wolkendecke machte es draußen stockdunkel. Es gab eine Pause, als das nächste Lied zwischengespeichert wurde, nur das Klopfen des Regens auf dem Glas, der sanfte Wind und das Zirpen der Grillen war übrig. Die Fensterscheiben waren zu Einwegspiegeln geworden: Mein Spiegelbild starrte mich an, die Brille rutschte mir von der Nase, der Oversized-Pullover hing über meine Hände. Draußen, in der Dunkelheit, würde ich nicht wissen, ob etwas zurückstarrte.
Jemand hätte direkt vor dem Glas stehen können, und ich hätte ihn nicht sehen können.
Das nächste Lied begann gerade zu spielen, gerade als mir ein Schauer über den Rücken lief. Die Hütte wirkte in der Nacht unbedeutend, als könnten ihre nackten Holzwände und großen Fenster nichts gegen die Dunkelheit ausrichten. Anstatt dass ich von innen beobachtete, hatte ich das Gefühl, dass etwas von draußen hereinschaute. Mich beobachtete.
Ich zuckte zusammen, als mein Telefon auf dem Couchtisch summte. Ich schnappte es mir, meine Musik pausierte und ich lächelte, als ich die Rufnummernanzeige sah.
»Hey, Mom.«
»Hallo, Liebling! Wie hast du dich eingelebt? War die Fahrt in Ordnung?«
Ich hörte im Hintergrund etwas brutzeln und mein Lächeln wurde breiter. Mom kochte das Abendessen, Dad saß im Wohnzimmer mit einem Glas Scotch und seinem neuesten Krimi. Meine Eltern waren, wie sie es ausdrückten, "freie Erziehungs-Eltern", die mir meistens selbst die Entscheidung überließen, es sei denn, ich war dabei, etwas katastrophal Gefährliches oder Zerstörerisches zu tun. Meine Mutter war der Inbegriff eines erwachsenen Woodstock-Hippies, während mein Vater eher der ruhige, studierende Typ war. »Lange Fahrt«, sagte ich und musste kichern, als eine Pfanne klapperte und meine Mutter leise fluchte. Mom und ich teilten die Vorliebe dafür, uns gegenseitig die Ohren vollzuquatschen, auch wenn wir uns eigentlich auf andere Aufgaben hätten konzentrieren sollen, wie Kochen – oder Auspacken. »Aber es war wirklich wunderschön.«
Wir plauderten weiter, während sie mich über all den Klatsch informierte, den sie in den zwei Tagen meiner Abwesenheit aufgeschnappt hatte. Dad plante wie immer akribisch jeden Aspekt ihres internationalen Umzugs, während Mom sich weit weniger Gedanken über eine perfekte Reiseroute machte – ein weiterer Beweis dafür, dass ich wirklich die Tochter meiner Mutter war.
»Ich hatte ganz vergessen, wie schön diese Stadt ist«, sagte ich, nachdem ich das Auspacken aufgegeben hatte, um stattdessen auf der Couch Chips zu mampfen. »Die Leute sind freundlich, es gibt keine Kettengeschäfte. Überall gibt es niedliche, kleine Tante-Emma-Läden. Warum sind wir überhaupt umgezogen?«
Meine Mutter kicherte, senkte aber ihre Stimme ein wenig, als sie antwortete. »Ach, du kennst doch deinen Vater. All sein Aberglaube, seine … Ängste … das Kleinstadtleben war nichts für ihn. Er hatte das Gefühl, die Leute würden sich zu sehr in unsere Angelegenheiten einmischen, was auch immer das heißen mag. Es wurde noch schlimmer, als du in die Grundschule kamst.« Sie hielt inne, als ob sie noch mehr sagen wollte – aber sie schien es sich anders zu überlegen. »Kalifornien bot mehr Möglichkeiten in seinem Beruf.«
»Ah, Dads guter alter Aberglaube.« Ich lachte. »Die eine Eigenschaft, die ich glücklicherweise von ihm geerbt habe. Lass mich raten: Er hat die Geschichte jedes Hauses überprüft, das ihr euch angesehen habt, um sicherzugehen, dass dort niemand gestorben ist?«
Ich konnte praktisch das Augenrollen meiner Mutter hören. »Natürlich.«
»Gute Entscheidung.« Ich nickte. »Dein Ruhestand muss nicht von rachsüchtigen Geistern unterbrochen werden.«
»Oh, fang damit nicht an.« Ich hörte das Klappern der Teller und wusste, dass sie das Telefon nicht weglegen würde, um zu essen, wenn ich sie nicht dazu zwang.
»Ich halte dich nicht länger auf, Mom. Ich liebe dich. Vermisse dich.«
»Ich vermisse dich auch, Liebling!« Im Hintergrund war ein Murmeln zu hören, und sie fügte hinzu: »Dad sagt, du sollst da draußen auf dich aufpassen.«
Das Haus fühlte sich noch leerer an, als ich den Hörer aufgelegt hatte. Ich war dankbar für Cheesecake, der laut miauend aus der Küche herüberschlenderte, um sein Abendessen zu fordern. Er war ein herrischer Mitbewohner, aber er war so verdammt süß, dass ich ihm verzeihen musste.
Auf dem Weg zurück zum Sofa, mit etwas Dip für meine Chips, fiel mir das braune Papierpaket ein, das aus meiner Tasche ragte. Das Buch, das Inaya mir geschenkt hatte, das Grimoire. Aufregung krampfte sich um meinen Magen, ein Gefühl, das dem ähnelte, das man hat, wenn man zum ersten Mal in eine Geisteruntersuchung geht: ein Nervenkitzel, gemischt mit Beklemmung.
Ich wickelte das Buch auf dem Couchtisch aus. Wahrscheinlich hätte ich Handschuhe tragen sollen; das Ding war so alt, dass es eigentlich in ein Museum gehörte. Eine Unterschrift war in der Ecke auf der Innenseite gekritzelt, aber die Kalligrafie war zu ausgefallen, als dass ich sie hätte erkennen können.
Ich blätterte durch die Seiten und bewunderte die detaillierten Skizzen und das winzige, saubere Latein. Es gab Zeichnungen von Kräutern und Pflanzen, und die schnelle Nutzung eines Online-Übersetzers verriet mir, dass der Text die magischen Eigenschaften des Grüns beschrieb. Dann waren da noch die Skizzen von Monstern: der knöcherne Wolf-Zombie, eine schlanke, gesichtslose Kreatur, die in Seetang gehüllt war und tentakelartige Beine hatte, ein mehrgliedriges Ding, das wie eine Spinne mit einem Vogelschnabel aus abgebrochenen Ästen aussah. Die Kunst war erstaunlich, die Art von Design, die Creepypastas und Indie-Videospielentwickler inspiriert hätte.
Es gab Seiten über Reinigungen, Kleidung, Gebete, astrologische Ereignisse – ich hatte nur die Geduld, einige Bruchstücke zu übersetzen, aber die schiere Menge an Informationen war überwältigend. Dieses Grimoire war ein wahrer Schatz. Jedes Mal, wenn ich eine Seite umblätterte, schlug mein Herz ein wenig schneller.
Dann fand ich eine Zeichnung, die sich von den anderen unterschied. Es war die Skizze eines Mannes, ungefähr in meinem Alter, schätzte ich. Sein Haar lag in Wellen, das sich um seine Ohren kräuselte, weiche Bleistiftstriche vermittelten eine gewisse Leichtigkeit. Er war oberkörperfrei, die Muskeln seiner schlanken Brust waren deutlich skizziert, aber mit etwas verunstaltet, von dem ich nur annehmen konnte, dass es sich um Narben und die vagen Umrisse von Tätowierungen handelte. Seine Lippen waren voll, sein Kinn hatte Grübchen. Unter den dunklen, stark gezeichneten Brauen waren seine Augen goldfarben gemalt.
Es war der einzige Farbfleck, der mir in dem Buch bisher begegnet war. Es ließ seine Augen lebendig aussehen, als ob sie mich beobachteten, und sie hatten eine Textur, als ob sie mit Flocken aus Blattgold geformt worden wären.
Auf der nebenstehenden Seite stand: Operation zur Beschwörung und Bindung des Mörders.
Der Mörder … Beschwörung und Bindung …
Dies waren Anweisungen für die Beschwörung eines Dämons.
Ich lehnte mich von dem Buch zurück, und die Beklommenheit, die am Rande meiner Aufregung gelauert hatte, trat in den Vordergrund. Ich war mir nicht sicher, ob ich an Dämonen und Magie glaubte. Geister waren eine Sache: die Überreste von verstorbenen Seelen, verbleibende Energie, gestrandete Geister. Aber Dämonen waren etwas ganz anderes, eine der vielen Kreaturen, die seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, in den Schatten der menschlichen Ängste lauerten. Ich leugnete nicht die Möglichkeit, dass sie existieren könnten – aber wie Götter und Engel ordnete ich sie gewöhnlich dem Reich der Mythen zu.
Dämonen waren aufregend, faszinierend. Die Möglichkeit, dass ein Ort nicht nur heimgesucht wird, sondern von dämonischen Kräften besessen ist, war der treibende Unterhaltungswert zahlreicher Horrorgeschichten. Sie spielten perfekt auf menschliche Ängste an: unerklärlich, furchterregend mächtig, verlockend und verführerisch, repräsentativ für die Sünde.
Ich bin durch Orte gelaufen, an denen es hieß, dass dort Dämonen angeblich spielten. Ich fand sie nicht beängstigender als irgendwo sonst.
Ich konnte diese Augen nicht aus dem Kopf bekommen. Golden, leuchtend, durchdringend in der Dunkelheit. Ich war immer noch wach um fast zwei Uhr morgens, lag in meinem Bett mit aufgeklapptem Laptop und versuchte, die Weigerung meines Körpers, zu schlafen, als Gelegenheit zu nutzen, neue Ideen für einen Vlog zu entwickeln.
Meine Abonnentenzahl wurde schnell von neueren Kanälen übertroffen, die eher das Drama als die Wissenschaft der sorgfältigen Untersuchungen in den Vordergrund stellten. WIR BENUTZEN EIN OUIJA-BRETT IN MASSACHUSETTS‘ HEIMGESUCHTESTEN WALD! VON EINEM DÄMON ANGEGRIFFEN! Millionen Aufrufe für diesen beschissenen Clickbait. Es war erst seit ein paar Tagen online.
Durch die grüne Linse des Nachtsichtgeräts aufgenommen, beobachtete ich die Gruppe, die vorgab, besessen zu sein. Ich sah ihnen dabei zu, wie sie kreischend durch den Wald rannten und ein Plättchen auf dem Ouija-Brett bewegten, um Drohbotschaften zu formulieren, die sie alle anglotzten. Es war unecht, alles unecht. Ich glaube, das Publikum wusste auch, dass es nicht echt war, aber den Kommentaren nach zu urteilen, hat es niemanden wirklich interessiert. Es war aufregend, es war lustig. Es war unterhaltsam. Dutzende von Kanälen haben solche Inhalte herausgebracht, während meiner bei den Zuschauerzahlen hinterherhinkte, weil ich auf Authentizität bestand.
Ich schnappte mir meinen Vape vom Nachttisch und inhalierte gereizt. Wenn ich nicht bald etwas änderte, würde ich den Kanal nicht mehr aufrechterhalten können. Bald würde ich mich der Realität stellen müssen, den Bürojob annehmen und sesshaft werden. Jede Faser meines Körpers sträubte sich gegen diese Vorstellung, aber ich war kein Teenager mehr. Ich hatte Rechnungen zu bezahlen, und dieses Erwachsenending schien fest entschlossen, auch den letzten Traum zu zerquetschen.
Der Mörder. Goldene Augen in der Dunkelheit.
Ich hatte diese Seite mit einem Lesezeichen markiert und war mir noch nicht sicher, warum. Es wurde noch schwieriger zu schlafen, weil ich wusste, dass unten auf dem Couchtisch das Grimoire verschlossen lag – aber auf diesen Seiten, im Dunklen, leuchteten immer noch diese goldenen Augen.
Beobachteten.
Warteten.
Kapitel 4
Rae
Der Montagmorgen brachte wieder einen grauen Himmel und Nieselregen. Ich ging unter meinem schwarzen Regenschirm zur Schule, meine Stiefel spritzen durch die Pfützen meiner schmalen Auffahrt zur Straße entlang. Als ich die Briefkästen erreichte, erblickte ich Mrs. Kathy, die ihre Post holte. Als sie meine Lehrerin in der ersten Klasse vor fast vierzehn Jahren gewesen ist, war ihr blondes Haar mit grauen Strähnen durchzogen gewesen – jetzt war es ganz silbern geworden.
»Hallo, Mrs. Kathy!« Ich winkte ihr fröhlich unter meinem Regenschirm zu. Sie sah mich mit zusammengekniffenen Augen an, blinzelte schnell hinter ihrer großen Hornbrille und ging dann eilig zurück zu ihrer Einfahrt.
Nun, verdammt. Also gut.
Es war nur ein fünfzehnminütiger Spaziergang zum Campus, aber die Kälte ließ ihn länger erscheinen. Dann tauchten die gotischen Spitzen und hohen Fenster der Abelaum-Universität hinter den Bäumen auf, umhüllt von Ranken und übersät mit Moos. Sie sah aus, als sollte sie verlassen und verfallen sein und nicht von Studenten wimmelnd, die iPhones und Starbucks-Tassen in der Hand trugen. Regenschirme waren hier definitiv nicht angesagt: Der nebelige Regen schien außer mir niemanden zu stören. Alle anderen hatten nur Regenmäntel mit Kapuzen.
In Südkalifornien brauchte man keine Regenmäntel – in meinem Schrank gab es keinen einzigen. Ich würde bald einkaufen gehen müssen, wenn ich nicht wie ein wundgescheuerter Daumen aus der Masse herausstechen wollte.
Ich schlenderte durch die breiten Steinflure auf der Suche nach meinem ersten Kurs und schielte zu den winzigen goldenen Zahlen, die neben jeder dunklen Holztür angebracht waren. Der Regen wurde stärker und rieselte in langsamen Rinnsalen an den schmalen Fenstern entlang, die eine Seite des Flurs säumten. Die Sicht war durch Espen und Fichten verdeckt, aber hinter den Nadeln konnte ich immer noch die hohen, scharfen Türme der Universität sehen. Der Versuchung, alle paar Meter anzuhalten und meine Kamera aus der Tasche zu holen, konnte ich kaum widerstehen, und als ich es schließlich pünktlich zum Unterricht schaffte, betrachtete ich das als eine große Leistung.
Der Unterricht verlief am ersten Tag wie üblich, es wurde der Lehrplan besprochen, allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Beide meiner Professoren am Morgen sprachen über den kürzlichen "tragischen Verlust eines Studenten". Sie versicherten, dass die Sicherheit erhöht wurde und die örtliche Polizei "alles in ihrer Macht Stehende" tue. Ich tappte im Dunkeln, bis ich eine schnelle Google-Suche machte.
Student tot auf dem Universitätsgelände aufgefunden: Untersuchung läuft noch.
Kurz vor Beginn des Semesters wurde die Leiche eines Studenten brutal ermordet in einem der Universitätsgebäude gefunden. Der True-Crime-Fan in mir suchte nach mehr, aber es gab wenig Anhaltspunkte. Keine Verdächtigen. Keine Spuren. Keine Aussagen der örtlichen Polizei. Ich war, ehrlich gesagt, fassungslos, dass ein Mord in einer so ruhigen Kleinstadt geschehen konnte und nicht zu einem regelrechten Medienrummel wurde und zu Spekulationen führte.
Der Morgennebel blieb, sickerte zwischen den alten Gebäuden hindurch und färbte die Steine in einen dunkleren Grauton. Die moosbewachsenen Wurzeln der Immergrünen waren wie von einer langsam anrollenden Flut umhüllt. Doch trotz des Wetters hatte die allgemeine Studienausbildung überall auf dem Platz Stände aufgebaut, um die neuen Studenten zu begrüßen, ebenso wie einige Dutzend der Campus-Clubs. Die Aufregung des neuen Semesters stand im Widerspruch zum dämpfenden Nebel, als würde die Natur alles in ihrer Macht Stehende tun, um die lauten, plappernden Studenten zum Schweigen zu bringen.
Da ich noch Zeit bis zu meinem nächsten Kurs hatte, gab ich nach und zückte meine Kamera. Alles, vom Glockenturm über der Bibliothek bis hin zu den niedrigen, krummen Steinmauern, die die Hecken umschlossen, wirkte hinter meiner Linse ästhetisch ansprechend. Die Feuchtigkeit, das Grün, die gotische Dramatik des Ganzen – ich fühlte mich wie in ein Märchen der Gebrüder Grimm versetzt, direkt zurück in das Märchenreich meiner Kindheit.
Aber der Tod war in das Königreich gekommen, und er kündigte seine Anwesenheit mit dem plötzlichen Schock eines gelben Absperrbandes an, das den Eingang zu einer der nordwestlichen Hallen absperrte.
Ich ging näher heran. CALGARY stand in rostigen Buchstaben über der geschlossenen Doppeltür des Gebäudes, gefolgt von einem H und einem ungünstig platzierten L. Die Bäume waren dicht daran gewachsen, und ihre Äste schlängelten sich um das steile Dach des Gebäudes, als ob sie es langsam in einen lebenden Kokon einhüllten.
Ich kannte den Namen aus den Zeitungsartikeln, die ich an diesem Morgen gelesen hatte: Dies war der Saal, in dem die Leiche des Studenten gefunden worden war. Ich knipste ein weiteres Foto, um den Kontrast zwischen dem grellen Plastikband und dem alten, löchrigen Stein festzuhalten. Es war wunderschön, auf eine furchtbar düstere Art.
»Hast du dich verlaufen?«
Verurteile mich nicht, aber es gab etwas an einer gemeinen Stimme, das mich heiß machte – und die Stimme, die hinter mir sprach, war so gemein, wie sie konnte. Ich drehte mich um und sah einen Mann am Fuß der Treppe von Calgarys stehen, die Arme verschränkt und die hellgrünen Augen über mich gleitend. Er konnte nur ein paar Jahre älter sein als ich, und war ganz in Schwarz gekleidet, mit einem engen Langarm-Sportshirt, einer Cargohose und geschnürten Militärstiefeln.
Scheiße. Genau mein Typ von zu-hübsch-für-sein-eigenes-Wohl-Arschloch.
»Nicht verlaufen«, sagte ich und setzte mein bestes Verpiss-dich-Lächeln auf. »Es ist schwer, das leuchtend gelbe Absperrband zu übersehen, das um den Schauplatz eines Mordes geklebt wurde.«
Er erwiderte mein Lächeln mit seinem eigenen, aber während meins zickig war, war seins die Art von Lächeln, die man sich nachts vor dem Fenster vorstellen kann, mit Eckzähnen, die scharf genug sind, um mich zu zerreißen. »Oh, gut, du hast das Band nicht übersehen. Dann gehe ich davon aus, dass du einfach nicht lesen kannst, weil du dich entschieden hast, hier herumzuhängen.«
Ich musste mich zwingen, meine Füße auf dem Boden zu halten und nicht mit ihnen zu wackeln. Irgendetwas an seinem Gesicht war nicht in Ordnung. Seine hohen Wangenknochen könnten ein Mädchen mit seiner scharfen Kante schneiden, wenn seine stechenden grünen Augen sie nicht zuerst erwischen würden. Seine vollen Lippen ließen ihn jungenhaft, fast unschuldig aussehen – aber diese Unschuld hörte bei seinen Augen auf. Sie lagen tief unter dicken Brauen, die dieselbe Farbe hatten wie sein honigblondes Haar, das über seinen Ohren kurz rasiert und oben lang und unordentlich war.
Er war absurd attraktiv. Mein Magen verkrampfte sich bereits, was bedeutete, dass meine Stimme nur noch schärfer wurde, als ich sagte: »Ich bin mir ziemlich sicher, dass auf dem Band ›Vorsicht‹ steht und nicht ›Sechs Meter Abstand halten‹. Ich sehe kein Schild, das mir sagt, dass ich mich fernhalten soll.«
Sein Lächeln verblasste. Es schmolz von seinem Gesicht wie Eiszapfen, die im Winter von einem Dach brechen, und er stieg die Stufen zu mir hinauf. Ich verschränkte die Arme und bereute, dass ich nicht einfach weggegangen war, als ich ein Logo gestickt auf seinem Shirt entdeckte: PNW Security Services.
Verdammt noch mal. Ich habe eine große Klappe einem Sicherheitsbeamten gegenüber gehabt.
Er überragte mich. Er musste sich herunterbeugen, um sein Gesicht an meins zu bringen.
»Wie heißt du?« Seine Stimme war leise, und die Worte schlossen sich bedrohlich um meine Kehle, so sicher wie es seine großen Hände hätten tun können. Ich begann nervös auf meiner Unterlippe zu kauen und schob die Brille auf meine Nase.
»Alex«, sagte ich. Wenn er mich irgendeiner Autoritätsperson melden wollte, dann wollte ich auf keinen Fall riskieren, am ersten Tag hier einen Vermerk in meiner Akte zu bekommen. Aber er schüttelte den Kopf mit einem langsamen, trägen, geduldigen Blinzeln.
»Nein. Das ist er nicht.«
Das Gefühl von Fingern, die sich um meine Kehle legten, verstärkte sich. Ich musste dem Drang widerstehen, meine Hand nach oben zu strecken, um mich zu vergewissern, dass nichts an meiner Kehle drückte. Was war das Problem dieses Kerls? Vielleicht wäre er nicht so sauer, wenn ich von Anfang an auf mein Verhalten geachtet hätte, aber dafür war es jetzt ein wenig zu spät.
Ich stand mit dem Rücken zu den geschlossenen Türen von Calgary, und dieser Typ versperrte mir den Weg die Treppe hinunter. Als ich zögerte zu antworten, richtete er sich auf und lehnte sich mit einer Hand über mir gegen die Tür. Jetzt war es nicht nur das Gefühl einer Hand um meine Kehle, sondern auch das Empfinden eines Stiefels, der mir auf den Schädel drückte, mich gegen den Beton drückte, unverständliche Drohungen ins Ohr flüsterte –
»Er ist Raelynn«, murmelte ich hastig. Augenblicklich verschwand das Gefühl. Was zur Hölle? Hatte ich einen niedrigen Blutzucker, oder war dieses Arschloch wirklich so einschüchternd? Ich zog meinen Rucksack etwas näher. »Wenn du so ein Arsch sein willst, dann gehe ich eben.«
Er schnaubte heftig, was entweder Belustigung oder Abscheu hätte sein können. Sein steinharter Gesichtsausdruck war unmöglich zu lesen, aber es war unangenehm, mit so viel Intensität fixiert zu werden. Er stieß sich von der Wand ab und trat zur Seite, um den Weg für meine eilige Flucht freizumachen.
»Pass auf, wohin du gehst, Mädchen«, sagte er und weigerte sich, meinen Namen zu nennen, selbst jetzt, nachdem er ihn aus mir herausbekommen hatte. »Neugierde kann dich in Schwierigkeiten bringen.«
Ein Teil von mir wollte unbedingt wissen, von welcher Art ›Ärger‹ er sprach, denn ein so schöner Mann könnte mir in der Tat eine Menge Ärger bereiten. Peinlich, dass ein Paar strahlende Augen und eine tiefe Stimme meinen Schwur, mich nicht mehr zu Arschlöchern hingezogen zu fühlen, über den Haufen werfen konnten.
Ich schlich vom Gebäude weg auf den Rasen, ich spürte, wie sich diese hellgrünen Augen in meinen Schädel bohrten. Ich warf mein Haar zurück und versuchte, Entschlossenheit in meinen Schritt zu bringen, um zu verbergen, wie nervös er mich gemacht hatte. Doch dann geschah etwas Seltsames. Es fühlte sich an wie ein Seil, das sich um meinen Knöchel schlängelte, höher und höher, fester und fester –
Diese toxische Beziehung von mir zur Schwerkraft? Ja, sie war zurück, um mir in den Arsch zu beißen.
Ich stolperte über meine eigenen Füße, und gleichzeitig gab mein alter, mit Anstecknadeln bedeckter Rucksack schließlich nach. Der ausgefranste Schulterriemen riss und die Tasche ging auf. Meine Lehrbücher verbreiteten sich auf dem nassen Gras, lose Blätter fielen in Pfützen, und mein To-Go-Becher mit Eiskaffee, den ich – dummerweise – in die Ecke der Tasche geklemmt hatte, platzte auf und ließ den verwässerten Kaffee auf meine Schuhe spritzen.
Ich musste einen Moment innehalten, bevor ich mich hinkniete und begann, meine Sachen einzusammeln. Ich spürte die Blicke der vorbeigehenden Schüler, die mich anstarrten: hin- und hergerissen zwischen dem Gefühl, sich schuldig genug zu fühlen, um zu helfen, und unbeholfen genug zu sein, um einfach schneller zu gehen. Mit brennenden Wangen warf ich einen Blick zurück über meine Schulter und stellte fest, dass der Wachmann mich beobachtete.
Ein kleines, schiefes Lächeln lag auf seinem Gesicht, und er blickte auf meine durchnässten Sachen im Gras, als wollte er sagen: Ich habe es dir gesagt. Dieses Lächeln wäre charmant gewesen, wenn er nicht so ein Idiot wäre.
Wem wollte ich etwas vormachen? Sein Lächeln war immer noch charmant und mein verräterischer Körper bekam Bauchkribbeln, weil er mich anstarrte.
»Oh, Rae, was ist passiert?«
Ich sah auf, mit einem halb eingesteckten Buch in meiner nutzlosen Tasche. Inaya joggte über den Rasen auf mich zu, ihr leuchtend gelber Regenmantel bildete einen starken Kontrast zur Düsterheit. Sie machte ein mitfühlendes Geräusch, als sie sah, wie ich aussah: Ich versuchte im Gras zu knien, ohne allen einen Blick unter meinen Rock zu gewähren, die Knie meiner schwarzen Leggings waren feucht und schlammig, die Brille rutschte mir von der Nase.
»Das ist der Fluch des ersten Tages, ich schwöre«, sagte sie. »Es geht immer etwas schief.« Sie kniete sich neben mich und sammelte schnell meine Bücher ein, während ich die ruinierten Blätter aufhob. Sie half mir auf die Beine, und ich tat mein Bestes, um den Schulterriemen der Tasche wieder zusammenzubinden. »Ab hier wird alles reibungslos laufen, mach dir keine Sorgen.«
Ich sah sie schmollend an, konnte aber meinen Gesichtsausdruck nicht aufrechterhalten und musste lachen, als sie mich in eine Umarmung zog. Ich verhakte meinen Arm mit ihrem und ging mit ihr über den Innenhof.
»Wie ich sehe, hast du unseren reizenden neuen Wachmann Leon bereits kennengelernt«, sagte sie und warf einen kurzen Blick zurück.
»Oh, er ist ein Prachtstück«, brummte ich, aber ich hatte mehr im Kopf als nur ein beunruhigend heißes Arschloch. Ich gab ihr einen spielerischen Klaps auf den Arm. »Warum hast du mir nicht gesagt, dass es auf dem Campus einen Mord gegeben hat, Inaya?«
Sie stöhnte und rollte mit den Augen. »Weil die meisten Leute ausflippen würden, und ich wollte dir deinen Umzug nicht noch schwerer machen, du Spinnerin!« Sie schüttelte den Kopf über mich. »Es war ziemlich schlimm. Ich habe noch nie gehört, dass so etwas hier passiert ist.«
Wir machten uns auf den Weg zu einem Platz mit vier Steinbänken, die unter hohen roten Erlen standen. Mehrere Studenten saßen dort, und Inaya winkte ihnen aufgeregt zu, als wir uns näherten.
»Endlich kann ich dich allen vorstellen«, flüsterte sie aufgeregt, als sich ein großer, vertrauter Mann in einer grauen Cabanjacke von seinem Sitz auf der Bank erhob und die Arme ausstreckte.
»Miss Raelynn Lawson!« Seine laute Stimme dröhnte, und er nahm mich in den Arm und drückte mich fest an sich, während Inaya lachte. »Es ist so lange her, ich schwöre, du bist gewachsen.«
»Oh, ha-ha, sehr lustig!« Ich lächelte, als er mich wieder absetzte. Trent, Inayas Verlobter, hatte vor zwei Jahren seinen Abschluss an der Abelaum Universität gemacht und – wie Inaya mir erzählt hatte – war er bereits erfolgreich in einer Investmentfirma in Seattle tätig. »Es sind die Stiefel, ich habe sie extra angezogen, damit ich deine Taille erreichen kann.« Trent kicherte und gab Inaya einen schnellen Kuss auf die Stirn. Inaya deutete auf den Mann und die Frau, die immer noch neben uns saßen.
»Rae, das sind Jeremiah und Victoria Hadleigh.« Sie waren offensichtlich Zwillinge. Hellbraunes Haar, dunkelblaue Augen, blasse Haut und sommersprossige Nasen. Sie sahen aus, als wären sie in der Highschool die Beliebtesten gewesen. Victorias Haar war perfekt glatt, ihre schwarzen Nägel lang und sargförmig, ihre Lippen hatten einen blassen nuden Glanz. Ihr Bruder wirkte wie ein Sportler: muskulös, groß, kantiges Kinn, mit einem eingebildeten Lächeln, das nicht nervig wirkte.
»Ihrem Vater gehört sozusagen die Schule, wenn du dich also beschweren willst, wende dich direkt an sie«, sagte Inaya, was Victoria ein Stöhnen und Jeremiah ein Kopfschütteln entlockte.
»Nein, nein, nein«, sagte Jeremiah. »Uns gehört die Schule nicht.«
»Eigentlich gehören Dad nur drei Gebäude«, sagte Victoria und nahm einen Zug von ihrer schlanken silbernen Vape, die sie aus ihrem schwarzen Regenmantel zog. »Und das einzige Gebäude, das wirklich wichtig ist, ist die Hadleigh-Bibliothek.« Sie deutete hinter sich auf das große Gebäude, das die gesamte Ostseite des Innenhofs einnahm. Sie zwinkerte mir zu. »Wenn du irgendwelche Bücherwünsche hast, kannst du sie auf jeden Fall an uns richten.«
»Das ist großartig, danke!« Ich machte mir geistig einen Vermerk, denn das Wissen eine Bibliothek zur Hand zu haben, war für die Recherche sehr hilfreich. Nicht alles konnte man im Internet finden, vor allem, wenn es sich um besonders alte oder seltene Texte handelte. Die Bibliothek war von Bäumen gesäumt, und ein riesiger Bogen aus Buntglasfenstern krönte ihren Eingang. »Es ist wunderschön.«
»Danke.« Victoria zuckte mit den Schultern, als ob es etwas Alltägliches wäre, für die Bibliothek des Vaters ein Kompliment zu bekommen. »Aber genug von uns. Was ist mit dir, Miss California? Was ist dein Sternzeichen, was magst du, was machst du?« »Oh, äh, Schütze«, räusperte ich mich und fummelte an dem Knoten im Gurt meiner Tasche herum. »Ich studiere Radio-Fernsehen-Film, ich mag Fotografie, äh …«
»Film, hm?«, sagte Jeremiah. »Brauchst du Schauspieler für kommende Projekte?«
Ich lachte nervös, aber Inaya ersparte mir eine Antwort, als sie sagte: »Erzähl ihnen von deinem YouTube-Kanal! Deinen Untersuchungen!«
»Untersuchungen?« Victoria stützte ihr Kinn auf ihre Handfläche. »Bist du so etwas wie eine Detektivin?«
Ich lächelte gezwungen und machte mich auf die kommenden seltsamen Blicke gefasst. »Na ja, irgendwie schon. Ich mache Vlogs, spreche über lokale Legenden, gruselige Geschichten … ich mache paranormale Untersuchungen.«
»Sie ist eine Geisterjägerin«, sagte Inaya.