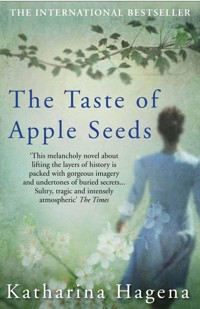13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arche Literatur Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Singen macht stark und zugleich verletzlich. Singen stiftet Frieden und befeuert Kriege. Singen ist Schmerz und Freude, Widerstand und Wiegenlied, Bühne und Dusche, Willkommen und Abschied, Leben und Tod. Das Lied hat seinen Ursprung in der Liebe, und die Literatur hat ihren Ursprung im Lied. Denn im Schreiben wie im Gesang wird das Innerste nach außen getragen. Aber nicht nur diesen Zusammenhang erkundet die Autorin und Literaturwissenschaftlerin Katharina Hagena. Sie richtet den Blick auch auf die Musik, Physiologie, Soziologie, Kulturgeschichte und das, was mit uns geschieht, wenn wir anfangen zu singen. Dieser Band ist eine mitreißende Gesamtkomposition, die man liest, hört und fühlt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Katharina Hagena
Herzkraft
Ein Buch über das Singen
© 2022 Arche Literatur Verlag AG, Zürich – Hamburg
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Herr K | Jan Kermes, Leipzig, unter Verwendung eines Motivs von Margaret Watts Hughes
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
ISBN978-3-03790-140-3
www.arche-verlag.com
www.facebook.com/ArcheVerlag
www.instagram.com/arche_verlag
Für Johann und Mathilda
Wünschelrute
Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.
Joseph von Eichendorff
Die Töne
Ihr tiefen Seelen, die im Stoff gefangen,
Nach Lebensodem, nach Befreiung ringt;
Wer löset eure Bande dem Verlangen,
Das gern melodisch aus der Stummheit dringt?
Wer Töne öffnet eurer Kerker Riegel?
Und wer entfesselt eure Aetherflügel?
Einst, da Gewalt den Widerstand berühret,
Zersprang der Töne alte Kerkernacht;
Im weiten Raume hier und da verirret
Entflohen sie, der Stummheit nun erwacht,
Und sie durchwandelten den blauen Bogen
Und jauchzten in den Sturm der wilden Wogen.
Sie schlüpften flüsternd durch der Bäume Wipfel
Und hauchten aus der Nachtigallen Brust,
Mit muthigen Strömen stürzten sie vom Gipfel
Der Felsen sich in wilder Freiheitslust.
Sie rauschten an der Menschen Ohr vorüber,
Er zog sie in sein innerstes hinüber.
Und da er unterm Herzen sie getragen,
Heist er sie wandlen auf der Lüfte Pfad
Und allen den verwandten Seelen sagen,
Wie liebend sie sein Geist gepfleget hat.
Harmonisch schweben sie aus ihrer Wiege
Und wandlen fort und tragen Menschenzüge.
Karoline von Günderrode
1780–1806
Masken
Während meiner Arbeit an diesem Buch bestimmt Corona immer noch große Teile meines Lebens. Seit einem Jahr habe ich in keinem Vokalensemble mehr gesungen. Davor sang ich bis zu dreimal pro Woche in unterschiedlichen Formationen. Corona, das bedeutet für mich und viele andere vor allem: ohne Chor, ohne meine eigenen Chöre, ohne fremde Chöre, ohne Oper, ohne Elbphilharmonie und ohne die Sängerin Emma Kirkby, deren Renaissancemusik ich so liebe und auf deren Konzert ich mich anderthalb Jahre gefreut hatte, bevor es kurzfristig abgesagt wurde, wie alles andere auch.
Ich lebe inzwischen fast ohne Gesang, abgesehen von dürftigen Duetten mit dem Küchenradio und zerstückelten Soli in der Dusche. Anfangs ging ich manchmal tagsüber in die Kirche und sang mit einer sieben Meter entfernt stehenden Freundin eine halbe Stunde lang zweistimmig, aber meistens wurden wir von den Organisten verscheucht, dann gab es wieder Verschärfungen, und inzwischen kann man die Kirche ohnehin nicht mehr ohne Maske betreten. Zudem ist Singen jetzt verrufen. Onlinesingen habe ich ausprobiert, aber das klappt nicht, denn es zeigt mir vor allem, was mir fehlt.
Dass Singen etwas Gesundheitsgefährdendes ist, dass es angeblich zu Massenansteckungen führen kann, bedrückt mich, selbst wenn neuere Studien besagen, dass die Massenansteckungen bei Chorsängerinnen und Chorsängern eher den Begrüßungsritualen und dem Schwätzchenhalten geschuldet seien. »Wo man singt, da lass dich ruhig nieder«, wurde mir in der Kindheit weisgemacht. Doch nun heißt es, wo man singt, da mach dich schnell vom Acker.
Ich war letzten Sommer auf einer Beerdigung, bei der wir hinter der Maske ein bisschen summen konnten, und allein das Summen von »Geh aus mein Herz« hat mich schon erfreut, auch wenn mein Herz nur wahrhaft ausgehen kann, wenn sich der Mund dabei öffnen darf. Beim Summen mit Maske fühlte ich – genau wie in jenem Gedicht der Günderrode – wie meine Töne »im Stoff gefangen (…) nach Befreiung« rangen, und wie sie fragte ich mich: »Wer löset eure Bande dem Verlangen, / Das gern melodisch aus der Stummheit dringt?«
Die Maske, die wir zurzeit überall tragen müssen, macht, dass wir undeutlich artikulieren; die Laute, die durch die Maske dringen, klingen dumpf. Und doch erkenne ich manche Maskierten – vor allem, wenn sie noch dazu Mütze und Sonnenbrille tragen – erst, wenn sie mich durch die Maske ansprechen. Zudem kann man an der Stimme immer noch hören, ob jemand lächelt.
Die Person hinter der Maske spricht und ist damit zu erkennen, ja das Wort Person bedeutet selbst »Maske«. Mit persona war in der Antike die Theatermaske gemeint, die vor allem die Mitglieder des, ja, da ist er wieder, des chorus trugen. Aber auch die einzelnen Akteure hatten solche Masken auf, um die typischen Merkmale ihrer Rolle sichtbar zu machen. Die klassische persona hatte, anders als eine Corona-Maske, am Mund eine Öffnung, sodass die Stimme »hindurchklingen« konnte, was auf Latein personare heißt. Die Stimme allein definiert also die Person.
Die Stimme vermag durch alle unsere Masken, die sichtbaren wie die metaphorischen, zu dringen. Deshalb ist es beim Singen das Wichtigste, die eigene Stimme zu finden und zu benutzen.
Natürlich ist es schön, eine »große« Stimme zu haben, mit der man Wagner-Arien locker wegschmettert, oder einen Stimmumfang von vier Oktaven aufweisen zu können oder eine perlende Koloratur mit der Beweglichkeit von Quecksilber oder ein Power-Vibrato, das schon fast unter Jodeln fällt. Technik ist gut, aber nur, wenn sie die eigene, persönliche und damit einzigartige Stimme unterstützt.
Das Gleiche gilt übrigens auch für das Schreiben, das eng mit dem Singen verwandt ist. In der Stimme, singend oder schreibend, tritt dein Inneres nach außen.
Die Stimme zu verstellen geht immer nur für einen kurzen Moment gut, wie beim Märchen vom Wolf, der die sieben Geißlein zu überlisten versucht, indem er seine Stimme durch den Verzehr von Kreide ziegenähnlich macht. Es nützt also nichts, wenn ich versuche, so kristallin zu singen wie Emma Kirkby oder so kraftvoll wie Adele. Oder wenn es andere versuchen, die es von vornherein schon besser konnten als ich. Ich empfinde einen fast körperlichen Widerwillen gegen »gefakte« Stimmen. Sie ärgern mich, egal wie gekonnt sie singen – oder sprechen. Ich fühle mich immer irgendwie betrogen, genau wie jene sieben Geißlein.
Erst wenn deine Stimme den Weg durch alle Masken schafft, sei es eine Geißenmaske, die Maske der Person, die du gern wärst oder von der du glaubst, dass andere gerne hätten, dass du sie wärst, vermag diese Stimme Menschen zu berühren. Sogar in Zeiten, da Berührungen verboten sind. Gerade dann.
Noch bist du da
Wirf deine Angst
in die Luft
Bald
ist deine Zeit um
bald
wächst der Himmel
unter dem Gras
fallen deine Träume
ins Nirgends
Noch
duftet die Nelke
singt die Drossel
noch darfst du lieben
Worte verschenken
noch bist du da
Sei was du bist
Gib was du hast
Rose Ausländer
1901–1988
Fliegen
Immer wenn ich singe, schwimme oder Schlittschuh laufe, glaube ich, dem Fliegen so schon sehr nahe zu kommen. Das bedeutet nicht, dass es nicht noch andere Dinge gäbe, bei denen man sich fühlt, als flöge man: Paragliding, Drachenfliegen, Kitesurfen, Trapezturnen oder Seiltanzen mögen ähnliche Empfindungen hervorrufen, aber Hilfsmittel, die größer und komplexer sind als ein Paar Schuhe mit Kufen, zählen für mich nicht.
Singen, wenn es einmal gelingt, fühlt sich vielleicht auch deshalb an wie Fliegen, weil es schließlich eine Art Flug ist: Mit der Stimme schweben wir über unserem eigenen Luftstrom. Sich zusammenziehend saugt das Zwerchfell die Luft an, die Lunge verströmt sie, die Stimmbänder schwingen darin, und die Stimmlippen steuern. Je sicherer und leichter und virtuoser wir uns in und auf der Luft bewegen können, desto beglückender der Höhenflug. Singend werfen wir mit unserer Stimme »die Angst in die Luft«, wie in jenem Gedicht von Rose Ausländer, in dem zumindest noch »die Drossel« singt.
Wenn das Singen also ist wie Fliegen, dann muss es natürlich auch wie Schlittschuhlaufen oder Schwimmen sein. Die Gefahren bei allen vier Tätigkeiten sind sich ähnlich: abstürzen, einbrechen, absinken, keine Luft mehr kriegen, untergehen. Die ersten gesungenen Töne nach langer Zeit sind wie der Moment, in dem meine Kufen im Winter zum ersten Mal den zugefrorenen See berühren. Erst bin ich noch ein wenig aufgeregt und wackelig, aber bald gleite ich über die weite Fläche und möchte mich eigentlich nie wieder anders fortbewegen.
Es mag sein, dass ich dies nur so empfinde, weil Winter ist, während ich dies schreibe. Wäre es draußen heiß, würde ich möglicherweise sagen, die ersten Töne seien wie das Schwimmen im See an einem späten Sommernachmittag: Beim Hineingehen bin ich erst atemlos, schaue mich noch etwas unsicher nach den anderen um, doch bald ziehe ich meine eigene Bahn durch das große, grüne Wasser, und je länger ich schwimme, desto weniger platscht und schäumt es um mich herum, bis ich mich fühle wie ein Fisch oder wie jene schlängelnde Ringelnatter, die mir einmal mitten auf dem See begegnet ist.
Ich habe Sängerinnen und Sänger gefragt, wie sich Singen für sie anfühlt: Baden in Luft- und Klangstrom, Seelenfreiflug, eine Schwingung, die vollkommene Durchlässigkeit. Wenn es gut läuft, wie Fliegen, wenn nicht, den Tränen nahe.
Fliegen, Baden, Strömen, Schwingen, Tränen – all dies sind Bilder von Luft und Wasser. Singen ist also wie ein Elementenwechsel, ja es ist, als könnten wir singend die Schwerkraft überwinden, und doch sind wir dabei so geerdet wie selten. Wir stellen die Füße bewusst nebeneinander, je weniger Absatz zwischen Fußsohle und Boden, je größer die Kontaktfläche zwischen uns und der Erde, desto besser: Um leicht zu singen, müssen wir uns schwer machen, uns auf das Zwerchfell konzentrieren, das Becken, auf Körperteile, die nicht im Kopf sind.
Eine Gesangslehrerin sagte mir einmal, ich müsse mehr mit den Oberschenkeln singen. Und ich glaube, sie meinte, ich müsse meine Töne besser gründen, tiefer im Körper verankern. Wenn wir aus voller Kehle singen, heißt das nicht, dass wir besonders viel mit der Kehle singen müssen. Im Zwerchfell entscheidet sich eher die Qualität meines Gesangs. Oder in der Stärke der Luftsäule, die, gefühlt, von meinen Fußsohlen bis zur Schädeldecke und noch ein Stück darüber hinaus reicht. Je höher mein Ton, desto tiefer muss ich ihn spüren. Singen ist immer beides zugleich: Erde und Luft, durchlässig und kraftvoll, Fluss und Form.
Das Hirtenfeuer
Dunkel, dunkel im Moor,
über der Heide Nacht,
nur das rieselnde Rohr
neben der Mühle wacht,
und an des Rades Speichen
schwellende Tropfen schleichen.
Unke kauert im Sumpf,
Igel im Grase duckt,
in dem modernden Sumpf
schlafend die Kröte zuckt,
und am sandigen Hange
rollt sich fester die Schlange.
Was klimmt dort hinterm Ginster
und bildet lichte Scheiben?
Nun wirft es Funkenflinster,
die löschend niederstäuben;
nun wieder alles dunkel –
ich hör’ des Stahles Picken,
ein Knistern, ein Gefunkel,
und auf die Flammen zücken.
Und Hirtenbuben hocken
im Kreis umher, sie strecken
die Hände, Torfes Brocken
seh ich die Lohe lecken;
da bricht ein starker Knabe
aus des Gestrüppes Windel
und schleiftet nach im Trabe
ein wüst Wacholderbündel.
Er läßt’s am Feuer kippen –
hei, wie die Buben johlen
und mit den Fingern schnippen
die Funken-Girandolen!
Wie ihre Zipfelmützen
am Ohre lustig flattern,
und wie die Nadeln spritzen,
und wie die Äste knattern!
Die Flamme sinkt, sie hocken
aufs neu umher im Kreise,
und wieder fliegen Brocken,
und wieder schwelt es leise;
glührote Lichter streichen
an Haarbusch und Gesichte,
und schier Dämonen gleichen
die kleinen Heidewichte.
Der da, der Unbeschuhte,
was streckt er in das Dunkel
den Arm wie eine Rute,
im Kreise welche Gemunkel?
Sie spähn wie junge Geier
von ihrer Ginsterschütte:
ha, noch ein Hirtenfeuer,
recht an des Dammes Mitte!
Man sieht es eben steigen
und seine Schimmer breiten,
den wirren Funkenreigen
übern Wacholder gleiten;
die Buben flüstern leise,
sie räuspern ihre Kehlen,
und alte Heideweisen
verzittern durch die Schmehlen.
»Helo, helo!
Heloe, loe!
Komm du auf unsre Heide,
wo ich mein Schäflein weide,
komm, o komm in unser Bruch,
da gibt’s der Blümelein genug! –
Helo, heloe!«
Die Knaben schweigen, lauschen nach dem Tann,
und leise durch den Ginster zieht’s heran:
Gegenstrophe.
»Helo, heloe!
Ich sitze auf dem Walle,
meine Schäflein schlafen alle,
komm, o komm in unsern Kamp,
da wächst das Gras wie Bram so lang! –
Helo, heloe!
Heloe, loe!«
Annette von Droste-Hülshoff
1797–1848
Mundorgel
Wenn einem im Auto leicht schlecht wird, hilft nur eines: singen. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Vielleicht hat es etwas mit der kontrollierten Atmung zu tun oder mit dem in die Ferne gerichteten Blick. Denn wenn die Augen nichts am Wegesrand festhalten, wird es ihnen auch nicht sofort wieder entrissen, der Gleichgewichtssinn wird nicht überfordert, und niemand muss sich erbrechen. So könnte es sein. Vielleicht klappt das aber auch nur in unserer Familie, weil wir es uns einbilden? Aber es klappt wirklich.
Meiner Mutter wurde eigentlich immer schlecht, wenn die Fahrt länger als eine Viertelstunde ging, mir nur auf dem Rücksitz und wenn die Straße kurvig war. Sobald wir also einen Ausflug machten, und besonders wenn wir uns über die Oberrheinische Tiefebene hinaus Richtung Schwarzwald oder gar Alpen bewegten, mussten wir eigentlich ununterbrochen singen.
Die ersten zwei oder drei Strophen von vielen Volksliedern kannten wir auswendig, meine Eltern kamen beide aus sangesfreudigen Familien. Meine Mutter war in einem großen Haus auf dem Land aufgewachsen, da sang immer jemand bei der Arbeit in der Küche oder im Garten. Und manchmal kam ihr Vater gutgelaunt aus dem Büro und sang selbstausgedachte Spott- und Quatschlieder auf unterschiedliche Familienmitglieder. Während ihrer Kindheit in den Vierzigerjahren wurden in der Schule noch viele Lieder gesungen und Gedichte auswendig gelernt, besonders von Theodor Storm und Annette von Droste-Hülshoff, in denen von Moor und Heide die Rede war, denn Moor und Heide gab es dort, wo meine Mutter herkam, auch. In den Versen der Droste ist alles vereint: Da werden Lieder in Moor und Heide gesungen und – helo, heloe – das Ganze noch bedichtet.
Mein Vater war ein Pastorenkind, und seine beiden Großväter waren auch schon Pastoren gewesen – es war also völlig klar, dass in seiner Familie zu allen Gelegenheiten Choräle angestimmt wurden. Da er schon als Kind in einem kirchlichen Posaunenchor das Flügelhorn spielte, wusste er intuitiv zu jeder Melodie sofort eine Begleitstimme zu singen, eine Fähigkeit, die mir als Kind wie eine Art Superkraft erschien.
Meine Eltern kannten zwar viele Lieder, aber nicht von allen Liedern alle Strophen. Oder nicht dieselben Strophen. So nahmen wir auf längeren Strecken meistens die Mundorgel zu Hilfe. Sie lag im Handschuhfach des Autos, ein kleines, zerfleddertes rotes Liederbüchlein in nicht ganz quadratischem Format. Es hatte keine Noten, sondern nur Texte und ein paar krakelige Illustrationen, die irgendwie bedrückend wirkten. Doch vielleicht war mir einfach immer nur schlecht. Und Bilder anschauen beim Autofahren hilft nicht. Aber eigentlich passten diese schwarzen Zeichnungen ganz gut, denn obwohl es durchaus viele fromme Lieder in der Mundorgel gab, waren andere äußerst bösartig. Einige wiederum sollten lustig sein, aber ich fand sie genauso bedrückend wie die Bilder.
Zum Beispiel das Lied von jener Ziege, die von einem Bauern mit einem Strick hinten an den Zug gebunden und brutal durch Süddeutschland geschleift wird. Natürlich kommt es zu einem Blutbad, und das nur, weil dieser schwäbische Bauer zu geizig ist, um zwei Fahrkarten zu kaufen. Wir sangen dieses Lied auch in der Schule. Wahrscheinlich steht es auf allen baden-württembergischen Lehrplänen, aber ich kann den Oberschulräten dieses Bundeslandes nur zurufen, dass sich, solange dieses Lied in badischen Schulen gesungen wird, der Graben zwischen Baden und Württemberg nie vollständig schließen wird: Der Strick einer erst strangulierten und dann enthaupteten Geiß wird immer zwischen uns passen.
Ein anderes Lied aus der Mundorgel, das ich eigentlich ganz gern sang, aber vor dem mir dennoch graute, war das von einem Psychopathen, der in Pankow erst sein jüngstes Kind im Gewühl verliert und dann feiern geht. Er massakriert fünf Leute mit dem Messer, und obwohl er zu Hause von seiner Frau verdroschen wird, stört es letztlich niemanden, dass er wahrscheinlich ein Alkoholproblem hat, Kindesmisshandler und mehrfacher Mörder ist. Zwar unternimmt dieser tief gestörte Mann am Ende einen Selbstmordversuch, aber sein Jüngster bleibt verschwunden, und niemand scheint ihn zu vermissen, im Gegenteil, alle amüsieren sich köstlich. Obwohl mich Herr Bolle befremdete, habe ich mich jedes Mal singend mit ihm solidarisiert. Bei allem Unbehagen faszinierte mich seine wilde, ja verzweifelte Unbekümmertheit. Und Frau Bolle machte sich viel weniger Sorgen als meine Mutter. Und bestimmt wurde ihr auch nicht im Auto schlecht.
Ein Lied, das meine zu norddeutscher Schwermut neigende Mutter besonders fröhlich machte, war das Lied mit dem Hasen aus dem tiefen Tal (»singing holly, polly, doodle all the day«), der sich nach einer Fallschirm-Notlandung im Parkverbot wiederfindet und sofort von einem Polizisten ins Gefängnis gesperrt wird, und zwar bei trocken Brot und Gänsewein. Ich weiß noch, wie ungläubig ich war, als man mir erklärte, dass Gänsewein Wasser war. Jahrelang hatte ich mir darunter etwas vorgestellt, das nach dem Schmalz schmeckte, das meine Mutter jedes Jahr aus dem Fett der Weihnachtsgans herstellte. Mein Bruder empörte sich darüber, dass der Hase nur wegen Falschparkens in den Bau kam – mein Bruder wurde später Jurist. Deshalb war das Lied Die Affen rasen durch den Wald dasjenige, das er aus der Mundorgel am liebsten mochte, »Der eine macht den anderen kalt«, nein, auch dies war kein familienfreundliches Friedenslied. Doch mein Bruder fand es ohnehin nervtötend, ständig im Auto zu singen. Ihm wurde nie schlecht, und er verstand die Bedrängnis nicht, aus der meine Mutter und ich ein Lied nach dem anderen anstimmten, immer eine Hand am Türgriff, damit wir, wenn die Straße zu kurvig wurde, nicht ins Auto spuckten.
Es gab Tage, da half nicht einmal mehr die Mundorgel, denn bisweilen schlich sich die Übelkeit unbemerkt heran, und dann kam schon der Punkt, an dem einem zu schlecht war, um mit dem Singen überhaupt zu beginnen.
Doch eigentlich habe ich mich immer gefragt, ob meine Reiseübelkeit durch unser kleines Liederbüchlein im Handschuhfach nicht vielleicht verstärkt oder gar verursacht wurde. Die Mundorgel war so ein seltsamer Name, unter dem ich mir nichts Gutes vorstellen konnte. Im zwinkernden Gesicht auf dem Umschlag erkannte ich damals keinen Mundharmonikaspieler, sondern einen Mann, der sich, mit seiner Reiseübelkeit kämpfend, den Mund mit einem Brett zuhielt. Und war es nicht so, dass im Moment des Erbrechens alles Innere orgelnd durch den Mund nach außen geschleudert wurde? Der Mundorgelmann auf dem Umschlag zwinkerte keck, fast verschwörerisch, während er mit Brett vor dem Mund darauf wartete, dass es gleich aus ihm herausorgelte. Bestimmt würde er ’ne volle halbe Stunde kotzen und sich dennoch köstlich amüsieren. Wie Bolle.
Die Luft (Auszug)
9.
Dieses Wunder muß vor allem
Wohl erwegt seyn und bedacht.
Aller Stimmen Saiten Schallen,
Aller Töne süsse Macht
Werden in der Luft erzeuget,
Wenn sie sich in Circkeln beuget,
Und wie sich ein Wasser rührt,
So den Klang zum Ohre führt.
10.
Wer kann dieses Wunder fassen,
Daß sich einer Stimme Klang
So gar oft muß theilen lassen,
Da ein Wörtchen, ein Gesang
Dergestalt die Luft erreget,
Daß sie wallend sich beweget,
Und viel tausend Ohren füllt,
Was aus einem Munde quillt.
Barthold Heinrich Brockes
1680–1747