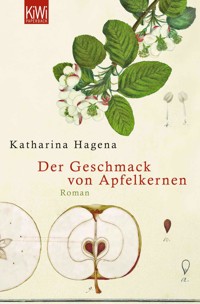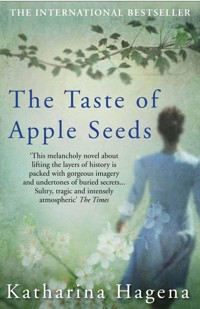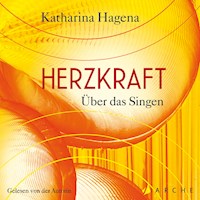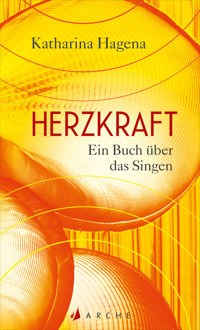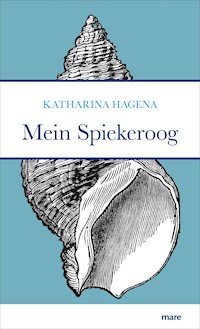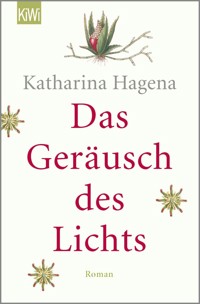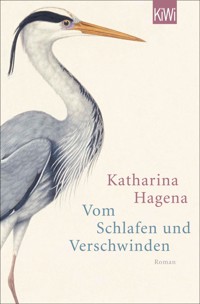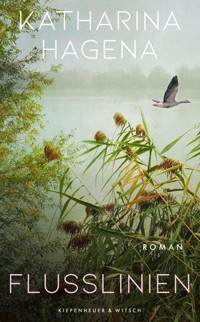
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit Wärme, sprachlicher Kraft und feinem Witz erzählt Katharina Hagena von drei Menschen, drei Schicksalen – und zwölf Frühsommertagen an der Elbe, die alles verändern. »Flusslinien« ist ein so bewegender wie vielschichtiger Generationenroman über das Leben mit den Wunden, die uns zeichnen, und die Frage, wie man lernt loszulassen, zu vertrauen und weiterzuatmen. Margrit Raven ist hundertzwei und wartet auf den Tod. Früher war sie Stimmbildnerin, jetzt lebt sie in einer Seniorenresidenz an der Elbe. Jeden Tag lässt sie sich von dem jungen Fahrer Arthur in den Römischen Garten bringen. Dort, mit Blick auf den Fluss, erinnert sie sich: an ihre Kindheit, den Krieg, ihre Liebhaber und an das, was sie über die einstige Gärtnerin dieses Parks weiß, Else, die große Liebe ihrer Mutter. Die Erinnerungen halten Margrit am Leben – und die Besuche ihrer zornigen Enkelin. Luzie hat sich kurz vor dem Abitur von der Schule abgemeldet und übernachtet nun allein in einer Hütte an der Elbe. Während sie Margrit, deren Mitbewohner und sich selbst im Keller der Seniorenresidenz tätowiert, versucht sie, Stich für Stich, ihre Kraft und ihr Leben zurückzugewinnen. Und dann ist da noch Arthur. Wenn er gerade niemanden zur Dialyse fährt, sucht er mit einer Metallsonde den Strand ab, erfindet Sprachen, kämpft für gefährdete Arten und ringt mit einer Schuld. Um nicht vom Strom der eigenen Erinnerungen fortgerissen zu werden, müssen sich die drei auf sich selbst besinnen. Und aufeinander einlassen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Katharina Hagena
Flusslinien
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Katharina Hagena
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Katharina Hagena
Katharina Hagena, geboren in Karlsruhe, lebt als freie Schriftstellerin mit ihrer Familie in Hamburg. Sie schrieb zwei Bücher über James Joyce, bevor sie 2008 ihren ersten Roman »Der Geschmack von Apfelkernen« veröffentlichte. Das Buch wurde in 26 Sprachen übersetzt und für das Kino verfilmt.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Mit Wärme, sprachlicher Kraft und feinem Witz erzählt Katharina Hagena von drei Menschen, drei Schicksalen – und zwölf Frühsommertagen an der Elbe, die alles verändern. »Flusslinien« ist ein so bewegender wie vielschichtiger Generationenroman über das Leben mit den Wunden, die uns zeichnen, und die Frage, wie man lernt loszulassen, zu vertrauen und weiterzuatmen.
Margrit Raven ist hundertzwei und wartet auf den Tod. Früher war sie Stimmbildnerin, jetzt lebt sie in einer Seniorenresidenz an der Elbe. Jeden Tag lässt sie sich von dem jungen Fahrer Arthur in den Römischen Garten bringen. Dort, mit Blick auf den Fluss, erinnert sie sich: an ihre Kindheit, den Krieg, ihre Liebhaber und an das, was sie über die einstige Gärtnerin dieses Parks weiß, Else, die große Liebe ihrer Mutter.
Die Erinnerungen halten Margrit am Leben – und die Besuche ihrer zornigen Enkelin. Luzie hat sich kurz vor dem Abitur von der Schule abgemeldet und übernachtet nun allein in einer Hütte an der Elbe. Während sie Margrit, deren Mitbewohner und sich selbst im Keller der Seniorenresidenz tätowiert, versucht sie, Stich für Stich, ihre Kraft und ihr Leben zurückzugewinnen.
Und dann ist da noch Arthur. Wenn er gerade niemanden zur Dialyse fährt, sucht er mit einer Metallsonde den Strand ab, erfindet Sprachen, kämpft für gefährdete Arten und ringt mit einer Schuld.
Um nicht vom Strom der eigenen Erinnerungen fortgerissen zu werden, müssen sich die drei auf sich selbst besinnen. Und aufeinander einlassen.
Inhaltsverzeichnis
Motti
Tag 1
Margrit
Arthur
Luzie
Tag 2
Margrit
Luzie
Margrit
Tag 3
Arthur
Luzie
Margrit
Arthur
Luzie
Tag 4
Arthur
Luzie
Margrit
Arthur
Luzie
Margrit
Luzie
Tag 5
Margrit
Arthur
Luzie
Margrit
Tag 6
Arthur
Margrit
Luzie
Margrit
Arthur
Tag 7
Margrit
Tag 8
Arthur
Luzie
Margrit
Luzie
Tag 9
Margrit
Luzie
Tag 10
Arthur
Luzie
Tag 11
Margrit
Arthur
Tag 12
Luzie
Margrit
Arthur
Margrit
Arthur
Margrit
Luzie
Margrit
Arthur
Luzie
Margrit
Nachbemerkung
Danksagung
She must make it once more. There’s the sprig on the table-cloth; there’s my painting; I must move the tree to the middle; that matters – nothing else. Could she not hold fast to that, she asked herself, and not lose her temper, and not argue; and if she wanted revenge take it by laughing at him?
Viriginia Woolf
Unerreichbar
Die Zeit zwischen zwei Atemzügen
Nelly Sachs
Tag 1
Über dem grauen Fluss liegt flacher Nebel, der unter dem Südostwind wallt und strömt wie Trockeneis. Darüber eine Schicht blasser Himmel, darüber die Wolken.
Hellgelber Rauch quillt aus dem einen Schornstein des Kraftwerks und zieht waagerecht Richtung Land. Ein Tanker fährt langsam stromabwärts, die obere Hälfte ragt aus dem Nebel, als durchquerte er den Himmel. Der Schlepper, kaum zu erkennen hinter den Schwaden, macht dicke Wellen, die auf den Sand schlagen wie schwere Klapse, zwei, drei, der vierte schon schlapper, Stille.
Flussinseln, hellgraue Schatten im hellgrauen Dunst. Selbst die Flugzeugfabrik löst sich auf an den Rändern. Ein Werkhallenfenster spiegelt die aufgehende Sonne, blinkt durch Milliarden von Wasserteilchen herüber, und auf dem Strand glänzt ein toter weißer Fisch. Er ist groß, ein Rapfen, knapp einen Meter lang, die Seite von einer Schiffsschraube längs aufgerissen, rostbraunes Blut klebt in den Schuppen. Drei Krähen hüpfen um ihn herum, hacken, kosten. Als eine fliegt, kommt eine mit, eine bleibt.
Hoch über dem Dunst kreisen die Bussarde, ihre Schreie dünn und scharf wie die Reue.
Margrit
Sie hat gehört, es gibt eine Sprache, die hat ein Wort für jene Stille, die eintritt, nachdem der Besuch gegangen ist. Arthur hat ihr davon erzählt, wer sonst.
Er sitzt vorne und fährt sie, wie fast jeden Tag, das kurze Stück zum Römischen Garten. Vielleicht gibt es auch eine Sprache mit einem Wort für die Stille, nachdem man ausgeatmet hat.
Oder für die Stille, nachdem eine Geschichte zu Ende ist.
Oder bevor sie beginnt.
Als Luzie eben ging, hat sie die Tür zu Margrits Zimmer lautlos zugezogen. Jedenfalls konnte Margrit kein Geräusch vernehmen.
Wie es wohl sein wird, wenn sie gar nichts mehr hört. Eine weite Stille wie in einer leeren Kathedrale? Oder eng und muffig wie der fensterlose Hauswirtschaftsraum, in den sich Frau Lange letzte Woche zurückzog, um in Ruhe zu sterben, wie sie ihnen hinterher erklärte?
Oder wird am Ende doch die ganze Zeit irgendetwas brummen, rauschen oder fiepen, so wie jetzt gerade?
Fast taub, hat die Ärztin gesagt. Doch in Wirklichkeit kommt es ihr so vor, als hörte sie mehr als früher, wenngleich gedämpfter. Nicht nur das, was gesprochen wird, sondern auch alle gemurmelten Selbstgespräche und Stoßgebete, alle Seufzer und unterdrückten Schreie, alle irgendwann einmal geäußerten Wünsche und Verwünschungen, ihre eigenen eingeschlossen, alles, was im Hellen weggeredet und im Schlaf ausgeplaudert wird, gelüftete und ungelüftete Geheimnisse, alle Schichten aller Geschichten.
So viel auf einmal rauscht bisweilen auf sie ein, dass sie die einzelnen Stimmen nicht auseinanderhalten kann und erst recht nicht mitbekommt, wenn jemand das Wort an sie richtet.
Irgendwann jedoch, bald wahrscheinlich, wird die ganz große Stille eintreten, fast kann sie sie schon hören.
Natürlich hat sie Angst. Doch sie ist auch gespannt.
Außerdem ist es besser, die Stille der Schattenwelt kommt, bevor sie anfängt sich zu wiederholen.
Es gibt aber noch so viel zu sagen.
Der Tod liebt Geschichten, er wird sich auch diese noch anhören wollen, sie ist sich sicher.
Sie hat winzige fleischfarbene Hörgeräte, die aussehen wie jene kleinen rosa Gummischweinchen, von denen manchmal eines in Frieders Eis war, sie steckten ganz unten in dem silbernen Eiskelch, der so spitz zulief, dass man den Stiel des langen Eislöffels nehmen musste, um das verkantete Gummitierchen herauszuhebeln. Oft kam es aber auch schon mit lautem Schlürfen und leichtem Kippen heraus. Wenn sie Frieder dann streng ansah, behauptete er, man müsse selbst zu einem Ferkel werden, um das Schweinchen zu gewinnen.
Großer Glücksbecher, so hieß das Eis. Es war riesig und rosarot, Erdbeer, Himbeer und Früchte des Waldes. Die Sahnehaube lief oben spitz zu wie ein barocker Kirchturm, aber mit scharfen Graten, von denen die Himbeersoße zäh herabtroff. Man konnte jedoch nie sicher sein, ob ein Schweinchen drin war oder nicht.
Glück musste man haben.
Sie sieht, wie Arthur den Kopf hebt und sie im Rückspiegel mustert. Anscheinend hat sie das gerade laut gesagt.
– Ja, Glück, sagt sie noch einmal mit Nachdruck. Arthur schweigt, der Bus fährt etwas über Schritttempo.
Im Allgemeinen aß Frieder recht schnell, doch dieses Eis löffelte er in solch hingebungsvoller Langsamkeit, dass es auf dem Weg zum Mund schon fast geschmolzen war. Sie hielt es kaum aus, ihm dabei zuzuschauen.
Später richtete sie es so ein, dass er mittwochs nachmittags immer einen Großen Glücksbecher bekam, manchmal sogar zwei, und sie konnte in der Zeit Cornelius einen Hausbesuch abstatten. Mama muss arbeiten, sagte Frieder zur Eisverkäuferin, mit der er schwatzte, wenn Margrit sich verspätete. »Frau Fortuna« stand auf dem Namensschild an ihrem Kittel, wahrscheinlich ein Künstlername. Frau Fortuna entschied darüber, wer Schwein hatte und wer nicht. Vielleicht war es ja doch ihr richtiger Name.
Margrit gab Stunden.
Jeden Mittwoch um fünf. Stimmbildung und Atemübungen, das unterrichtete sie. Die meisten ihrer Patienten kamen mit Krankenschein, aber nicht alle. Die Mittwochsstunde mit dem Dirigenten Cornelius Fischer war privat.
Eine Luftstunde.
Langsames Atmen, Luftanhalten, den Bewegungen des Zwerchfells mit den Händen nachspüren, er bei ihr, sie bei ihm, einengende Kleidung ablegen, Aufwärmen, schnelles Atmen, Erweiterung der Zungenkapazität durch Küssen, Beckenboden anspannen, Diaphragma, noch schnelleres Atmen, Herauskitzeln der Brustspitzentöne, schließlich Ausatmung, Luftholen, ein – gehauchtes – Adieu, und hinaus. Die Haare richtete sie sich danach im Schaufenster der Bäckerei.
Die Eisdiele war quer über die Straße. Sie hätte von Cornelius’ Wohnung aus Frieder sehen können, hätte also gemerkt, wenn er weggegangen wäre. Aber natürlich hat sie nie aus dem Fenster geschaut. Er hätte sie ja auch sehen können. Er kannte das Fenster. Sie hatte es ihm von unten aus gezeigt.
Dass Cornelius jetzt auch hier wohnt, ist komplizierter, als sie dachte. Als er sie in der letzten Weihnachtskarte fragte, ob dies ein gutes Haus sei, antwortete sie nicht. Das hatte Zeit bis zu ihrer nächsten Weihnachtskarte. Er wählte das Wort »Haus«, nicht »Heim«, so wie man über Konzerthäuser und Opernhäuser spricht. Ist diese Seniorenresidenz ein A-Haus oder doch nur ein B-Haus? Wahrscheinlich B.
Aber er hat recht, es ist kein Heim, wenn es nur Mieter und keine Patienten gibt. Cornelius ist jetzt einer von ihnen. Er hat sie schon gefragt, ob sie noch »praktiziert«. Was glaubt er denn? Möchte er nach über einem halben Jahrhundert dort weitermachen, wo sie einst aufgehört hatten? Die Vorstellung ist grotesk. Aber auch schmeichelhaft. Und schmerzlich.
Sie sind beide uralt. Von morschen Knochen hängt fauliges Fleisch, notdürftig zusammengehalten von dünner Haut und dickem Blut. Sie würden es wahrscheinlich beide nicht überleben. Ein Liebestod, er kann ja eine Oper darüber schreiben.
Aber vielleicht möchte er wirklich Atemübungen machen. Das wäre mal etwas Neues.
Damals jedenfalls war Frieder nach mehreren aufeinanderfolgenden Glücksbecher-Mittwochen Stammgast in der Eisdiele, und das rosa Schweinchen wartete im Eisesdunkel wie ein Geheimnis, das danach drängt, gelüftet zu werden. Sicher hatte Frau Fortuna Mitleid mit ihm. Bei der Mutter.
Ob Frieder immer noch so langsam Eis isst?
Sie muss ihn fragen. Sie hat ein Heft, in das sie die Fragen einträgt, die sie ihm stellen, und Erlebnisse und Gedanken, die sie ihm erzählen möchte. Sonst vergisst sie alles bis zum nächsten Anruf. Schon zwei Jahre hat sie ihn nicht gesehen.
Aber Luzie ist hier und spricht manchmal mit ihm am Bildschirm, er ist ihr wahrscheinlich ein besserer Vater, als sie ihm eine Mutter war.
Wenn Luzie ihn von Margrits Wohnung aus anruft, setzt sie sich dazu, aber wirklich sprechen kann man so nicht. Sie ist abgelenkt von ihrem eigenen Bild. Jedes Mal kann sie zunächst nicht glauben, dass sie das sein soll, aber schließlich erkennt sie sich doch, und das ist der schlimmste Moment. Dass sich die reichen Leute in Amerika einfrieren lassen, wenn sie alt sind, versteht sie trotzdem nicht. Wenn man sich unbedingt einfrieren lassen möchte, dann doch mit Mitte zwanzig.
Und ob Frieder auch noch immer so gerne Eis isst?
Luzie wird es wissen. In Australien ist es ja so heiß. Andererseits achtet Frieders neue Frau sehr auf die Ernährung. Luzie sagt, das tun alle zweiten Frauen. Mit der ersten Familie machen die Väter alles falsch und mit der zweiten alles richtig. Aber Frieder hatte gar nicht so viel Zeit, etwas falsch zu machen. Barbara, also Brisko, wie sie sich jetzt nennt, war schon vorher weg. Trotzdem ist Margrit grundsätzlich auf der Seite der Erstfrauen. Vielleicht weil sie selbst auch viel falsch gemacht hat.
Frieder sah beim letzten Mal auf dem Computer etwas schmaler aus. Aber auch müder. Den eigenen Verfall zu beobachten, ist die eine Sache, Zeugin des Verfalls des eigenen Kindes zu sein, bricht einem das Herz. Sie wäre gern tot, bevor Frieder richtig alt ist. Undenkbar, nach ihm zu sterben. Wirklich, sie kann es nicht denken.
Luzie geht es zum Glück wieder besser, letztes Jahr war sie nicht gut beieinander, das konnte Margrit sehen, aber Frieder hat ihr nicht gesagt, was los war. Nur Brisko hat ein paar Andeutungen gemacht.
Luzie wird wissen, ob ihr Vater noch Eis essen darf. Sie weiß wahrscheinlich mehr über ihn als er über sich selbst. Sie ist klug, ihre Luzie. Doch dann geht sie hin und meldet sich von der Schule ab. Zwei Tage nach ihrem achtzehnten Geburtstag. Kurz vor dem Abitur. Einfach so. Und ohne jemandem zu sagen, warum. Ein paar Wochen hat sie es für sich behalten, ist morgens mit ihrer Tasche losgegangen, wie eine dieser Arbeitslosen, die den Tag im Shoppingcenter absitzen. Doch letzte Woche brach sie plötzlich in Tränen aus, und Margrit konnte ihr mühsam ein paar Fetzen Wahrheit entreißen.
Natürlich war das ein Schreck.
Aber ihr Schreck war nicht so groß wie der einer Mutter, nur wie der einer Großmutter (vom Wort her müsste es genau anders herum sein. Darüber möchte sie bei Gelegenheit mit Arthur sprechen, aber jetzt ist sie zu müde).
Und natürlich hat sie versucht, mehr zu erfahren, aber Luzie wischte sich das Gesicht mit den Händen ab und schüttelte den Kopf. Margrit bekommt Angst, wenn sie zu lange darüber nachdenkt. So vieles im Leben eines jungen Menschen kann schiefgehen. Es grenzt an ein Wunder, wenn nur die Hälfte von allem so läuft, wie es soll. Als sie jung war, hielt sie alles, was gut war, für normal, trotz des Kriegs und der Nachkriegszeit. Das Schlechte war das Unnormale. Nun, da sie alt ist, ist es genau umgekehrt.
Wie bedauerlich, dass die Jugend immer nur an Jugendliche verschwendet wird.
Wer hat das noch gesagt?
– Wer hat was gesagt, fragt Arthur.
– Ach, nur ein Zitat, es fällt mir nicht mehr ein.
Arthur zuckt die Schultern und lächelt ihr im Spiegel zu. Er ist so jung. Seine geschwungenen Lippen haben noch diesen weißen Rand, der erst verschwindet, wenn man ganz erwachsen ist.
Ja, es wäre schon schön, wenn man etwas Jugend im Alter übrig hätte. Damit meint sie aber nicht diesen Junggebliebenenquatsch mit den braungebrannten Weißhaarigen in weißen Turnschuhen. Neulich hatte sie einen Versicherungsmakler am Telefon (woher hatte der Mann nur ihre Nummer?), und er redete in einem so wahnwitzigen Tempo auf sie ein, dass sie nichts verstand. Und das, obwohl sie die Schweinchen drin hatte. Irgendwann begann der Mann (vielleicht war er verwirrt? Er klang noch so jung. Sicher nahm er Drogen) von silbernen Surfern zu reden. Da legte sie leise auf, denn sie war doch recht erschöpft: Der Mann hatte so flach und hastig geatmet, dass sie selbst ganz aus der Puste war.
Die Menschen von heute sprechen alle zu schnell.
Sie kann es jeden Tag im Radio hören. Manche jungen Frauen klingen wie Kinder, weil sie ihr Gaumensegel nicht heben und nur noch die Nebenhöhlen als Resonanzräume nutzen. Andere klingen wie Frösche, weil sie zu wenig Luft durch ihre Stimmbänder strömen lassen, und dann knarren die nur. Margrit versteht das nicht. Atmen ist doch keine Mode.
Dass der rasende Versicherungsmann wollte, dass sie ihm Geld gibt, hat sie aber verstanden. Grundsätzlich möchte sie jedoch nicht allzu viel darüber nachdenken, was heute in der Welt alles schlechter ist, möglichst auch nicht, was bei ihr selbst alles schlechter ist. Lieber blickt sie in sich hinein, in jene dunkle Stille, die sich dort im Laufe der letzten Jahre ausgebreitet hat, und betrachtet die Dinge, die langsam daraus hervortreten.
Jungsein ist heutzutage viel schwieriger als früher. Andererseits. Der Krieg. Der war schwierig, machte aber manches einfacher. Sie wollte ihn auf jeden Fall überleben. Allein schon für ihre Mutter, die ihn nicht überlebt hatte.
Die Jungen von heute denken mehr nach, sie machen es sich nicht so einfach wie sie früher. Sie hat in ihrer Jugend zu wenig über den Krieg nachgedacht. Das hat ihr Frieder oft vorgehalten. Es stimmt. Sie hat erst später gelernt, richtig nachzudenken. In einer Diktatur ist Nachdenken schlecht für das Überleben. Der Satz klingt glatt wie eine Ausrede.
Luzie ist milder mit ihr, weil sie nur ihre Großmutter ist. Die wichtigen Auseinandersetzungen führt man mit den Eltern. Der Krieg war da, das wusste man natürlich, aber es galt, Essen aufzutreiben, Kleider und Geld. Sie merkt, wie sie »man wusste« und »es galt« denkt. Ist das ein Echo ihres damaligen Denkens oder eine Abwehr gegenwärtiger Schuld?
In jener Zeit, während des Krieges, arbeitete sie im Krankenhaus. Da sah sie so viel Leid und Schmerz, dass sie sich bemühte, immer nur für kurze Zeit mehrfach über den Tag verteilt nachzudenken. Sonst wäre sie zu Stein geworden wie jene, die versuchten, dem Ungeheuer direkt ins Antlitz zu blicken. Sie wollte dringend leben. Sie liebte es, lebendig zu sein. Daran erinnert sie sich. Und es gab ja auch genug Lebenswichtiges zu organisieren. Nur Hitlers schnarrendes Geschrei im Radio schaltete sie nach Johannes Tod immer aus. Sie war Stimmbildnerin, sie konnte sofort hören, dass mit dem Führer etwas nicht stimmte, also nicht stimmte, im wahrsten Sinne des Wortes. Zum Beispiel, dass die überartikulierten Explosivlaute und das gleich mehrfach angeschlagene Zungen-r nicht über seinen schwachen Stimmkern hinwegtäuschen konnten.
Man hätte es von Anfang an wissen können, denkt sie manchmal. Wir haben alle nicht richtig hingehört.
Ja, der Krieg, die Bomben über Hamburg. Feuersturm, Gomorrha, ihre Mutter, Johanne, damals in Altona. Sie will jetzt nicht darüber nachdenken. Sie ist müde. Die Elbe, der Garten. Die dunkle Girlandenhecke, fast schwarz, hoch, runter, hoch und die Tauben und Krähen, Möwen auch –
Erst, als sie wieder hochschreckt, merkt sie, dass sie kurz geschlafen haben muss. Rasch wirft sie einen Blick in Arthurs Rückspiegel, es ist ihr ein wenig peinlich, in der Öffentlichkeit einzuschlafen. Wie eine Greisin. Aber Arthurs Bus ist ja zum Glück nicht die Öffentlichkeit, jedenfalls nicht ganz. Und vielleicht hat er es gar nicht gemerkt.
Im Auto schläft sie sofort, im Bett kaum. Im Bett stellt sie sich vor, sie schläft ein, und plötzlich wacht sie auf und ist tot.
Manchmal wird sie nachts von der Stille geweckt.
Es war still, als der Krieg zu Ende ging. Oder vielleicht waren alle nur etwas taub geworden. Später kamen die Amerikaner, ihre Musik war das Erste, was sie wieder hörte.
Ein amerikanischer Soldat, mit dem sie getanzt hatte, küsste sie auf dem Heimweg, es war im Frühsommer, Junikäfer brummten um sie herum und stießen sie immer wieder sanft in den Rücken, wie eine Horde winziger, dicker Anstandsdamen. Der Amerikaner war ein Stückchen kleiner als Margrit, doch er küsste besser als alle.
Damals wusste sie das aber noch nicht. Sie dachte, Küssen sei immer so. Vielleicht hat sie deshalb seine Adresse gleich verloren. Erst als sie später von anderen geküsst wurde, verstand sie, wie gut der Amerikaner geküsst hatte. Sie hätte es ihm gern gesagt.
Er lebt bestimmt nicht mehr.
Niemand, der einmal älter war als sie, lebt noch.
Ob er selbst je gewusst hat, wie gut er küsste? Vielleicht hat es ihm eine andere Frau gesagt. Vielleicht hat er aber andere Frauen nie wieder so gut geküsst wie sie? Der erste Kuss sollte nicht der beste gewesen sein.
Margrit hofft, Luzie wurde schon gut, aber nicht zu gut geküsst. Heute denken die Kinder ohnehin nicht mehr so viel ans Küssen. Sie denken mehr an den Sex. Und an die Erderwärmung, das Aussterben der Arten, an den Gazastreifen und die Ukraine. Sie hat ein Musikstück im Radio gehört, das hieß »Gebet für die Ukraine«, es waren lauter langgezogene Noten, klagende Frauenstimmen, und dabei hat sie mehr begriffen als beim Betrachten der verwackelten Telefonfilmchen in den Nachrichten.
Das Schlimme ist, dass sie sich so schnell an alles gewöhnt. Wenn sie eine Weile auf die Tagesschau stiert, überkommt sie eine Art Lähmung. Je länger die Kriege dauern, desto weniger alarmierend findet sie sie.
Vielleicht ist sie ja doch schon zu Stein geworden.
Sie sitzt in ihrer warmen betreuten Wohnung und geht jeden Tag hinunter in den Speisesaal, der sich Bistro nennt, um zu essen. Und sie beklagt sich darüber, dass die Speisen immer beige sind. Wenn das dein größtes Problem ist, sagt Frieder, muss ich mir keine Sorgen um dich machen.
Sie vermisst Frieder. Sie würde gern seine neuen Kinder kennenlernen, ihre beiden anderen Enkel. Luzie hat ihr kürzlich Fotos von ihnen gezeigt, die sie auf dem Telefon hatte. Sie sind so jung, dass es ihr Angst macht.
Heute ist es kompliziert, jung zu sein. Schon die kleinen Kinder müssen so vieles entscheiden. Was sie anziehen wollen und woher die Kleidung kommt, was alles Giftiges darin ist, und ob sie von anderen Kindern gemacht wurden, die nicht in die Schule gehen dürfen, weil sie giftige Kleider nähen müssen. Sie müssen entscheiden, ob sie Fisch oder Soja oder freiwillig vom Baum gefallenes Streuobst essen wollen – Brisko hat erzählt, dass es Leute gibt, die das tun, aber so ganz glaubt sie es nicht. Die Kinder müssen entscheiden, welches Geschlecht sie haben, ob sie überhaupt eines haben oder vielleicht mehrere. Und später müssen sie entscheiden, mit Menschen welchen Geschlechts sie Geschlechtsverkehr haben wollen, wie sie verhüten oder – und bei dem Gedanken kommen ihr immer die Tränen – ob sie nicht lieber ganz auf das Kinderkriegen verzichten sollten, um das Klima zu schützen und auch, weil sie nicht mit Sicherheit sagen können, ob es, bis ihr Kind erwachsen ist, noch eine Welt gibt, in die es sich lohnt, hineingeboren zu werden.
Bei jeder Entscheidung geht es um Leben und Tod. Von allem.
Ach!
Und wieder schaut Arthur auf. Margrit schließt die Augen und lächelt beruhigend. Er soll sich keine Sorgen machen.
Jedenfalls ist es nicht verwunderlich, dass sich die Kinder von der Schule abmelden, irgendwann braucht ja wohl jeder einmal Zeit, um über alles gründlich nachzudenken.
Margrit bekommt Rückenschmerzen, wenn sie über diese Dinge nachdenkt.
Er tut aber meistens weh.
Es gibt keine Sekunde am Tag, an dem ihr nichts wehtut. Und es wird auch keine mehr geben. Außer vielleicht im Moment des Sterbens. Den stellt sie sich ganz schön vor. Sie wünscht sich trotzdem, Luzie würde ihr genau erklären, warum sie nicht mehr in die Schule geht.
Luzies Eltern sind keine Hilfe.
Frieder sitzt in Australien mit seiner neuen Familie, er ist über sechzig, und seine neuen Kinder sind klein, vielleicht vier und zwei. Oder doch schon älter? Sie vergisst immer, die Pandemiejahre mitzuzählen. Ihre unbekannten Enkelkinder, ein Junge, ein Mädchen, sehen niedlich aus mit ihren hellen Augen und Haaren. Der Junge hat Frieders Wirbel, und das Mädchen hat die Form seiner Augen. Luzie hat auch Frieders weit auseinanderstehende Augen. Ihr dickes braunes Haar kommt aus Heinrichs Familie. Doch ihre Schönheit kommt ganz aus ihr selbst.
Die beiden neuen Kinder von Frieder heißen Maggie und Henry, nach Heinrich und ihr, das kann sie sich gut merken. Trotzdem, sie ist zu alt für diese kleinen Kinder. Sogar Frieder ist zu alt für sie.
Sie war natürlich auch zu alt, als sie Frieder bekam, fast vierzig, Heinrich sogar noch älter. Frieders neue Frau tut ihr leid. Cheryl. Klingt wie Sheriff. Und genau das ist sie auch. Sie ist von Beruf Bürgermeisterin. Luzie sagt, sie mag Cheryl.
Frieder hat jetzt einen Hund und ist Hausmann. Das passt viel besser zu ihm als die Arbeit an der Universität. Er kocht gern, macht die Wäsche und ist viel ordentlicher, als Margrit es je war. Die halbe deutsche Fakultät sei in den vorgezogenen Ruhestand gegangen, sagt er. Und dass ihn die akademische Welt enttäuscht habe. Er finde nicht mehr das, was er dort einst gesucht habe.
Aber das gilt doch irgendwann für alles im Leben, oder nicht?
Brisko, Luzies Mutter und Frieders erste Frau, scheint auch nicht das zu finden, was sie gerade sucht. Zumindest in dieser Hinsicht passten die beiden gut zusammen. Zu gut, sagt Luzie.
Seit Jahren versucht Brisko nun, sich selbst zu finden. Doch womöglich ist sie ja gar nicht so verloren, wie sie glaubt? Vielleicht muss sie sich gar nicht mehr finden, sondern ist inzwischen längst wieder aufgetaucht, wie Margrits verschwundene Gartenschere, die nach Jahren plötzlich zwischen den Astern lag.
Aber Luzie.
Sie ist ihr Augenstern.
Vor achtzehn Jahren wurde Margrit ein grüner Star aus dem Auge operiert, und kurz darauf kam Luzie auf die Welt. Doch Margrit hatte Luzie erst kennengelernt, als sie schon zwei Jahre alt war. Es war Liebe auf den ersten Blick. Barbara, ihre Mutter, also Brisko, hatte nach der Trennung von Frieder noch eine Zeit lang auf einer australischen Farm gelebt, hatte Wolle gefärbt und versponnen und Gedichte geschrieben. Sie kam zurück nach Hamburg, um »Sprache zu tanken«, wie sie es nannte, und blieb. Margrit hätte ihr Augenlicht gegeben, um Luzies Mutter davon abzuhalten, wieder fortzugehen. Doch Brisko brauchte kein Augenlicht. Sie brauchte eine Oma. Und Margrit war zur Stelle.
Luzies Augen sind grün. So steht es jedenfalls in ihrem Pass. In Wirklichkeit sind sie bunt. Grün ist dabei, aber auch Gelb und Blau und Braun, Türkis und Grau. Damit kann sie alles sehen – auch das, was hinter den Dingen ist. Und sie kann alles zeichnen, was sie sieht.
Margrit hat inzwischen mehrere Brillen. Alle helfen ein bisschen, aber sie hat trotzdem das Gefühl, immer nur sehr kleine Ausschnitte der Welt scharf zu sehen. Und manchmal sieht sie nur gleißendes Licht. Neulich konnte sie nicht im Speisesaal essen, weil die Tischdecken so geblendet haben. An manchen Tagen sieht sie fast gar nichts und kann nur Dinge erkennen, die in ihrer Erinnerung auftauchen, und selbst die nicht besonders gut.
Nur sprechen, das geht noch.
Obwohl sie auch da nicht immer weiß, ob sie etwas gesagt hat oder nur gedacht. Neulich hat die Pflegerin Justyna sie so schief angesehen und dabei beruhigend genickt, als wäre sie schon wunderlich. Sie weiß, sie hat etwas zu Justyna gesagt, aber vielleicht hat alles, was sie ihr davor erklärt hatte, nur in ihren Gedanken stattgefunden. Justyna ist sicher Schlimmeres gewöhnt, aber trotzdem.
Wenn sie ihre Hörgeräte einsetzt oder herausholt, merkt sie besonders deutlich, wie stark ihre Hände zittern, und Arthrose hat sie auch in den Fingern (oder ist es Arthritis? Sie wird den Unterschied nie lernen). Meistens braucht sie mehrere Anläufe, um die Schweinchen in die Ohren zu stecken. Die Dinger sind klein, aber zum Glück nicht glatt, sie fühlen sich eher an wie Radiergummis.
Vor ein paar Jahren hatte Luzie eine Phase, da musste sie alles, was sie gezeichnet hatte, wieder wegradieren. Der Sinn ihrer Bleistiftzeichnungen schien einzig in der Herstellung winziger grauer Gummiwürstchen zu liegen, Würstchen aus eingerollten Fehlentscheidungen. Inzwischen radiert sie gar nicht mehr. Sie zeichnet und zeichnet, und wenn es ihr nicht gefällt, legt sie das Blatt zur Seite und nimmt sich ein neues. Margrit erinnert sich an ein Duftradiergummi, an dem sie immer schnupperte, wenn Luzie früher bei ihr im Zimmer Hausaufgaben machte. Es sah aus wie ein Schnitz Wassermelone, grün und pink, roch aber nach Honigmelone.
Mit dem Obst sind sie hier sparsam. Wassermelone gibt es nie, immer nur Bananen, Äpfel oder Birnen. Mit Obst, das beige ist, kann man nicht kleckern. Das warme Essen hinterlässt kaum Flecken auf dem Tischtuch: Nudeln mit Käsesoße, Hühnerfrikassee in Königinnenpastete, Dampfnudeln, Milchreis, Kartoffelbrei, Serviettenknödel. Jeden Nachmittag kann man hier Kuchen bekommen, der ist auch beige: Zitronenrolle, Käsetorte, Butterkuchen, Windbeutel, Streuselkuchen. Ihre Zimmerwände sind beige, und ihre Hörgeräte sind auch beige, rosabeige.
Sie muss sich das Ohr vor dem Einsetzen zuerst mit Spucke betupfen, damit die Schweinchen gut in der Muschel haften. Das mit der Spucke ist ein bisschen eklig, macht aber Spaß. Alt sein ist oft wie Kind sein, bloß ohne dabei noch irgendwen zu entzücken.
Hören kann sie mit den Dingern eigentlich nicht.
Sie versteht nur besser, was man ihr sagt.
Wenn sie hingegen etwas hören möchte, wenn sie eine Stimme wirklich wahrnehmen will, ihren Klang, ihre Farbe, wie sie sich anfühlt, was in ihr schwingt und was gerade nicht schwingt, festsitzt, hart ist, sich verweigert, muss sie die rosa Schweinchen wieder herauspulen. Sie legt sie dann in eine kleine Plastikdose mit zwei perfekten Ausbuchtungen. Die Dose muss mit Strom versorgt werden, wie ein sehr kleiner Brutkasten.
Aus Luzies Stimme erfährt sie mehr als aus ihren Worten.
Wenn sie kommt, steckt sich Margrit erst die Schweinchen hinein, damit sie alles Notwendige in Erfahrung bringen kann, und dann nimmt sie sie heraus und horcht auf das, was Luzie alles nicht erzählt.
Natürlich kann sie nicht hören, was genau sie ihr verschweigt. Sie bekommt aber besser mit, an welcher Stelle sie etwas verschweigt. Wenn etwas nicht stimmt, schwingt die Stimme nicht. Macht sich klein und starr wie ein Tier im Versteck.
Heute Abend geht sie mit Luzie ins Konzert. Es spielt das Heim-Orchester, die Stillen Wasser. Es ist erst das zweite Konzert, man muss sich früh anmelden, die Plätze sind begehrt. Cornelius hat es gegründet und dirigiert auch. Vielleicht kann sie nach dem Konzert noch einmal mit Luzie reden.
Sie merkt, dass sie seufzt, und vielleicht hat sie auch noch den Kopf geschüttelt, denn Arthur schaut sie im Rückspiegel an und fragt, ob sie etwas brauche.
Sie schüttelt noch einmal den Kopf, und Arthur sagt, sie könne wirklich sehr laut mit dem Nacken knacken, aber jetzt wisse er es auch, deshalb könne sie ruhig wieder damit aufhören.
Immer wenn er das Gefühl hat, sie braucht Aufmunterung, fängt er an mit seinen geriatrischen Betrachtungen.
– Da machen sich die Leute ihr Leben lang jünger, als sie sind, aber ab fünfundsiebzig runden alle plötzlich auf, fordern ungläubiges Erstaunen ein und lassen sich für ihr Aussehen mehr feiern als zu der Zeit, als sie tatsächlich hübsch waren. Warum?
Sie muss lächeln.
– Es ist eine Leistung, nicht tot zu sein.
Arthur tut, als habe er sie nicht gehört, schaut auf die Straße, während er weitermurmelt:
– Mündige Erwachsene vertuschen den Verfall ihres Körpers, aber im Altersheim, pardon, in der Seniorenresidenz, geht es zu wie bei einer Siechen-Olympiade: Wessen Blutdruck ist am höchsten, wessen Knochen knacken am lautesten, wessen Tumore wachsen am schnellsten, wessen Inkontinenzeinlagen wiegen am schwersten.
Margrit lacht und prustet dabei aus Versehen gegen die Kopfstütze vor ihr.
– Sehen Sie? Genau das meine ich, sagt Arthur angewidert und reicht ihr einen Lappen nach hinten.
Arthur zum Lachen oder wenigstens zum Entrunzeln seiner Stirn zu bringen, ist für Margrit eine Art Sport. Wenngleich es meistens damit endet, dass sie lacht, er aber nicht. Auf dem Wochenplan für montags um elf steht »Gehirnjogging«. Doch Margrit kann natürlich nicht zu etwas gehen, was so heißt. Wahrscheinlich ist es gar nicht so schlimm, wie es klingt. Sie machen Ratespiele und lösen Sudokus.
Als Arthur ganz neu war, fragte sie ihn gleich montags morgens, ob er sie zum Römischen Garten fahren könne. Er schaute sie kurz an und sagte gedehnt: Ja, aber da steht doch Gehirnjogging auf dem Plan. Sie klopfte ihm auf den Rücken und sagte, dass das eine gute Idee sei, und dass man gar nicht früh genug damit anfangen könne. Sie selbst würde in der Zeit dann das Auto nehmen. Dabei hielt sie die Hand auf, damit er den Autoschlüssel hineinlegen konnte. Da nahm er ihre Hand in beide Hände, schüttelte sie feierlich und versicherte ihr, er stehe ihr am Montagmorgen und an jedem anderen Morgen zu Diensten.
Hier im Haus nehmen sie jeden Witz mit, den sie kriegen können. Es ist durchaus so, wie Arthur sagt: Alte Leute lachen wirklich über jeden Scheiß. Sie lachen eben, weil sie es können. Sie lachen, um sich selbst zu beweisen, dass sie gerade nicht heulen, niemandem etwas vorjammern und nicht tot sind. Sie lachen auch, weil sie andere Bewohner, deren Witze zugegeben oft, nun ja, beschissen sind, aufmuntern wollen.
Margrit muss sich überwinden, die Wörter »Scheiß« und »beschissen« zu denken, aber es geht immer besser. Ihre Mutter Johanne fand es entsetzlich, wenn eine junge Frau fluchte. Aber Margrit ist eben keine junge Frau mehr. Wann bitte soll sie fluchen, wenn nicht jetzt?
Arthur ist noch jung, ein Baby.
Er ist ihr Fahrer, und er ist entzückend. Er weiß viel und fragt viel. Das ist selten. Vor allem bei jungen Männern. Bei älteren Männern ist es nicht einmal selten. Denn da gibt es so etwas gar nicht. Wenn sie viel wissen, wollen sie nichts von dem wissen, was sie weiß, sondern lieber darlegen, was sie wissen, unabhängig davon, ob sie es vielleicht selbst auch weiß. Wenn sie jedoch nicht viel wissen, fragen sie einen erst recht nichts. Margrit wird müde, wenn sie noch länger darüber nachdenkt.
Arthur fährt sie jeden Tag an der Elbe entlang, am Campingplatz vorbei und an einer Handvoll Villen – fast alle neu oder neureich. Ob jemand neureich ist, erkennt Margrit an diesen lackierten Dachziegeln, die aussehen, als seien sie immer nass.
Unterhalb des Römischen Gartens parkt Arthur mit einer Sondergenehmigung für Krankentransporte, die an der Windschutzscheibe klebt. Obwohl sie nicht krank ist, sondern nur alt. Alt sei bloß ein anderes Wort für gebrechlich, sagt Arthur, während er den Minibus möglichst nah an den Elbhang stellt. Und ein Gebrechen sei eine Krankheit. Mit einem Ruck zieht er die Handbremse des kleinen Busses nach oben, als könnte er so die Reißfestigkeit seiner Argumentationskette prüfen. Er steigt aus, hilft ihr aus dem Wagen und begleitet sie den steilen Weg hinauf.
Sie hat eine Gehhilfe, aber die nützt nichts auf den Treppenstufen, im Gegenteil. Deshalb nimmt Arthur den Rollator in die rechte Hand, sie hakt sich bei ihm unter und hält sich mit der linken Hand am Geländer fest, und so gehen sie langsam hinauf. Der Weg ist lang und steil, und in seiner Mitte wechselt das Geländer die Seiten. Sie bleiben stehen, jeden Tag an derselben Stelle, Arthur nimmt die Gehhilfe in die Linke, sie hakt sich wieder an seinem anderen Arm unter und hält sich rechts am Geländer fest. Es ist ein mühsamer Aufstieg.
Oben angelangt, tut Arthur so, als brauche er eine Verschnaufpause, weil er sieht, dass sie eine braucht. Er gibt vor, kurzatmig zu sein, wischt sich mit einer großen Bewegung den Schweiß ab und fragt, ob sie den Alten im Heim Wackersteine zu essen gäben, sie würde ja von Tag zu Tag schwerer.
Er gibt ihr die Gehhilfe zurück, die er Rollartur nennt, mit r und u, weil sie ihn, wie er behauptet, an ihn selbst erinnert. Mitleidig tätschelt er die Sitzfläche des Rollarturs und raunt ihm zu, er müsse jetzt ganz stark sein. Denn jetzt sei die dicke Alte wieder dran, dabei zeigt er mit dem Kinn auf Margrit und setzt eine sorgenvolle Miene auf. Sie muss jedes Mal laut lachen, aber er schüttelt nur resigniert den Kopf und sagt, ihr Alten lacht echt über jeden Scheiß.
Beim letzten Mal sagte sie ihm, sie würde nur deshalb über seine Witze lachen, weil sie ihre Hörgeräte nicht drin habe. Da lächelte er kurz und schief, und sie hatte gleich das Gefühl, etwas Großes und Bedeutendes vollbracht zu haben.
Sie schaut sich um. Rechts geht es in den schmalen Römischen Garten hinein. Eigentlich ist er nur noch eine grüne Rasenterrasse, zur Flussseite hin begrenzt von einer auffälligen Girlandenhecke. Aber wenn man hier oben länger verweilt, fällt das Auge bald auf steinerne Treppen, blühende Mauern, vereinzelte Bäume und ein altes Seerosenbecken ohne Wasser. Und dann der weite Blick über die Elbe, die Flussinseln und dahinter das andere Ufer. Der Himmel ist weit, und die Wolken sind nah.
Bevor Arthur Margrit im Römischen Garten allein lässt, versichert er ihr, dass er in einer Stunde zurück sei. Er wünscht ihr Glück, und sie bedankt sich.
Arthur verrät ihr nicht, wohin er geht, aber Luzie hat berichtet, sie sehe ihn oft unten am Strand, wo er mit einem Metalldetektor und Kopfhörern langsam über den Sand gehe und nach vergrabenen Münzen oder anderen Schätzen suche. Sie hätte nicht vermutet, dass er ein solches Hobby hat, dass er überhaupt ein Hobby hat. Luzie sagt, Typen mit Metalldetektoren hätten immer einen Bart und kein Leben. Arthur hat keinen Bart, aber hat er ein Leben? Am besten, sie fragt ihn das bei Gelegenheit. Er ist ja kein schweigsamer Mensch. Aber verschwiegen, das schon.
Arthur
In der Sprache, die er zuletzt entwickelt hat, gibt es ein Wort für jene Stille, die eintritt, nachdem der Besuch gegangen ist. So etwas Ähnliches gibt es im Japanischen auch. Seine Sprache hat auch ein Wort für die Stille, die herrscht, wenn der Gast gar nicht erst kommt, für die Stille vor einer schlechten Nachricht, die Stille nach einem Streit, die Stille, nachdem zwei Menschen gleichzeitig dasselbe gesagt haben, die Stille, wenn man allein von einem Ort weggeht, an den man zu zweit gekommen ist.
Seine Sprache heißt Sigé, das ist nicht nur die Göttin des Schweigens, vielmehr ist sie das Schweigen selbst. Sie war schon da, lange bevor irgendein Gott etwas erschuf. Das Schweigen ist das dunkle Wasser, über dem später in der Genesis einmal der Geist Gottes schwebt, bevor dieser anfängt zu schöpfen. Die biblische Schöpfungsgeschichte ist das Gegenteil von Schweigen, eine Mischung aus Aufräumen und Mansplaining. Am Anfang war aber nicht das Wort. Gäbe es kein Schweigen, gäbe es nichts, was das Wort zu einem Wort machen könnte, denn alles wäre nur eine große Labermasse.
Arthur wohnt erst seit Kurzem hier unten an der Elbe, und zwar in einem Haus, das aus Brettern gebaut ist und auf Pfählen steht. Ein paar Mal im Jahr stehen die Pfähle im Fluss, eigentlich ist es eher eine Hütte. Sie gehört Gregor Holzbach, einem Bewohner der Seniorenresidenz, die aber von vielen nur »das Heim« genannt wird. Gregors Schwiegersohn vermietet sie für wenig Geld. Das ist nett, aber er tut sich selbst auch einen Gefallen damit, weil seine Frau und er auf diese Weise nicht mehr in der Nähe übernachten und deshalb nicht so oft zu Besuch kommen können. Vielleicht will der Schwiegersohn aber auch nur dafür sorgen, dass sich Arthur besonders gut um Gregor kümmert. Aber Arthur würde sich so oder so um Gregor kümmern, selbst wenn er nicht in dessen Hütte wohnen würde. Denn Gregor ist freundlich zu allen, obwohl er über einen scharfen Geist und eine scharfe Zunge verfügt. Gregor behauptet, sein Geist und seine Zunge hätten sich nur geschärft, weil sie ständig hilflos am harten, glänzenden Verstand seiner Frau abgerutscht seien. Gregors Frau Marlies ist schon seit siebzehn Jahren tot. Er liebt seine Tochter, aber seinen Schwiegersohn hält er für eine Flachpfeife. Das erkenne man gleich an seinem Herrenschal, sagt er. Tatsächlich trägt Arthurs Vermieter, genau genommen ist er ja nur der Verwalter, immer einen dieser dünnen Schals, die man sich erst doppelt gefasst über den Nacken legt und dann die beiden Enden auf der einen Seite durch die Schlaufe auf der anderen Seite führt. Bevor Arthur Gregor kennengelernt hat, wusste er nicht, dass der Herrenschal ein Merkmal für Flachpfeifentum ist, aber jetzt fühlt er es auch.
Im Allgemeinen wohnt er gern in dieser Hütte. Nur wenn sie bei Sturm so hin und her schwankt, dass die Stelzen quietschen, wird ihm etwas mulmig. Wenn das Wasser nachts ganz nah herankommt, kann er hören, wie es rauscht und strömt. Einmal wurde er sogar evakuiert. Das heißt, er hat eine Tasche gepackt und ist die paar Schritte hinauf zur Straße gegangen. In einem Feuerwehrauto gab es Tee, und ein paar Stunden später war er wieder in der Hütte.
Der Fluss steigt sehr schnell sehr hoch, schneller und höher als vor der Elbvertiefung. Das fällt Arthur besonders auf, weil er und Theo bis vor Kurzem in der Schweiz gewohnt haben. Als er wieder nach Hamburg zurückkam, war alles anders, sogar die Elbe.
In der Schweiz haben sie noch ein bisschen weiterstudiert, aber vor allem als freie Taucher gearbeitet. Langsam und schwerfällig schritten sie die weichen Böden der Seen und Flüsse ab, mit Sauerstoffflaschen auf dem Rücken und Gewichten in den Anzügen. Sie halfen dabei, Autos oder Müll aus dem Wasser zu ziehen, oder suchten nach Waffen. Nun ja, eigentlich sollten sie nur ein einziges Mal ein Messer suchen. Aber leider haben sie es nicht gefunden. Jedenfalls nicht das richtige. Nur ein Schweizer Taschenmesser.
Meistens begutachteten und vermaßen Theo und er Uferbefestigungen vom Wasser aus und sammelten Daten für den Hydrologischen Atlas der Eidgenössischen Schweiz. Oder sie kontrollierten Brückenpfeiler und Unterwasserkabel. Wenn es nicht zu kompliziert war, reparierten sie dabei auch mal etwas, aber Schweißer oder Metallschmiede waren sie nicht. Solche Arbeiten mussten Fachleute übernehmen, richtige Industrietaucher, die viel höhere Gehälter bekamen. Das Tauchen war für sie eher ein erweitertes Hobby. Aber Theo und er verdienten damit genug Geld, sie lebten nah an der Grenze zu Deutschland, wo sie billiger einkaufen konnten als auf der Schweizer Seite, und sie brauchten ohnehin nicht viel. Theo hatte einen See zum Angeln, und Arthur konnte sich um seine Sprachen kümmern.
Seit Theo weg ist, war Arthur nicht mehr im Wasser.
Jetzt ist er hier und fährt die Alten von der Seniorenresidenz in der Gegend herum. Geld verdient er immer noch nicht so viel, aber er wohnt fast umsonst, und von Theos Geld ist auch noch etwas da.
Wenn Margrit sich nach seinem Befinden erkundigt, sagt er immer, es sei »alles ganz gut soweit«. Ohne Margrit würde ihm die Arbeit nur halb so viel Spaß machen. Sie fragt ihn jeden Tag, wie es ihm geht, und was er macht oder denkt. Schwer zu sagen, ob sie neugierig ist oder anteilnehmend, die Grenzen sind wahrscheinlich fließend, aber es macht ihm nichts aus, ihr ein paar Sachen zu erzählen. Sie versteht sich aufs Schweigen. Wer so alt ist wie sie, vernimmt schon die Stille des Grabes. Außerdem ist Neugierde immer in der Anteilnahme enthalten, aber nicht immer ist Anteilnahme in der Neugierde. Er macht sich eine Notiz ins Telefon: »Wörter für unterschiedliche Neugierden, mit und ohne Anteilnahme, Faszination, Höflichkeit, Wissbegierde, Besessenheit, Macht über andere, warm, kalt.«
Margrit ist aufmerksam, wenn er antwortet, hakt nach, aber bohrt nicht. Wie viel sie davon wirklich hört, vermag er nicht mit Sicherheit zu sagen. Manchmal ist sie völlig abwesend, und dann haut sie plötzlich Sachen raus, über die er noch Tage später nachdenkt. Selbst wenn also nicht »alles ganz gut soweit« ist, ist es auf jeden Fall besser so. Margrit nickt, wenn er das sagt, sie fragt nicht, was »soweit« bedeutet. »Soweit« heißt natürlich »nicht so besonders weit«. Vieles wäre einfacher, wenn man eine vernünftigere Sprache hätte, eine, in der »ganz gut« nicht »halb gut« bedeutet. Eine, in der ein »besserer« Tag nicht schlechter ist als ein »guter« Tag.
Sprachen zu konstruieren, ihre Grammatik, ihren Klang und ihr Wesen zu erfinden, ermöglicht ihm, die Grenzen des Ausdrückbaren zu verschieben, und verschafft ihm die Aussicht auf eine tiefere und klarere Verständigung. Und wahrscheinlich treibt ihn auch immer noch die Vorstellung von der Schuldlosigkeit einer frischen Sprache an. Dass die nur ein Trug ist, weiß er inzwischen selbst am besten. Trotzdem macht er weiter. »Prebabelian« hieß seine erste konstruierte Sprache, seine erste Conlang – natürlich mit Ausnahme von »Thethur«. Aber in einen Fantasyfilm oder wenigstens in ein Spiel hat es Prebabelian nie geschafft. Zu kompliziert, zu wohlklingend, nicht das, was wir suchen, hieß es in den Absage-Mails. Die verkäuflichen Conlangs müssen simpel sein. Und harsch. Computerspieldesigner benötigen immer nur Sprachen für die Bösen, für die Monster und Maschinen, für die Feinde und Fremdenlegionäre, die Killer und Dämonen. Denn die Guten sprechen alle schlechtes Amerikanisch.
Die Sprache Thethur hat er sich aber wahrscheinlich nicht alleine ausgedacht, darin waren Theo und er schon fließend, als sie noch im Fruchtwasser tauchten, zusammen in einem einzigen Ei.
Seit Arthur an der Elbe lebt, möchte er eine Wassersprache, eine Wasserzeichensprache erfinden, eine Flusssprache, aber Elbisch gibt es ja leider schon. Tolkien wird von den Conlang-Leuten wie ein Gott verehrt. Arthur findet seine Romane nicht so gut wie die Sprachen darin. Obwohl die meisten seiner Kollegen aus der Fantasy-Szene stammen, sieht sich Arthur eher in der Science-Fiction-Fraktion. Mittelalterschauplätze mit Zwergen, Drachen und Menschen in Samtumhängen schlagen ihm auf den Magen, wortwörtlich. Er weiß nicht genau, warum, aber ihm wird wirklich schlecht davon. Schon nach wenigen Fantasyromankapiteln spürt er eine seltsame Wärme, und wenn er nicht aufhört zu lesen, sammelt sich Spucke in seinem Mund.
Nicht einmal die beiden Folgen der Hexenschülerinnen-Serie, in der eine seiner Sprachen benutzt wird, konnte er bis zu Ende sehen. Vielleicht kommt das Wort Magie ja von Magen. Er hat sich schließlich nur die Szenen angeschaut, in denen seine Sprache von haarlosen Zombienazi-Kampfmaschinen gesprochen wird. Und selbst das hat er bereut: Die wenigen Dialoge waren schlecht gesprochen und nicht einmal untertitelt. Wozu haben die eine ganze Sprache eingekauft, wenn es ein paar aneinandergereihte Rülpsgeräusche genauso getan hätten?
Die Elbe ist, wenn die Tide umschlägt, eine graubraune Brühe, träge, trüb. Doch die Trägheit trügt. Seit die Fahrrinne ausgebaggert wurde, fließt das Wasser viel schneller hinein als hinaus. Dabei schwemmt es den schwarzen Schlick hinein, der jetzt irgendwo im Wattenmeer fehlt. Der Schlick riecht im Sommer nach Fäulnis, aber auch nach Ozean. Jede Woche liegen andere Dinge zwischen den Rillen im feuchten Sand, die lieber in der Tiefe geblieben wären. Diese Woche sind es lauter kleine weiße Schneckenhäuser. Sie sehen aus, als wären sie schon länger unbewohnt. Ihre Schalen sind ausgeblichen, porös und so zart, dass sie beim Auflesen zwischen den Fingerspitzen zerbrechen und die Scherben an den Händen kleben bleiben. Er hat auch schon einmal einen Bernstein gefunden, dunkelgelb und klar, in Form eines Tropfens.
In einer anderen Woche war der nasse Sand übersät von sterbenden Krabben. Manche kämpften noch um ihr Leben, rannten seitwärts auf spitzen Füßen Richtung Fluss, wo sie im Süßwasser verendeten. Andere versuchten, sich mit letzter Kraft zu vergraben. Die Krähen waren interessiert, aber nicht gierig. Sie hüpfen lieber hinter den Hundebesitzern her und fangen Hunde-Leckerlis auf.
In letzter Zeit stecken immer wieder Tausende kleiner Babyflussmuscheln im schwärzlichen Schlick, sie knistern beim Darübergehen wie dünnes Eis.
Neulich wand sich ein schmales Band Gallertkügelchen kilometerweit den Flutsaum entlang. Es funkelte in der Morgensonne wie ein Diamantenkollier. Das waren irgendwelche Fischeier, vielleicht vom Stint? Der stirbt gerade aus, weil die Elbe zu dunkel und zu schnell wird. Kröteneier waren es jedenfalls nicht, denn die durchsichtigen Perlen hatten keinen schwarzen Kern.
Ein anderes Mal lagen große Klumpen Uferpflanzen mit Wurzelballen und Blüten an der Wasserkante. Sie warfen lange Schatten auf den glänzenden Schlick, und von Weitem sah es aus, als seien Menschen nach einem Schiffsunglück angespült worden und lägen nun ausgestreckt oder auf der Seite im spiegelnden Sand. Aber ertrunkene Flüchtlinge gibt es hier noch nicht. Nur ab und zu Tote im Container.
Die Containerschiffe werden mit der neuen Elbvertiefung noch größer. Vorher waren sie ungefähr dreihundert Meter, jetzt sind sie vierhundert Meter lang. Schwimmende Städte mit bunten Plattenbauten, aber ohne Menschen darin. Jedenfalls keine sichtbaren.
Zwar ist er beim Nabu, aber Hydrologie hat Arthur damals nur studiert, weil Theo es wollte. Schon in der Schule schlief Theo regelmäßig im Fremdsprachenunterricht ein. Ein Lateinlehrer fragte Theo sogar, ob er an Narkolepsie leide. Dass sie trotzdem dasselbe studieren würden, hat keiner von ihnen je infrage gestellt. Warum also nicht Hydrologie in Hamburg. Zunächst teilten sie sich die akademische Arbeit. Theo recherchierte, Arthur schrieb. Aber nach zwei, drei Jahren gingen sie immer seltener zu den Vorlesungen. Ohne dass sie groß darüber gesprochen hätten. Das Tauchen war erst nur ein Zusatzangebot im Rahmen einer praktischen Übung, aber zumindest Arthur hatte dafür mehr Talent als für die Hydrologie. Sie wurden Mitglieder in einem Tauchverein und gingen immer zu zweit auf Tauchgang. Theo wäre wohl ein guter Hydrologe geworden, aber letztlich tauchte er lieber. Irgendwann hatte Arthur keine Lust mehr, die Hausarbeiten zu schreiben, zumal Theo die Vorarbeit auch nur noch sehr halbherzig erledigte.
Irgendwann entdeckten sie auf dem digitalen Schwarzen Brett des Fachbereichs Umwelthydrologie eine Ausschreibung, in der nach Studierenden mit Tauchschein gesucht wurde, für die Arbeit am »Hydrologischen Atlas der Eidgenössischen Schweiz«. Arthur fand die Anzeige unwiderstehlich, weil darin dieser Atlas die ganze Zeit mit H.A.D.E.S. abgekürzt wurde.
Also wechselten sie von Hamburg nach Basel. Sie belegten der Form halber ein paar Seminare an der Uni und arbeiteten frei für den H.A.D.E.S., wo sie aber auch wenig Kontakt zu Mitarbeitenden hatten. Ab und zu plauderten sie mit der alleinstehenden Sekretärin Frau Schmid, die, laut eigener Aussage, eine Schwäche hatte für Zwillinge mit guten Manieren. Doch außer ihr hat sich nie jemand nach ihnen erkundigt oder gar gefragt, wann sie ihre Uni-Abschlüsse machen wollten, nicht einmal ihre Eltern. Letztere waren der Meinung, dass man ab einundzwanzig für sich selbst sorgen müsse.
Arthur besucht seine Mutter ab und zu. Sie ist Hebamme, macht aber nur Nachtdienste, immer schon. Tagsüber schläft sie. Wenn Arthur kommt, steht sie auf, kocht Nudeln mit Tomatensoße, weil sie glaubt, dass sei Theos und sein Lieblingsessen gewesen, was nicht stimmt, und dann trinkt sie zwei Gläser Ouzo und weint. Ihre Augenringe werden von Jahr zu Jahr dunkler. Arthur hat das Gefühl, dass es ihr besser geht, wenn er nicht zu Besuch kommt.
Mit seinem Vater telefoniert er selten. Die meiste Zeit reden sie über Fußball, wofür sich Arthur nicht interessiert. Der Vater war eine Zeit lang mit Karin verheiratet, die Theo und ihn öfter nach Hause zum Kaffee einlud. Sie servierte ihnen jedes Mal einen kleinen Marmorkuchen von Bahlsen, von dem sie behauptete, sie habe ihn selbst gebacken. Die glänzende Plastikhülle ließ sie aber immer offen in der Küche liegen. Theo und er lobten den Kuchen, denn er schmeckte ihnen wirklich ganz gut. Nach ein paar Jahren war Karin wieder weg. Warum genau, darüber hat sein Vater nicht gesprochen. Sie hätten sich auseinandergelebt, sagte er bloß, was aber Quatsch war, denn dafür musste man sich erst einmal zusammengelebt haben.
Den Bahlsen-Marmorkuchen haben sich Theo und er aber hin und wieder selbst gekauft, und dann hat immer einer von ihnen gesagt, den habe ich selbst gebacken. Und der andere hat begeistert das Rezept verlangt, während der eine versuchte, die glänzende Hülle verschwinden zu lassen. Einmal hat Theo sich die Verpackung langsam mit einer Hand in den Mund gestopft, während er die andere Hand vor seinen Mund hielt und über die Wichtigkeit des Geheimhaltens alter Familienrezepte sprach. Arthur hat zum Schluss nichts mehr verstanden, aber Theo hat so getan, als sei nichts, und hat mit ernster Miene weitergeredet, bis ihm die Spucke aus den Mundwinkeln troff. Als Arthur daraufhin vor Lachen nach hinten kippte, musste Theo schließlich auch lachen, und die angesabberte Plastikhülle fiel auf den Tisch. Nanu!, hat Theo empört ausgerufen, während er seine Spucke zurückschlürfte, wo kommt denn das jetzt her? Immer wenn Arthur daran denkt, entfährt ihm ein komischer Laut aus der Nase, etwas zwischen Schnauben und Grunzen, Schluchzen und Schlucken. Wirklich jedes Mal.
Luzie
Die Stille geht ihr auf die Nerven. Was, wenn sie jetzt laut brüllt? Oder wenigstens geht. Aber sie hat es ihrer Großmutter versprochen. Sie merkt, wie ihr das Gebrüll den Bauch hochquillt, zum Mund hindrängt wie beim Erbrechen. Aber dann schluckt sie doch alles wieder runter und hält die Klappe. Gelernt ist gelernt.
Sie begleitet ihre Großmutter zum Konzert. Was heißt Konzert. Es sind die Stillen Wasser aus dem Heim, und alle spielen Luftinstrumente. Also nicht Blasinstrumente, sondern Luft wie in Luftgitarre. Sie haben schwarze feine Sachen an, Notenständer vor den Stühlen, klappen ihre Instrumentenkoffer auf, und darin ist nichts. Luft. Sie tun so, als nähmen sie ihre Instrumente heraus, schließen sogar die Augen dabei, um sich zu sammeln. Ein paar Streicher drehen zum Stimmen an den unsichtbaren Schrauben. Die meisten aber nehmen nur ihr Luftinstrument in die Hand, legen es sich an den Hals, klemmen es sich zwischen die Knie oder heben es kurz an den Mund. Alle führen ihre Handgriffe mit einer sparsamen Eleganz aus, die trotz gichtiger Hände, steifer Wirbelsäulen und zittriger Kinne von jahrzehntelanger Übung spricht.
Luzie spürt die Konzentration der schwarz gekleideten Ensemble-Mitglieder. Nur zwei oder vielleicht drei Typen spielen da mit. Bei dem einen ist sie sich nicht ganz sicher. Männer, die im Alter ihre Haare nicht verlieren, sehen jedes Jahr mehr aus wie Frauen. Warum müssen die Frauen ausgerechnet Mitglieder sein? Warum sind die paar Männer da nicht Mitmuschis?
Alle sind alt.
Einige flüstern miteinander, schieben sich die Notenständer und Stühle zurecht, knöpfen sich die Jacke auf oder sichern die Haarklammern. Noch bevor es richtig angefangen hat, ist in der Reihe hinter ihr schon ein Zuschauer eingeschlafen. Sie kann hören, wie er durch den offenen Mund einatmet und ausatmet. Sie dreht sich nicht um, aber sie kann seinen Atem riechen.
Als der Dirigent hereinkommt, wedeln die Streicherinnen mit ihren Luftbögen, es sieht aus, als würden sie alle auf einmal vom selben Tremor geschüttelt. Im Saal wird schwach geklatscht, eine Art Rascheln. Jemand ruft mit quengeliger Stimme, was ist denn nun schon wieder! Offenbar ist der eine hinter ihr aufgewacht. Sie möchte lachen, aber ihre Großmutter schaut sie an und hebt die Augenbrauen. Ob warnend oder belustigt, kann Luzie nicht sagen. Vielleicht weiß es ihre Großmutter selbst nicht. Luzie beißt sich auf die Innenseiten der Wangen und lacht nicht.
Sie ist trotzdem froh, hier zu sein. Ihre Mutter ist zu anstrengend. Sie bricht in Tränen aus, sobald sie Luzie sieht, und ruft, was das für eine Verschwendung sei und dass sie als Mutter versagt habe. Und obwohl sie immerzu ausruft, warum, warum!, will sie die Gründe für Luzies Entscheidung anscheinend gar nicht wirklich wissen. Nach wenigen Sätzen springt sie auf und rennt heulend raus. Luzie zeichnet auf die Rückseite des Programmzettels eine flache Teletubby-Landschaft, in der kleine Vulkane explodieren. Über jedem Vulkan steht in Großbuchstaben WWWARRRUMMMM, während kleine, fette Wolken von den Kratern aufsteigen.
Ihre Großmutter fragt nicht, warum sie nicht mehr in die Schule geht, doch Luzie spürt, dass Margrits Schweigen nicht mehr lange anhält. Bald wird sie versuchen, sie umzustimmen. Luzie kann fühlen, wie Margrit Kraft sammelt für ein Gespräch. Das mit der Schule ist aber entschieden, sie ist achtzehn.
Die Stücke auf dem Programm heißen »Air« oder »Silentium Maximum« oder »Mutette«. Also nicht Motette, sondern Mu, wie mute. Da hat sich aber einer richtig was bei gedacht.
Es riecht nach altem Kleiderschrank, und still ist es überhaupt nicht. Eine Dame räuspert sich ununterbrochen sehr laut. Ein Mann zieht Schleim von der Nase in den Rachen und schluckt ihn glucksend hinunter, Geräusche von Menschen, die sich nicht mehr hören. Oder denen es scheißegal ist, wenn andere sie hören. Oder die unbedingt wollen, dass jemand sie hört. Oder eine Mischung aus allem. Eine andere fragt ihre Nachbarin, wann denn Abendbrotzeit sei. Luzie schaut ihre Großmutter an, um zu sehen, ob sie das auch komisch findet. Doch Margrit hat die Brauen zusammengezogen und starrt auf den Dirigenten. Sein oberer Rücken ist so stark gekrümmt, dass er den Kopf in den Nacken legen muss, um das Orchester zu sehen. Aber meistens hält er den Kopf gesenkt und rollt sich ein. Luzie muss an einen Nautilus denken. Waagerecht schnellen seine langen, dünnen Arme aus ihm heraus. Sie würde das gern ihrer Großmutter zuflüstern, doch die ist mit ihren Gedanken immer noch ganz woanders. Vielleicht stellt sie sich ja gerade die herrlichste Musik vor.
Das letzte Stück heißt »Tacet I und III aus 4’33« und ist von John Cage. Und jetzt tun die nicht einmal mehr so, als würden sie spielen, sondern lassen die Hände gleich im Schoß. Wahrscheinlich sind sie müde vom ewigen Sitzen. Die Insassen. Eine der Zuschauerinnen vorne aus der Rollstuhlreihe ruft ganz laut: Kann ich jetzt gehen? Kann ich jetzt endlich gehen? Hallo! Halloooo! Niemand antwortet ihr.
Schließlich macht der Dirigent eine kleine Bewegung mit dem Handgelenk, woraufhin die Musikerinnen und Musiker ausatmen, sich zurücklehnen und lächelnd in die gut besetzten Stuhlreihen schauen. Wieder dieser vereinzelte Applaus (nur wofür?), und die Vorstellung ist zu Ende. Die Frau aus der ersten Reihe ruft immer noch hallo, obwohl eine Pflegerin ihren Rollstuhl schon Richtung Aufzug schiebt. Die Pflegerin hat ein Tattoo. Ein blaugelber Papagei, der über ihren ganzen Unterarm geht, keine schlechte Arbeit.
Als Luzie sich vom Sitz erhebt und umdreht, sieht sie ein paar Reihen hinter ihnen Margrits Fahrer. Sein Blick streift sie ohne ein Zeichen des Erkennens. Streng genommen kennt er sie ja auch nicht. Trotzdem kann man davon ausgehen, dass er mindestens so viel über sie weiß, wie sie über ihn, also könnte er wenigstens nicken. Als Luzie sich wieder Margrit zuwenden will, ist diese schon mit ihrer Gehhilfe nach vorne gerollt und drängt aus dem Saal. Luzie eilt ihr nach.
– Da war auch dein Freund, der unhöfliche Fahrer, sagt sie, als sie sie schließlich eingeholt hat. Aber Margrit hört nicht, also wiederholt sie es noch einmal lauter.
– Und da ist die höfliche Enkelin, sagt eine Stimme hinter ihr, kühl, smooth, und Luzie muss sich nicht einmal umsehen, um zu wissen, dass sie dem Fahrer gehört. Sie möchte dringend raus aus diesem stickigen Raum. Der Fahrer spricht weiter, aber nicht mehr zu ihr, denn seine Stimme klingt jetzt viel netter.
– Oh, Margrit, Ihr Rollator ist ja gar nicht richtig aufgeklappt. Warten Sie mal kurz.
Er bückt sich und schüttelt Margrits Rollator auseinander. Das hätte Luzie auch machen können. Es ist eindeutig viel zu heiß hier drinnen, ihr Kopf glüht. Er spricht das Wort Rollator nicht ganz richtig aus. Angeblich ist er doch so ein Sprachengenie.
– Arthur, das ist meine Enkelin!
Es versetzt ihr einen Stich, dass ihre Großmutter so selig aussieht, während sie das sagt. Kein Grund, stolz zu sein. Sie dreht sich zu ihm und sagt guten Abend, so ironisch sie kann. Doch er hat sich schon abgewandt, weil ihn von hinten ein kleiner Mann am Ellbogen packt und zu sich herumdreht.
Der Fahrer sagt, guten Abend, Gregor, und der alte Mann lächelt erfreut und macht Anstalten, dem Fahrer auf die Schulter zu klopfen. Doch er kommt nicht ganz bis hinauf und haut dem Fahrer stattdessen nur ein paar Mal kräftig auf den Arm.
– Das war mal wieder wundervoll. Cornelius Fischer hat sich selbst übertroffen. John Cage! Nie zuvor habe ich ihn so virtuos gehört wie heute.
Der Mann lacht in sich hinein, er hat längliche braune Augen, seine Brauen sind schwarz, trotz der weißen Stoppelhaarfrisur. Mit einem letzten klatschenden Hieb auf den Arm des Fahrers dreht sich der Alte zu der Pflegerin mit dem Papagei und sagt, Justyna, Sie sehen heute wieder ganz bezaubernd aus, und dann hat er einen Hustenanfall.
Währenddessen ist ihr Margrit schon wieder entwischt. Luzie blickt suchend über die Köpfe der Konzertbesucher. Da ist sie: Ihre kinnlangen weißen Haare, silbrige Seidentunika und hellgraue Leinenhose schimmern zwischen den hinausdrängenden Zuhörern hindurch. Der Mann mit den schwarzen Augenbrauen, also Gregor, nickt und beugt sich hinüber zu Luzie:
– Ihre Großmutter gleicht einer Königin. Einer Feenkönigin. Oder halt, wie heißen diese weißhaarigen Leute noch? Ich meine, in diesem Buch? Na, mir fällt es nicht ein. Es ist grün und hat sehr lange Kampfszenen.
– Die Elben?
– Elben, danke. Ob mir das noch eingefallen wäre? Elben, genau. Das passt. Die Elbe ist ja gleich hinterm Haus. Ha!
Dicht hinter ihr murmelt der weirde Fahrer seltsame Laute: rîn glân a celebren, dabei rollt er das r, es ist unsagbar peinlich. Luzie tut so, als hätte sie nichts gehört, das ist das Netteste, was sie machen kann. Der Typ redet in einer Fantasiesprache. Er tut ihr leid. Jetzt fällt es ihr viel leichter, freundlich zu sein. Sie dreht sich um und verzieht ihren Mund zu einem Lächeln, das sich gütig anfühlt, gütig und warm.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: