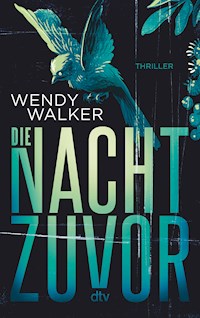12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was geschah wirklich mit Molly Clarke? Ein heftiger Sturm und ein leeres Auto irgendwo am Straßenrand. Ein Brief, der in einem Hotel in der Nähe zurückgelassen wird. Eine zerbrochene Familie, die nicht mehr zusammenfand. Alles zusammen scheint einen klaren Fall zu ergeben: Molly Clarke hat ihre Familie verlassen, um irgendwo ein neues Leben zu beginnen. So sieht es jedenfalls die Polizei. Doch zwei Wochen nach Mollys Verschwinden erhält ihre 21-jährige Tochter Nic eine Nachricht, die alles verändert. Sie hat ein angespanntes Verhältnis zu ihrer Mutter, aber nun ist sie die Einzige, die wirklich nach Molly sucht. Und je näher Nic der Wahrheit kommt, desto größer wird die Gefahr, in der sie selbst schwebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wendy Walker
Herzschlag der Angst
Thriller
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
1
Tag eins
Der Himmel wird dunkel, während ich fahre.
Ich befehle mir, mich zu konzentrieren. Nur auf die schwarze Asphaltstraße und die doppelte gelbe Linie in der Mitte zu schauen.
Es ist, als befände ich mich in einem Tunnel, herausgeschlagen aus den braunen Maisfeldern, die sich rechts und links der Straße ins Unendliche erstrecken. Dunkelheit umgibt mich. Sie ist überall.
Ich höre, wie die Frau im Radio vom Sturm spricht, aber meine Gedanken an die Ereignisse dieses schrecklichen Tages überlagern ihre Stimme.
Auf diesem Abschnitt der Route 7 reiht sich eine neuenglische Kleinstadt an die andere – nicht die reizenden Dörfer, die man weiter südlich findet, sondern ehemalige Industriezentren, die nun verfallen.
Unbestelltes Ackerland, heruntergekommene Häuser, leer stehende Fabriken ragen wie Grabsteine empor. Ich frage mich, wo hier Menschen leben. Wo sie einkaufen. Wo sie arbeiten und essen gehen. Warum sie noch hier sind.
Ich ziehe die Schultern hoch und drücke den Rücken durch, weil ich mich so unbehaglich fühle. Es ist jedes Mal das Gleiche. Diese Städte verfolgen mich bis spät in die Nacht.
In der Ferne taucht ein Tankstellenschild auf. Eine Gas ’n’ Go. Sie liegt an der Kreuzung der Route 7 und einer gespenstischen Straße, die ins Zentrum einer dieser Kleinstädte führt. Ich bin noch nie dort abgebogen und werde es auch nie tun. Alle Reisenden, die vom südlichen Connecticut ins westliche Massachusetts fahren, scheinen genau hier tanken zu müssen. In der Umgebung dürfte es ein halbes Dutzend Internate und kleine Colleges geben, die man von der Route 7 aus erreicht. Manchmal erkenne ich Autos oder Gesichter wieder, wenn ich hier anhalte.
Und heute muss ich anhalten. Die Tankanzeige bedeutet mir, dass ich kaum noch Benzin habe.
Von der Gas ’n’ Go aus brauche ich noch zwei Stunden, bis ich ganz im Süden des Bundesstaates bin, wo ich wohne. Das grüne Willkommensschild liegt schon hinter mir. Willkommen in Connecticut.
Ich werde um kurz nach neun zu Hause ankommen. Mein Ehemann John wird im Fitnessstudio sein. Oder bei der Arbeit. Mit einem Freund in der Kneipe. Meine Tochter Nicole ist sicher auch irgendwo unterwegs. Irgendwo weit weg von mir. Sie ist gerade einundzwanzig geworden, ihr stehen alle Möglichkeiten offen. Möglichkeiten, die mich nachts wach halten, während ich auf die Uhr sehe. Auf die Tür horche.
Die Hunde werden bellen und an meinem Mantel hochspringen. Sie wollen etwas zu fressen. Die Zuneigung sparen sie sich für meinen Mann auf. Er hat sie angeschafft, nachdem Annie gestorben war, also sind es eher seine Hunde als meine.
Das Haus wird nach Reinigungsmittel und Trocknertüchern mit Lavendel riechen, weil heute Donnerstag ist, und am Donnerstag kommt der Putzdienst. Ich frage mich, ob sie daran gedacht haben, die Asche aus dem Kamin in unserem Schlafzimmer zu fegen. Es ist Ende Oktober und kalt genug für ein Kaminfeuer. John schaut gerne im Bett fern, während das Feuer knistert. Wie gestern Abend. Er schlief schon, als ich nach oben kam, wobei mir gerade einfällt, dass ein frisches Holzscheit aufgelegt war. Die Schlussfolgerung daraus kommt umgehend, und ich drücke die Hand auf meinen Mund.
Bin ich zu sensibel? Bin ich einfach zu sehr ich, zu Molly? Ich höre diese Gedanken mit Johns Stimme. Sei nicht so Molly. Er gebraucht meinen Namen jetzt als abwertendes Adjektiv. Aber nein – ich irre mich nicht, es lag ein Scheit auf dem Feuer. Also hatte er sich schlafend gestellt.
Der Tag heute geht mir nicht aus dem Kopf.
Mein Sohn Evan besucht ein Internat hier in der Gegend. In der neunten Klasse wurde er ins Footballteam aufgenommen. Jetzt ist er in der elften und fängt in dieser Saison als Lineman an. Jeden zweiten Donnerstag fahre ich diese Strecke, um mir seine Heimspiele anzusehen. Die Saison ist zur Hälfte vorbei, sie sind Tabellenführer. Sie können dieses Jahr sogar Meister werden.
Für die Hin- und Rückfahrt brauche ich jeweils vier Stunden. John hält mich für verrückt, weil ich das zweimal im Monat mache. Er sagt, Evan sei es ohnehin egal. Nicole drückt es brutaler aus. Sie sagt, Evan wolle mich gar nicht dort haben. Dass ich ihm peinlich sei. Dass er kein kleiner Junge mehr sei und keine Mommy dabeihaben muss, die ihm zuschaut.
Sie hat recht, er hat sich verändert. Er weiß um die Macht, die er auf dem Spielfeld besitzt. Ich habe es heute zum ersten Mal bemerkt. Etwas in seiner Haltung, seinem Gang. In seinen Augen.
Und in seiner kalten Härte. Ich frage mich, seit wann sie da ist. Ob sie neu ist. Oder nur neu für mich.
Ich hatte am Eingang zum Umkleidetrakt gewartet. Wie in Zeitlupe lasse ich die schmerzliche Szene noch einmal vor mir ablaufen.
Wie er mit seinen Freunden auf das Gebäude zukam, die riesige Tasche über der Schulter, die hohen Turnschuhe mit den offenen Schnürsenkeln, die Baseballkappe nach hinten gedreht, ein verstohlenes Grinsen, weil sie vermutlich über ein Mädchen redeten.
In diesem Moment, bevor er mich entdeckte und sein Gesicht sich veränderte, war ich sehr stolz auf ihn.
Mein Junge, mein süßer Evan, das pflegeleichte mittlere Kind, bewegte sich, als gehörte ihm die ganze Welt. Ein Lächeln breitete sich auf meinem Gesicht aus, während ich darauf wartete, dass er mich an der Tür stehen sah.
Dann bemerkte er mich.
Seine Augen wurden groß, und er schaute weg. Er kam näher, doch sein Blick kehrte nicht zu mir zurück. Er schob sich zwischen zwei seiner Freunde und betrat das Gebäude, ließ mich stehen.
Erst jetzt, hundertachtundsiebzig Kilometer später, spüre ich den Schmerz, den seine Geringschätzung verursacht hat.
Mein Blick verschwimmt. Ich wische die Tränen weg. Herrgott, höre ich John sagen. Sei nicht so Molly!Er ist ein Teenager.
Doch die Gedanken bleiben, der Anblick seines Rückens, als er den Flur entlangging.
Ich schaue zu den Wolken empor. Dieser Sturm ist ein Hurrikan. Ich fahre mitten hinein.
Auch das war ein Grund, weshalb John mir von der Fahrt abgeraten hatte. Die Schule könnte das Spiel wegen des Sturms absagen, und selbst wenn nicht, wäre ich ihm auf dem Rückweg ausgesetzt.
Der Sturm. Dass Evan mich nicht wollte.
Und Annie. Er hatte ihren Namen nicht ausgesprochen, doch er stand zwischen uns.
Heute ist ihr Todestag. Heute vor fünf Jahren haben wir unser jüngstes Kind verloren. Sie war neun Jahre alt.
Nein. Ich will nicht an Annie denken. Ich will nicht zurückgehen. Ich will vorwärtsgehen.
Einen Fuß vor den anderen setzen.
Das habe ich in der Trauerberatung gelernt. Und ich habe früher an der Mittelschule Naturwissenschaften unterrichtet. Ich weiß, dass man Probleme analysiert, indem man sie in ihre Bestandteile zerlegt und Hypothesen aufstellt. Genauso bin ich mit der Trauer umgegangen. Objektiv. Klinisch. Wir sind nicht dafür geschaffen, den Tod eines Kindes mitanzusehen. Ihn zu ertragen. Ihn zu überleben. Trotzdem berufen wir uns, wie bei jedem anderen menschlichen Defekt, auch in diesem Fall auf die Wissenschaft, um unsere eigene Biologie zu überlisten. Wir können ein Gehirn, das entzweigerissen ist, mit solchen Mantras wieder zusammenfügen. Mantras, die in klinischen Versuchen getestet wurden. Die von Fachkollegen geprüft und in TED-Talks vorgestellt und in Selbsthilferatgebern empfohlen werden.
Du setzt einfach einen Fuß vor den anderen, Molly. Jeden Tag nur einen Schritt mehr.
Hätte ich nicht noch weitere Kinder, um die ich mich kümmern musste, hätte ich diese Schritte niemals tun können. Ich wäre gestorben. Hätte mich sterben lassen. Einen Weg gefunden, um zu sterben. Diesen Schmerz konnte man nicht überleben. Und dennoch habe ich überlebt.
Vorwärts.
Doch der Tag entrollt sich weiter, zurück zum heutigen Morgen.
Nicole war gerade von einer ihrer Nächte zurückgekommen. Ich wusste nicht, wo sie geschlafen hatte. Ihre Haut ist blass, ihre Haare sind lang und widerspenstig. Sie ist vom Laufen schlank geworden. Sie läuft und läuft, bis sie von Kopf bis Fuß empfindungslos ist. Innen und außen. Danach schläft sie den ganzen Tag. Bleibt wieder die ganze Nacht weg. Sie ist eine schlanke, wilde, aufsässige Kriegerin. Aber noch immer voller Schmerz.
Wo bist du die ganze Nacht gewesen?, hatte ich gefragt. Es folgte der übliche Dialog. Es gehe mich nichts an … aber es geht mich sehr wohl etwas an, weil sie in meinem Haus lebt, und was war eigentlich mit ihrer Zulassungsprüfung zum College und dem Versuch, sich selbst aus diesem Loch zu befreien … Ich sei schuld, dass sie in dem Loch steckt, wegen Annie, der Trauer und weil nicht jeder einfach darüber hinwegkommt … aber wann wird sie endlich aufhören, den Tod ihrer Schwester als Entschuldigung dafür zu benutzen, dass sie in der Abschlussklasse von der Privatschule geflogen ist, ihre Collegezulassung verloren hat und seither in keine Schule gegangen ist?
Sie hatte mit den Schultern gezuckt und mir geradewegs in die Augen gesehen. Wann war sie so geworden? Bereit, jeden abzuwehren, der ihr zu nahe kommt.
Was ist denn mit dir? Wann gehst du wieder arbeiten?, hatte sie gefragt.
Sie erinnert mich gern daran, dass auch ich aufgehört habe zu leben – ich atme, das schon, aber ich lebe nicht mehr richtig.
Heute Morgen hatte ich keine Antwort für meine Tochter. Heute Nachmittag hatte ich keine Antwort für meinen Sohn.
Ich habe Evan nach dem Spiel nicht mehr gesehen. Ich hatte wieder vor dem Gebäude gewartet, doch er musste einen anderen Ausgang genommen haben. Beinahe wäre ich in den Umkleideraum marschiert, um ihm zu sagen, wie ich über sein Verhalten denke. Um zu tun, was eine Mutter eben tut, wenn sie weiß, dass sie recht hat und ihrem Kind eine Lektion erteilen muss.
Das Tankstellenschild ist jetzt ganz nah. Die Wolken färben sich immer dunkler, genau wie meine Gedanken. Ich bin nicht zu ihm gegangen. Ich habe nicht getan, was eine Mutter hätte tun sollen. Eine gute Mutter.
Plötzlich weiß ich auch, warum.
Der Wagen wird langsamer. Ich gebe Gas, aber er reagiert nicht.
Ich bin keine gute Mutter.
Ich kann sie nicht länger zurückhalten, die Gedanken an mein totes Kind. An Annie. Nicht dass sie mich je wirklich loslassen. Sie lauern überall, verbergen sich, verkleiden sich, damit ich sie nicht heranschleichen sehe.
Ich fahre an den Straßenrand. Das Lenkrad ist eingerastet. Der Motor ist tot. Als der Wagen stehen bleibt, drehe ich den Zündschlüssel, aber es rührt sich nichts.
Dann sehe ich die Warnleuchte am Armaturenbrett. Ich habe kein Benzin mehr. Ich habe nicht aufgepasst, war mit meinen Gedanken weit weg. John hatte recht, ich hätte nicht fahren sollen. Nicht heute.
Vor mir liegt die Einfahrt zur Tankstelle. Es sind höchstens zehn Meter bis dahin. Der Wind peitscht, rüttelt am Wagen. Mit einer weiteren Armee von Wolken zieht der Regen herauf. Ich kann nicht erkennen, wie weit die Wolkendecke entfernt ist. Wie viel Zeit mir bleibt.
Ich habe keinen Regenschirm dabei, nur eine dünne Jacke. Ich ziehe sie trotzdem an. Ich greife nach meiner Handtasche und schiebe sie unter die Jacke.
Ich mache die Tür auf, steige aus, schließe sie. Dann renne ich, die Handtasche an mich gedrückt. Ich renne gegen den Wind, der mächtiger ist als erwartet.
Erinnerungen an den Streit mit Nicole blitzen auf, als mein Körper sich gegen den Wind stemmt. Wir streiten jeden Tag.
Mach die Augen auf!
Die Auseinandersetzung war so kurz und heftig gewesen, dass ich nicht jedes Wort registriert hatte. Jetzt fällt mir alles wieder ein.
Sie sind offen. Ich sehe dich klar und deutlich, Nicole.
Es geht nicht um mich. Es geht um deinen Mann!
Sie hat recht. Ich sehe nicht, was vor meinen Augen passiert. Er kommt nie zum Abendessen nach Hause. Er stellt sich schlafend, wenn ich das Schlafzimmer betrete.
Mein Mann liebt mich nicht mehr. Mein Mann liebt eine andere.
Der Gedanke fühlt sich alt an, wie ein kantiger Stein, den ich schon lange in der Manteltasche trage und glatt zu reiben versuche. Doch egal wie fest ich meine Finger daraufdrücke, es gelingt mir nicht.
Und dann diese Worte. Sie hatten immer in der Luft gelegen. Als ich sie von meiner eigenen Tochter hörte, drehte sich ein Messer in meinen Eingeweiden herum.
Ich hasse dich!
Ich weine, während ich renne.
Annie. Feine blonde Haare auf zarten Schultern. Große runde Augen und lange Wimpern. Ich spüre sie noch in meinen Armen. Ihr Leben hatte gerade erst angefangen. Annie.
Annie!
Nein, ich bin keine gute Mutter. Denn ich bin nicht vier Stunden zum Footballspiel meines Sohnes gefahren, damit er sich geliebt fühlt. Ich bin vier Stunden gefahren, damit ich mich geliebt fühle.
Evan war alles, was mir geblieben war. Ich musste sein Gesicht sehen, wie er aufblühte, damit mein Leben etwas wert war.
Vielleicht hatte Evan es gespürt. Ein Kind sollte kein Bedürfnis erfüllen müssen.
Keuchender Atem. Der Wind ist stark und die Luft kalt. Meine Lungen brennen.
Ja, ich bin eine schlechte Mutter.
Ich habe ein Kind sterben lassen.
Ich bin jetzt an der Einfahrt zur Tankstelle. Keine Autos. Im Laden brennt kein Licht. Vor den Zapfsäulen stehen orangefarbene Hütchen.
Plötzlich kommt der Regen. Die Wolkendecke wird zum gebrochenen Damm. Es ist jetzt stockdunkel, aber ich erkenne die Schrift auf dem Pappschild. Wegen Sturm geschlossen!
Ich bleibe stehen und lasse den Regen über mich strömen, während ich auf die Worte starre.
Evan, Nicole, John. Ich bin eine Last für sie, weil sie mich nicht lieben. Weil sie mich nicht lieben können.
Genau heute vor fünf Jahren haben sie damit aufgehört.
Fünf Jahre, seit Annie gestorben ist.
Fünf Jahre, seit sie auf die Straße gelaufen ist.
Fünf Jahre, seit ich sie mit dem Wagen angefahren habe. Seit ich sie getötet habe.
Tränen, Regen, Wind. Ich gehe ein paar Schritte zur Kreuzung, zur Straße namens Hastings Pass, die in eine dieser Städte führt. Nichts als verdrecktes Pflaster, das sich über Hügel wellt, und vertrocknete Maispflanzen auf endlosen Feldern. Kein Auto in Sicht.
Es ist ein Hurrikan der Stufe vier. Das haben sie im Radio gesagt. Ich erinnere mich jetzt an die Stimmen. Ich erinnere mich an den Namen der Stadt. Hastings. Ich bin mitten ins Auge des Sturms gefahren. Ich höre das Mantra in meinem Kopf. Gib nicht auf. Meine Schuld ist wie ein schwerer Stein, den ich über dem Kopf halte. Ich habe mich so sehr bemüht, ihn nicht fallen zu lassen. Doch vielleicht ist es jetzt so weit. Vielleicht kann ich ihn endlich fallen lassen.
Vielleicht kann ich einfach fortgehen.
Bei dem Gedanken werde ich plötzlich euphorisch.
Geh fort. Geh einfach fort.
Die elende Straße erscheint mir plötzlich wunderschön. Eine Oase. Ein Fluchtweg. Meine Beine bewegen sich, ziehen meinen Körper mit. Ich bin wie in Trance. Betäubt von den Worten und dem, was sie mir versprechen.
Du kannst all das hinter dir lassen.
Du kannst neu anfangen.
Du kannst den Stein weglegen, die Last, die du trägst.
Ich gehe die Straße entlang, bis ich Teil des Sturms geworden bin. Die Nässe nicht mehr spüre. Die Kälte nicht mehr spüre. Die Wahrheit hinter den Versprechen nicht mehr spüre. Zum ersten Mal, seit ich mein Kind getötet habe, empfinde ich Frieden.
Lasst mich bitte gehen. Lasst mich fortgehen. Ich spüre die Worte im Kopf wie ein Gebet.
Bitte, flüstern sie. Sucht nicht nach mir.
Ich weiß nicht, wie lange oder wie weit ich schon gegangen bin, als ein Licht von hinten auftaucht. Ich drehe mich um und sehe Scheinwerfer, die langsam auf mich zukommen. Es muss so etwas wie ein Lastwagen sein. Und trotz der Trance, in der ich mich befinde, und des Friedens, den sie mir gebracht hat, hebe ich die Arme über den Kopf und winke wild, die Handtasche fest umklammert.
Der Wagen bleibt vor mir stehen.
Ich trete heran, bis ich neben dem Beifahrerfenster stehe. Drinnen sitzen zwei Leute.
Ich lege die Hand über die Augen, um sie vor dem Regen zu schützen. Beuge mich vor und sehe, wie das Fenster einen Spaltbreit aufgeht.
»Der Sturm zieht auf – Sie sollten nicht hier draußen sein.« Eine Männerstimme. Freundlich. Aber auch drängend. »Sollen wir Sie mit in die Stadt nehmen?«
Eine andere Stimme aus dem Wagen. Das Fenster geht noch weiter auf.
Die Stimme eines kleinen Mädchens. Das Gesicht eines Engels.
»Und? Wollen Sie oder nicht?«, fragt sie.
Ich starre sie an, ihre blonden Haare und hellen Augen, und an ihr vorbei zu dem Mann.
Ich starre das kleine Mädchen an und sehe, Gott steh mir bei, für einen Sekundenbruchteil mein totes Kind.
Und dann erkenne ich, was diese Straße wirklich ist. Eine Fata Morgana. Eine Illusion. Und die Worte, die meine Beine dazu bewogen haben, mich aus meinem Leben wegzutragen – sind Lügen. Ihre Versprechungen nicht mehr als eine billige Täuschung.
Die Schuld wird mich nie verlassen. Ich werde meine Familie nie verlassen.
»Ja.«
Das Beifahrerfenster schließt sich, das Mädchen verschwindet. Die Türverriegelung öffnet sich mit einem Klick. Ich taste nach dem Griff der hinteren Tür, will verzweifelt aus dem Regen fliehen. Will verzweifelt zu meiner Familie zurück. Will vergessen, was ich beinahe getan hätte. Der Sturm hätte mich töten können. Der Wind und die Kälte. Dann würden sie sich schuldig fühlen. John, Nicole, Evan. Wie konnte ich so selbstsüchtig sein, nach allem, was ich ihnen angetan habe? Ich darf nie wieder daran denken.
Ich steige ein, schließe die Tür. Erleichterung ringt mit Verzweiflung.
Und bevor ich mir den Regen aus den Augen wischen und sehen kann, wen ich vor mir habe, klickt es wieder.
Ich bin eingeschlossen.
2
Tag dreizehn
Das Telefon klingelte. Verstummte. Klingelte erneut.
Nicole Clarke wachte auf, spürte einen Körper neben sich. Er rührte sich nicht.
Das Klingeln war laut. Das Tageslicht grell, selbst durch geschlossene Augen. Reue überkam sie, während sie nach der Geräuschquelle tastete.
Sie hielt das Handy ans Ohr, die Augen fest zugekniffen, rückte näher an die Bettkante, damit sie den Fremden, den sie mitgebracht hatte, nicht länger berühren musste.
Sie schaffte ein Hallo. Ihre Stimme klang rau.
»Nicole Clarke?«, fragte eine Frau. Sie klang nervös. »Ich rufe wegen der Frau an, die in Hastings verschwunden ist.«
Der Name der Stadt. Adrenalin. Übelkeit. Nic antwortete nicht.
Dann blitzten Bilder von gestern Abend auf.
Wodka-Shots … der Mann am Ende der Theke … jetzt hier in ihrem Bett.
In den frühen Morgenstunden hatte sie gesagt, er solle gehen. Vielleicht war sie auch eingeschlafen, bevor sie die Worte herausbrachte.
Die Frau sprach weiter. »Ich heiße Edith Moore. Ich hoffe, ich tue das Richtige, aber vielleicht … vielleicht weiß ich etwas über diese Frau – Ihre Mutter, richtig?«
Der Mann stöhnte, legte einen schweren Arm über ihre Brust. Nic schob ihn beiseite.
Letzte Nacht hatte er sie gar nicht fest genug halten können. Jetzt hatte sie genug von ihm. Es war immer das Gleiche.
Sie drehte sich auf die Seite und zog die Knie an den Bauch. »Augenblick«, sagte sie und wartete, dass sich die Übelkeit legte.
Die Anrufe wegen ihrer Mutter waren weniger geworden. Die meisten Verrückten hatten andere Wege gefunden, um ihr Aufmerksamkeitsbedürfnis zu stillen. Die Psychologin hatte ihnen erklärt, weshalb Leute sich von solchen Geschichten angezogen fühlten, vom Kummer anderer Menschen, und weshalb sie sich einmischten, selbst wenn sie mit ihren Lügen die Suche nach der Wahrheit behinderten. Mit ihren erfundenen Geschichten. Mit ihrem Bullshit.
Dann war da natürlich noch die Belohnung. Eine Million Dollar für die sichere Rückkehr ihrer Mutter. Fünfhunderttausend für Hinweise, die zur Aufklärung ihres »Verbleibs« führten. Nichts rief Lügner schneller auf den Plan als Geld. Ihr Vater hatte einen Privatdetektiv angeheuert, um die Hinweise zu bearbeiten.
Die Frau sprach weiter.
»Ich wohne in Schenectady, das ist zwei Stunden von Hastings entfernt – hinter der Grenze zu New York. Ich war auf dem Rückweg von Manhattan. Hatte mich mit Freundinnen getroffen. Darum war ich auf der Straße.«
Nic stellte die Fragen, die das Gespräch vermutlich beenden würden. Welcher Tag? Welche Uhrzeit? Welche Straße?
Die Anrufer machten nie ihre Hausaufgaben. Mit der Stadt lagen sie meistens richtig. Manchmal sogar mit der Marke und dem Modell des Autos, das ihre Mutter gefahren hatte – ein hellblauer Audi Q5. Er war kurz vor der Tankstelle liegen geblieben.
Edith Moore rasselte die Antworten nur so herunter. Bei der letzten horchte Nic auf.
Hastings Pass.
Die meisten Leute behaupteten, sie hätten Molly Clarke auf der Route 7 gesehen. Dort hatte man ihren Wagen gefunden. Das war die Straße, die zum Casino führte, wo ihre Kreditkarte benutzt worden war. Naheliegend, dass sie es damit versuchten, die Verrückten. Und die Lügner.
Das hier aber war neu.
»Was haben Sie auf dem Hastings Pass gemacht?«, wollte Nic wissen. Ihre Stimme klang barsch. »Das ist ein riesiger Umweg, wenn Sie von Manhattan nach Schenectady wollten.«
Hastings.
Nic kannte jeden Winkel der Stadt. Jede Straße, jedes Feld, jeden verlassenen Brunnen, in den ihre Mutter auf der Suche nach Schutz vor dem Hurrikan gestürzt sein konnte.
»Ich wollte wegen des Sturms dort übernachten. Es gibt da ein Motel, das Hastings …«
»Hastings Inn.« Nic saß jetzt aufrecht.
»Genau – das Hastings Inn. Ich bin gegen sieben dort angekommen, aber Türen und Fenster waren schon mit Brettern vernagelt. Ich wusste, dass ich mich vor dem Hurrikan in Sicherheit bringen musste, also habe ich gewendet und bin zur Route 7 zurückgefahren. Ich glaube, ich bin direkt an Ihrer Mutter vorbeigefahren.«
Nun meldete sich eine andere Stimme. Der Mann in ihrem Bett, der längst nicht mehr willkommen war. »Wer ist dran?«
»Niemand … du musst gehen.« Nic zeigte von ihm zur Tür und auf seine Kleidung, die auf dem Teppich verstreut lag. Als er sie verwirrt anstarrte, wurde sie noch deutlicher.
»Bitte – geh einfach.« Und dann: »Tut mir leid.«
Sie sagte es noch einmal. Tut mir leid, tut mir leid, bis er sich in Bewegung setzte.
Sie bereute die letzte Nacht und die Nächte davor und die Nächte, die noch kommen würden. Sie bereute viele Nächte, seit Annie gestorben war.
Zurück zur Frau am Telefon.
»Warum haben Sie sich nicht früher gemeldet? Es ist zwei Wochen her.«
»Wie gesagt, ich wohne nicht in der Gegend. Und verfolge die Nachrichten nur selten. Aber vor einigen Tagen habe ich mich mit einer der Freundinnen unterhalten, mit denen ich mich in Manhattan getroffen hatte. Sie hat gefragt, ob ich in den Sturm geraten sei, und dann hat sie eine verschwundene Frau erwähnt.«
Nic hörte aufmerksam zu, während der Mann durchs Zimmer ging, sich das Hemd schnappte, Hose, Unterwäsche. Diese Nächte mussten aufhören.
Aber das würden sie nicht, das wusste sie.
Edith Moore sprach weiter, ihre Stimme zitterte aufgeregt. »Ich habe die Geschichte gegoogelt und wusste einfach, dass sie es war! Ich habe sie auf der Straße gesehen. Hastings Pass – nicht Route 7. Sie stand da, es hatte angefangen zu regnen. Sie war klatschnass.«
Während sie zuhörte, schossen Nic die Fakten des Falls durch den Kopf.
Der verlassene Wagen kurz vor der Tankstelle.
Kein Benzin im Tank.
Im Auto das Handy, das ans Ladegerät angeschlossen war.
Jedes Feld, jedes Haus, alles durchsucht.
Zwei Tage später, wurde ihre Kreditkarte in einem nahe gelegenen Spielcasino benutzt.
Dann fand man ihre Kleidung, noch nass, im Hotelzimmer – zusammen mit der Nachricht.
Der Nachricht, die alles erklärte – und nichts.
»Und Sie haben nicht angehalten? Haben ihr nicht geholfen?«, fragte Nic.
Die Frau redete weiter, dass sie langsamer gefahren, dann aber ein Wagen aus der Gegenrichtung gekommen sei.
»Was für ein Wagen?«
»Ein Pick-up. Dunkle Farbe. Er hielt an, und sie stieg ein.«
Nic sprang auf und krümmte sich.
»Ich habe alles gelesen, was ich finden konnte«, sagte die Frau. »Über den Wagen, den man am nächsten Morgen gefunden hat, und die geschlossene Tankstelle und den Sturm und den Stromausfall. Ach ja, und dass die ganze Stadt nach ihr gesucht hat, bis man die herzzerreißende Nachricht in einem Motelzimmer fand. Ihre arme Mutter, was muss sie alles durchgemacht haben. Und dann wurde der Fall ›neu eingestuft‹, wie es hieß. In der Presse stand, sie sei ›fortgegangen‹.«
Genau so war es gewesen.
Nic und ihr Vater hatten die Suchtrupps unterstützt. Vier Tage in Hastings, die in ihrer Erinnerung verschwammen. Flüchtige Bilder von kalter Luft und steifen Maispflanzen, bitterem abgestandenem Kaffee auf Klapptischen, den die Einheimischen brachten. Der Kneipe gegenüber dem Motel. Wodka. Tequila. Ein Fremder im hinteren Flur – der Barkeeper. Es war nicht schön gewesen.
Dann war herausgekommen, wie schlimm sich ihre Familie am Tag des Verschwindens verhalten hatte.
Nics grausame Worte in der Küche, die das Reinigungspersonal gehört hatte. Evan, der seine Mutter ignoriert hatte, wie seine Teamkameraden berichteten. Und John, der Ehemann von Molly Clarke, der geschlafen und nicht einmal bemerkt hatte, dass seine Frau nicht nach Hause gekommen war.
Wie konnte das sein? Er hatte tausend Ausflüchte. Es kostete Nic übermenschliche Kraft, nicht den wahren Grund preiszugeben: dass er seine Frau nicht mehr liebte. Dass er eine Affäre hatte. Nic hatte seinen Wagen in der Stadt gesehen, als er angeblich im Büro war. Ihr war aufgefallen, dass er dem Blick seiner Frau auswich und sich dann wieder ungewohnt höflich und rücksichtsvoll ihr gegenüber verhielt – wohl um jedem Verdacht zuvorzukommen. So vieles hatte sich verändert in letzter Zeit. Es waren subtile Veränderungen. Bis auf die eine, die ganz offensichtlich war. Zum ersten Mal, seit seine Frau seine Tochter getötet hatte, wirkte er glücklich.
Und sie hatten sich ausgerechnet an Annies fünftem Todestag so schlimm verhalten.
Man hatte die Nachricht ihrer Mutter im Licht dieser hässlichen und unverzeihlichen Geschehnisse gedeutet. Worte, hingekritzelt auf den hoteleigenen Notizblock. Nic hatte sie nur einmal gelesen, aber sie sah jeden einzelnen Buchstaben vor sich, wenn sie die Augen schloss.
Meine geliebte Familie, es tut mir so schrecklich leid. Ich habe es nicht nach Hause geschafft, und dann dachte ich mir, dass ihr ohne mich vielleicht besser dran seid. Ich bitte euch, sucht nicht nach mir. Ich bete für euer Glück.
Sie hatte mit ihrem vollen Namen unterschrieben. Molly Clarke. Die Polizei vermutete, sie habe auf diese Weise sicherstellen wollen, dass das Hotel die Nachricht korrekt zuordnen und sie an die Familie weitergeben konnte.
Aber sie hatte das Zimmer mit ihrer Kreditkarte bezahlt. Und die lief auf ihren Namen, der somit längst bekannt war. Und die Wortwahl, die Formulierungen – das klang so gar nicht nach ihrer Mutter.
Man schickte die Nachricht zu einem Graphologen. Sie passte zu den Schriftproben, die sie eingereicht hatten. Es war die Handschrift von Molly Clarke.
Trotzdem hatte Nic gekämpft. Gegen die örtliche Polizei. Die Staatspolizei. Sogar gegen ihren Vater. Man hatte ihr Statistiken vorgelegt, um die Theorie zu untermauern, dass ihre Mutter die Familie verlassen hatte. Die meisten erwachsenen Frauen, die verschwanden, wollten ihr altes Leben hinter sich lassen. Sie kamen zurück, wenn und falls sie dazu bereit waren.
Welche Argumente blieben ihr? Bruchstücke der Vergangenheit, Fragmente von Erinnerungen an eine liebevolle Mutter, die niemals Leid über ihre Kinder bringen würde, indem sie einfach wegging? In Wahrheit hatte Nic keine Ahnung, was ihre Mutter dachte und fühlte oder ob sie glaubte, dass sie eine Last und ihre Familie besser ohne sie dran sei.
So etwas Ähnliches hatte Nic ihr an jenem letzten Morgen ins Gesicht gesagt.
Die Vorstellung, dass ihre Mutter sie verraten hatte, war zuerst ein Schock gewesen, dann hatte sie sich leise in ihr festgesetzt, war in die Hohlräume eingedrungen, die Kummer und Schuld nach Annies Tod hinterlassen hatten. Diese Hohlräume waren überall. In jedem Winkel ihres Körpers, in jeder Zelle. Und sie gierten unersättlich danach, gefüllt zu werden. Männer und Alkohol reichten kaum noch aus.
Evan war mit dem Verschwinden der Mutter besser zurechtgekommen. Es hatte Tränen gegeben, doch er war rasch in die Schule zurückgekehrt. Sein Vater hatte seine Pflicht getan, eine düstere Miene aufgesetzt und sich um die Eltern seiner Frau gekümmert. Sie lebten in einem Heim und waren beide dement. Nic beneidete sie. Inzwischen waren fast zwei Wochen vergangen, und die Freundinnen brachten keine Aufläufe mehr vorbei. Alle nahmen ihr normales Leben wieder auf, weil es unerträglich war, in einem Zustand von Kummer und Verlust zu verharren. Ihr Vater kehrte ins Büro und zu seinen anderen Aktivitäten zurück. Und Nic zu ihren Nächten.
Nur waren sie schlimmer geworden.
Jetzt wieder die Frau am Telefon. »Der Fahrer des Pick-ups könnte wissen, wo sie ist.«
Ja, dachte Nic. Der Fahrer könnte wissen, weshalb sie uns verlassen hat.
»Können Sie mir sonst noch etwas sagen? Irgendwelche Einzelheiten, die Ihnen aufgefallen sind? Ich muss Sie das fragen.«
»Natürlich«, sagte Edith Moore. »Mal überlegen … ja – sie hat etwas getan, aber ich weiß nicht, ob es hilft …«
»Was?«, fragte Nic, hoffte plötzlich verzweifelt, dass dies hier die Wahrheit war. »Was hat sie getan?«
»Als sie dem Pick-up gewinkt hat – da hat sie beide Arme über den Kopf gestreckt und hin- und hergeschwenkt. In einer Hand hatte sie die Handtasche, daher sah es komisch aus. Ich meine, dass sie nicht nur mit einer Hand gewinkt hat. Ich weiß noch, dass es mir seltsam vorkam.«
Nic schloss die Augen und sah ihre Mutter vor sich. Es war Jahre her, sie hatte bei einem Cross-Country-Lauf an der Ziellinie gestanden. Und sie hatte genauso gewinkt – mit beiden Armen in der Luft. Das machte sie bei Evans Spielen oder wenn sie auf sich aufmerksam machen wollte.
Sie hatten sich darüber lustig gemacht, es aber auch liebenswert gefunden.
Damals, als es noch Raum für liebenswerte Dinge gab.
»Wie sah die Tasche aus?«, fragte Nic.
»Die war orange – und es standen Buchstaben drauf. NEA. Damals hielt ich es für ein Monogramm, aber nachdem ich von Ihrer Mutter gelesen hatte, kam mir der Gedanke, es könnte eine Designermarke sein.«
»Es sind unsere Namen«, sagte Nic. »Die Namen ihrer Kinder.«
Ihre Mutter hatte die Tasche selbst anfertigen lassen. Niemand sonst wäre so morbide gewesen. Denn das war es. Eine leuchtend orange Erinnerung daran, dass sie drei Kinder hatte. Nicole. Evan. Annie. Drei Kinder, nicht zwei. Und daran, dass eines von ihnen tot war. Das goldene »A« ein täglicher Schlag in die Magengrube. Sie nahm die Handtasche überallhin mit.
Nic öffnete die Augen und ließ zu, dass die Wahrheit zu ihr durchdrang.
Es ist die Wahrheit. Diese Frau hat meine Mutter gesehen.
»Warum treffen wir uns nicht?«, schlug Edith Moore vor. »Ich kann Ihnen genau zeigen, wo der Pick-up sie mitgenommen hat.«
Der Gedanke war unerträglich. Hastings …
»Vielleicht können Sie sich mit der örtlichen Polizei treffen.«
Doch die Frau blieb beharrlich. »Ich glaube nicht, dass das etwas bringt. Deren Meinung steht fest.«
Stille. Nic schloss die Augen und versuchte, die Übelkeit zu vertreiben.
Hastings …
»Die Sache ist die«, sagte die Frau. »Ihrer Familie dürfte doch am meisten daran liegen, was aus dieser armen Frau am Straßenrand geworden ist.«
Zehn Minuten später stopfte Nic Kleidung in eine Reisetasche. Jeans, T-Shirts, Sweatshirts, Turnschuhe. Was sonst noch? Pyjama, Unterwäsche.
Sie holte Zahnbürste und Shampoo aus dem Bad.
Eine Stimme meldete sich, flüsterte … Läufst du schon wieder weg?
Die Trauerberaterin hatte ihre eigene Theorie, was Nics Verhalten betraf.
Laufen Sie nicht vor dem Schmerz weg. Sie müssen ihn spüren, bevor es besser wird.
Aber sie spürte ihn ja. Und es wurde trotzdem nicht besser.
An jenem Morgen hatte sie Dinge zu ihrer Mutter gesagt, von denen sie niemandem erzählt hatte. Dinge über Annie. Sie konnte nicht mal daran denken.
Sie hatte Elend statt Liebe im Gesicht ihrer Mutter sehen wollen. Und es war ihr gelungen. Seit dem Gespräch mit Edith Moore trug sie ein Bild im Kopf – ihre Mutter in Regen und Sturm, klatschnass. Und Nic hatte sie mit ihren furchtbaren Worten in diesen Sturm getrieben.
Und nun gab es da draußen jemanden, der wusste, wohin sie gegangen war. Der einen Pick-up besaß. Der ihr helfen konnte, ihre Mutter zu finden, damit Nic ihr sagen konnte, dass sie sie nicht hasste. Damit sie alles zurücknehmen konnte, was sie an jenem Morgen gesagt hatte. Sie verscheuchte die Stimmen. Den guten Rat. Die wohlmeinenden Worte, die unweigerlich kommen würden. Sie möchte nicht gefunden werden. Sei fair zu dir selbst, Nicole. Aber Nic wusste Dinge, die andere nicht wussten. Dinge, die sie gesagt hatte, um ihre Mutter zu vertreiben.
Sie war schuld und musste es wiedergutmachen. Sie musste ihre Mutter finden.
3
Tag eins
Das Mädchen trägt eine Maske vor dem Gesicht. Es ist eine medizinische Maske, ich kann sie nur im Außenspiegel sehen. Der Mann hat seine Wollmütze tief ins Gesicht gezogen.
Wir fahren durch den strömenden Regen. Ein heftiger Wind rüttelt am Pick-up.
»Danke, dass Sie angehalten haben. Ich hatte kein Benzin mehr.«
Das Mädchen dreht sich um.
»Das war nicht sehr schlau«, sagt sie. Ihre Stimme klingt fröhlich, als würde sie nur das Offensichtliche feststellen, ohne mich zu verurteilen. Trotzdem ist es seltsam, wenn ein Kind ihres Alters nicht erkennt, dass es genau das getan hat.
»Du hast recht.«
Der Mann lächelt. »Ist ja gut gegangen. Die Stadt ist nicht weit.«
Seine Augen zucken zum Spiegel, also kann er mich sehen. Er wendet sich rasch ab und schaut zu seiner Tochter.
Tochter … Ich komme ins Grübeln. Habe vorschnelle Schlüsse gezogen.
Das Mädchen redet weiter.
»Ich bin gegen alles allergisch, darum muss ich eine Maske tragen, wenn ich rausgehe. Klingt meine Stimme damit komisch?«
Ihre Worte gehen durch mich hindurch. Ich schaue aus dem Fenster und frage mich, wo wir sind, wie weit entfernt von der Stadt. Ich sehe nur das kurze Stück Straße, das von den Scheinwerfern beleuchtet wird. Der Himmel ist eine schwarze Leinwand.
Ich rieche Benzin und bemerke drei Plastikkanister, die neben mir auf dem Boden stehen. Ansonsten ist der Pick-up alt, aber sauber. Das Leder der Sitze ist rissig, stellenweise durchgesessen.
»Hey!«, sagt das Mädchen jetzt verärgert. »Beantworte meine Frage!«
Meine Aufmerksamkeit springt von der Straße und dem schwarzen Himmel und den Benzinkanistern zu dem Mädchen mit der Maske, das mich tadelt, weil ich nicht zugehört und ihre Frage nicht beantwortet habe. Irgendwie krame ich sie aus dem Kurzzeitgedächtnis hervor. Etwas mit der Maske und ihrer Stimme … Ich rate einfach.
»Für mich klingt sie ganz normal.« Sie sieht mich mit zusammengekniffenen Augen im Außenspiegel an, und ich stelle mir vor, wie ärgerlich sie hinter der Maske ist.
Also lächle ich. Ein großes, warmes Lächeln mit Lippen, die vor Kälte zittern, und weil mir plötzlich klar wird, dass ich mit Fremden in einem Wagen eingeschlossen bin.
»Wie heißt du?« Ich versuche, freundlich zu sein. Sie müssen mich ja nur bis in die Stadt mitnehmen.
Das Mädchen schaut den Mann an, bevor sie antwortet. Er nickt und sagt: »Nur zu! Nicht so schüchtern«, was mir seltsam erscheint, weil sie alles andere als schüchtern ist.
Diesmal dreht sie sich ganz herum und lächelt so breit, dass ihre Wangen sich hinter der Maske verziehen.
»Alice!«, sagt sie. Ich halte inne, weil der Name für mich anders klingt. Sie sagt Alice, doch ich höre Annie. Und mein Herz setzt einen Moment lang aus.
Alice dreht sich wieder zur Straße, diesmal mit einem kleinen Hüpfer, und der Mann wuschelt ihr durch die Haare. Es wirkt spielerisch, aber unbeholfen, als machte er das selten.
Der Wagen wird langsamer.
Ich schaue durch die Windschutzscheibe und sehe Geschäfte mit verbarrikadierten Fenstern. Sie tauchen wieder in die Dunkelheit.
Der Pick-up rollt die Straße entlang. Der Mann schaut geradeaus.
»Ist das die Stadt?«
Wir kommen an einem Gebäude vorbei, dessen graue Silhouette und große Fenster, die mit Sperrholzplatten gesichert sind, an einen Diner erinnern. Daneben bemerke ich ein Schild auf einer Rasenfläche. Es blitzt nur kurz auf, als unsere Lichter darüberstreichen. Hastings Inn.
»Vielleicht da, bei dem Motel. Sie könnten mich einfach …«
Der Mann sieht vorsichtig aus dem Fenster.
»Scheint geschlossen zu sein. Alles verrammelt. Verdammt, anscheinend hat die ganze Stadt keinen Strom.«
Meine Stimme bricht, als ich die nächste Frage stelle. »Können wir zu meinem Wagen zurückfahren? Vielleicht kann ich etwas von Ihrem Benzin hier nachfüllen? Nur ein paar Liter. Eine halbe Stunde weiter gibt es noch eine Tankstelle, beim Casino. Ich habe an der Route 7 ein Schild gesehen …«
Bitte, bitte, bitte! Bring mich zurück zu meinem Wagen, zu meinem zwei Stunden entfernten Leben, egal was daraus geworden ist. Ich sehne mich jetzt danach und weiß nicht mal warum. Ich sehne mich nach meiner respektlosen Tochter, die mich hasst, und meinem grausamen Sohn, der mich ignoriert. Ich vermisse meinen Mann, der sich schlafend stellt, wenn ich ins Bett komme, und ich vermisse die Hunde, die nur ihr Futter von mir wollen. Gott steh mir bei, ich vermisse sogar den Schmerz, der mich nie verlässt.
Er kommt von einem verborgenen Ort. Ein archaischer Instinkt, dieses Vermissen von Dingen.
Der Pick-up biegt ab und beschleunigt.
»Die sind leer. Wir wollten sie auffüllen, aber die Tankstelle hatte schon zu.«
Ich schaue zu den Benzinkanistern. Ich könnte schwören, dass Flüssigkeit darin schwappt, aber ich kann mich irren. Oder höre nur den letzten Rest von Benzin.
Warum sollte er lügen? Die Tankstelle hatte ja geschlossen.
»Was machen wir jetzt?«
»Die Straße ist blockiert. Ein Baum ist umgestürzt. Haben Sie das nicht im Radio gehört? Uns bleibt nur ein Weg.«
Ich habe nichts mitbekommen. Ich kann im Wagen auch kein Radio hören. Und wie konnten sie so schnell darüber berichten?
Das Mädchen scheint zu wissen, wohin wir fahren.
Ich öffne die Handtasche, will nach dem Handy greifen. Ich muss John und Nicole sagen, was passiert ist. Ich wühle in der Tasche – Portemonnaie, Bürste, Pfefferminzbonbons, Taschentücher. Ich räume alles auf meinen Schoß, bis die Tasche leer ist.
Dann fällt es mir ein – das Handy war am Ladegerät, es lag auf dem Sitz.
Ich habe kein Handy. Eine neue Angst steigt in mir auf.
Dann frage ich jetzt –
»Haben Sie ein Handy, das ich benutzen kann? Meine Familie macht sich wahrscheinlich große Sorgen.«
Alice schaut auf ihre Hände, die sie im Schoß gefaltet hat.
Und der Mann schüttelt den Kopf.
»Nein. Tut mir leid. Ich habe es zu Hause gelassen. Aber wir sind gleich da. Sie können anrufen, und dann überlegen wir, wie wir Sie zu Ihrer Familie bekommen.«
»Oder du bleibst heute Nacht einfach bei uns!«, sagt Alice. Wieder dreht sie sich um. Wieder ausgelassen.
Der Mann lächelt jetzt.
»Eins nach dem anderen«, sagt er.
Und so fahren wir weiter. Biegen ab. Nach links. Nach rechts. Tiefer in den Wald hinein.
Ich kann die Stille nicht ertragen. Nicht zu wissen, was hier gerade passiert, macht mich wahnsinnig. Also verhalte ich mich, wie ich es normalerweise und mit klarem Kopf tun würde.
»Ich bin übrigens Molly. Molly Clarke. Ich bin Ihnen wirklich dankbar für die Hilfe.«
Alice kichert nervös. Der Mann starrt geradeaus.
Ich versuche, seinen Blick im Rückspiegel aufzufangen.
»Verraten Sie mir auch Ihren Namen?«
Er schaut zu Alice. Sie schaut zurück und stupst ihn mit dem Finger an.
Er zuckt mit den Achseln, schaut wieder auf die Straße. Er wirkt belustigt.
Alice antwortet für ihn.
»Er heißt Mickymaus«, lacht sie.
Der Mann lächelt, und ich begreife, dass sie ein kleines Spiel spielen. Alice erfindet Namen für ihn, wenn Fremde dabei sind.
Ich spiele mit, obwohl mir nicht wohl dabei ist.
»Soll ich Sie Micky oder Mr. Maus nennen?«
Er lacht laut, antwortet aber nicht.
Der Pick-up fährt langsam durch den Sturm. Wir sind mittendrin. Zeit und Entfernung sind nicht mehr kalibriert.
Ich sehe nichts jenseits des Scheinwerferlichts. Der Wind peitscht den Regen beinahe waagerecht über die Straße. Abbiegen und wieder abbiegen, weiteren umgestürzten Bäumen ausweichen, von denen der Mann berichtet, obwohl ich sie von hier hinten nicht sehen kann.
Er macht keine Konversation. Er fragt nicht, wer ich bin oder woher ich komme. Ich nehme an, dass ihn der Sturm nervös macht und er Alice sicher nach Hause bringen will.
Ich schmecke Blut, so fest habe ich mir auf die Lippe gebissen. Mir ist jetzt warm, aber ich zittere noch immer.
Der Pick-up wird langsamer und bleibt diesmal wirklich stehen. Alice wird munter. Sie schaut hinaus und sieht, was auch ich sehe – einen hohen Metallzaun, ein Tor, dahinter eine ungepflasterte Auffahrt.
Der Mann steigt aus. Alice fragt nicht nach dem Grund. Er setzt die Kapuze seiner Jacke auf, ist aber trotzdem sofort durchweicht. Er rennt zum Tor und bleibt vor einer großen Kette stehen, die zwischen zwei Torpfosten hindurchgeschlungen ist. Er schließt das Vorhängeschloss auf, wickelt die Kette ab, ein Torflügel schwingt auf.
Ich schaue zum Türgriff, der sich direkt neben meinem rechten Arm befindet. Die Tür wurde nicht entriegelt, als er ausgestiegen ist, aber ich taste dennoch nach dem Griff und ziehe so vorsichtig wie möglich. Nichts passiert. Vermutlich die Kindersicherung. Ich spähe zwischen den Sitzen nach vorn und frage mich, ob mein Körper hindurchpasst – ob ich zur Fahrerseite klettern und durch die Tür entkommen kann. Alice ist zu klein, um mich aufzuhalten. Aber laut genug, um den Mann zu warnen, und er hätte mich sicher mit wenigen Schritten erreicht.
Dann halte ich inne. Wir sind an einem Haus. Dort wohnt eine Familie. Vielleicht eine Frau, weitere Kinder. Alice und ihr Vater wollten ja nur Benzin in den Kanistern holen, die neben mir auf dem Boden stehen. Und Wasserflaschen. Die liegen vorn neben Alice’ Beinen. Sie sind zufällig auf mich gestoßen. Haben mir angeboten, mich mitzunehmen.
Sei nicht so Molly, sage ich mir. Aber Molly hat ihr Kind getötet. Molly weiß, dass das Undenkbare geschehen kann, und denkt seitdem Dinge, die manchmal nicht real, sondern hyperbolisch sind, wie John sagen würde. Sie denkt sie trotzdem. Denn es gab eine Zeit, da waren sie real. Und sie sind geschehen.
Molly.
Ich denke an das Holzscheit, das gestern Abend im Kamin lag, und frage mich, ob meine Schlussfolgerung daraus verrückt war. Und Evan mit seiner Grausamkeit … und Nicole – ist das alles Wirklichkeit?
Jetzt spricht Alice wieder.
»Wir sind zu Hause!« Sie klingt triumphierend.
Der Mann kommt zurück, steigt ein und schließt die Tür.
»Wow! Das ist vielleicht ein Sturm!« Er schüttelt den Regen ab.
Dann legt er den Gang ein, und der Pick-up rollt durchs offene Tor. Dahinter hält er erneut. Steigt aus. Rennt zum Tor, um das Kettenschloss anzubringen. Uns auf seinem Anwesen einzuschließen.
Er steigt wieder ein und fährt weiter. Diesmal passe ich genau auf. Der Tacho zeigt fünfundvierzig Stundenkilometer. Ich zähle die Sekunden im Kopf mit. Ich zähle wie ein Schulmädchen. Eins Mississippi … zwei Mississippi …
Ich komme bis zwanzig. Das macht etwa zweihundertsiebzig Meter von der Straße bis zum Haus.
Ich speichere die Information irgendwo in meinem wirren Kopf. Überlege, was sie mir über das Anwesen und das Haus verrät, das vor mir auftaucht, als der Pick-up anhält.
Der Mann stellt den Motor ab und nimmt den Zündschlüssel an sich.
Er geht zur Beifahrerseite, öffnet meine Tür, dann Alice’ und hebt sie aus dem Auto. Sie schlingt die Arme um seinen Hals und quiekt, als der Regen ihr Gesicht und den Körper trifft. Sie drückt sich an ihn wie eben ein Kind an seinen Vater, und meine Erleichterung überrascht mich selbst.
Alice liebt diesen Mann, und er liebt sie. Wo Liebe ist, kann es keine Gefahr geben.
»Na los!«, ruft er mir zu. Ich steige aus und folge ihnen. Ich ziehe meine schicke, wenn auch vollkommen unzulängliche Regenjacke so weit wie möglich über den Kopf und lache, weil mich die Erleichterung geradezu überwältigt. Beim Lachen drohen mir die Tränen zu kommen, aber ich unterdrücke sie, bevor ich meine Retter einhole.
Ich sehe wenig, während wir durch den Regen gehen. Nur den Schatten einer großen Veranda mit Pfosten und Stufen ohne Geländer. Ich schaue auf meine Füße, als ich hinaufgehe. Eins, zwei, drei, vier …
Sechs Stufen, dann stehen wir auf der Veranda. Drei Schritte bis zur Tür, die sich ohne Schlüssel öffnen lässt. Trockene Luft weht uns entgegen, es riecht muffig und nach Holz.
Als die Tür zugeht, stehen wir drei in tiefer Dunkelheit da. Der Regen hämmert aufs Dach, doch die Wände verschlucken die meisten Geräusche. Plötzlich durchbricht das Licht einer Sturmlaterne die Dunkelheit.
»Ich versuche, den Generator anzuwerfen«, sagt er. »Das Benzin sollte bis zum Morgen reichen. Alice, warum zeigst du Molly nicht das Gästezimmer. Gib ihr ein Handtuch aus dem Schrank.«
Er spricht meinen Namen so beiläufig aus, als wären wir alte Freunde.
Handtücher und Gästezimmer und Laternen. Es gibt keine weiteren Familienmitglieder, aber es ist in Ordnung. Ja, denke ich. Es ist in Ordnung – bis ich anrufen kann.
Er gibt mir die Laterne und geht wieder nach draußen. Alice nimmt die Maske ab. Es ist eine weiße Schutzmaske, wie man sie im Drogeriemarkt kaufen kann. Ich habe so etwas schon beim Anstreichen benutzt, aber das ist viele Jahre her, als John und ich gerade zusammengezogen waren. Als wir Dinge selber machten, weil wir mehr Zeit als Geld hatten.
Der Gedanke an meinen Mann raubt mir den Atem, Gefühle überkommen mich. Ich liebe ihn noch immer. Selbst wenn er mich nicht mehr liebt.
Alice hat hellblaue Augen und weiches blondes Haar und Haut wie Schnee, sie kommt offenbar nie an die Sonne. Aber sie ist nicht mager. Ihre Wangen sind rosig von der Kälte. Und ihre Farben – das Blau und Gelb und Weiß und Rot – sind hinreißend. Die Farben der Jugend. Die Farben eines kleinen Mädchens. Sie füllen mein Herz und fließen durch das Loch, das ich vor fünf Jahren hineingerissen habe, wieder hinaus.
Ich folge ihr mit der Laterne durch ein Wohnzimmer, vorbei an einer Küchentür und in einen Flur, wo wir stehen bleiben. Sie öffnet einen Wandschrank, in dem Handtücher, Decken und Bettwäsche liegen. Normale Dinge. Normal.
Sie holt ein verschlissenes weißes Badetuch heraus und gibt es mir. Ich nehme es mit einer Hand entgegen und wische mir das Gesicht ab.
»Na los!«, sagt sie fröhlich.
Ich schaue in den Flur, kann mich aber nicht orientieren. Alle Türen sind geschlossen.
Ich möchte trocken werden. Ich möchte warm werden. Ich möchte, dass der Mann zurückkommt, damit ich meine Familie anrufen kann. Das alles scheint jetzt zum Greifen nah, und ich wünsche es mir umso dringlicher.
Wir betreten das erste Zimmer auf der linken Seite. Darin stehen ein Bett und eine Kommode, ein ovaler Spiegel hängt an der Wand. Das Bett ist ordentlich gemacht, mit Tagesdecke und zwei Kissen. Es hat ein eigenes Badezimmer, dessen Tür offen steht. Das einzige Fenster ist mit Sperrholz verrammelt. Wegen des Sturms, sage ich mir. Genau wie der Diner vorhin in der Stadt.
»Das ist das Gästezimmer. Du kannst heute Nacht hier schlafen«, sagt Alice. »Ich schlafe gleich nebenan.«
Ich lächle ihr zu. Sie lächelt zurück. Aber ich habe nicht vor, in diesem Haus zu schlafen.
John wird mich abholen – trotz des Sturms. Obwohl er mich nicht mehr liebt.
»Kann ich mit dir warten?«, fragt sie.
»Sicher«, sage ich. Im Haus ist es dunkel. Das verstehe ich. Dann aber hören wir Schritte, die sich bewegen. Die stehen bleiben, von einem Fuß auf den anderen treten, weitergehen. Ein anderes Licht scheint durch den Flur, und plötzlich steht der Mann auf der Schwelle.
»Mach dich bettfertig«, sagt er zu Alice. Er hat zwei Laternen dabei und gibt ihr eine davon. Sie gehorcht und lässt uns allein.
»Ich habe den Generator eingeschaltet. Der betreibt die Heizung. Mit der Laterne können Sie sich heute Nacht orientieren. In der Kommode ist Kleidung. Sie können sich gern etwas nehmen.«
Ich starre den Mann an, das Handtuch bis zu den Augen vors Gesicht gedrückt.
»Ich muss telefonieren – mein Mann kann mich sicher irgendwie abholen.«
Noch während ich es sage, weiß ich die Antwort. Weil er mir nicht angeboten hat, zu telefonieren, was seltsam ist. Nicht Molly-seltsam. Wirklich seltsam.
Und dann folgt die Antwort.
»Die Sache ist die – wir haben hier draußen keinen Handyempfang, und das Festnetz ist zusammengebrochen. Ich habe gerade das Telefon in der Küche überprüft.«
Ich nicke und zwinge mich zu einem höflichen Lächeln. Warum, weiß ich nicht. Eine Angewohnheit aus meiner Kultur, die Emotionen unterdrückt.
»Können wir es wenigstens versuchen? Vielleicht in einem anderen Teil des Hauses oder draußen? Oder ich leihe mir den Pick-up und rufe von der Straße aus an.« Ich rede wirr drauflos. »Mein Mann und meine Tochter machen sich große Sorgen. Ich sollte vor über einer Stunde zurück sein und habe meinen Wagen am Straßenrand stehen lassen. Die Leute fragen sich sicher schon, wem er gehört. Vermutlich sucht die Polizei nach mir, und ich möchte wirklich nicht, dass sie sich mit so etwas beschäftigen muss.«
Ich rede vor mich hin und starre ihm ins Gesicht, suche nach Verständnis oder Überraschung oder irgendetwas, das einer menschlichen Regung gleichkommt. Doch er beobachtet nur, wie sich meine Lippen bewegen, und lächelt mitfühlend.