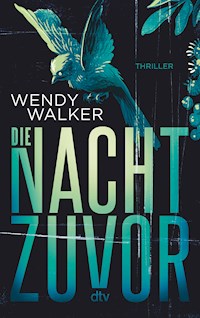8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
»Ich stand frierend im Wald, von Furcht erfüllt zu scheitern. Es stand so viel auf dem Spiel. Sie mussten mir meine Geschichte glauben. Sie mussten Emma finden. Und um Emma zu finden, mussten sie nach ihr suchen. Es hing allein von mir ab, ob meine Schwester gefunden wurde.« Früh an einem Sonntagmorgen im Juli ist Cassandra – Cass – Tanner plötzlich wieder da. Sie steht auf der Türschwelle ihres Elternhauses und sagt immer wieder "Findet Emma!" Drei Jahre zuvor waren die 15-jährige Cass und ihre zwei Jahre ältere Schwester Emma spurlos aus der Kleinstadt in Connecticut verschwunden. Niemand konnte sich erklären, was passiert war. Es gab keine Hinweise, keine Zeugen, nur Emmas Auto am Strand, daneben ihre Schuhe, die Autoschlüssel und ihr Portemonnaie auf dem Sitz. Die Ermittlungen liefen ins Leere, Emma und Cass blieben vermisst. Nur die forensische FBI-Psychologin Dr. Abby Winter hatte schnell eine Theorie zu diesem ungewöhnlichen Fall, eine Theorie, die nur zu schmerzlich mit ihrer eigenen Kindheit und Jugend in Verbindung steht. Aber niemand glaubte an ihre Sicht der Dinge. Jetzt erzählt Cassandra, was Emma und ihr widerfahren ist. Je mehr sie preisgibt, desto klarer erkennt Abby, dass etwas an Cass' Geschichte nicht stimmen kann. Und dass sie selbst die ganze Zeit über recht hatte: Cassandra und Emma sind in keiner "normalen" Familie groß geworden.Ihr Leben schien nach außen unbeschwert, war aber im Inneren eine psychische Hölle. Perfekte Täuschung, unbarmherzige Manipulation. Die Dämonen der Kindheit lauern noch immer im Elternhaus der Tanner-Schwestern. Abby wird diese Dämonen ans Licht zerren müssen, um eines zu verstehen: Warum ist Cass zurückgekehrt? Und wo werden sie Emma finden? Nach Dark Memories – Nichts ist je vergessen nimmt SPIEGEL-Bestsellerautorin Wendy Walker ihre Leser mit auf eine hochmanipulative Reise – soghafte, faszinierende und schockierende Psycho-Spannung, die erschüttert und nicht mehr loslässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 468
Ähnliche
Wendy Walker
Kalte Seele, dunkles Herz
Roman
Aus dem Amerikanischen von Maria Poets
FISCHER E-Books
Inhalt
Für meine Schwestern und meinen Bruder –
Becky, Cheryl, Jennifer und Grant
In der griechischen Mythologie war Narziss ein Jüngling, der gänzlich von seiner eigenen Schönheit und seinem Stolz eingenommen war. Eines Tages, als er im Wald jagte, erblickte ihn eine Nymphe namens Echo, und eine tiefe Liebe zu ihm entbrannte in ihr. Narziss spürte, dass jemand ihm folgte, und rief: »Wer ist da?« Schließlich zeigte Echo sich ihm und versuchte, ihn zu umarmen, aber Narziss stieß sie von sich und ließ sie allein und mit gebrochenem Herzen zurück. Nemesis, die Göttin der Rache, beschloss, Narziss zu bestrafen. Sie lockte ihn zu einem Teich, in dem er sein eigenes Spiegelbild erblickte und sich darin verliebte. Unfähig, sich von der Schönheit seines Spiegelbildes zu lösen, starrte Narziss sich selbst an, bis er starb.
1Cassandra Tanner
Tag eins meiner Rückkehr
Wir glauben, was wir glauben wollen. Wir glauben, was wir glauben müssen. Möglicherweise gibt es keinen Unterschied zwischen wollen und müssen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass die Wahrheit sich uns entziehen kann, sie kann sich hinter unseren blinden Flecken verstecken, hinter unseren Vorurteilen, unseren hungrigen Herzen, die sich nach Ruhe sehnen. Doch sie ist immer da, wenn wir die Augen öffnen und versuchen, sie zu sehen. Wenn wir wirklich versuchen zu sehen.
Als meine Schwester und ich vor drei Jahren verschwanden, hielten alle die Augen geschlossen.
Man fand Emmas Auto am Strand. Auf dem Fahrersitz ihre Handtasche. In der Tasche ihre Schlüssel. In der Brandung ihre Schuhe. Manche Leute glaubten, sie wäre losgezogen, um eine Party zu suchen oder sich mit einem Freund zu treffen, der niemals auftauchte. Sie glaubten, sie sei schwimmen gegangen. Sie glaubten, sie sei ertrunken. Vielleicht war es ein Unfall gewesen. Vielleicht Selbstmord.
Jeder glaubte, Emma sei tot.
Was mich betrifft – das ist nicht so einfach.
Ich war fünfzehn, als ich verschwand. Emma hätte mich niemals mit zum Strand genommen, als ich fünfzehn war. Sie war in ihrem letzten Jahr auf der Highschool, und ich war eine Nervensäge. Meine Tasche lag in der Küche. Von mir wurde nichts am Strand gefunden. Nach Auskunft meiner Mutter fehlte nichts von meiner Kleidung aus dem Haus. Und Mütter wissen solche Dinge. Oder etwa nicht?
Aber sie fanden Haare von mir in Emmas Auto, und manche Leute klammerten sich an den Gedanken, dass ich ebenfalls tot sein musste, obwohl ich unzählige Male in ihrem Auto gesessen hatte. Sie klammerten sich daran, denn wenn ich nicht mit Emma zum Strand gefahren war, wenn ich nicht in jener Nacht im Ozean ertrunken war, vielleicht ins Meer gelaufen war, um sie zu retten – wo war ich dann? Manche Leute wollten glauben, ich sei tot, weil es zu unangenehm war, sich Fragen zu stellen.
Andere waren sich nicht so sicher. Sie waren offen genug, um einen bizarren Zufall in Betracht zu ziehen. Eine Schwester ertrank am Strand. Die andere lief davon oder wurde möglicherweise entführt. Andererseits … Ausreißer nehmen normalerweise eine Tasche mit. Sie muss entführt worden sein. Auf der anderen Seite … solche furchtbaren Dinge passieren doch nicht Leuten wie uns.
Es war keine ganz normale Nacht gewesen, und das befeuerte die Zufallstheorien. Meine Mutter erzählte die Geschichte auf eine Art und Weise, mit der sie das Publikum fesselte und genügend Mitgefühl weckte, um ihren Hunger nach Aufmerksamkeit zu stillen. Ich erkannte es an ihrem Blick, als ich sie in den Nachrichten und den Talkshows sah. Sie beschrieb den Streit zwischen Emma und mir, das Gekreische von Mädchen im Teenageralter. Dann die Stille. Das Auto, das zu später Stunde das Grundstück verließ. Sie hatte die Scheinwerfer von ihrem Schlafzimmerfenster aus gesehen. Tränen wurden vergossen, als sie die Geschichte erzählte, ein kollektives Seufzen erfasste das Studiopublikum.
Auf der Suche nach Antworten wurden unsere Leben auseinandergenommen. Die sozialen Medien, Freunde, SMS und Tagebücher. Alles wurde eingehend geprüft. Sie erzählte ihnen, wir hätten uns wegen einer Halskette gestritten. Ich hatte sie für Emma gekauft, zum Schulbeginn. Es war ihr letztes Jahr! Das ist eine ganz besondere Zeit. Cass war eifersüchtig. Sie war immer so eifersüchtig auf ihre Schwester.
Darauf folgten noch mehr Tränen.
Der Strand liegt direkt an der Meerenge des Long Island Sound. Es gibt dort keine starke Strömung. Bei Ebbe muss man lange laufen, bis das Wasser einem bis zu den Knien reicht. Bei Flut rollt das Wasser so sanft heran, dass man kaum den Sog an den Knöcheln spürt, und man versinkt auch nicht im Sand, wie an den Stränden weiter oben an der Küste, die direkt am Atlantik liegen. Es ist nicht einfach, an unserem Strand zu ertrinken.
Ich erinnere mich, wie ich meine Mutter im Fernsehen beobachtete. Worte kamen aus ihrem Mund, Tränen rannen aus ihren Augen. Für diesen Anlass hatte sie sich neu eingekleidet, ein maßgeschneidertes dunkelgraues Kostüm, dazu Schuhe eines italienischen Designers, der, wie sie uns erklärt hatte, der Beste sei und unsere Stellung in der Welt betonen würde. Ich erkannte es an der Form der Schuhspitze. Sie hat uns eine Menge über Schuhe beigebracht. Ich glaube nicht, dass es an den Schuhen lag, dass jeder ihr glauben wollte. Aber sie taten es. Ich konnte es förmlich durch den Fernseher spüren.
Vielleicht waren wir unter dem Druck auf unserer Privatschule zerbrochen. Es könnte eine Art Selbstmordpakt gewesen sein. Womöglich hatten wir unsere Taschen mit Steinen gefüllt und waren langsam in unser wässriges Grab gegangen, wie Virginia Woolf.
Aber wo waren dann unsere Leichen?
Sechs Wochen und vier Tage dauerte es, bis die Story in den Nachrichten nicht mehr an erster Stelle erwähnt wurde. Meine Promi-Mutter wurde wieder zu der gewöhnlichen, alten Judy Martin oder Mrs Jonathan Martin, wie sie es vorzog, genannt zu werden, ehemals Mrs Owen Tanner, ehemals Judith Luanne York. Es ist nicht so kompliziert, wie es klingt. York war ihr Mädchenname, bevor sie die Namen ihrer beiden Ehemänner annahm. Zwei Ehemänner sind heutzutage nicht viel.
Emma und ich stammen vom ersten – Owen Tanner. Emma wurde nach der Mutter meines Vaters benannt, die an einem schwachen Herzen starb, als er siebzehn war. Mein Name, Cassandra (Cass in der Kurzform) entstammt einem Buch mit Babynamen, das meine Mutter besaß. Sie sagte, er klinge wie der Name einer wichtigen Person. Jemand, den die Leute bewundern. Jemand, den sie beneiden. Dazu kann ich nichts sagen, aber ich erinnere mich daran, dass sie mir meine langen Haare vor ihrem Badezimmerspiegel bürstete und mich mit einem zufriedenen Lächeln betrachtete.
Sieh dich an, Cassandra! Du solltest immer einen Spiegel bei dir haben, damit du nie vergisst, wie schön du bist.
Zu Emma sagte unsere Mutter nie, dass sie schön sei. Sie sahen sich zu ähnlich, als dass Worte der Zuneigung zwischen ihnen gewechselt werden konnten. Jemanden zu loben, der genauso aussieht wie man selbst, der sich genauso verhält oder dieselben Kleider trägt, das ist, als würde man sich selbst loben, und doch fühlt es sich nicht so an. Es fühlt sich eher an wie ein Dämpfer, als würde die andere Person das Lob einheimsen, das einem selbst zusteht. Unsere Mutter hätte Emma nie erlaubt, ihr etwas so Wertvolles wie Lob und Anerkennung zu stehlen.
Aber zu mir sagte sie es. Sie sagte, ich hätte das Beste aus beiden Genpools. Sie war sehr bewandert in solchen Dingen – warum Kinder blaue oder braune Augen hatten oder besonders talentiert in Mathematik oder Musik waren.
Wenn du so weit bist, Kinder zu bekommen, Cassandra, wirst du dir fast jedes Merkmal aussuchen können! Kannst du dir das vorstellen? Ach, wie anders hätte mein Leben verlaufen können, wenn diese Wissenschaftler nur ein wenig schneller gewesen wären! Sie seufzte.
Damals wusste ich nicht, was sie damit meinte. Ich war erst sieben. Aber wenn sie mir die Haare bürstete, wenn sie mir ihre geheimen Gedanken anvertraute, hörte ich mit großem Interesse zu, weil es mich von den Zehenspitzen bis zum Scheitel mit Freude erfüllte und ich wünschte, es würde niemals enden.
Aber das tat es immer. Unsere Mutter wusste, wie sie unseren Hunger nach ihr am Leben erhalten konnte.
Als wir klein waren, fragte sie uns, ob sie hübsch sei, das hübscheste Mädchen, das wir je gesehen hätten, und ob sie klug sei, die klügste Frau, die wir kannten, und dann natürlich …
Bin ich eine gute Mutter? Die beste Mutter, die ihr euch wünschen könnt?
Dabei lächelte sie stets und sah uns mit großen Augen an. Damals antworteten Emma und ich mit ernster Stimme ja. Dann schnappte sie nach Luft, schüttelte den Kopf und drückte uns so fest, als sei die Aufregung darüber, so wunderbar zu sein, mehr, als sie ertragen konnte, als müsste sie diese Erregung unter Aufbietung körperlicher Kraft aus ihrem Leib herauspressen. Nach dem Drücken folgte ein langer Seufzer, um die Anspannung, die ihr in den Knochen gesessen hatte, zu lösen. Die Erregung verließ ihren Körper in heißen Atemstößen und erfüllte den ganzen Raum. Sie selbst wurde vollkommen ruhig und zufrieden.
Zu anderen Zeiten, wenn sie traurig oder wütend war, weil die Welt so grausam zu ihr war, weil niemand sah, wie außergewöhnlich sie war, waren wir diejenigen, die diese Worte sagten, in dem Wissen, dass es sie aus ihrer Düsternis herausreißen würde.
Du bist die beste Mutter auf der ganzen großen Welt.
Und wir glaubten es, Emma und ich, damals, als wir so jung waren.
Ich erinnere mich nur bruchstückhaft an diese Momente, und die Bruchstücke passten irgendwann nicht mehr zusammen, wie verwitterte Glasscherben, deren Ränder abgeschliffen waren. Starke Arme, die kräftig zudrückten. Der Geruch ihrer Haut. Sie benutzte Chanel No°5, das, wie sie uns erklärte, sehr teuer sei. Wir durften die Flasche nicht berühren, aber manchmal hielt sie uns den Flakon hin, und wir inhalierten den Duft, der noch am Zerstäuber haftete.
Andere Erinnerungsfragmente enthalten den Klang ihrer Stimme, wenn sie schrie und sich in ihrem Bett hin und her warf, während ihre Tränen das Bettzeug benetzten. Wie ich mich hinter Emma verstecke. Emma, die ruhig hinsieht, sie mustert und Berechnungen anstellt. Wie wir aufwachen und ihre Euphorie sehen. Wie wir aufwachen und ihre Verzweiflung sehen. Ich erinnere mich auch an dieses eine Gefühl, das ich gelegentlich hatte. Es ist nicht an einen bestimmten Moment gebunden. Es ist nur die Erinnerung eines Gefühls. Jeden Morgen ängstlich die Augen zu öffnen, weil ich keine Ahnung hatte, was uns an diesem Tag erwartete. Ob sie uns umarmen würde. Ob sie mir das Haar bürsten würde. Oder ob sie in ihre Decke weinen würde. Es war, als versuchte man, sich zu überlegen, was man anziehen soll, ohne zu wissen, welche Jahreszeit herrscht, Sommer oder Winter.
Als Emma zehn und ich acht war, begann der Zauber unserer Mutter im hellen Licht der Welt draußen zu verblassen – der realen Welt, in der sie nicht so hübsch war, nicht so klug und nicht so eine gute Mutter. Emma fielen nach und nach ein paar Dinge an ihr auf, und wenn ihr danach war, erzählte sie mir davon.
Sie irrt sich, verstehst du? Es war egal, was danach folgte, ob es eine Meinung war, die unsere Mutter über eine andere Mutter von der Schule gefasst hatte, oder eine Tatsache über George Washington oder was für ein Hund gerade die Straße überquert hatte. Was zählte, war, dass sie sich geirrt hatte, und jedes Mal, wenn sie falschlag, klangen wir weniger aufrichtig, wenn wir ihr antworteten.
Bin ich nicht eine gute Mutter? Die beste Mutter, die ihr euch wünschen könnt?
Wir hörten niemals auf, das Wort Ja zu sagen. Aber als ich acht war und Emma zehn war, wusste sie, dass wir logen.
An jenem Tag waren wir in der Küche. Sie war wütend auf unseren Vater. An den Grund kann ich mich nicht erinnern.
Er sollte froh sein, dass er mich hat. Ich hätte jeden Mann haben können. Ihr Mädchen wisst das. Meine Mädchen wissen Bescheid.
Sie beschäftigte sich mit dem Abwasch. Stellte den Wasserhahn an. Und wieder aus. Das Geschirrtuch fiel zu Boden. Sie hob es auf. Emma stand auf der anderen Seite der riesigen Kücheninsel, ich dicht neben ihr, die Schultern hochgezogen, beugte mich zu ihr, damit ich, falls nötig, hinter ihr verschwinden konnte. Emma kam mir damals so stark vor, als wir abwarteten, welche Jahreszeit es dieses Mal werden würde. Ob es Sommer oder Winter sein würde.
Unsere Mutter begann zu weinen. Sie drehte sich um und sah uns an.
Was habt ihr gesagt?
Ja. Wir antworteten, wie wir es immer taten, wenn sie uns fragte, ob sie die beste Mutter sei.
Wir gingen zu ihr, warteten auf unsere Umarmung oder das Lächeln oder das Seufzen. Doch nichts davon kam. Stattdessen stieß sie uns beide zurück, eine Hand auf meiner Brust und eine auf Emmas. Skeptisch musterte sie unsere Gesichter. Dann schnappte sie nach Luft, ohne wieder auszuatmen.
Geht auf eure Zimmer! Sofort!
Wir taten, was sie verlangte. Wir gingen in unsere Zimmer. Ich versuchte, mit Emma zu reden, als sie voranstürmte und ich hinter ihr herhastete. Ich weiß noch, dass ich auf dem Weg nach oben fragte, Was haben wir getan? Doch Emma sprach nur über unsere Mutter, wenn sie Lust dazu hatte – und wenn sie etwas zu erzählen hatte. Die Geschichte unserer Mutter wurde von ihr geschrieben, ganz allein von ihr. Sie schob meine Hand von ihrem Arm und sagte mir, ich solle den Mund halten.
Wir bekamen kein Abendessen. Keine Umarmungen. Keine Gutenachtküsse. Der Preis für diese Dinge, für die Zuneigung unserer Mutter, stieg an jenem Abend und in den folgenden Jahren. Die Dinge, die wir sagen und tun mussten, um sie von unserer Bewunderung zu überzeugen, wurden immer umfangreicher, je häufiger wir sie sagten und taten – sie blähten sich auf und veränderten sich ständig, so dass die Liebe unserer Mutter rar wurde.
Ein paar Jahre später, mit elf, schlug ich meinen Namen nach, Cassandra, als ich ihn in einem Buch über Mythen entdeckte. Er stammte aus der griechischen Mythologie, Kassandra war die Tochter des trojanischen Königs Priamus und seiner Gemahlin Hekabe. Kassandra besaß die Gabe der Weissagung, war aber dazu verflucht, dass niemand ihren Weissagungen jemals Glauben schenken würde. Ich starrte meinen Computermonitor lange an. Mein Verstand hatte sich davongemacht. Plötzlich ergab das ganze Universum Sinn, und ich war der Mittelpunkt von allem. Meine Mutter hatte mir diesen Namen gegeben, doch in Wahrheit musste es Schicksal sein. Schicksal oder Gott oder was auch immer – etwas war in den Geist meiner Mutter eingedrungen und hatte ihr diesen Namen in den Kopf gesetzt. Er wusste, was geschehen würde. Er wusste, dass ich die Zukunft vorhersagen und dass niemand mir glauben würde. Kinder neigen dazu, Phantasien für wahr zu halten. Heute weiß ich, dass die Tatsache, dass meine Mutter mich Cassandra genannt hat und das, was uns zustieß, nichts als das zufällige Zusammentreffen von Ereignissen war. Aber damals, als ich elf war, fühlte ich mich verantwortlich für alles, was geschehen würde.
Es war das Jahr, in dem meine Eltern sich scheiden ließen. Es war das Jahr, in dem ich ihnen sagte, was ich wusste – dass ich sehen könne, was geschehen würde. Ich erzählte ihnen, dass Emma und ich besser nicht bei unserer Mutter und ihrem neuen Freund namens Mr Martin leben sollten, zusammen mit seinem einzigen Kind, seinem Sohn Hunter.
Die Scheidung meiner Eltern war keine Überraschung für mich. Emma sagte, sie sei auch nicht überrascht, aber ich glaubte ihr nicht. Sie weinte zu viel, als dass es die Wahrheit sein konnte. Jeder hielt Emma für zäh und glaubte, sie käme mit allem klar. Die Leute täuschten sich immer in Emma, weil sie auf erschütternde Vorfälle mit einer beunruhigenden Härte reagieren konnte. Sie hatte dunkle Haare wie unsere Mutter, und ihre Haut war sehr weich und blass. Als Teenager entdeckte sie hellroten Lippenstift und dunklen, fast schwarzen Lidschatten und dass sie sich dahinter verstecken konnte, so wie Farbe eine Wand verdeckte. Sie trug kurze Röcke und enge Pullover, meistens schwarze Rollkragenpullover. Ich habe nicht nur ein Wort, das beschreibt, wie ich sie sah. Sie war schön, ernst, gequält, verletzlich, verzweifelt, unbarmherzig. Und ich bewunderte sie und beneidete sie und sog jeden Moment ein, in dem sie mir ein Stückchen von sich schenkte.
Die meisten dieser Stücke waren klein. Viele von ihnen sollten mich verletzen oder mich ausschließen oder mich gegenüber unserer Mutter ausstechen. Aber gelegentlich, wenn unsere Mutter schlief und das Haus still war, kam Emma in mein Zimmer und kletterte zu mir ins Bett. Sie kroch unter meine Decke und legte sich dicht neben mich, und manchmal schlang sie ihre Arme um mich und drückte ihre Wange an meine Schulter. In solchen Momenten erzählte sie mir Dinge, die mich nährten und mich warm hielten und mir ein Gefühl von Sicherheit gaben, selbst wenn ich in der Winterstimmung unserer Mutter erwachte. Eines Tages wird es nur noch uns beide geben, Cass. Dich und mich und sonst niemanden. Ich kann mich an ihren Geruch erinnern, an die Wärme ihrer Brust, an die Kraft ihrer Arme. Wir werden gehen, wohin wir wollen, und sie niemals wieder in unser Leben lassen. Wir werden uns nicht mehr um sie kümmern. Ich kann noch immer ihre Stimme hören, mit der meine Schwester mir in der Nacht zuflüsterte, Ich liebe dich, Cass. Wenn sie solche Dinge zu mir sagte, dachte ich, nichts könne uns je etwas anhaben.
Ich ließ mich von Emma dazu überreden, unsere Mutter während der Scheidung zu verraten. Sie konnte den nächsten Zug jedes Spielers auf dem Spielbrett erkennen. Sie konnte deren Kurs verändern, indem sie ihren eigenen änderte. Sie war empfänglich und anpassungsfähig. Und sie war niemals auf einen bestimmten Ausgang festgelegt, ausgenommen ihre Selbsterhaltung.
Cass, wir müssen bei Dad leben. Verstehst du das nicht? Er wäre so traurig ohne uns. Mom hat Mr Martin. Dad hat nur uns. Verstehst du? Wir müssen etwas tun, und wir müssen es jetzt tun. Oder es ist zu spät!
Emma brauchte mir das nicht zu erklären. Ich verstand das alles. Der Freund unserer Mutter, Mr Martin, war ins Haus unseres Vaters gezogen, kaum dass dieser es verlassen hatte. Sein Sohn Hunter ging auf ein Internat, aber er lebte bei uns, wenn er in den Ferien und an den Wochenenden nach Hause kam, und er war häufig zu Hause. Mr Martins Exfrau war schon vor langer Zeit nach Kalifornien gezogen, bevor wir die Familie überhaupt kannten. Mr Martin war »halbpensioniert«, was bedeutete, dass er viel Geld verdient hatte und jetzt viel Golf spielte.
Ich begriff, dass unsere Mutter unseren Vater, Owen Tanner, nie geliebt hatte. Sie ignorierte ihn so offenkundig und mit solchem Desinteresse, dass es schwer war, ihn einfach nur anzuschauen und den Schmerz zu sehen, der von seinem Körper abzustrahlen schien. O ja, unser Vater war traurig.
Ich erklärte Emma, dass ich die Traurigkeit unseres Vaters sehen könne. Was ich Emma nicht erzählte, war, dass ich auch noch andere Dinge sehen konnte. Ich konnte sehen, wie Mr Martins Sohn Emma ansah, wenn er von seiner Schule nach Hause kam, und wie Mr Martin seinen Sohn ansah, der Emma ansah, und die Art, wie unsere Mutter Mr Martin ansah, wenn er die beiden ansah. Und ich konnte sehen, dass das böse enden würde.
Aber in die Zukunft blicken zu können war eine wertlose Gabe, wenn man nicht die Macht hatte, die Zukunft auch zu ändern.
Als die Frau vom Gericht mich fragte, erklärte ich also, dass ich bei meinem Vater leben wollte. Ich sagte, meiner Ansicht nach würden sich die Dinge zu Hause schlecht entwickeln, mit Mr Martin und seinem Sohn. Ich glaube, Emma war überrascht von meinem Mut oder vielleicht auch verblüfft über den Einfluss, den sie auf mich zu haben schien. Auf jeden Fall justierte sie, nachdem ich diesen Zug auf dem Spielbrett getan hatte, ihren eigenen Kurs neu, stellte sich an die Seite unserer Mutter und besiegelte damit ein für alle Mal ihre Position als Lieblingskind. Ich hatte es nicht kommen sehen. Jeder glaubte ihr, und niemand glaubte mir, weil ich erst elf war und Emma dreizehn. Und weil Emma Emma war und ich ich.
Unsere Mutter war außer sich vor Zorn, weil die Leute, mit denen ich gesprochen hatte, dafür hätten sorgen können, dass wir nicht bei ihr leben würden. Wie konnte sie die beste Mutter der Welt sein, wenn sie keine Kinder mehr übrig hatte? Als sie den Sorgerechtsstreit gewonnen hatte, fand ich heraus, wie wütend sie wirklich war.
Nach allem, was ich für dich getan habe! Ich wusste, dass du mich nie geliebt hast!
In diesem Punkt irrte sie sich. Ich habe sie geliebt. Aber sie hat mir nie wieder die Haare gebürstet.
Und nenn mich nie wieder Mutter! Für dich bin ich Mrs Martin!
Als sich nach der Scheidung der Staub gelegt hatte, tanzten Emma und unsere Mutter zusammen in der Küche, während sie Schokoladenkuchen backten. Sie lachten hysterisch über YouTube-Videos von klavierspielenden Katzen oder Kleinkindern, die ungeschickt gegen Wände liefen. Sie fuhren samstags zum Schuhekaufen und sahen sich sonntags Real Housewives an. Und sie stritten sich fast jeden Tag, laut, schreiend, fluchend und boxend – die Art von Streit, die auf mich selbst nach Jahren des Zusehens immer wieder so wirkte, als gäbe es kein Zurück mehr. Doch am nächsten Tag, manchmal noch am selben Tag, lachten sie wieder zusammen, als sei nichts geschehen. Niemand entschuldigte sich. Es gab keine Diskussionen darüber, wie es besser laufen könnte. Es wurden keine Grenzen für die Zukunft gesetzt. Sie machten einfach so weiter.
Ich brauchte lange, bis ich ihre Beziehung begriff. Ich war immer bereit, den Preis für die Liebe meiner Mutter zu zahlen, gleichgültig, welchen Preis sie verlangte. Emma hingegen wusste etwas, das ich nicht wusste. Sie wusste, dass unsere Mutter unsere Liebe genauso brauchte wie wir ihre, vielleicht sogar noch mehr. Und sie wusste, dass sie, indem sie drohte, ihr diese Liebe zu entziehen, und den Preis ihrer Zuneigung in die Höhe trieb, unsere Mutter zum Nachgeben bewegen konnte. So ging es hin und her, fast täglich handelten sie ihren Pakt neu aus, änderten ständig die Bedingungen. Und sie suchten stets nach Wegen, ihre Macht am Verhandlungstisch zu vergrößern.
Ich wurde die Außenseiterin. Ich mochte schön sein, wie meine Mutter sagte, aber ich war schön wie eine Puppe, wie ein lebloses Ding, das die Menschen einmal ansahen, ehe sie wieder zur Tagesordnung übergingen. Bei Emma und unserer Mutter war das anders, sie hatten etwas, das Menschen anzog. Und so waren sie in ihrem Geheimclub erbitterte Konkurrentinnen um die Liebe der anderen, um die Liebe aller Menschen um sie herum. Ich konnte nur zusehen, aus einer Entfernung, die so gering war, dass ich die Eskalation jedes Mal kommen sah. Zwei Nationalstaaten in einem permanenten Kampf um Macht und Kontrolle. Es war unerträglich. Doch er dauerte an, dieser Krieg zwischen meiner Mutter und meiner Schwester, bis zu jenem Abend, an dem wir verschwanden.
Ich erinnere mich, was ich am Tag meiner Rückkehr empfand. Als ich an einem Sonntagmorgen im Juli Mrs Martins Haus erreichte, mein Zuhause, könnte man sagen (obwohl es sich nicht wie mein Zuhause anfühlte, nachdem ich so lange fort gewesen war), stand ich frierend draußen im Wald. Drei Jahre lang hatte ich unablässig über meine Rückkehr nachgedacht. Erinnerungen hatten sich nachts in meine Träume geschlichen. Lavendelseife und frische Minze in kaltem Eistee. Chanel No°5. Mr Martins Zigarren. Gemähtes Gras, gefallene Blätter. Das Gefühl der väterlichen Arme um mich. Tagsüber war die Angst mit meinen Gedanken durchgegangen. Sie würden alle wissen wollen, wo ich gesteckt hatte und warum ich verschwunden war. Und sie würden alles über Emma wissen wollen.
Die Nacht, in der wir verschwanden, verfolgte mich. Immer wieder ging ich jedes Detail durch. Reue hatte sich in meinen Eingeweiden eingenistet und fraß mich bei lebendigem Leib von innen auf. Ich hatte darüber nachgedacht, wie ich es ihnen erzählen, wie ich es erklären sollte. Ich hatte Zeit gehabt, zu viel Zeit, um mir die Geschichte so zurechtzulegen, dass man sie nachvollziehen konnte. Ich hatte sie überdacht und dann entwirrt, sie anschließend neu erdacht, während Selbstzweifel und Selbsthass das Skript löschten und neu schrieben. Eine Geschichte ist mehr als die Nacherzählung von Ereignissen. Die Ereignisse bilden die Skizze, den Umriss, aber es sind die Farben und die Landschaft und das Medium und die Hand des Künstlers, die aus ihr das machen, was sie am Ende ist.
Ich musste eine gute Künstlerin sein. Ich musste ein Talent entwickeln, wo keines existierte, und diese Geschichte so erzählen, dass man sie glaubte. Ich musste meine eigenen Gefühle für die Vergangenheit beiseiteschieben. Meine Gefühle für meine Mutter und Emma. Mrs Martin und Mr Martin. Mich und Emma. Ungeachtet meiner selbstsüchtigen, unbedeutenden Gefühle liebte ich meine Mutter und meine Schwester. Aber das verstehen die Menschen nicht, also durfte ich nicht selbstsüchtig und dumm sein. Ich musste die Person sein, von der sie wollten, dass ich sie war. Ich hatte nichts bei mir als die Kleider, die ich am Leib trug. Ich hatte keinen Beweis. Nichts, das mir Glaubwürdigkeit verlieh, außer der Tatsache meiner Existenz.
Ich stand frierend im Wald, von Furcht erfüllt zu scheitern. Es stand so viel auf dem Spiel. Sie mussten mir meine Geschichte glauben. Sie mussten Emma finden. Und um Emma zu finden, mussten sie nach ihr suchen. Es hing allein von mir ab, ob meine Schwester gefunden wurde.
Sie mussten mir glauben, dass Emma noch am Leben war.
2Dr. Abigail Winter, Forensische Psychologin, FBI
Abby lag im Bett, starrte an die Decke und dachte über das Ausmaß ihres Scheiterns nach. Es war sechs Uhr an einem Sonntagmorgen Mitte Juli. Die Sonne schien, ihr Licht ergoss sich durch die hauchzarten Vorhänge in den Raum. Abbys Kleider lagen verstreut auf dem Boden herum, abgeworfen bei dem Versuch, in dieser schwülen Sommerhitze Linderung zu finden. Die Klimaanlage hatte wieder zu scheppern begonnen, und sie hatte die Stille der Kälte vorgezogen. Doch jetzt waren ihr selbst die Bettlaken auf der Haut zu viel.
Ihr Kopf pochte. Ihr Mund war trocken. Beim Geruch von Scotch, der aus einem leeren Glas aufstieg, drehte sich ihr der Magen um. Zwei Drinks um Mitternacht hatten ihren ruhelosen Geist überwältigt und ihr ein paar Stunden Erleichterung verschafft. Und wie es aussah, auch einen Kater.
Am Fußende des Bettes stöhnte ihr Hund und hob den Kopf.
»Sieh mich nicht so an«, sagte sie. »Das war es wert.«
Drei Stunden Schlaf würden sie durch den Tag bringen, an dem sie ihren Papierkram nacharbeiten konnte. Zu zwei Fällen waren die Berichte fällig, dazu kamen die Korrekturen an einer eidesstattlichen Aussage, die sie im Februar gemacht hatte – als könnte sie sich noch daran erinnern, was sie vor so langer Zeit zu irgendeinem Thema gesagt hatte.
Doch dies war kein Sieg über ihren Geist – den Geist, der ihren Körper kontrollierte und bisweilen die Absicht zu haben schien, ihn zu zerstören.
Ihre Überlegungen wurden vom Klingeln des Telefons auf dem Nachttisch unterbrochen. Ihr Körper schmerzte, als sie am leeren Glas vorbei danach griff. Die Nummer kannte sie nicht.
»Hier ist Abby.« Sie setzte sich auf und wickelte sich das verdrehte Laken um den Körper.
»Hey, Kleines – hier ist Leo.«
»Leo?« Sie richtete sich auf. Zog das Laken höher. Nur eine Person nannte sie mit ihren zweiunddreißig Jahren »Kleines«, und das war Special Agent Leo Strauss. Seit über einem Jahr hatten sie nicht mehr zusammengearbeitet. Seit er sich nach New York hatte versetzen lassen, um in der Nähe seiner Enkelkinder zu sein. Trotzdem traf seine Stimme sie direkt ins Herz. Er war so etwas wie Familie für sie gewesen.
»Hör zu. Hör einfach nur zu«, sagte er. »Ich weiß, es ist eine Weile her.«
»Was ist los?« Abbys Gesichtszüge wurden hart.
»Cassandra Tanner ist nach Hause gekommen.«
Sofort war Abby auf den Beinen und suchte nach sauberen Klamotten. »Wann?«
»Vor einer halben Stunde, vielleicht weniger. Sie ist heute Morgen aufgetaucht.«
Das Telefon zwischen Schulter und Ohr geklemmt, schlüpfte Abby in Bluse und Jeans.
»Wo?«
»Bei den Martins zu Hause.«
»Sie ist zu ihrer Mutter gegangen?«
»Ja, aber ich bin mir nicht sicher, was das zu bedeuten …«
»Emma?«
»Sie war allein.«
Abby knöpfte ihre Bluse zu und stolperte ins Badezimmer. Sie spürte, wie ihr Adrenalinspiegel stieg, ihre Knie zitterten.
»Ich bin schon auf dem Weg zum Auto … O Mann …«
Ein langes Schweigen ließ sie innehalten. Sie nahm das Telefon in die Hand und stützte sich am Waschbecken ab.
»Leo?«
Abby hatte die Tanner-Schwestern nicht vergessen. Keinen Tag, keine Minute. Die Fakten aus den Ermittlungen zu ihrem Verschwinden hatten schlummernd in den schattigen Winkeln ihres Bewusstseins gewartet. Aber das war nicht dasselbe wie vergessen. Sie waren da, auch nach einem Jahr, in dem sie nicht mehr mit dem Fall befasst war. Sie steckten ihr in den Knochen. In ihrer Haut. Mit jedem Atemzug atmete sie sie ein und aus. Die vermissten Mädchen. Und die Theorie zu dem Fall, die niemand sonst glaubte. Ein Anruf, und der Damm war gebrochen. Alles kam zurück wie eine Flutwelle und riss die Beine unter ihr weg.
»Leo? Bist du noch da?«
»Ich bin da.«
»Sie haben dich von New York hinzugezogen?«
»Ja. Du wirst einen Anruf von New Haven mit dem offiziellen Auftrag bekommen. Ich wollte vorher sichergehen, dass bei dir alles in Ordnung ist.«
Abby blickte auf und in den Spiegel, während sie überlegte, was sie sagen sollte. Zwischen ihnen hatte es unschön geendet, nachdem der Fall erkaltet war.
»Ich bearbeite diesen Fall, Leo …«
»Okay … Ich wusste nur nicht, was bei dir gerade der Stand ist. Es heißt, du würdest eine Therapie machen …«
Mist. Abby ließ den Kopf hängen. Es war immer noch da, der Ärger oder vielleicht auch die Frustration oder Enttäuschung. Was immer es war, sie spürte, wie es durch die Besorgnis in seiner Stimme geschürt wurde.
Das FBI hatte ihr eine Therapie angeboten, und sie hatte angenommen. Es ist normal, so zu empfinden, hatte man ihr gesagt. Ja, hatte Abby damals gedacht. Sie wusste, dass es normal war. Manche Fälle gehen einem unter die Haut.
Alle waren sich einig, dass dieser Fall einen in den Wahnsinn treiben konnte. Niemand wusste, womit sie es eigentlich zu tun hatten. Mord, Entführung, Unfall? Sie hatten in Betracht gezogen, dass die Mädchen ausgerissen sein könnten, hatten an Sexualverbrecher, Terroranwerber und Internetstalker gedacht. Alles war möglich. Das Auto am Strand, die Schuhe eines der Mädchen in der Brandung. Sie hatten nichts gefunden, das den Schluss nahelegte, die Jüngere wäre bei ihr gewesen, bis auf Cass’ Haar – das sie bei einer ganzen Reihe von Gelegenheiten in Emmas Auto hinterlassen haben konnte. Es gab keine Hinweise darauf, dass sie geplant hätten, zusammen auszureißen. Und auch keine Hinweise auf ein Verbrechen, weder Mord noch Entführung, keins von beiden. Es gab keine Leichen, keine Verdächtigen, keine Motive, keine Fremde auf ihren Profilen in den sozialen Medien, keine Telefonnummern oder SMS-Nachrichten oder E-Mails. Keine auffälligen Veränderungen in den letzten Jahren. Die Wahrheit war, dass man genauso gut die NASA ins Spiel bringen und behaupten könnte, sie seien von Außerirdischen entführt worden.
Doch das war nicht der Grund gewesen, weshalb Abby zur Therapeutin gegangen war. Sie machte diesen Job, seit sie vor fast acht Jahren promoviert hatte. Sie hatte schon andere schwierige Fälle gehabt. Sie konnte sich an alle erinnern, sobald sie sie heraufbeschwor. Der brutale Überfall auf eine Prostituierte. Die Exekution eines Drogendealers aus der Nachbarschaft. Das Erhängen eines Hundes an einem Baum. Die Liste ging immer weiter – Fälle, die nie gelöst wurden, in denen nie jemand gerichtlich belangt wurde, in denen den Familien der Opfer und manchmal den Überlebenden angesichts der Ungerechtigkeit die Luft wegblieb.
Es war eine Erleichterung, mit einem anderen Profi zu reden. Obwohl Abby nie als Therapeutin gearbeitet hatte – Ich bin selbst zu verrückt, um mit Verrückten zu arbeiten, kalauerte sie früher –, bedeutete das nicht, dass sie nicht an die heilende Wirkung glaubte. Sprechen konnte neue Perspektiven eröffnen. Sprechen konnte die scharfen Kanten schleifen. Aber nach einem Jahr Reden, endlosem Reden, gingen ihr die Ermittlungen im Fall Tanner immer noch nah. Dass der Schmerz nicht mehr so tief saß, half ihr nicht beim Kampf gegen die Dämonen, die der Fall in der Dunkelheit der Nacht heraufbeschwor.
Und jetzt kamen die Therapiesitzungen wieder hoch, um sie zu quälen.
»Ich übernehme den Fall, Leo …«
»Okay, okay …«
»Was wissen wir? Hat sie irgendetwas gesagt?«
Abby hörte ein kurzes Seufzen, als sie sich vom Spiegel abwandte und in ihr Schlafzimmer zurückkehrte, um nach ihren Schuhen zu suchen.
»Nichts, Kleines. Sie hat geduscht. Hat etwas gegessen. Jetzt ruht sie sich aus, bis wir da sind.«
»Sie hat geduscht? Wie konnte das passieren?«
»Es war ihre Mutter. Sie hat nicht nachgedacht. Sie hatte schon beinahe die Waschmaschine angeworfen.«
»Mit Cass’ Kleidern? Vor der forensischen Untersuchung? O Mann!«
»Ich weiß … beeil dich einfach. Ruf mich an, wenn du im Auto sitzt.«
Das Telefon verstummte erneut, aber dieses Mal hatte er aufgelegt.
Mist! Mit rasendem Herzen zog sie ihre Schuhe an, rief nach dem Hund, der ihr durch das kleine Bauernhaus in die Küche folgte. Sie füllte ihm etwas Futter in die Schüssel. Kraulte ihn am Nacken. Öffnete die Hintertür, damit er hinauskonnte.
»Schlüssel, Schlüssel …«, sagte sie laut und kehrte suchend ins Wohnzimmer zurück. Sie hatte es eilig, zur Tür zu kommen. Zum Auto zu kommen. Zu Cassandra Tanner zu kommen.
Ihr wurde schwindelig, ihr Blick begann zu verschwimmen. Chronischer Schlafmangel hatte gewisse Nebenwirkungen. Sie blieb stehen und griff haltsuchend nach der Rückenlehne eines Stuhls.
Vor drei Jahren hatte niemand an ihre Theorie geglaubt, nicht einmal Leo, und er war wie ein Vater für sie gewesen. Ein ungelöster Fall war eine Sache. Eine andere war es, nicht alle Steine umgedreht zu haben.
Die Therapeutin hatte ihr zugehört, sie aber nicht verstanden. Sie sagte Dinge wie Ich kann verstehen, warum Sie auf diese Weise empfinden. Klassische Bestätigung der Gefühle. So etwas lernte man im ersten Semester an der Uni. Sie fragte nach, was nicht getan worden war. Sie ließ Abby immer wieder über die Familie reden, die Mutter, Judy Martin, die Scheidung, den neuen Vater, Jonathan Martin. Und über den Stiefbruder, Hunter. Zusammen hatten sie jedes Detail der Ermittlungen auseinandergenommen, auf eine Art und Weise, die Abby endlich Erleichterung und Trost bringen sollte.
Die Therapeutin – Sie haben getan, was Sie konnten.
Abby konnte noch immer die Überzeugung in ihrer Stimme hören. Sie konnte die Aufrichtigkeit in ihrem Gesicht sehen, auch jetzt, als Abby die Augen schloss, damit der Schwindel nachließ. Sie holte tief Luft und atmete vollständig aus. Ihre Hand umklammerte die hölzerne Rückenlehne des Stuhls.
Ihre gemeinsame Analyse der Ermittlungen war zu Abbys Bibel geworden, die Verse wiesen ihren umherirrenden, verzweifelten Gedanken einen Weg zur Rettung.
Vers eins. Die Normalität, die von allen Außenstehenden bestätigt wurde – Freunde, Lehrer, die Sozialarbeiterin der Schule. Cass beneidete ihre ältere Schwester. Emma war von Cass genervt. Cass war ruhig, aber entschlossen. Emma war freiheitsliebender. Manche benutzten das Wort undiszipliniert. Aber sie hatte ein College gesucht, hatte Bewerbungen verschickt. Alles deutete darauf hin, dass sie nur auf den Moment wartete, in dem sie zu Hause ausziehen konnte.
Die Therapeutin – Das klingt alles vollkommen normal, Abby. Sie kamen immer pünktlich zur Schule. Eine sehr angesehene Privatschule. Die Soundview Academy. Sie verbrachten die Sommerferien in teuren Ferienlagern, manchmal sogar in Europa. Sie trieben Sport. Hatten Freundinnen …
Abby war ungeduldig mit ihr geworden.
Vers zwei. Abby erklärte, dass die beiden für das, was immer ihnen zugestoßen sein mochte, anfällig gewesen sein mussten. Und dass diese Anfälligkeit in ihrem Elternhaus begründet war. So war es immer. Gleichgültig, wie solche Geschichten in den Nachrichten dargestellt wurden, Teenager wurden nicht auf geheimnisvolle Weise von ihrem Zuhause fortgelockt. Ein akutes traumatisches Ereignis. Chronische Vernachlässigung, Missbrauch, Instabilität, Dysfunktionalität. Die düstere Leere unerfüllter Bedürfnisse. Die Anfälligkeit für Sexualstraftäter, terroristische Gruppen, religiöse Fanatiker, regierungsfeindliche Extremisten. Der Täter fand einen Weg, um diese Bedürfnisse zu stillen und ihnen zu geben, wonach sie sich sehnten. Der Täter wurde zur Droge. Der Teenager zum Süchtigen.
Sobald die anfängliche Hektik verebbt war und sie begriffen, dass die Mädchen schon längst verschwunden waren und sie langsam und methodisch ihr gesamtes Leben würden enträtseln müssen, hatte Abby sich der Familie zugewandt.
Als sie jetzt die Augen aufschlug, stand der Raum still. Da waren auch ihre Schlüssel, auf dem Tisch neben dem Stuhl, und sie nahm sie in die Hand. Sie ging zur Tür und ließ das grelle Sonnenlicht und eine Woge heißer, drückender Luft ins Haus.
Damals hatte niemand widersprochen. Tatsächlich hatten sich die gesamten Ermittlungen mehr auf das Innen konzentriert, auf die Familie und das Haus der Martins im Besonderen. Die Kriminaltechniker hatten ihre Arbeit im Haus beendet, Bankkonten, Kreditkarten, Telefonaufzeichnungen waren gesammelt und analysiert, Freunde und Nachbarn befragt worden.
Abby konnte sich noch an die Gespräche zu Beginn der Ermittlungen erinnern. Ja, ja, das sind alles gute Informationen. Alles hilft uns weiter. Mädchen im Teenageralter wurden vermisst. Wo Rauch war, musste auch Feuer sein – also suchten sie in der Nähe des Hauses nach der Glut.
Der Vater der Mädchen, Owen Tanner, war glücklich mit seiner ersten Frau verheiratet gewesen, bevor sie geboren wurden. Er und seine Frau hatten einen kleinen Jungen, Witt. Sie besaßen ein nettes Haus, und die Familie hatte Geld. Owen arbeitete in New York City bei einer Importfirma, die seiner Familie gehörte. Sie hatten sich auf Gourmetspeisen spezialisiert, was seiner Leidenschaft entgegenkam. Er hatte ein gesundes Selbstvertrauen und brauchte das Einkommen nicht, aber seine Frau fand, es täte ihm gut, regelmäßig zur Arbeit zu gehen. Ironischerweise lernte er ausgerechnet dort Judy York kennen, die sexy Brünette mit großen Brüsten und einer unwiderstehlichen Persönlichkeit. Owen hatte sie eingestellt, damit sie sein Büro managte.
Nach der Affäre, seiner Scheidung und der neuen Ehe bekamen Judy und Owen innerhalb von vier Jahren zwei Mädchen. Laut Owen war Judy keine ideale Bezugsperson für ihre kleinen Töchter. Sie wäre durchaus dazu imstande, betonte er. Aber sie wollte nicht. Owen sagte, sie habe jede Nacht zwölf Stunden geschlafen, sich dann Reality-Shows im Fernsehen angeschaut und sei anschließend den ganzen Tag shoppen gewesen. Um fünf Uhr nachmittags öffnete sie eine Flasche Wein, und um zehn, wenn sie ins Bett ging, war diese leer. Sie sprach verwaschen, und diese unwiderstehliche Persönlichkeit wurde plötzlich abstoßend. Angeblich habe sie ihm erklärt, sie habe ihren Teil der Arbeit geleistet, indem sie die Mädchen zur Welt gebracht habe.
Da läutete die erste Alarmglocke.
Jetzt, wo ihre Bibel aufgeschlagen war und die Verse herauspurzelten, sprang Abby in ihr Auto, als könnte sie ihnen irgendwie entkommen. Nichts von alldem war jetzt noch wichtig. Weil Cassandra Tanner zu Hause war. Weil sie bald die Wahrheit erfahren und wissen würde, ob sie recht gehabt hatte oder nicht. Weil sie bald wissen würde, ob sie die Mädchen hätte retten können, egal, vor was.
Agent Leo Strauss hatte die Ermittlungen damals geleitet. Sie hatten nicht zum ersten Mal zusammengearbeitet, und ihr Verhältnis war eng und vertrauensvoll. Er war ihr Mentor gewesen, bei der Arbeit und im Leben. Seine Familie hatte sie an Feiertagen eingeladen. Seine Frau, Susan, hatte ihr zum Geburtstag Kuchen gebacken. Zwischen ihnen hatte eine Verbindung bestanden, die es Abby schwergemacht hatte zu verbergen, was sie dachte. Dass Judy Owen Tanner verführt hatte. Dass sie ihre Kinder vernachlässigt hatte. Dass sie eine Affäre mit einem Mann vom Country Club hatte. Über den erbitterten Sorgerechtsstreit. Und über das vergiftete Zuhause, das Judy ihren Töchtern mit Jonathan Martin und dessen Sohn Hunter geschaffen hatte.
Abby hatte erwartet, die Ermittlungen würden zielstrebig in diese Richtung gelenkt werden, sobald sie die Scheidungsunterlagen bekommen hatten, vor allem den Bericht der Anwältin, die die beiden Kinder vertreten hatte. Der Prozesspflegerin, wie sie in Connecticut genannt wurden. Da war sie, in einem unabhängigen Bericht – die Stimme von Cassandra Tanner, vier Jahre vor ihrem Verschwinden. Sie erzählte ihnen, dass in diesem Haus etwas nicht stimmte. Etwas mit Emma und Jonathan Martin und Hunter. In Abbys Ohren klang es wie ein Geist aus der Vergangenheit, der ihnen verriet, wo sie zu suchen hatten.
Dieser Bericht war die zweite Alarmglocke. Aber die Forensiker hatten ihre Theorie nicht unterstützt.
Vers drei.
Die Therapeutin – Was glaubten Sie, was sie mit diesem Bericht aus der Scheidungsakte tun würden? Nachdem sämtliche kriminaltechnischen Untersuchungen nichts erbracht haben? Das Haus, die Telefone, das Geld? Alles, was sie gefunden haben, war ein zerbrochener Bilderrahmen – war es nicht so? Von dem die Mutter sagte, er sei beim Streit der Mädchen um die Halskette zerbrochen?
Abby glaubte, man würde ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag geben. Sie glaubte, man würde zwingend weitere Befragungen durchführen. Sie glaubte, alle würden sehen, was sie sah.
Die Therapeutin – Die Frau, die während der Scheidung diesen Bericht geschrieben hat, die Prozesspflegerin – sie hat Cass’ Sorgen wegen den Martins nicht gelten lassen, oder?
Ja, das hatte sie. Aber sie war eine inkompetente Pfuscherin. Sie hatte die Ängste eines elfjährigen Mädchens abgetan und stattdessen der Mutter geglaubt – hatte geglaubt, das Mädchen würde lügen, um ihrem Vater zu helfen.
Die Therapeutin – Weil der Vater, Owen, wegen der Affäre und der Scheidung am Boden zerstört war, stimmt’s? Eltern machen so etwas, wenn sie um das Sorgerecht streiten. Sie benutzen die Kinder …
Ja, das tun sie. Aber Owen stimmte einer Einigung zu, er wollte die Kinder schonen. Jeder, der in diesem Bereich arbeitet, weiß, dass die Partei, der die Kinder am meisten am Herzen liegen, normalerweise verliert. Und Owen hatte verloren. Es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass er seiner Tochter gesagt hatte, sie solle lügen.
Und dann war da noch die Sache mit der Halskette.
Vers vier.
Die Therapeutin – An diesem Punkt beschlossen Sie, das psychiatrische Gutachten einzufordern? Als Sie das mit der Halskette herausfanden?
Judy Martin hatte die Geschichte der Presse erzählt. Dass sie die Silberkette mit dem Anhänger in Form eines fliegenden Engels für Emma gekauft habe und dass Cass bitterlich eifersüchtig gewesen sei – und dass sich ihre Töchter deswegen am Abend ihres Verschwindens gestritten hätten.
Allerdings entsprach das nicht der Wahrheit. Leo befragte die Frau, die Judy die Kette verkauft hatte – ein Stück Modeschmuck für zwanzig Dollar. Die Frau war die Inhaberin des Geschäfts, eines kleinen Ladens, der auf Mädchen im Teenageralter ausgerichtet war und überteuerte Jeans, kurze Miniröcke und trendigen Wegwerfschmuck verkaufte. Sie kannte die Mädchen und ihre Mutter. Sie kauften seit Jahren bei ihr ein, und die Mutter wurde es nie müde, mit einer Flüsterstimme, die im ganzen Laden zu hören war, ihre Verachtung für die Waren kundzutun.
Die Frau erinnerte sich an zwei Begebenheiten mit Judy Martin und der Halskette. Beim ersten Mal waren Judy, Cass und Emma hereingeschneit, um ein wenig zu stöbern, während sie Schulsachen einkauften. Das jüngere Mädchen, Cass, nahm die Kette und seufzte. Sie bat ihre Mutter, ihr die Kette zu kaufen. Judy Martin nahm sie ihr mit den Worten aus der Hand, dass es billiger Schund sei und sie eigentlich einen besseren Geschmack haben sollte. Das Mädchen bat erneut, erklärte der Mutter, wie sehr ihr die Kette gefalle. Der Engel erinnere sie an Tinker Bell aus Peter Pan – und das sei ihr Lieblingsbuch gewesen, als sie klein war. Offensichtlich hatte ihr Vater es ihr jeden Abend vorgelesen. Peter Pan. Das half ihr nicht im Geringsten. Judy Martin wies sie nur noch strenger zurecht, dann verließ sie das Geschäft. Beide Mädchen folgten ihr. Die ältere, Emma, stieß die Schwester mit der Schulter an, so dass Cass stolperte. Emma hielt sich die Hand in Form eines Ls an die Stirn. Loser.
Am nächsten Tag kam Judy Martin erneut in den Laden und kaufte die Halskette. Die Frau erinnerte sich daran, gelächelt zu haben, denn sie glaubte, die Mutter würde die Kette für die Tochter kaufen, die sie sich gewünscht hatte – für die jüngere. Leo hatte sie gefragt, mit zwei Bildern in den Händen – Sind Sie sicher, dass es dieses Mädchen war, Cass Tanner, und nicht dieses, Emma Tanner, das sich die Kette ausgesucht hatte? Die Besitzerin des Ladens war sich sicher. Als ich dieses Interview mit der Mutter las, konnte ich es kaum glauben. Sie hat gesagt, sie habe die Kette für die ältere Tochter gekauft, für Emma. Und vermutlich stimmte das auch, oder? Sie hat doch die Kette Emma gegeben, nicht der anderen Schwester, die sie sich gewünscht hatte?
Emma hatte die Kette jeden Tag getragen. Freunde bestätigten es. Ihr Vater bestätigte es. Die Schule bestätigte es. Es bestand kein Zweifel daran, dass Judy Martin noch einmal in den Laden gegangen war, um Emma die Kette zu kaufen. Emma, nicht Cass.
Die Therapeutin dachte darüber nach. Vielleicht hat die Verkäuferin sich geirrt, Abby.
Das hatte Leo auch gedacht. Die ganze Abteilung hatte das gedacht, als sie ihre Theorie zu der Familie verwarfen, nachdem die Zeugenaussagen nichts Belastbares zutage gefördert hatten – und nachdem die Familie angefangen hatte, mit Anwälten und tränenreichen Interviews zurückzuschlagen.
Aber Abby kannte die Wahrheit. Genau so handelten sie, Menschen wie Judy Martin. Sie waren wahre Meister der Täuschung und unbarmherzig in ihren Manipulationen. Abby hatte diese Dinge nicht nur studiert, sie hatte sie erlebt.
Vers fünf.
Die Therapeutin – Gab es jemals eine Diagnose? Bei Ihrer Mutter?
Nein. Nie. Und Abby war das einzige Familienmitglied, das wusste, dass es etwas gab, das diagnostiziert werden müsste. Nicht ihr Vater. Nicht ihre Stiefmutter. Und nicht einmal ihre Schwester Meg, die bis zum heutigen Tag ihre Mutter für zu zügellos und freiheitsliebend hielt.
Die Therapeutin – Glauben Sie, dass das der Grund ist, warum Sie sich diesem Fachgebiet widmen? Weshalb Sie Ihre Doktorarbeit über den Teufelskreis des Narzissmus in Familien geschrieben haben?
Und was bewies das? Psychologie zu studieren war keine bewusste Entscheidung gewesen. Aber als Abby zum ersten Mal etwas über Narzissmus und narzisstische Persönlichkeitsstörungen gelesen hatte, hatte das Adrenalin sie so hart und schnell überschwemmt, dass sie auf die Knie gesunken war. An Ort und Stelle in der Bücherei in Yale. Direkt vor ihrer Zimmergenossin, die glaubte, der Schlag hätte sie getroffen. Abby hätte sich am liebsten auf dem Boden zusammengerollt und wäre darin geschwommen – in dem Begreifen, das aus den Worten des Lehrbuchs herauströpfelte.
Es war eine Krankheit, von der alle glaubten, sie zu kennen. Jedem Mädchen, das zweimal am Tag in den Spiegel schaute, und jedem Jungen, der nie anrief, wurde das Etikett »Narzisst« angehängt. Bücher und Filme bezeichneten jeden selbstsüchtigen Charakter als »Narzissten«, aber dann kommt es zur Erlösung und Aussöhnung, am Ende des Tunnels schimmert ein Licht auf. Nur wenige Menschen wussten, was diese Krankheit wirklich bedeutete. Wie sie sich wirklich auswirkte. Es gab keine Erlösung. Oder Aussöhnung. Kein Licht am Ende des Tunnels. Es war die Kombination aus Fehlwahrnehmung und Überbeanspruchung, die diese Krankheit so gefährlich machte.
Vers sechs.
Die Therapeutin – Lassen Sie es uns durchspielen. Angenommen, Sie hätten stärker nachgebohrt – das Gericht hätte psychiatrische Gutachten angefordert, hätte sich mit der lokalen Presse angelegt, die sich offen hinter die trauernden Eltern gestellt hat. Angenommen, man hätte herausgefunden, dass Judy unter irgendeiner Persönlichkeitsstörung litt. Dass Owen Tanner vielleicht eine Depression hatte. Und dass Jonathan Martin womöglich ein Alkoholiker war und sein Sohn ADHS hatte. Und so weiter – angenommen, man hätte herausgefunden, dass hier jede Menge psychiatrischer Störungen vorlagen. Das bedeutet nicht, dass man auch die Mädchen gefunden hätte.
Und da war es – das Rettungsboot. Abby war hineingeklettert, und es hatte sie gerettet. Jedes Mal, wenn sie herausfiel – wenn sie an diese Halskette dachte, wenn die dritte Alarmglocke schrillte, die sie zweifelsfrei überzeugt hatte, dass die Familie etwas mit dem Verschwinden der Mädchen zu tun hatte –, kletterte sie wieder zurück ins Boot und rettete sich selbst vor dem Ertrinken.
Es hätte sie möglicherweise nicht gerettet.
Es hätte sie möglicherweise nicht gerettet.
Dieser Vers, dieses Rettungsboot, hatte Abby gerettet. Aber er hatte ihr nicht einen Moment des Friedens gebracht.
Als sie aus der Ausfahrt fuhr und das Sonnenlicht ihr in die Augen stach, blätterte sie die letzte Seite der Bibel um, zu dem einen Vers, der leer geblieben war. Der Vers, der noch nach Worten schrie. Nach Antworten. Und sie konnte die Hoffnung nicht loslassen, dass er jetzt endlich geschrieben werden würde.
3Cass
Ich lag im Bett, meine Mutter hielt mich im Arm. Mein Haar war nass, und ich konnte spüren, wie das Wasser in das Kissen eindrang und sich kalt an meiner Wange anfühlte. Sie weinte. Schluchzte.
O Cassandra! Mein Baby! Mein Baby!
Ich hatte mir diesen Moment seit drei Jahren ausgemalt. Aber auch nach all der Zeit, in der ich mich hatte vorbereiten können, war ich doch erschreckend unvorbereitet.
Ihr Körper fühlte sich zerbrechlich an, und ich versuchte, mich an das letzte Mal zu erinnern, als ich ihn gespürt hatte. Nach dem Sorgerechtsstreit hatte sie mir körperliche Zuwendungen größtenteils verweigert, aber nicht gänzlich. Zu besonderen Gelegenheiten gab es Umarmungen, vor allem an ihrem Geburtstag und zum Muttertag, weil unser Vater uns Geld gab, damit wir ihr Geschenke kaufen konnten. Ich erinnerte mich nicht, dass es sich so angefühlt hatte. Harte Knochen.
»Mein Baby! Ich danke dir, Gott! Danke!«
Auf was ich nicht gefasst gewesen war, woran ich nicht ein einziges Mal gedacht hatte, während ich mich jahrelang auf den Moment meiner Rückkehr vorbereitete, war ihr Gesichtsausdruck, als sie mich vor weniger als einer Stunde auf ihrer Veranda wiedergesehen hat.
Ich hatte neunzig Sekunden gewartet, ehe ich klingelte. Ich zählte die Sekunden in meinem Kopf, was ich schon tue, solange ich denken kann. Ich kann perfekt Sekunden zählen und darauf aufbauend Minuten und sogar Stunden. Ich musste viermal läuten, ehe ich Schritte die Holztreppe aus dem ersten Stock herunterkommen hörte. Das Haus, in dem wir lebten, war überdurchschnittlich groß, aber dort, wo wir lebten, kostete ein durchschnittliches Haus über eine Million Dollar. Es war in den 1950er Jahren im traditionellen weißen Kolonialstil erbaut worden, hatte drei Anbauten und eine Veranda und war unzählige Male renoviert worden. Seit wir verschwunden waren, hatte Mrs Martin weitere Umbauten vornehmen lassen. Ich sah einen Wintergarten und ein Arbeitszimmer an der Stelle, an der einst ein kleiner Garten gewesen war. Wir besaßen außerdem zwei Hektar Land, ein Poolhaus, einen Tennisplatz sowie einen Wald, in dem man sich verlaufen konnte. Land war ziemlich teuer hier. Und obwohl das Haus immer noch klein genug war, um meine Mutter die Treppe herunterkommen zu hören, war es dennoch die Treppe eines sehr teuren Anwesens. Sie würde wollen, dass ich das klarstelle.
Als ich hörte, wie die Tür aufgeschlossen wurde, spürte ich, wie der Boden unter meinen Füßen nachgab. Tausende Male war ich durch diese Tür gegangen, hinter Emma, nach Emma Ausschau haltend, nach Emma rufend. Jedes Gesicht, das meine Schwester je gezeigt hat, verändert von Stimmungen, vom Älterwerden und den Spuren der Zeit, hatte ich wie eine Warnung vor Augen, als sich die Tür langsam öffnete. Ich sagte beinahe ihren Namen. Ich spürte ihn in meinem Mund. Emma. Ich wollte auf die Knie sinken, die Augen in meinen Händen vergraben und mich hinter meiner Schwester verstecken, wie ich es als Kind getan hatte. Ohne sie fühlte ich mich nicht in der Lage, das zu tun, was getan werden musste.
Doch dann sah ich die erste Strähne vom Haar meiner Mutter hinter jener Tür, und die Gesichter meiner Schwester verschwanden. Ich wurde ganz ruhig.
Mrs Martin hatte sich in einen seidenen Morgenmantel gewickelt. Ihre Haare waren nach einem unruhigen Schlaf zerzaust, und eine dicke Schicht Augen-Make-up klebte unter ihren Wimpern.
»Ja, bitte?«
Sie stellte diese Frage mit einer Prise Höflichkeit, aber darunter lag ein Berg der Verärgerung. Es war sechs Uhr morgens an einem Sonntag.
Sie sah mich an, musterte mein Gesicht, meine Augen, meinen Körper. Ich glaube nicht, dass ich mich sehr verändert hatte. Ich trug noch dieselbe Kleidergröße. Dieselbe Größe für Hosen und Oberteile, selbst beim BH. Mein Haar war noch immer hellbraun und reichte mir bis über die Schultern. Mein Gesicht war noch immer kantig, meine Brauen dicht und gebogen. Wenn ich in den Spiegel schaute, sah ich immer noch mich. Aber vermutlich ist genau das der Punkt – wir alle verändern uns so allmählich, jeden Tag ein wenig, dass wir es nicht bemerken. Wie der Frosch, der im Wasser bleibt, bis es kocht und der Frosch tot ist.
Der Moment, auf den ich nicht vorbereitet war – die eine Sache, an die ich in all den Jahren nicht im Traum gedacht hatte – war, dass meine Mutter mich nicht erkennen würde.
»Ich bin’s«, sagte ich. »Cass.«
Sie sagte nichts, aber ihr Kopf fuhr zurück, als hätten meine Worte ihr einen Schlag ins Gesicht versetzt.
»Cass?«
Sie schaute mich genauer an, ihre Augen traten regelrecht hervor, und ihr Blick sprang hektisch hin und her, musterte mich von Kopf bis Fuß. Ihre rechte Hand hob sich zum Mund. Mit der Linken packte sie den Türrahmen und fing ihren Körper ab, während sie auf mich zustolperte.
»Cass!«
Ich musste mich zwingen, die Füße stillzuhalten, als sie sich auf mich stürzte, meine Hände, die Arme, das Gesicht, mich überall berührte und befummelte. Ein kehliges Stöhnen entwich ihrem Körper.
Uhhhh!
Dann begann sie, nach Mr Martin zu schreien.
Auf diesen Teil hatte ich mich vorbereitet, und ich tat, was ich mir vorgenommen hatte. Ich ließ sie fühlen, was sie fühlte, und stand einfach nur da und tat nichts. Sagte nichts. Man sollte meinen, sie würde begeistert sein, beschwingt und voller Freude. Aber Mrs Martin hatte sich als trauernde Mutter mit zwei vermissten Töchtern neu erfunden, so dass meine Rückkehr einem schmerzhaften Zusammenbruch gleichkam.
»Jon! Jon!«
Die Tränen begannen zu fließen, als aus dem ersten Stock Schritte erklangen. Mr Martin rief laut: »Was zum Teufel ist denn los?«
Meine Mutter antwortete ihm nicht. Stattdessen packte sie mein Gesicht mit den Händen, drückte ihre Nase direkt auf meine und sagte meinen Namen in demselben kehligen Ton.
Caaaasss!
Mr Martin trug einen Pyjama. Er hatte zugenommen, seit ich ihn das letzte Mal gesehen hatte, und er sah noch älter aus, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ich hätte damit rechnen müssen. Aber wenn man jung ist, sind alle Menschen ab einem gewissen Alter einfach nur alt, und es besteht keine Notwendigkeit, sie sich noch älter vorzustellen. Er war sehr groß und sehr dunkel – Haare, Haut, Augen. Ich war nie gut darin gewesen, ihn zu durchschauen. Er war geschickt darin, seine Gefühle zu verbergen. Oder vielleicht hatte er auch nicht viele davon. Nur wenige Dinge machten ihn wütend. Noch weniger Dinge brachten ihn zum Lachen. Doch an diesem Tag entdeckte ich in seinem Gesicht etwas, das ich noch nie zuvor darin gesehen hatte – vollkommene Fassungslosigkeit.
»Cass? Cassandra? Bist du das?«
Noch mehr Umarmungen. Mr Martin rief die Polizei an. Als Nächstes rief er bei meinem Vater an, aber der nahm nicht ab. Ich hörte, wie er eine Nachricht hinterließ, er sagte nur, es sei wichtig und er solle sofort zurückrufen. Ich fand es sehr rücksichtsvoll von ihm, meinem Vater die schockierenden Details nicht auf dem Anrufbeantworter zu hinterlassen, und ich geriet ins Grübeln, ob er sich womöglich geändert hatte.
Sie stellten mir die Fragen, mit denen zu rechnen war. Wo war ich gewesen? Was war mir zugestoßen? Als ich nicht darauf antwortete, hörte ich sie miteinander flüstern. Sie kamen zu dem Schluss, dass ich traumatisiert sei. Mr Martin schlug vor, sie sollten weiterfragen, bis ich antwortete. Meine Mutter stimmte zu.
»Cass – erzähl uns, was passiert ist!«
Ich antwortete nicht auf ihre Fragen. »Wir brauchen die Polizei!«, weinte ich stattdessen. »Sie müssen Emma finden! Sie müssen sie finden!«
Die Zeit schien sehr lange stillzustehen, dabei waren es nur acht Sekunden. Mr Martin warf meiner Mutter einen Blick zu. Meine Mutter beruhigte sich und begann, mir übers Haar zu streichen, als wäre ich eine zerbrechliche Puppe, die sie nicht kaputtmachen wollte – und von der sie nicht wollte, dass sie sich bewegte oder sprach.
»Okay, Liebes. Beruhige dich einfach.«
Sie hörte auf, mir Fragen zu stellen, aber meine Hände zitterten. Ich sagte ihr, dass ich fror, und sie ließ mich heiß duschen. Ich sagte ihr, ich hätte Hunger, und sie machte mir etwas zu essen. Ich sagte ihr, ich sei müde, und ich durfte mich hinlegen. Meine Mutter blieb bei mir, und ich tat, als würde ich schlafen, während ich heimlich das Chanel No°5 einsog, das ihr Hals verströmte.