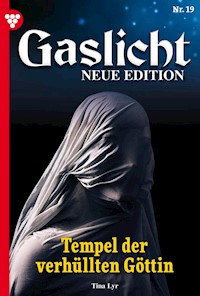Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Gaslicht
- Sprache: Deutsch
In dieser neuartigen Romanausgabe beweisen die Autoren erfolgreicher Serien ihr großes Talent. Geschichten von wirklicher Buch-Romanlänge lassen die illustren Welten ihrer Serienhelden zum Leben erwachen. Es sind die Stories, die diese erfahrenen Schriftsteller schon immer erzählen wollten, denn in der längeren Form kommen noch mehr Gefühl und Leidenschaft zur Geltung. Spannung garantiert! »Was geht hier vor?«, fragte Samantha scharf. »Bitte, Mutter Hubbard, ich habe ein Recht darauf, es zu erfahren.« Die Greisin wand sich vor Verlegenheit. Sie musste jedes Wort einzeln abringen. »Es … geht um …, um die Hexe«, stieß sie mit erstickter Stimme hervor. »Um die Hexe?« Das klang nach einer faustdicken Lüge! »Ja, um Tabitha Shelby«, bestätigte Mutter Hubbard. Was es mit Tabitha Shelby auf sich hatte, sollte Samantha nicht mehr erfahren. Pechvogel Tony hatte soeben zu seinem neuesten Schlag ausgeholt. Im dichtbesiedelten Osten der Vereinigten Staaten gibt es abgelegene kleine Orte, die ihren traditionellen puritanischen Charakter bis heute bewahrt haben. Eine solche Gemeinde ist Heaven's Glory im Bundesstaat Connecticut. Moderne Geistesströmungen finden hier keinen Widerhall. Die Menschen halten sich an die Regeln, die ihre Vorväter vor rund dreieinhalb Jahrhunderten aufgestellt haben. Oberstes Gesetz sind die Zehn Gebote, höchste Instanz ist die Bibel. Über Tugend und Sittsamkeit wacht Tobias Amsdale, der Pfarrer, dessen Einfluss bis in die Ehebetten reicht. Eine ganze Schar von Zuträgern ist ihm zu Diensten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gaslicht – 60 –Hexenjagd
Unveröffentlichter Roman
Tina Lyr
»Was geht hier vor?«, fragte Samantha scharf. »Bitte, Mutter Hubbard, ich habe ein Recht darauf, es zu erfahren.« Die Greisin wand sich vor Verlegenheit. Sie musste jedes Wort einzeln abringen. »Es … geht um …, um die Hexe«, stieß sie mit erstickter Stimme hervor. »Um die Hexe?« Das klang nach einer faustdicken Lüge! »Ja, um Tabitha Shelby«, bestätigte Mutter Hubbard. Was es mit Tabitha Shelby auf sich hatte, sollte Samantha nicht mehr erfahren. Pechvogel Tony hatte soeben zu seinem neuesten Schlag ausgeholt. Mit einem ohrenbetäubenden Knall flog der Schuppen in die Luft …
Im dichtbesiedelten Osten der Vereinigten Staaten gibt es abgelegene kleine Orte, die ihren traditionellen puritanischen Charakter bis heute bewahrt haben. Eine solche Gemeinde ist Heaven’s Glory im Bundesstaat Connecticut. Moderne Geistesströmungen finden hier keinen Widerhall. Die Menschen halten sich an die Regeln, die ihre Vorväter vor rund dreieinhalb Jahrhunderten aufgestellt haben.
Oberstes Gesetz sind die Zehn Gebote, höchste Instanz ist die Bibel. Über Tugend und Sittsamkeit wacht Tobias Amsdale, der Pfarrer, dessen Einfluss bis in die Ehebetten reicht. Eine ganze Schar von Zuträgern ist ihm zu Diensten. Wer strauchelt – und sich dabei ertappen lässt, wird am Sonntag von der Kanzel herab zurechtgewiesen. Das ist demütigend, beschämend. Es hat sich also wenig geändert seit den Zeiten, da ein Missetäter auf dem Pranger zur Schau gestellt und vom Volk begafft wurde. Barmherzigkeit sei ein Privileg Gottes und Züchtigung die Aufgabe seines Dieners, meinte Reverend Amsdale. Die Bigotterie treibt Blüten.
Auch äußerlich widerspiegelt das Ortsbild etwas vom Geist des frühen siebzehnten Jahrhunderts. Wie in vielen neuenglischen Gemeinden scharen sich die ältesten, noch aus der Siedlungszeit stammenden Häuser um den ehemaligen Dorfanger. Eines davon ist das alte Magistratsgebäude, heute Amtssitz von Bürgermeister Forbes. Davor steht, noch gut erhalten, der Pranger. Aus der gleichen Epoche stammen die Apotheke, die einstmals ein Barbierladen war; die Grundschule, das Gerichtsgebäude, die Polizeiwache, die Häuser der Marshalls, Fotheringhams, Hubbards und anderer, die zu den ersten Siedlerfamilien zählen.
Eine imposante Kirche im neogotischen Stil ist das größte und wichtigste Gebäude im Ort. Wie schon der Name Heaven’s Glory (Himmelsruhm) besagt, waren die Gründerväter gottesfürchtige Leute, die ihr Dorf in den Dienst des HERRN stellten. Auch ihre Nachfahren sind – von einigen Ausnahmen abgesehen – fleißige Kirchgänger. Trotzdem nimmt ihre Zahl ab. Viele junge Leute sind nicht mehr gewillt, sich in eine starre überholte Ordnung zu fügen, sie brechen aus und suchen ihr Glück woanders. Zuzüge sind selten, sie sind auch nicht erwünscht. Fremde gelten als Unruhestifter und werden weitgehend gemieden. Senta Marshall, die Mutter des Arztes, könnte ein Lied davon singen. Obwohl sie seit vierzig Jahren in Heaven’s Glory ansässig ist und überall mitmischt, haben die Alteingesessenen nicht vergessen, dass sie aus New York stammt und eigentlich nicht dazugehört.
Andersdenkende haben es in Heaven’s Glory sehr schwer. Unangepasste werden als Ketzer gebrandmarkt. Intellektuelle Freiheit passt nicht in eine Einheitsschablone. Die geistige Entwicklung der Jugend wird nach Kräften unterdrückt. Die Zwänge beginnen schon im Kindergarten.
In einer solchen Atmosphäre gedeiht ein besonderer Menschenschlag: er ist streng, freudlos, gefühlsarm, intolerant und selbstgefällig. Heuchelei ist den Leuten von Heaven’s Glory zur zweiten Natur geworden. Ihr rechtschaffenes Gebaren überdeckt eine gute Portion Grausamkeit, und hinter den sorgsam verputzten Fassaden der altehrwürdigen Häuser tut sich erstaunlich viel Hässliches.
Da ist Reverend Amsdale, ein engherziger religiöser Eiferer, der seine Pfarrkinder zu Spitzeldiensten anhält und den Abtrünnigen mit ewiger Verdammnis droht. Er predigt den rächenden Gott des Alten Testaments und kennt weder Liebe noch Vergebung.
Da ist Martha Haysmith, die Besitzerin des Supermarktes. Sie ist die ehrgeizigste Informantin des Pfarrers. Ihre bösartige Zunge hat schon viel Unheil und Verzweiflung angerichtet.
Da ist Bürgermeister Forbes, der sich immer auf die Seite derer schlägt, die besonders laut beten. Das Recht bleibt dabei oft auf der Strecke.
Da ist Giles Fotheringham, der tyrannische Patriarch seiner Sippe. Er gilt als achtbarer Mann, doch charakterlich ist er eine wahre Pest. Am liebsten umgibt er sich mit Duckmäusern. Wer nicht kuscht, wird kurzerhand verstoßen. Seiner Tochter ist es so ergangen.
Die Geschichte von Heaven’s Glory ist reich an geduldetem Unrecht, an ungesühnter Schuld. Lauterkeit ist eben ein Begriff, der sich wie Kaugummi dehnen lässt. Nur Verstöße gegen die Keuschheit werden als Sünde geahndet.
Das ist vor einhundert Jahren nicht anders gewesen.
Damals sind jene, die das Unglück auf Captain’s Fancy verursacht haben, straflos ausgegangen. Sie hatten den Pfarrer auf ihrer Seite. Noch heute gilt die Tragödie als »Gottesurteil«, der Überfall auf wehrlose Frauen und Kinder als »ein Gott wohlgefälliges Werk«. Der Acker des HERRN, heißt es, wurde von Disteln gesäubert.
Frömmigkeit hat manchmal ihren eigenen Zynismus.
Die Leute von Heaven’s Glory haben nichts dazugelernt. Sie sind stolz auf die Bluttat ihrer Vorfahren.
Für sie ist Captain’s Fancy ein unheiliger Ort, ein Schandfleck, der für immer von der Erde getilgt werden müsste.
Es gibt einige, die gegen den Strom schwimmen. Leute wie Dr. Marshall und seine Mutter. Sie stehen auf der Seite der Schwachen, der ewig Unterlegenen, der Opfer. Dieser Standpunkt war seit jeher unpopulär.
*
An einem Hügel östlich des Ortes, weit von den übrigen Häusern abgesetzt, erhebt sich Captain’s Fancy, ein romantisches rotes Backsteingebäude aus der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts. Der Volksmund nennt es »das Hexenauge«, nach einem mit farbigem Glas eingelegten Rundfenster, das wie ein großes schillerndes Auge über dem mit Efeu umwucherten Frontportal sitzt. Das kostbare Fenster war das Hochzeitsgeschenk von Kapitän Nathaniel Shelby, dem Erbauer des Hauses, an seine haitische Frau Tabitha. Bei einer gewissen Sonneneinstrahlung beginnt das Fenster zu glühen; seine kunstvolle Ornamentierung bricht sich auf dem gepflasterten Rondell vor dem Haus. Die idyllische Szenerie vermittelt den Eindruck von Ruhe, Wohlstand und Geborgenheit.
Das Bild täuscht.
Captain’s Fancy hat keinem seiner Herren Glück gebracht. Wer immer hier lebte, lernte Hass, Verzweiflung und Bitterkeit kennen. Das liegt nicht an dem Haus, sondern an der Gemeinde, zu der es gehört.
Schon für seine erste Herrin, Tabitha Shelby, war Captain’s Fancy kein behagliches Heim, das ihr das Gefühl von Sicherheit und Wärme gab. Vielmehr war es für sie ein unentrinnbares Ghetto, aus dem sie sich nicht herauswagen durfte. Sie war »anders« als ihre Nachbarn, das genügte für Hetzreden und Verteufelung. Eines Nachts zog eine Meute von Frömmlern los, um das Böse mit Stumpf und Stiel auszurotten. Das Ergebnis war grauenvoll. Tabitha Shelby, ihre beiden jüngeren Kinder und einige haitische Mägde verloren dabei das Leben.
Tabithas Erben kamen wieder und hielten die Stellung – trotzig, herausfordernd, verbittert. Zwei Generationen harrten in Captain’s Fancy aus, immer bemüht, in den Einheimischen so etwas wie Gewissensbisse zu wecken. Ein erfolgloses Unterfangen. Die Shelbys hätten ebenso gut an die Einsicht von Sonne und Mond appellieren können.
Seit etwa einem halben Jahr steht Captain’s Fancy leer. Ned Shelby, Tabithas Urenkel, hat die Gegend verlassen und das Anwesen zum Verkauf ausgeschrieben. Natürlich ist die Annonce nicht im Lokalanzeiger erschienen, denn kein Einheimischer wäre bereit, seinen Fuß ins »Hexenauge« zu setzen. Über das Haus sind wilde Geschichten im Umlauf.
Es soll dort nicht mit rechten Dingen zugehen. Tabitha Shelby sei zurückgekehrt, um ihr ruchloses Treiben fortzusetzen, heißt es. Auch der Tod habe ihre teuflische Macht nicht gebrochen.
Kein Wunder also, wenn die Einheimischen um den Hügel einen großen Bogen schlagen.
Neuerdings unterstützt selbst Mutter Hubbard, die uralte Hebamme des Ortes, das Gerede über den Spuk. Die Greisin gilt als glaubwürdige Zeugin. Sie ist eine der wenigen, die das Haus von innen kennt. Außerdem kümmert sie sich um die Pflanzen, die auf der Veranda von Captain’s Fancy wachsen.
Reverend Amsdale hat das Anwesen zwar nie betreten, doch er hält die Gerüchte für zutreffend. Die Seelen der Verdammten, sagt er, würden nie Ruhe finden. Ein unreiner Ort werde immer unrein bleiben. Es sei eine Brutstätte des Bösen.
Tatsächlich geschehen im Shelby-Haus seltsame Dinge. Gegenstände stehen nicht mehr an ihrem angestammten Platz. Es gibt leise, verstohlene Geräusche. Lichtfinger huschen über die Wände. In mancher Nacht blitzt das Glasmosaik über dem Portal auf.
Was in Captain’s Fancy wirklich vor sich geht, ist eines der dunklen Geheimnisse von Heaven’s Glory.
*
Eine grob gekieste Straße führte vom östlichen Ortsrand zu dem einsamen Anwesen am Hügel. Eine massive Steinmauer, die das Haus und den dazugehörigen Park einfasste, verwehrte ungebetenen Besuchern den Zutritt. Die Shelbys hatten es offenbar darauf angelegt, ihre Mitmenschen auf Distanz zu halten. Ob die Mauer ein Symptom für Weltflucht, Arroganz oder übertriebene Ängstlichkeit war, ob sie Feinde oder bloß Neugierige abwehren sollte, wusste Samantha Parker nicht. Sie hielt es auch für unwichtig.
Schwungvoll öffnete die junge Frau das hohe schmiedeeiserne Gittertor, das den öffentlichen Weg beendete, und setzte sich wieder hinters Steuer. Langsam rollte der Kombi über die abschüssige, mit Strauchrosen und Jasmin gesäumte Auffahrt. Auf einem halbkreisförmigen Vorhof kam der Wagen zum Stehen.
Samantha schaltete die Zündung ab, nickte ihrem Begleiter aufmunternd zu. »Aussteigen, Tony. Wir sind am Ziel.«
Behende glitt der Junge vom Beifahrersitz. Er pflanzte sich in der Mitte des Platzes auf und begutachtete kritisch seine neue Umgebung.
»Alle Wetter!«, stieß er ehrfürchtig hervor. »Bist du sicher, dass du dich nicht in der Adresse geirrt hast? Das ist ja ein richtiges Schloss.«
»Es ist himmlisch, nicht wahr?«, schwärmte Samantha.
Selbstzufrieden betrachtete sie das verwinkelte dreistöckige Gebäude, dessen stolze Eigentümerin sie seit knapp einer Woche war. Eigentlich hatte sie nur ein schlichtes Häuschen auf dem Land gesucht, ein Feriendomizil für sich und die Kinder. Das Projekt war einige Nummern größer ausgefallen, weil Ned Shelby den Besitz seiner Väter ausverkaufte. Samantha hatte spontan zugegriffen. Sie konnte es sich leisten, einmal unvernünftig zu sein. Ihr jüngstes Computerprogramm hatte ihr einen wahren Dollarregen beschert.
»Darf ich später im Weiher schwimmen?«, fragte Tony sehnsüchtig. Der Tag versprach heiß zu werden. Obwohl es noch nicht elf Uhr war, zeigte das Thermometer schon um die dreißig Grad.
Samantha riss sich vom Anblick des Hauses los und drehte sich um. In die Rasenfläche, die das gepflasterte Rondell umgab, war ein künstlicher kleiner See eingelassen. Algen und Seerosen schwammen darauf. Libellen flitzten dicht über die tiefgrüne Wasseroberfläche, auf der sich das Laubwerk hoher Bäume spiegelte. An der Stelle, wo das Mosaikfenster über dem Hauptportal vom Wasser reflektiert wurde, tanzten Myriaden bunter Lichtpunkte. Fröhliches Vogelgezwitscher untermalte die tiefe Stille, die über dem Anwesen lag.
»Schwimmen ist zu gefährlich, Professor. Im Teich wachsen Schlingpflanzen. Wenn du Lust hast, pumpen wir dein neues Paddelboot auf und lassen es feierlich vom Stapel.«
»Oh, prima«, rief Tony begeistert aus. »Du bist eine Wucht, Sammy.«
Die Frau lachte. »Du schmeichelst mir. Übernimm dich nicht.« Sie wies mit dem Kopf auf das Haus. »Wie gefällt es dir?«
Der Junge kickte mit der Spitze seines Turnschuhs einen Kieselstein fort. »Nicht übel«, sagte er beiläufig. Als er begriff, dass von ihm Enthusiasmus erwartet wurde, fügte er eilig hinzu: »Sieht irre gespenstisch aus.« Aus seinem Mund war es ein echtes Lob.
Samantha war gekränkt. »Es sieht überhaupt nicht gespenstisch aus«, widersprach sie schroff.
»O doch. Vielleicht fehlt dir die Antenne dafür.«
Tonys Charakterisierung war nicht aus der Luft gegriffen. Mit seinen vielen Türmchen, Giebeln und Erkern erinnerte Captain’s Fancy an ein verwunschenes Märchenschloss: zauberhaft, versponnen, bizarr. Der perfekte Hintergrund für eine Erzählung von Edgar Allen Poe. In der Finsternis, besonders in einer stürmischen Gewitternacht, musste das Haus recht unheimlich wirken.
Samantha hob die feinen schwarzen Brauen. »Du siehst zu viele Horrorfilme, Professor.«
»Eben«, erwiderte der Junge lakonisch. »Wetten, dass Captain Nats Geist hier spukt?«
Die Frau drehte die Augen himmelwärts. »Willst du kneifen?«
Der Elfjährige schnaubte entrüstet. »Kneifen? Ich? Du spinnst wohl! Ich mag alles, was gruslig ist.«
Samantha zwickte ihn liebevoll in die Wange. »Wir werden einen Geist aus England importieren, falls es dir zu langweilig wird.«
Das sonnenverbrannte Lausbubengesicht leuchtete hoffnungsvoll auf. »Kannst du das?«
Die Frau schmunzelte. »Klar«, spottete sie. Insgeheim fragte sie sich, ob es richtig von ihr war, den Jungen in diese Einsamkeit zu bringen. Mit seiner blühenden Phantasie konnte er auf die unmöglichsten Einfälle kommen.
»Im Dorf findest du sicher Freunde, Professor. Du darfst sie jederzeit zu uns einladen, wenn du magst.«
Tony, ein überzeugter Individualist, schob störrisch die Unterlippe vor. Über seiner Nasenwurzel erschien eine steile Unmutsfalte. Erstens kochte er gern sein eigenes Süppchen, zweitens schätzte er es nicht, wenn seine Terminpläne ignoriert wurden. Er würde in nächster Zeit furchtbar beschäftigt sein.
»Ich glaube nicht, dass ich mag«, entschied er.
Es war eine typische Parker-Antwort. Die Familie bestand aus lauter Einzelkämpfern. Nur Kay, Tonys quirlige Schwester, schlug ein bisschen aus der Art. Sie war ungeheuer gesellig und kannte – wie ihr Bruder Larry zu spotten pflegte – mehr Leute, als der Präsident der Vereinigten Staaten.
»Warten wir es ab«, sagte Samantha. »Nun komm.«
Sie wedelte verheißungsvoll mit ihrem Schlüsselbund. Der Junge setzte sich gemächlich in Trab.
Der überdachte, von zwei Säulen getragene Vorbau führte in eine große holzgetäfelte Halle, die mit kostbaren alten Möbeln ausgestattet war. Samantha zog die Vorhänge zurück, um das Tageslicht einzulassen. Strahlende Helligkeit erfüllte den Raum. Das Rundfenster über dem Eingang blitzte und funkelte wie eine riesige Brosche aus Edelsteinen.
Auf Tony machte die stilvolle Atmosphäre wenig Eindruck. Ihn faszinierten vielmehr die Reisetrophäen an den Wänden: Masken, Speere, Buschtrommeln und ähnlich exotische Dinge, die der legendäre Erbauer des Hauses von seinen Fahrten mitgebracht hatte. Das war fabelhaft. Alles andere war vorsintflutlicher Kram. Als zukünftiger Raumschiffkommandant und Glaxienbummler bevorzugte Tony eine Umgebung, die futuristisch genug war, um in eine Hotelhalle auf dem Mars zu passen.
»Wo ist der Fernseher, Sammy?«
»Keine Ahnung. Ich habe nicht darauf geachtet.«
»Du hättest dich vergewissern müssen, ob einer da ist«, sagte der Junge vorwurfsvoll. Die Vorstellung, dass er womöglich auf TV-Unterhaltung verzichten sollte, erschütterte ihn. Ohne Fernseher, verkündete er, sei ein zivilisiertes Leben undenkbar.
Samantha seufzte. Eine größere Suchaktion begann.
Ein triumphierendes Indiandergeschrei zeigte an, dass Tony fündig geworden war.
Der Apparat stand, mit einer Vitrine aus geschnitztem Walnussholz verkleidet, im Kaminzimmer, dem größten Raum in der unteren Etage. Es war vornehmlich im englischen Stil gehalten und mit antikem Mobiliar ausgestattet. Rötliches Mahagoniholz spendete einen warmen, behaglichen Ton. Die hohen französischen Fenster waren mit Vorhängen aus geblümtem Chintz drapiert. Auf dem dunklen Parkettfußboden lagen feine orientalische Teppiche und Brücken. Vor dem offenen Kamin luden bequeme Sessel zum Sitzen ein.
Tony erprobte sofort das Fernsehgerät und stellte zu seiner Beruhigung fest, dass es einwandfrei funktionierte. Er war nun imstande, seine Aufmerksamkeit auf andere Dinge zu lenken.
»Wer ist sie?«, fragte er und deutete mit dem Zeigefinger auf das Gemälde über dem Kamin. Es war das lebensgroße Porträt einer bezaubernd schönen Frau mit langen schwarzen Locken, feinen fremdländischen Zügen und dunklen, leicht melancholischen Augen. Ihr Alter war schwer zu bestimmen, doch sie musste wohl um die Dreißig sein. Sie sah rassig und ein wenig exotisch aus. Ihr samtbrauner Teint hatte die Farbe von hellem Milchkaffee, und an ihren Ohren glitzerten große goldene Ringe. Alles sprach dafür, dass sie nicht aus Heaven’s Glory stammte. Selbst ihr kapriziös geschnittenes weinrotes Abendkleid passte nicht zum hausbackenen Stil einer neuenglischen Landgemeinde. Roben wie diese pflegten elegante Damen in Paris, Mailand oder New York zu tragen. Nach der Mode zu urteilen, war das Porträt etwa um 1870 entstanden.
Samantha zuckte die Achseln. »Ich weiß nicht, wen das Bild darstellt. Ich habe den Makler danach gefragt, doch er konnte mir keine Auskunft geben. Wahrscheinlich handelt es sich um eine der Shelby-Damen.«