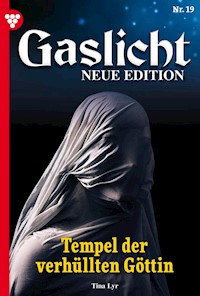Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Irrlicht - Neue Edition
- Sprache: Deutsch
Der Liebesroman mit Gänsehauteffekt begeistert alle, die ein Herz für Spannung, Spuk und Liebe haben. Mystik der Extraklasse – das ist das Markenzeichen der beliebten Romanreihe Irrlicht – Neue Edition: Werwölfe, Geisterladies, Spukschlösser, Hexen und andere unfassbare Gestalten und Erscheinungen erzeugen wohlige Schaudergefühle. Diese Serie enthält alles, was die Leserinnen und Leser von Mystik Romanen interessiert. Kaum lag ich im Bett, da fielen meine Augen wie von selbst zu. Schlaftrunken griff ich nach dem Lichtschalter, um meine Lampe auszuknipsen, als meine Finger ein kleines viereckiges Objekt aus Metall berührten. Verblüfft richtete ich mich auf und hob es auf. Mit einem Schlag war meine Müdigkeit wie fortgeblasen. Ich begann zu zittern. Mit fahrigen Handbewegungen rieb ich mir über die Augen. Dann ließ ich den Gegenstand auf meine Zudecke fallen. Nie wird Mama das private Sanatorium verlassen und in die Welt draußen zurückkehren. Nie wird sie das Jauchzen meiner Kinder hören oder geliebte Menschen erkennen. Serena St. Alban, die hochbegabte Malerin, Gastdozentin an den berühmtesten Kunstakademien der Welt, weiß nicht mehr, wer sie ist, wer sie war. Vielleicht ist es eine Gnade, daß sie, die keine Zukunft hat und in einer Region von Schatten dahindämmert, sich nicht an die Vergangenheit erinnert. Mir, ihrer einzigen Tochter, fällt es schwer, das Unabänderliche hinzunehmen. Wieviel Schönheit, wieviel Charme, wieviel künstlerisches Talent wurde mit Mama ausgelöscht. Aussicht auf Heilung besteht nicht. Serenas Gehirn ist unwiderruflich zerstört, ihr sprühender Geist tot. Seit über drei Jahren lebt Serena St. Alban hinter dicken Anstaltsmauern und Gitterfenstern, erst der Tod wird sie von ihrer trostlosen Existenz erlösen. Für mich, für meine gesamte Familie, wird sie stets eine große Persönlichkeit bleiben. Auch ihr Werk wird fortbestehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Irrlicht - Neue Edition – 14 –Warten auf Rebecca
Treffpunkt Rom – Wo bleibt die rätselhafte Freundin?
Tina Lyr
Kaum lag ich im Bett, da fielen meine Augen wie von selbst zu. Schlaftrunken griff ich nach dem Lichtschalter, um meine Lampe auszuknipsen, als meine Finger ein kleines viereckiges Objekt aus Metall berührten. Verblüfft richtete ich mich auf und hob es auf. Mit einem Schlag war meine Müdigkeit wie fortgeblasen. Ich begann zu zittern. Mit fahrigen Handbewegungen rieb ich mir über die Augen. Dann ließ ich den Gegenstand auf meine Zudecke fallen. Hätte ich in meinem Bett eine scharfe Handgranate gefunden, meine Entsetzen wäre nicht größer gewesen …
Nie wird Mama das private Sanatorium verlassen und in die Welt draußen zurückkehren. Nie wird sie das Jauchzen meiner Kinder hören oder geliebte Menschen erkennen. Serena St. Alban, die hochbegabte Malerin, Gastdozentin an den berühmtesten Kunstakademien der Welt, weiß nicht mehr, wer sie ist, wer sie war. Vielleicht ist es eine Gnade, daß sie, die keine Zukunft hat und in einer Region von Schatten dahindämmert, sich nicht an die Vergangenheit erinnert. Mir, ihrer einzigen Tochter, fällt es schwer, das Unabänderliche hinzunehmen. Wieviel Schönheit, wieviel Charme, wieviel künstlerisches Talent wurde mit Mama ausgelöscht. Aussicht auf Heilung besteht nicht. Serenas Gehirn ist unwiderruflich zerstört, ihr sprühender Geist tot.
Seit über drei Jahren lebt Serena St. Alban hinter dicken Anstaltsmauern und Gitterfenstern, erst der Tod wird sie von ihrer trostlosen Existenz erlösen. Für mich, für meine gesamte Familie, wird sie stets eine große Persönlichkeit bleiben. Auch ihr Werk wird fortbestehen. Die Ausdruckskraft ihrer Bilder ist unvergänglich.
Ich schreibe diese Geschichte nieder, um Mama und ihre Nachfahren vom Stigma des erblichen Wahnsinns zu befreien. Und um aufzuzeigen, zu wieviel Heimtücke manche Menschen aus Habgier fähig sind.
Fast hätte ich das bittere Schicksal meiner Mutter geteilt. Wäre ein niederträchtiger Plan nicht vereitelt worden, hätte auch ich den Rest meines Lebens in geistiger Umnachtung und räumlicher Isolation zugebracht. Ein menschliches Wrack, aller natürlichen Fähigkeiten beraubt. Daß es nicht dazu kam, ist nicht mein Verdienst.
Damals, in jenem schicksalhaften Sommer, bin ich nichtsahnend in mein Verderben gerannt. Mehr und mehr verirrte ich mich in einem fein gesponnenen Netz mysteriöser Ereignisse, bis selbst wohlmeinende Leute an mir und meiner Zurechnungsfähigkeit zweifelten. Ich selbst nicht ausgenommen. Ich durchlebte eine schwere Persönlichkeitskrise, die mich bis an den Rand der Selbstaufgabe trieb.
Genau das war es, was meine Peiniger beabsichtigten. Heute, vier Jahre danach, ist mir bewußt, wie grenzenlos naiv und weltfremd ich gewesen war. Wer über einen gesunden Selbsterhaltungstrieb verfügt, vertraut seinen Mitmenschen nur bedingt. Ich hingegen setzte blindes Vertrauen in jeden, der vorgab, es gut mit mir zu meinen. Das machte mich wehrlos, als ich unversehens zum Opfer infamer Manipulationen wurde.
Es waren bittere Erfahrungen, die ich damals sammeln mußte. Ich bin gereift daraus hervorgegangen. Aber beinahe wäre ich daran zerbrochen.
In dieser schlimmen Phase begegnete ich einem Menschen, der unerschütterlich an mich glaubte. Ihm und seinem tatkräftigen Beistand verdanke ich meine Gesundheit, wenn nicht gar mein Leben. Und das tiefe, erfüllte Glück, das ich an seiner Seite gefunden habe. Schon wenige Wochen nach den unheilvollen Ereignissen haben wir geheiratet. Nach einigem Zögern hat uns Großmama, um wertvolle Erfahrungen reicher, ihren Segen gegeben. Sie hat aus ihren Fehlern gelernt und eingesehen, daß sie nicht allmächtig ist.
Die alte Dame hat sich überhaupt sehr verändert. Sie ist nachsichtiger geworden, verständnisvoller und duldsamer. Sie hat es aufgegeben, ihre Umgebung beherrschen zu wollen, und verwöhnt statt dessen ihre zwei Urenkel, an denen sie mit größter Liebe hängt. Mein Sohn Philip, genannt Fips, hat vorige Woche seinen zweiten Geburtstag gefeiert. Er ist ein strammer kleiner Bursche und für sein Alter recht pfiffig. Sein Schwesterchen Catherine ist gerade sechs Monate alt. Großmama strahlt vor Stolz, wenn sie – was sie fast unentwegt tut – mit unseren quecksilbrigen Rangen prahlt. Die staunenden Zuhörer erfahren, daß Fips und Cathy angehende Genies sind, und wehe dem, der es wagen sollte, Malvinia St. Albans urgroßmütterliches Urteil in Zweifel zu ziehen. Mein Mann und ich tun’s jedenfalls nicht. Die Vorstellung, daß unsere Lieblinge sich dereinst mit Ruhm bekleckern werden, gefällt uns sehr. Um der Ehrlichkeit willen sei erwähnt, daß sie sich vorläufig mit ganz anderen Dingen bekleckern.
Großmamas erbitterter Groll gegen meine Mutter ist in tiefe Anteilnahme umgeschlagen. Ich glaube, sie fühlt sich an Mamas traurigem Schicksal mitschuldig. Sie setzt alles daran, um wenigstens ein bißchen Sonne in das Elend ihrer Schwiegertochter zu bringen. Leider gibt es nicht viel, das wir für Serena tun können. Sie muß ihren Leidensweg bis zum Ende gehen. Vor einer Woche allerdings, als ich ihr meine Gemälde vorführte, erschien es mir, als träte ein schwaches Leuchten in ihre leeren Augen.
Mag sein, daß es sich dabei um eine Lichtbrechung handelte, doch ich stelle mir lieber vor, daß sie ihren Sinn für Konturen und Farben nicht völlig verloren hat. Bevor ich meine Bilder zu meiner ersten Vernissage gebe, werde ich sie zu Mama bringen. Ermutigt von meinem Mann, habe ich mir vorgenommen, beruflich in ihre Fußstapfen zu treten. Selbst wenn ich ihre künstlerische Brillanz nie erreichen werde.
Aber ich greife vor. Meine Geschichte begann Jahre vorher. Eigentlich hat sie noch vor Vaters Tod angefangen. Aber das stellte sich erst heraus, als alles vorüber war.
Als ich an jenem nebligen Junitag frohgemut das Flugzeug nach Rom bestieg, steuerte eine willkürlich herbeigeführte Tragödie ihrem Ende entgegen. Ich wußte es bloß nicht. Ebensowenig wie ich wußte, daß mir in dem Drama eine Hauptrolle zugedacht war.
Meine Gedanken wandern zurück ins Jahr 1973.
Wie verheißungsvoll hatte dieser Sommer begonnen…
*
Immer schneller rollte die Maschine über die Startbahn, hob vom Boden ab und gewann rasch an Höhe. Das ungewohnte Gefühl der Freiheit überwältigte mich. So wie mir mußte es einem Vogel zumute sein, der nach einem zermürbend langen Käfigaufenthalt ungehindert umherfliegen darf.
Ich kuschelte mich tief in meinen Sitz und schloß zufrieden die Augen. Noch konnte ich es kaum glauben, daß ich London für eine Weile hinter mir gelassen hatte. Das soll nicht heißen, daß ich meine Heimatstadt nicht mochte. Ich lebte sehr gern dort. Ich liebte auch Ivory Hall, unseren traditionsreichen, aus der späten Tudorzeit stammenden Familiensitz. Dennoch hatte ich bisweilen das Empfinden, ersticken zu müssen. Ich benötigte dringend eine Luftveränderung, einen Tapetenwechsel, bevor mir die Decke tatsächlich auf den Kopf fiel.
Ich hatte meinen Auslandsurlaub nicht ohne heftige Kämpfe durchgesetzt. Großmamas verkniffenes Gesicht stand noch deutlich vor mir, als sie sagte: »Schlage dir diese Reise aus dem Kopf, Frederica. Bildest du dir allen Ernstes ein, ich ließe dich allein nach Rom reisen, noch dazu zu einer wildfremden Person?«
»Rebecca ist keine Fremde für mich«, hatte ich aufbegehrt. »Sie ist meine Freundin.«
»So?« Wenn Großmama etwas nicht vertrug, dann war es Widerspruch. »Wieso kenne ich sie nicht? Wieso hast du sie mir nie vorgestellt?«
Weil du kein gutes Haar an ihr gelassen hättest, war es mir durch den Kopf gegangen. Natürlich war meine Antwort viel diplomatischer ausgefallen.
»Es hat sich noch keine Gelegenheit dazu ergeben, Großmama.«
Das war natürlich eine Ausflucht gewesen. Eine gemeinsame Teestunde hätte sich durchaus organisieren lassen. Aber eine Begegnung von Malvinia St. Alban und Rebecca Merrit war so ziemlich das letze, das ich mir wünschte. Ich brauchte nicht viel Phantasie, um mir auszumalen, was bei einem Zusammentreffen derart unvereinbarer Charaktere herauskommen würde. Ebensogut hätte ich Öl in offenes Feuer gießen können. Einige wesentliche Merkmale hatten Großmama und meine Freundin nämlich gemeinsam: ein hitziges Temperament und die Neigung, ihre Meinung ungeschminkt zu äußern. Nie kümmerten sie sich darum, ob sie andere mit ihrer Direktheit vor den Kopf stießen. Lieber unhöflich sein als heucheln, hieß ihre Devise.
Ansonsten verband sie nichts.
Wie unterschiedlich die zwei Frauen waren, zeigte sich schon bei ihren Eßgewohnheiten. Während Großmama auf solide britische Kost schwor, leckerte es Rebecca nach exotischen Gaumenfreuden. Die Liste der Gegensätze reichte weiter. Großmama plädierte für eiserne Disziplin, meine Freundin hingegen pifff auf alle Regeln und Konventionen. Malvinia St. Alban war hausbacken und seriös wie einst Königin Victoria, Miß Merrit hatte etwas von den schillernden Reizen eines Kolibris. Die eine pries die britische Lebensart als die einzig wahre, die andere fühlte sich überall mehr zu Hause als in ihrer schottischen Heimat.
Eines stand für mich fest: Nie würde ein so mondänes, lebenshungriges Geschöpf wie Rebecca vor Großmamas strengen Augen Gnade finden.
Zum Glück zeigte meine Freundin kein Verlangen, das despotische Oberhaupt der St. Albans kennenzulernen.
»Die liebe Dame hat Haare auf den Zähnen, stimmt’s?« hatte sie auf ihre saloppe Weise bemerkt. »Sei ein Schatz, Freddy, und halte sie mir vom Leib. Mein Bedarf an Besen ist hinreichend gedeckt. In meiner eigenen Sippe gibt es mehr als genug von ihnen.« Ein entwaffnendes Lächeln hatte den Worten die Spitze genommen. Kein Mensch konnte Rebecca böse sein, selbst wenn sie die unmöglichsten Dinge von sich gab.
»Was ich immer wieder an dir vermisse, ist der ausgeprägte Familiensinn, der den Schotten nachgesagt wird«, hatte ich gestichelt.
»Ausnahmen bestätigen die Regel«, hatte meine Freundin lachend erwidert. »Wer weiß, vielleicht bin ich ein Kuckucksei, weil ich so gar nicht in meinen stockkonservativen Clan passe?«
»Wie oft besuchst du deine Angehörigen in Edinburgh?«
Die Antwort war typisch für Rebecca gewesen. »Nur, wenn es sich absolut nicht vermeiden läßt. Das heißt, alle Jubeljahre einmal. Meine Verwandten sind so langweilig wie der Haferbrei, den sie zum Frühstück vertilgen. Sie öden mich an.«
Rebecca Merrit war mir an Weltgewandtheit und vielen anderen Dinge weit überlegen. Sie war es, die in unserer Freundschaft den Ton angab. Ich ließ es mir gern gefallen, allein schon deshalb, weil Rebecca zehn Jahre älter war als ich.
Wir kannten uns seit etwa vier Jahren. Ein paar Monate nach Papas Tod waren wir uns zufällig in der Londoner Nationalgalerie begegnet, genauer gesagt, vor einem Turnerschen Sonnenuntergang. Irgendwie waren wir ins Gespräch gekommen und hatten uns auf Anhieb höchst sympathisch gefunden. Deshalb waren wir nach dem Rundgang gemeinsam in die Cafeteria gegangen, um uns eingehender zu beschnuppern. Das Ergebnis war zur beiderseitigen Zufriedenheit ausgefallen. Wir waren in Verbindung geblieben, und obwohl wir uns nur selten sahen, war der Kontakt nie ganz abgerissen.
Rebecca führte ein unstetes Nomadenleben und war immer dort anzutreffen, wo ihre Nobelclique sich gerade ein Stelldichein gab. Leider hielt meine Freundin nicht viel vom Schreiben, sie telefonierte lieber. Aber wann immer sie einen kurzen Zwischenaufenthalt in London einlegte, trafen wir uns. Dann lieferte sie mir farbige Berichte von ihren diversen Reiseerlebnissen, und ich lauschte ihr mit leuchtenden Augen. Wie glühend ich die Ältere beneidete! Jedes Wort, das sie sagte, war wie eine Offenbarung für mich. Märchenhaft schön war das Leben derer, die sich aufs Genießen verstanden. Es mußte herrlich sein, viel und unbekümmert durch die Welt zu schwirren.
Was mich wie magisch zu Rebecca hinzog, war ihr mitreißender Frohsinn, ihre angeborene Sorglosigkeit, ihre leichtsinnige Art zu leben. Im Gegensatz zu mir schien sie Leid und Trauer nicht zu kennen. Sie war quirlig, kapriziös, verschwenderisch. Sie konnte es sich leisten, einer extravaganten Laune nachzugeben. Dank der Großzügigkeit eines reichen Onkels, der ihr sein Vermögen hinterlassen hatte, war sie finanziell unabhängig.
Pedantische Leute wie Großmama hätten Rebecca wohl als oberflächlich, verantwortungslos oder gar als liederlich bezeichnet. Aber das war, wie gesagt, das Urteil von Moralaposteln, die sowieso über jedermann den Stab brachen.
Groß, schlank und rassig, war Rebecca eine sehr attraktive Frau, die allenthalben umschwärmt wurde. Selbst auf der Straße drehten die Männer sich nach ihr um. Mich wunderte das nicht. Meine Freundin hatte aufregend schöne Beine, die sie durch raffiniert geschnittene Kleider voll zur Geltung brachte, und langes nachtschwarzes Haar, das ihr lose über die Schultern fiel. Mit müheloser Grazie bewegte sie sich auf dem Parkett der Oberen Zehntausend. Ich pflegte die klangvollen Namen förmlich in mich hineinzutrinken.
Großmama und ich hatten uns weitgehend von der großen Gesellschaft zurückgezogen. Früher, als Serena noch gesund war, hatten auch wir mit prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verkehrt. Hochkarätig ging es bei uns selbst heute noch zu, doch nun bewirteten wir nicht mehr Künstler und Intellektuelle, sondern Leute aus der Finanzwelt. Ich sehnte mich oft nach der Vergangenheit zurück.
Vor knapp drei Wochen hatte Rebecca Pfeffer in mein tägliches Einerlei gestreut.
»Mitte Juni treffen wir uns in Rom, Freddy«, hatte sie mich am Telefon informiert. »Nimm dir Urlaub. Ich werde im Hotel ›Imperiale‹ Zimmer für uns reservieren lassen. Es ist höchste Zeit, daß du aus deinem Mauseloch hervorkriechst und dir frischen Wind um die Nase wehen läßt. Contessa Malpaesana hat uns bereits zu einem Ball eingeladen, und Fürstin Varinovska hat vor, eine große Gartengesellschaft zu arrangieren. Ich habe unser Kommen schon zugesagt. Keine Widerrede also.«
Weit davon entfernt, Einwände zu erheben, hatte ich die überraschende Einladung mit einem Jubelschrei angenommen. Ich hätte vor lauter Freude Purzelbäume schlagen mögen.
»Du kannst mit mir rechnen«, hatte ich Rebecca eifrig versichert. »Von wo rufst du überhaupt an?«
»Aus Lissabon. Wir feiern hier eine Fete. Super, sage ich dir.«
Rebeccas Unternehmungen waren immer super. Bald würde auch ich an rauschenden Partys teilnehmen. Schon beim Gedanken daran wurde mir vor Glück ganz schwindlig.
Großmama hatte sich meinen Plänen entschieden widersetzt. Schließlich hatte sie doch nachgegeben, wohl in der Einsicht, daß sie ihre vierundzwanzigjährige Enkelin nicht länger am Gängelband führen konnte. Zum ersten Mal war ich bei einem Kräftemessen mit Malvinia als klare Siegerin hervorgegangen.
Malvinia St. Alban war die Mutter meines Vaters. Mamas Eltern waren noch vor meiner Geburt bei einem Lawinenunglück ums Leben gekommen. So war Großmama seit langem meine einzige Stütze, ein Umstand, aus dem sie das Recht ableitete, mich nach ihrem Gutdünken zu bevormunden.
Frühzeitig verwitwet, war Großmama seit rund einem halben Jahrhundert daran gewöhnt, ihren Willen durchzusetzen. Als blutjunge Frau hatte sie lernen müssen, was es heißt, ein großes Vermögen zu kontrollieren und zugleich ein Kleinkind zu erziehen. Daß ihr trotz der Doppelbelastung nie die Zügel aus der Hand geglitten waren, zeugt von ihrer stählernen Energie. Als mein Vater, ihr einziger Sohn, an den Folgen eines Terroranschlags starb, hatte sie sich abermals allein gesehen. Mit der ihr eigenen Tapferkeit hatte sie den Schicksalsschlag überwunden, aber dabei das Lachen verlernt.
Selbstverständlich hatte sie ihre Enkelin und ihre untröstliche Schwiegertochter unter ihre Fittiche genommen. Mama war über Papas Tod schwermütig geworden. Sogar ihre Malerei hatte sie nicht zu trösten vermocht, sie war körperlich und geistig verfallen. Immer wieder hatte sie versucht, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Sie wurde von Wahnvorstellungen und Horrorvisionen gequält. Ihr verstorbener Mann habe sie aufgefordert, ihm ins Jenseits zu folgen, hatte sie uns nach einem ihrer Selbstmordversuche berichtet. Er spräche oft zu ihr.
Sie hatte sich alles mögliche eingebildet. In ihrem Bett, so hatte sie sich eines Morgens beklagt, seien tote Kröten gewesen. Ein anderes Mal waren es Schlangen oder Mäuse gewesen.
Renommierte Psychiater und andere Spezialisten hatten sich bei uns die Klinke in die Hand gegeben. Mamas Erkrankung war als Melancholie, Paranoia und manische Depression diagnostiziert worden. Genützt hatte es nichts. Mama hatte auf keine Behandlung angesprochen, ebensowenig auf die vielen Medikamente, die ihr verabreicht wurden. Ihr Zustand hatte sich weiter verschlechtert, bis selbst die beiden privaten Pflegerinnen, die wir engagiert hatten, kaum noch mit ihr fertig wurden. Auf wilde Tobsuchtsanfälle waren Phasen völliger Apathie gefolgt, dann wieder Ausbrüche von Raserei, in denen es uns fast nicht gelang, die Tobende zu bändigen.