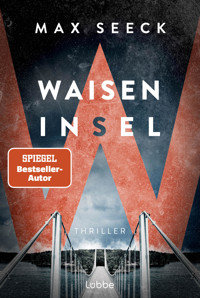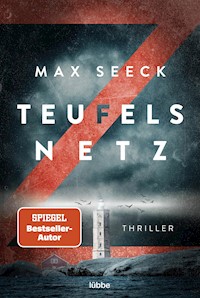9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jessica Niemi
- Sprache: Deutsch
Der Mörder geht nach einem perfiden Plan vor: Detailgetreu stellt er die Morde einer Bestseller-Trilogie nach. Und die sind äußerst brutal und erinnern an mittelalterliche Foltermethoden. Die Opfer - allesamt Frauen. Ist ein Fan der Trilogie durchgedreht? Kommissarin Jessica Niemi und ihr Team ermitteln unter Hochdruck, doch der Mörder ist ihnen immer einen Schritt voraus. Die Ermittler tappen im Dunkeln, bis ihnen klar wird, dass die Opfer Jessica Niemi erschreckend ähnlich sehen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmung123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110Mein Dank giltÜber dieses Buch
Der Mörder geht nach einem perfiden Plan vor: Detailgetreu stellt er die Morde einer Bestseller-Trilogie nach. Und die sind äußerst brutal und erinnern an mittelalterliche Foltermethoden. Die Opfer – allesamt Frauen. Ist ein Fan der Trilogie durchgedreht? Kommissarin Jessica Niemi und ihr Team ermitteln unter Hochdruck, doch der Mörder ist ihnen immer einen Schritt voraus. Die Ermittler tappen im Dunkeln, bis ihnen klar wird, dass die Opfer Jessica Niemi erschreckend ähnlich sehen …
Über den Autor
Max Seeck war zunächst im Marketing und Vertrieb einer großen finnischen Firma tätig. Seit einigen Jahren widmet er sich jedoch ganz dem Schreiben von Romanen. Mit großem Erfolg. Er ist momentan der bedeutendste Thriller-Autor Finnlands. Er liebt Jo Nesbø und Stieg Larsson, ließ sich für seinen Thriller aber auch von Lars Kepler, Jens Lapidus, Dan Brown und Michael Crichton inspirieren. Er lebt und schreibt in Helsinki. »Hexenjäger« ist sein internationaler Durchbruch.
M A X S E E C K
H E X E NJ Ä G E R
T H R I L L E R
Übersetzung aus dem Finnischen vonGabriele Schrey-Vasara
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Diese Übersetzung wurde gefördert von FILI.
Titel der finnischen Originalausgabe:
»Uskollinen Lukija«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2019 by Max Seeck
Original edition published by Tammi publishers, 2019
German edition published by agreement with Max Seeckand Elina Ahlback Literary Agency, Helsinki, Finland
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Katharina Rottenbacher, Berlin
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Einband-/Umschlagmotive: © shutterstock: Adam Vilimek | Jozef Sowa | photosoft
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-9433-7
luebbe.de
lesejury.de
Für William
Es werden noch viele Jahre vergehen, bis ich dir erlaube, dieses Buch zu lesen. Und wenn es so weit ist, denk daran, dass dein Vater nicht ganz so verrückt (gewesen) ist, wie der Text vermuten lässt.
1
Der Wind ist heftiger geworden und heult um das große, aus Glas und Beton gebaute Einfamilienhaus. Das Pochen am Dach hat allmählich zugenommen, das dumpfe Geräusch erinnert an ein prasselndes Kaminfeuer. Auf der Terrasse hat sich der Schnee zu weißen Dünen angesammelt, die nun unglaublich schnell davongeweht werden. Maria Koponen bindet den Gürtel ihrer Strickjacke fester und starrt durch das große Wohnzimmerfenster in die Dunkelheit. Sie betrachtet das zugefrorene Meer, das in dieser Jahreszeit einem flachen Acker verblüffend ähnlich sieht, und dann den von kniehohen Lichtsäulen beleuchteten Weg, der zum Bootssteg führt.
Maria krallt die Zehen in den Florteppich, der fast den ganzen Fußboden bedeckt. Im Haus ist es warm und gemütlich. Dennoch ist sie unruhig, und selbst kleine Dinge regen sie übermäßig auf. Wie zum Beispiel diese verdammt teuren Gartenlampen, die einfach nicht richtig funktionieren wollen. Maria schreckt aus ihren Gedanken, als sie merkt, dass die Musik verstummt ist. Sie geht am Kamin vorbei zu dem riesigen Regal, in dem die fast vierhundert Vinylplatten umfassende Sammlung ihres Mannes in fünf säuberlichen Reihen Platz gefunden hat.
Maria hat sich im Lauf der Jahre daran gewöhnen müssen, dass in diesem Haus Musik nicht auf dem Smartphone gespielt wird. Auf Vinyl ist der Sound verdammt viel besser. Das hat Roger schon vor Jahren gesagt, als Maria zum ersten Mal vor der Sammlung stand. Damals waren es über dreihundert Schallplatten. Fast hundert weniger als jetzt. Dass die Zahl der Platten in der Zeit ihres Zusammenlebens vergleichsweise wenig gestiegen ist, erinnert Maria daran, wie lange Roger schon vor ihr gelebt hat. Ohne sie. Maria selbst war vor Roger nur mit einem Mann zusammen: Die Beziehung, die in der Oberstufe begonnen hatte, führte zur Hochzeit in jungen Jahren und endete, als Maria dem berühmten Schriftsteller begegnete. Im Gegensatz zu Roger hat sie nie Gelegenheit gehabt, das Single-Dasein auszuprobieren. Manchmal wünscht sie sich, auch sie hätte all das erleben dürfen: zielloses Umherstreifen, Selbstfindung, unverbindliche Beziehungen. Freiheit. Es stört sie nicht, dass Roger sechzehn Jahre älter ist. Was an ihr nagt, ist die Sorge, dass sie eines Tages von einer Rastlosigkeit gepackt wird, die nur nachlässt, wenn man sich oft genug ins Unbekannte stürzen kann. Genau das hat Roger in seinem früheren Leben getan. Jetzt, an diesem stürmischen Februarabend, als sie allein durch ihr großes Haus am Meer streift, empfindet Maria all das plötzlich und zum ersten Mal als Bedrohung. Als Ungleichgewicht, das ihr Schiff zu sehr in Schräglage bringen kann, falls ihre Beziehung irgendwann in einen schlimmen Sturm gerät.
Maria hebt den Tonarm an, nimmt Bob Dylans Blonde on Blonde vom Plattenteller und steckt die Scheibe vorsichtig in die Hülle, auf der der junge Künstler in brauner Wildlederjacke und schwarzweiß kariertem Schal selbstsicher und mürrisch in die Kamera blickt. Sie stellt die Platte zurück und wählt aufs Geratewohl eine neue vom Ende der alphabetisch geordneten Sammlung. Bald darauf klingt nach kurzem Rauschen die honigweiche, gefällige Stimme von Stevie Wonder aus den Lautsprechern.
Und dann sieht Maria es wieder. Diesmal aus dem Augenwinkel. Die Lichtsäule, die dem Ufer am nächsten steht, schläft kurz ein. Und leuchtet dann wieder auf.
Sie erlischt nur für einige Sekunden, genau wie vorhin. Maria weiß, dass die Leuchtröhren vor Weihnachten ausgewechselt wurden. Sie erinnert sich genau daran, denn sie selbst hat die unverschämt hohe Rechnung des Elektrikers bezahlt. Und eben deshalb macht diese Kleinigkeit sie wütend.
Maria schnappt sich ihr Handy und schreibt eine Nachricht an Roger. Sie könnte nicht sagen, warum sie ihren Mann mit so etwas belästigen will, zumal sie weiß, dass er gerade eine Lesung hat. Vielleicht steckt dahinter ein plötzlicher Anfall von Einsamkeit, in den sich eine Prise Unsicherheit und grundlose Eifersucht mischen. Eine Weile starrt sie auf die Nachricht, die sie geschickt hat, und wartet darauf, dass die kleinen Häkchen am unteren Rand sich blau färben, doch das tun sie nicht. Roger behält sein Telefon nicht ständig im Auge.
Im selben Moment bleibt die Platte hängen. What I’m about to. What I’m about to. What I’m … Wonders Stimme klingt stammelnd, da ein Teil des Satzes mitten in der schönen Botschaft abgeschnitten ist. Einige von Rogers Platten sind bereits in so schlechtem Zustand, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt, sie aufzubewahren. Funktioniert in diesem verflixten Haus denn gar nichts? Eine kalte Welle erfasst Maria. Und ohne ihre Beobachtung ganz zu begreifen, sieht sie hinter den Glastüren etwas, was dort nicht hingehört. Einen Moment lang vermischen sich die Umrisse mit ihrem eigenen Spiegelbild, doch dann bewegt sich die Gestalt und wird zu einem eigenständigen Ganzen.
2
Roger Koponen setzt sich auf den Stuhl, dessen Sitz mit rauem, schwitzigem Stoff bezogen ist, und kneift die Augen zusammen. Die Spots, die von der Decke des hohen Saals im Konferenzgebäude herabhängen, scheinen dem Auftretenden direkt ins Gesicht. Einen Moment lang sieht er nur das Licht und vergisst, dass vor ihm und seinen beiden Schriftstellerkollegen an die vierhundert neugierige Leser und Leserinnen sitzen, die gekommen sind, um die Gedanken ihrer Lieblingssäufer über deren neueste Werke zu hören. Roger ist klar, dass die Veranstaltung wichtig ist, um sich selbst und seine Bücher bekannt zu machen. Ihm ist klar, warum er sich die Mühe macht, vierhundert Kilometer durch dichtes Schneetreiben zu fahren und in irgendeiner Bruchbude am Marktplatz zu übernachten, die dem ersten Anschein nach immerhin einigermaßen sauber ist und im Erdgeschoss einen nichtssagenden, mit Tischdecken und Bedienung aufgemotzten Fastfood-Laden beherbergt.
Unklar ist ihm dagegen, wieso die Leute in Savonlinna sich an einem derartigen Abend herbemühen. Auch wenn seine Bücher sich weltweit millionenfach verkaufen, wird er nie ein von kreischenden Fans umringter Star werden. Kaum jemand kommt auf den Gedanken, dass Musiker und Schriftsteller zwar ganz ähnliche Arbeit leisten – die gleiche Scheiße, nur anders verpackt –, dass aber nur die Ersteren Frauen mittleren Alters dazu veranlassen, ihre Slips auf die Bühne zu werfen. Und dennoch kommen Menschen. Die meisten sind alte Leute, die ihren Kopf langsam hin und her wiegen. Sind sie die sportschaumäßigen Selbstverständlichkeiten und oberflächlichen Analysen, die ihnen die Autoren vorsetzen, noch nicht leid? Offenbar nicht, denn der Saal scheint bis auf den letzten Platz gefüllt zu sein.
Rogers Psychothriller erschien voriges Jahr im Frühling und ist der dritte und letzte Teil seiner Hexenjagd-Trilogie, die sich als Riesenerfolg entpuppt hat. Seine Bücher haben sich immer ganz gut verkauft, aber die Hexenjagd-Serie ist ein Volltreffer. Mit einem derartigen Megaerfolg hat niemand gerechnet, am allerwenigsten seine Agentin, die das Thema anfangs für bedenklich hielt, und sein früherer Verlag, von dem Roger sich vor der Veröffentlichung des ersten Bandes wegen Vertrauensmangel getrennt hat. Die Übersetzungsrechte für die Trilogie wurden innerhalb weniger Jahre in fast dreißig Länder verkauft, und weitere sind zu erwarten. Maria und er sind auch früher gut über die Runden gekommen, doch jetzt können sie haben, was immer das Herz begehrt. Plötzlich sind alle möglichen Luxusartikel und Genüsse in Reichweite.
Die Veranstaltung läuft routinemäßig ab, Roger hat die Fragen auf seinen Tourneen hundert Mal gehört und in vier Sprachen beantwortet, wobei er gelegentlich Sprechtempo, Betonung und kleine Details variiert, nur um sich im Dunstkreis der hellen Lampen und der Lachsalven wach zu halten.
»Ihre Bücher sind ziemlich brutal«, sagt eine Stimme, aber Roger fixiert die Wasserkaraffe, aus der er sein Glas zum dritten oder vierten Mal auffüllt. Diese Bemerkung hört er ziemlich oft, und es stimmt ja auch – rohe Morde, sadistische Folterungen, sexuelle Gewalt gegen Frauen, albtraumartiges Eintauchen in die Strudel einer kranken Psyche werden in Roger Koponens Büchern minutiös geschildert.
»Das erinnert mich an Bret Easton Ellis, der gesagt hat, er baue seine Furcht ab, indem er in allen Einzelheiten über Gewalt schreibt«, fährt dieselbe Stimme fort. Nun richtet Roger den Blick auf den Mann, der in der Mitte des Saals sitzt und ein Mikrofon in der Hand hält. Roger hebt das Glas und wartet darauf, dass der Mann seine Frage stellt. Es dauert jedoch qualvoll lange, bis er endlich seine Gedanken in Worte fasst.
»Fürchten Sie sich? Schreiben Sie deshalb?«, fragt er schließlich mit leiser, monotoner Stimme. Roger stellt das Glas auf den Tisch und mustert den mageren Mann mit der Halbglatze. Überraschend und interessant. Beinahe unverschämt. Diese Frage hat er noch nie gehört.
»Ob ich mich fürchte?«, sagt Roger und beugt sich näher an das Tischmikrofon heran. Aus irgendeinem Grund spürt er ausgerechnet jetzt ein nagendes Hungergefühl.
»Haben Sie Ihre eigenen Ängste in Ihre Bücher eingeschrieben?«, fragt der Mann und legt das Mikrofon in den Schoß. Der Typ spricht aufreizend selbstsicher. Ganz ohne die nervöse Rücksichtnahme, die Unterwürfigkeit gegenüber Prominenten, an die Roger gewöhnt ist.
»Tja«, sagt Roger und lächelt nachdenklich. Er vergisst den Mann für einen Moment und lässt den Blick über das Publikum wandern. »Ich glaube, dass immer auch etwas vom Autor selbst zu Papier kommt. Man schreibt ja notwendigerweise über das, was man kennt oder zu kennen glaubt. Ängste, Hoffnungen, Traumata, Versäumnisse oder nicht ausreichend begründete Taten …«
»Sie beantworten meine Frage nicht.« Der magere Mann hat das Mikrofon wieder an den Mund gehoben. Roger spürt zuerst Verblüffung und dann Ärger aufsteigen. Was soll dieses beschissene Verhör? So einen Mist braucht man sich doch nicht anzuhören.
»Könnten Sie Ihre Frage präzisieren?« Pave Koskinen, der altgediente Literaturkritiker und Organisator, der die Veranstaltung moderiert, mischt sich ein. Bisher glaubte er wohl, dass er seine Aufgabe tadellos und mit vollem Einsatz erledigt hat, doch nun fürchtet er, sein Stargast, der brandheiße Thrillerautor, der drei internationale Bestseller geschrieben hat, würde den Zwischenfall übelnehmen. Doch Roger hebt versöhnlich die Hand und lächelt selbstsicher. »Tut mir leid. Vielleicht habe ich die Frage tatsächlich nicht richtig verstanden. Sie möchten also wissen, ob ich über das schreibe, wovor ich am meisten Angst habe?«
»Nein. Umgekehrt«, entgegnet der Mann kühl. Irgendwer in der ersten Reihe hustet überlaut.
»Umgekehrt?«, fragt Roger und verbirgt seine Verblüffung hinter einem albernen Lächeln.
»Genau, Herr Roger Koponen«, fährt der Mann fort, und die Art, wie er Rogers Namen ausspricht, ist nicht nur sarkastisch, sondern auch irgendwie lähmend. »Fürchten Sie sich vor dem, was Sie schreiben?«
»Warum sollte ich mich vor meiner eigenen Fiktion fürchten?«
»Weil nichts fantastischer ist als die Wirklichkeit«, sagt der Mann mit dem hageren Gesicht. Angespannte Stille legt sich über den Saal.
Zehn Minuten später setzt sich Roger an einen langen weißgedeckten Tisch in der Aula, in der es von Menschen wimmelt. Der Erste in der Schlange derjenigen, die sich ein Buch signieren lassen wollen, ist natürlich Pave Koskinen.
»Danke, Roger. Danke. Und tut mir leid, das mit dem komischen Kerl. Du bist prima damit umgegangen. Leider sind nicht alle mit sozialen Fähigkeiten gesegnet.«
»Schon gut, Pave. Schräge Vögel gibt es überall. In dieser Welt ist jeder nur für sein eigenes Benehmen verantwortlich«, lächelt Roger und merkt, dass Pave ihm alle drei Bände der Trilogie zum Signieren hingelegt hat. Während er neben seinem Autogramm etwas vorgeblich Persönliches auf das Vorsatzblatt kritzelt, wirft er einen Blick auf die Schlange und stellt fest, dass der Bekloppte mit dem hageren Gesicht nirgendwo zu sehen ist. Zum Glück. Von Angesicht zu Angesicht wäre er womöglich nicht fähig, die Provokation so diplomatisch zu übergehen wie vorhin.
»Danke, Roger. Wir haben für neun Uhr einen Tisch im Hotelrestaurant reserviert. Da gibt es ganz vorzüglichen Lammbraten«, verkündet Koskinen und bleibt vor ihm stehen, die Bücher an die Brust gedrückt. Roger nickt langsam und senkt den Blick auf den Tisch, wie ein Angeklagter, dem der Richter gerade sein Urteil verkündet hat. Eigentlich müsste Koskinen merken, dass Roger sich am liebsten in sein Zimmer zurückziehen würde. Er hat gelernt, die nichtssagende Geselligkeit beim obligatorischen Rotwein-Umtrunk zu hassen, die kaum Einfluss darauf hat, wie sich seine Bücher verkaufen. Ebenso gut könnte er ablehnen und sich als unsoziales Arschloch abstempeln lassen.
»Klingt gut«, sagt er schließlich matt und verzieht sein Gesicht zu einem beinahe glaubhaften Grinsen. Pave Koskinen nickt zufrieden und bleckt die Zähne, die dank neuer Kronen nahezu weiß aussehen. Er wirkt unsicher. Dann tritt er vom Tisch zurück und macht den Leuten Platz, die mit bereitgehaltenen Büchern hinter ihm Schlange stehen.
3
Kriminalhauptmeisterin Jessica Niemi bindet ihre schulterlangen schwarzen Haare zum Pferdeschwanz und zieht ihre Lederhandschuhe an. Das Auto lässt einen hohen Signalton erklingen, als sie bei laufendem Motor die Beifahrertür öffnet.
»Danke fürs Mitnehmen«, sagt Jessica zu dem Mann am Lenkrad.
»Ist wohl besser, wenn niemand weiß, wer dich hergebracht hat«, erwidert der Mann gähnend. Eine Weile schauen sie sich an, als ob sie beide auf einen Kuss warten. Doch keiner will die Initiative ergreifen.
»Das Ganze ist total falsch.«
Jessica steigt aus und kneift die Augen zusammen, als der eisige Wind an ihrem Gesicht leckt. Es hat stark geschneit, und die Schneepflüge, die bei der Schule dröhnten, haben es noch nicht bis ans Ufer geschafft. Jessica drückt die Tür zu und sieht vor sich ein großes, modernes Einfamilienhaus, einen schmalen Vorgarten, eine mannshohe Thujahecke und ein schmiedeeisernes Tor. Auf der Straße vor dem Haus stehen zwei Streifenwagen, und das ferne Geräusch einer Sirene lässt darauf schließen, dass weitere hinzukommen.
»Hallo.« Ein Mann in einem dicken blauen Overall kommt hinter dem Polizeifahrzeug hervor. »Koivuaho, Polizeimeister.«
»Jessica Niemi«, antwortet Jessica und zeigt ihre Dienstmarke vor. Die uniformierten Kollegen haben sie allerdings schon erkannt. Alle kennen den Affen, aber der Affe kennt keinen. Beiläufig hat sie auch ein paar Spitznamen aufgeschnappt. Detective Zimtzicke. Lara Croft. PILF.
»Was ist passiert?«, fragt sie.
»Eine verdammte Scheiße …« Koivuaho nimmt die dunkelblaue Mütze ab und reibt sich den kahlen Schädel. Jessica wartet geduldig, bis er sich gefasst hat. Sie wirft einen Blick auf die Haustür und sieht nun, dass sie halb offen steht.
»Der Alarm kam um Viertel nach zehn. Taskinen und ich waren in der Nähe und als erste Streife vor Ort«, sagt Koivuaho und winkt Jessica, ihm durch das Tor in den Vorgarten zu folgen.
»Wie lautete der Auftrag der Zentrale?«, fragt Jessica, während sie die Streifenbeamten, die bei den Autos Wache halten, mit einem knappen Nicken grüßt.
»Es hieß, jemand habe die Absicht, sich umzubringen. In diesem Haus«, sagt Koivuaho, als sie auf der Veranda ankommen. Auf dem Steinfußboden in der Diele hat geschmolzener Schnee eine Pfütze gebildet. Der Wind legt sich kurz, und Koivuaho fährt fort: »Die Tür stand auf, also sind wir reingegangen.«
Hier, auf der hell beleuchteten Veranda, sieht Jessica, wie erschüttert der stämmige Mann ist. Sie krümmt ihre schmerzenden Finger und versucht, sich anhand der wenigen Informationen, die sie kurz zuvor am Telefon bekommen hat, ein Bild von der Situation zu machen.
»Es ist also sonst niemand im Haus?«, fragt sie, obwohl sie die Antwort kennt. Koivuaho schüttelt mit ernster Miene den Kopf und setzt die Mütze wieder auf.
»Wir haben beide Etagen durchsucht. Ich muss zugeben, dass mein Herz noch nie so gerast ist. Und dazu die verdammte Musik aus den Lautsprechern.«
»Musik?«
»Die passte irgendwie nicht dazu … Zu friedlich.«
»Wo ist die Leiche?«, fragt Jessica, als Koivuaho ihr die Basisausrüstung für die Tatortarbeit reicht: Handschuhe, Atemmaske und Überschuhe. Sie bückt sich und streift die blauen Überzieher über ihre schwarzen Turnschuhe. Das Holster mit der Pistole rutscht ein Stück nach unten.
»Wir haben uns bemüht, nichts zu beschmutzen«, sagt Koivuaho und hustet in die Hand. Jessica schiebt eine nasse Haarsträhne aus der Stirn und tritt ins Haus. Sie geht an Gästetoilette und Küche vorbei und gelangt in ein geräumiges Wohnzimmer, dessen Wände ganz aus Glas sind und Meerblick bieten. Das Blaulicht, das durch die riesigen Fenster schimmert, lässt die Möbel im Takt des Herzschlags blau pulsieren. Das Zimmer hat zu viel Ähnlichkeit mit einem Aquarium, um gemütlich zu sein, doch als Jessica die am Esstisch sitzende Gestalt erblickt, verliert sie jedes Interesse an den ästhetischen Besonderheiten des Raums.
Sie hält kurz inne und versucht zu begreifen, warum die nahezu aufrecht auf dem Stuhl sitzende Frau so unnatürlich wirkt. Dann tritt sie ein paar Schritte näher und spürt, wie sich ihr Magen verkrampft.
»Hast du schon mal sowas Gruseliges gesehen?«, fragt Koivuaho irgendwo hinter ihr, aber Jessica hört nichts. Das Gesicht der Toten ist zu einer grotesken Grimasse verzerrt. Selbst ihre Augen lachen. Der Gesichtsausdruck steht absolut im Widerspruch zu der Tatsache, dass die Frau tot ist. Sie trägt ein elegantes schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt. Ihre gefalteten Hände liegen auf dem Tisch. Der Tisch ist leer. Kein Handy, keine Waffe. Nichts.
»Ich hab nach dem Puls gefühlt. Sonst hab ich nichts angefasst«, sagt Koivuaho, und nun dreht Jessica sich um und sieht ihn an. Dann tritt sie vorsichtig neben die Frau und beugt sich vor, um deren unnatürlich grinsendes Gesicht zu mustern.
»Was zum Teufel …«, murmelt sie so leise, dass es nur die Frau hören könnte, wenn sie noch am Leben wäre. Mit einem raschen Blick stellt sie fest, dass die nackten Füße unter dem Stuhl überkreuzt sind und die hochhackigen mattschwarzen Jimmy Choos ordentlich neben dem Stuhl stehen. Sowohl die Finger- als auch die Zehennägel sind schwarz lackiert.
»Koivuaho?«, sagt Jessica, während sie den Blick wieder auf das zwanghaft euphorische Gesicht der Toten richtet.
»Ja?«
»Ihr habt sofort einen Mord gemeldet. Allerdings sieht das hier ja auch nicht nach einem typischen Suizid aus.«
»Zum Teufel«, sagt Koivuaho schwer schluckend und tritt ein paar Schritte näher. Der Schweiß läuft ihm über die Schläfen, rinnt hinter die Ohren und verschwindet zwischen dem kräftigen Nacken und dem Kragen des Overalls. Er scheint den Blick des leblosen Wesens zu meiden und fährt unsicher fort: »Hat man dir nicht gesagt, dass der Anruf bei der Notrufzentrale …«
»Was ist damit?«, fragt Jessica ungeduldig, als er sekundenlang schweigt.
»Die Frau hat nicht selbst angerufen«, sagt Koivuaho und braucht nun einige Sekunden, um seine trockenen Lippen mit der Zunge anzufeuchten. Jessica weiß, was er als Nächstes sagen wird, und doch schaudert sie, als sie den Satz hört.
»Der Anruf kam von einem Mann.«
4
Roger Koponen trinkt den restlichen Calvados aus und lässt ihn vorsichtig über die Zunge rollen, schmeckt aber keinen Hauch von Apfel oder Birne. Billiger Fusel. Das Abendessen selbst war jedoch eine positive Überraschung, was keineswegs den Veranstaltern zu verdanken ist, sondern der dreißigjährigen Alisa, der Filialleiterin einer Buchhandlung in Savonlinna. Eine ausgesprochen attraktive Frau, die außer ihrem schönen Gesicht und ihrem hellen Lachen einen durchtrainierten Körper vorzuweisen hat. Crossfit. Das hat sie irgendwann erwähnt, als sie erzählte, wie ihr Exfreund seinen Schlüssel in der Wohnung im zweiten Stock vergessen hatte und wie sie es geschafft haben, mithilfe von Gartenmöbeln hochzuklettern und … Blabla. Total uninteressant. Roger hat die dezent geschminkten Lippen betrachtet, die die Worte formten, statt auf die Einzelheiten der Geschichte zu achten. Wesentlich ist, dass der Boyfriend, der in der Geschichte vorkam, in gemeinsamer Übereinkunft oder nach dem Willen einer der beiden Seiten die Vorsilbe »Ex« bekommen hat.
Alisa betrachtet ihn so, wie alleinstehende Frauen um die dreißig – zwischen ewiger Jugend und beginnendem Kinderwunsch – ihn im besten Fall ansehen. Roger genießt die Aufmerksamkeit. Als junger Mann hatte er keinen Erfolg bei Frauen. Es hat fast zwei Jahrzehnte gedauert, bis er die Enttäuschungen, die er als Teenager erlebte, überwunden hatte. Als er jung war, fanden seine Altersgenossinnen ihn seltsam und fremdartig, erst mit knapp vierzig hat er begonnen, seinem Aussehen und seinem Charme wirklich zu vertrauen, und nun ist er bereit zu glauben, dass die Frau, die ihm gegenübersitzt, tatsächlich ihm schöne Augen macht und nicht dem wie Shia LaBeouf aussehenden jungen Kellner, der hinter ihm steht und miserablen Calvados nachschenkt.
Mit dem Alter sind Erfolg, Geld und Selbstvertrauen gekommen, und vor allem ein Charisma, das nicht allein mit künstlicher Bräune, definierten Bauchmuskeln und einer üppigen Mähne zu erreichen ist. Die Frauen begehren ihn. Wie so viele Womanizer hat er sein eigenes Segment gefunden, den Frauentyp, bei dem er immer landen kann. Irgendwann ist Maria eine dieser Glücklichen geworden. Und zur selben Schar gehört unweigerlich auch Alisa aus dem Buchladen.
»Bin ich die Einzige, die die Hexenjagden noch nicht gelesen hat?«, fragt Alisa und lacht lauthals. Die Speichellecker am Tisch äußern ironische Missbilligung und stimmen in das Lachen ein. Alisa nippt an ihrem Wein. Über den Rand ihres Glases sieht sie Roger verschmitzt an und zuckt neckisch die Achseln, als hätte sie ihm gerade einen Schneeball an den Hinterkopf geworfen. Die Frau flirtet, indem sie provoziert. Roger findet das verdammt sexy. Er spürt die beginnende Erektion und erwägt, aufzustehen und zur Toilette zu gehen. Alisa würde ihm folgen, zweifellos. Er könnte der Buchhändlerin einen ordentlichen Fick bieten, und es bliebe ihm erspart, sie später im Bett seines kleinen Hotelzimmers anschauen zu müssen, sich tiefsinnigen Gesprächsstoff einfallen zu lassen, wenn es keinen Grund für Gespräche mehr gab.
»Du gehörst zur Minderheit, Alisa«, sagt der neben ihr sitzende Pave Koskinen, löffelt geschmolzene Eiscreme und fügt hinzu: »Es kommt mir vor, als hätte jeder sie gelesen. Sogar diejenigen, die nie Krimis lesen.«
Roger stellt sein Glas auf den Tisch, lächelt Koskinen zu und ist sicher, dass es ihm nicht gelingt, seine Abscheu hinter dem gekünstelten Grinsen zu verbergen. Der alte Mann büßt den Rest seiner Würde ein, indem er Roger schmeichelt und nicht erkennt, dass Alisas Bemerkung Teil eines Flirts ist.
»Ich muss kurz verschwinden«, sagt die junge Frau, tupft sich die Mundwinkel an der Serviette ab, als gehöre das zur Etikette, und steht auf. Sie ist ihm einen Schritt voraus. Roger folgt ihr mit dem Blick, als sie auf ihren hohen Absätzen den Tisch umrundet und im Vorbeigehen unauffällig seinen Rücken berührt. Eine unnötige Geste, das Spiel wäre auch so klar gewesen. Eine Weile mustert Roger die Dinosaurier am Tisch und stellt fest, dass nur Pave Koskinen seinen unsicher flackernden Blick auf Alisas Rücken gerichtet hat. Du hast also doch noch einen Puls, Pave. Roger streicht mit dem Finger über den Stiel seines Calvadosglases und denkt über seinen nächsten Schachzug nach. Das letzte Mal liegt schon mehr als ein halbes Jahr zurück. Er hat sich wiederholt geschworen, Maria nicht mehr zu hintergehen. Wenigstens nicht in Situationen, in denen das Risiko, erwischt zu werden, größer ist als die Verlockung. Dies hier ist ein Grenzfall. Die Begierde, die in den Augen der jungen Frau brennt, macht sie besonders interessant, obwohl während des Abendessens klar geworden ist, dass keine tiefere Verbindung zustande kommen wird. Rein, raus. Die Sache wäre in ein paar Minuten erledigt.
Roger schiebt seinen Stuhl zurück, seufzt erwartungsvoll und steht auf. Als er auf dem Handy nach der Uhrzeit sieht, stellt er fest, dass drei Anrufe von einem unbekannten Anschluss gekommen sind. Außerdem eine WhatsApp-Nachricht von Maria. Vor zwei Stunden. Die teuren neuen Gartenlampen funktionieren nicht! Darunter ein weinendes und ein wutrotes Smiley.
Roger spürt einen Stich in der Magengrube. Immerhin hat er ein schlechtes Gewissen wegen seines Verhaltens, ist also nicht restlos verkommen, doch das ändert nichts daran, dass er sich wie ein Arschloch fühlt. Er begreift plötzlich, dass es falsch war, nur deshalb eine feste Beziehung einzugehen, damit kein anderer ihm die Beute streitig machen kann. Er weiß, dass jeder Mann in mittleren Jahren eine Niere dafür opfern würde, mit einer Frau wie Maria alt werden zu dürfen. Und dennoch ist er im Begriff, zu dem Mädchen aus der Buchhandlung zu eilen.
Kein Stress. Ich kümmere mich morgen darum. Roger wartet eine Weile darauf, dass Maria die Antwort liest, doch als nichts geschieht, steckt er das Handy wieder in die Hosentasche.
»Entschuldigt mich«, sagt er ohne weitere Worte und marschiert davon. Erst als er den separaten Raum, in dem sie gegessen haben, verlassen hat, hört er sie wieder reden. Sie versichern sich gegenseitig, wie schön der Abend war und dass Roger Koponen mit der Veranstaltung bestimmt zufrieden ist. Im Hotelrestaurant sitzt sonst niemand, er geht durch den leeren Saal zu den Toiletten. Als er an der Rezeption vorbeikommt, nickt er der Angestellten zu, die gerade einen Anruf annimmt, und sieht die angelehnte Tür zur Damentoilette. Sein Herz schlägt immer wilder, und er malt sich aus, wie er gleich das schwarz-weiß gestreifte Kleid bis zur Taille hochrollt, den Slip verschiebt und in die junge Frau eindringt, ihr die Hand auf den Mund legt, um zu verhindern, dass sie die Aufmerksamkeit der anderen Gäste weckt. Als er gerade nach der Klinke greift, hört er eine Stimme hinter sich und erstarrt. Wie ein Teenager, der sich unerlaubterweise zu einer Party davonschleichen will und von der wütenden Stimme seiner Mutter aufgehalten wird. Die Stimme klingt jedoch nicht tadelnd, sondern eher bedauernd. Sie gehört der Frau an der Rezeption.
»Entschuldigung, Sie sind doch Roger Koponen?«, fragt die Frau aus sicherer Entfernung.
»Ja«, antwortet Roger und überlegt, ob er glaubhaft behaupten kann, das Symbol an der Tür, die Silhouette eines Hirtenmädchens, übersehen zu haben.
»Ein Anruf für Sie«, sagt die Frau, und Roger merkt, dass sie besorgt wirkt. Ein Anruf? Beschissenes Timing.
»Von der Polizei«, fügt die Frau hinzu, bevor Roger nachfragen kann.
»Was?« Er stößt die Frage barsch hervor, er ist überrascht und enttäuscht zugleich. In der Damentoilette klappern Absätze über die Fliesen.
»Die Polizei ruft an. Sie schicken jemanden her.«
»Warum …«
»Wegen Ihrer Frau. Es geht um Ihre Frau.«
5
Jessica Niemi hat ihre schwarzen Lederhandschuhe ausgezogen und stattdessen Einmalhandschuhe aus dünnem Gummi übergestreift. Während sie die Falten glättet, denkt sie an die Worte ihres Vorgesetzten Erne: Handschuhe schützen nicht nur die Indizien vor den Ermittlern, sondern auch die Ermittler vor den Indizien. In diesem Fall trifft das ganz besonders zu. Bei äußerlicher Betrachtung gibt die Leiche keinen Aufschluss über die Todesursache. Keine blutenden Wunden, keine Würgemale und auch keine anderen Hinweise darauf, woran die Frau gestorben ist. Möglicherweise befindet sich auf dem Tisch – oder im ganzen Zimmer – eine giftige Substanz, die mit bloßem Auge nicht zu sehen ist.
»Die Spurensicherung ist da.« Die Stimme gehört Jusuf Pepple, dem Kriminalmeister im Ermittlungsteam. Jessica sieht den dunkelhäutigen Mann an, der mit dem Kopf zur offenen Haustür nickt. Vom Wohnzimmer aus hat sie keine Sicht auf die Straße, doch sie hört, wie ein Motor abgestellt und die Schiebetür eines Kleintransporters zugezogen wird. Jusuf ist ein paar Jahre jünger als Jessica, ein sportlicher Mann mit schönem Gesicht und großen Augen. Seine Wurzeln liegen wohl in Äthiopien. Allerdings hat Jusuf Äthiopien nie gesehen, er ist in Söderkulla bei Sipoo geboren und aufgewachsen, und eigentlich ist er ein beinahe schon zu netter Junge vom Land.
»Hat man den Ehemann erreicht?«, fragt Jessica und schließt die Augen. Das große Haus lebt mit dem Wind, es klingt, als wollte es seine eigene Version der Ereignisse erzählen.
»Man hat ihn gefunden. Jemand von der Polizei in Savonlinna ist gerade auf dem Weg zu dem Hotel, in dem …«, beginnt Jusuf, doch in dem Moment hören sie ein Handy klingeln. Jessica öffnet die Augen und blickt sich um.
»Wo ist es?«, murmelt sie. Jusuf nähert sich der Sitzgruppe auf der anderen Seite des Zimmers.
»Hier, neben der Fernbedienung.«
»Warte«, sagt Jessica schärfer als beabsichtigt und eilt zu Jusuf. Auf dem Display des iPhones, das auf dem Sofa eine irgendwie bekannte Melodie ertönen lässt, leuchtet das Foto eines Mannes auf. Rouzer <3.
»Rouzer?«
»Roger. Roger Koponen«, sagt Jessica und beugt sich über das Handy.
»Sieht irgendwie bekannt aus.«
»Du bist wohl kein Bücherfreund?«, fragt Jessica lakonisch. Jusuf betrachtet den nicht mehr ganz jungen, lächelnden Mann auf dem Display einen Moment, bis sich die Erkenntnis auf seinem Gesicht abzeichnet. Jessica schiebt den Atemschutz ein Stück zur Seite, zieht den rechten Handschuh aus und drückt mit dem Zeigefingerknöchel auf die Taste. Dann schaltet sie die Lautsprecherfunktion ein.
»Hallo?«
»Maria?«, sagt eine resolute, aber bange Männerstimme nach kurzem Schweigen.
»Roger Koponen?«, fragt Jessica und beugt sich näher zum Handy.
»Wer spricht da?«
»Kriminalhauptmeisterin Jessica Niemi von der Helsinkier Polizei«, antwortet sie und schöpft kurz Atem. Der Mann am anderen Ende sagt nichts. Aus seiner unsicheren Stimme hat Jessica jedoch geschlossen, dass die traurige Nachricht ihn bereits erreicht hat. »Es tut mir aufrichtig leid.«
»Aber … was ist passiert?« Roger Koponens Stimme bricht nicht, auch wenn sie schwankt.
»Es tut mir leid. Am besten kommen Sie jetzt nach Hause«, sagt Jessica und spürt, wie das Mitgefühl ihr die Kehle zuschnürt. In ihrer bisherigen Laufbahn hat sie noch nicht viele Gespräche dieser Art geführt. Die Aufgabe, eine Trauerbotschaft zu überbringen, ist ihr erst ein paar Mal zugefallen. Andererseits haben viele Kollegen erzählt, dass es auch beim zehnten oder hundertsten Mal nicht leichter wird. Wie sagt man einem Menschen die Worte, vor denen sich alle am meisten fürchten? Jessica überlegt, wie und von wem sie selbst diese Worte zum ersten Mal gehört hat. Von einem der Ärzte auf der Intensivstation? Von einer Sozialarbeiterin? Von ihrer Tante Tina?
Jessica schluckt, um ihre trockene Kehle anzufeuchten, und will gerade etwas sagen, als Roger Koponen auflegt. Im selben Moment legt sich der Wind, und sie hören deutlich, wie sich die Leute von der Spurensicherung vor dem Haus unterhalten.
»Hast du vorhin gesagt, der Mann ist in Savonlinna?«, fragt Jessica, ohne zu Jusuf aufzublicken. Das Display wird schwarz. Sie versucht, das Handy wieder einzuschalten, was jedoch an der PIN scheitert. Plötzlich ist das Gerät nur ein nutzloser schwarzer Gegenstand.
»Haben die Kollegen gemeldet.«
»Verdammt«, murmelt Jessica wieder. Der Streifenbeamte, der ein Stück von ihr entfernt steht, horcht auf. Was für ein Fall. Die Frau des derzeitigen finnischen Exportschlagers, des Thrillerautors Roger Koponen, ist unter gelinde gesagt zwielichtigen Umständen gestorben. Der Autor selbst befindet sich wie auf Bestellung am anderen Ende Finnlands, was die statistisch wahrscheinlichste Alternative ausschließt. Vor Jessicas Nase liegt das Handy, mit dem Maria Koponens Mörder offensichtlich vor Kurzem die Notrufzentrale angerufen hat. Um dann hinaus in die stürmische Nacht zu gehen. Der Täter kann nicht weit sein. Doch im selben Moment begreift Jessica, dass sie voreilige Schlüsse zieht.
»Kam der Notruf von diesem Anschluss?«, fragt sie und spürt das dringende Bedürfnis, über den Sofarand dahin zu schauen, wo Maria Koponen hysterisch lacht. So würde es auf einem Foto jedenfalls aussehen. Ein übertrieben gemimter Jubel. Doch es ist kein Foto. Alles andere rundherum lebt. Die blauen Lichter, der Wind, Jusuf und die draußen tanzenden, kahlen Bäume. Aber Maria Koponen ist tot wie ein Stein.
»Das weiß ich nicht«, sagt Jusuf und zieht den Reißverschluss seiner Jacke auf. Es ist heiß im Zimmer, obwohl durch die offene Tür eiskalte Luft hereinströmt.
»Klär das bitte bei der Zentrale. Jetzt gleich«, weist Jessica ihn an, als drei Gestalten in weißen Overalls langsam ins Wohnzimmer watscheln, als wären sie darauf bedacht, die in ewigen Schlaf gesunkene Prinzessin am Tisch nicht zu wecken.
Jessica beobachtet die Männer von der Spurensicherung, die mit ihrer Arbeit beginnen. Sie wirken so routiniert, dass man glauben könnte, sie täten irgendetwas Banales, Alltägliches. Als würden sie zum Beispiel die Spülmaschine ausräumen. Diese in Schutzanzüge gehüllten Männer haben nach jedem Maßstab viel gesehen und sind nicht leicht zu erschüttern. Es entgeht Jessica jedoch nicht, dass jeder von ihnen kurz innehält und einen Blick auf die Leiche wirft, deren hübsches Gesicht durch seine schräge Position an Jack Nicholsons Joker denken lässt.
»Die erste ist erledigt«, murmelt einer der Ermittler durch seine Kapuze und die Atemmaske hindurch. Nach den Schritten zu schließen, die kurz zuvor im Flur zu hören waren, ist er aus der oberen Etage gekommen, nun steht er untätig vor Jessica und lässt den Blick durch das Zimmer schweifen. Die drei anderen Ermittler arbeiten konzentriert rund um die Leiche. Jessica betrachtet den Mann und kneift die Augen zusammen zum Zeichen, dass sie nicht versteht, was er meint. Sie vertraut der Fachkenntnis dieser Leute hundertprozentig und hatte bisher noch nie einen Grund, sich in die Tatortroutine einzumischen.
»Was ist erledigt?«, fragt sie dennoch, aber der Mann hat sich bereits abgewandt und verschwindet im Flur.
Jessica geht am Tisch vorbei zu dem Bücherregal, das mit Schallplatten gefüllt ist. Sie schlendert daran entlang und lässt ihre vom Gummihandschuh geschützten Fingerkuppen über die schmalen Rücken der Hüllen hüpfen. Dutzende und Aberdutzende LPs, das Ehepaar muss Musik in analoger Form wirklich lieben. Das Bücherregal eines Schriftstellers voller Musik. Jessica bleibt vor dem Plattenspieler stehen und stellt fest, dass er nagelneu und offensichtlich mit der drahtlosen Lautsprecheranlage verbunden ist. Der Tonarm hat sich gehoben, und die Vinylscheibe liegt unbeweglich auf dem zu großen Plattenteller. Sieben Zoll. Eine Single. Auf dem Beistelltisch neben dem Gerät liegt die Hülle, mit einem Schwarzweißfoto von John Lennon, der durch eine runde Sonnenbrille in die Kamera blickt. Imagine. Released as a single for the first time in the UK. Jessica hebt den Deckel des Plattenspielers und dreht die Scheibe um. Zwei Seiten. Zwei Songs. Einer pro Seite. Imagine. Jessica spürt, wie eine kalte Welle ihren Körper schüttelt, als sie sich erinnert, was Koivuaho ihr vorhin erzählt hat. Die verdammte Musik. Wenn der Song lief, als die Streife eintraf, muss jemand die Nadel aufgesetzt haben, als die Polizisten schon beinahe im Haus waren.
Jessica lässt die Platte auf den Tisch fallen und schiebt die Hand unter ihre Jacke, noch bevor sie über die Bedeutung ihrer Erkenntnis nachdenken kann. Sie fasst nach dem Griff ihrer Glock-Pistole und dreht sich zu den weißen Engeln hin, die rund um die Leiche beschäftigt sind. Es sind drei Tatortermittler. Es waren die ganze Zeit nur drei, und keiner von ihnen war je in der oberen Etage.
6
Mit raschen Schritten geht Jessica durch den kurzen Flur zur Haustür. Sie knipst die Klappe des Holsters auf und biegt die Waffe etwas zu sich hin, damit der Verschlussmechanismus sich öffnet. In ihren Schläfen pocht es, und der rhythmische, immer schneller werdende Herzschlag gibt ihr das Gefühl, von ihren automatischen Körperfunktionen aufrecht gehalten zu werden. Als sie die Tür erreicht hat, sieht sie drei uniformierte Polizisten, zwei Streifenwagen, den Kleintransporter der Kriminaltechniker sowie den eben eingetroffenen Leichenwagen. Dagegen fährt der Krankenwagen, der sich als überflüssig erwiesen hat, gerade ab. Die roten und blauen Blinklichter der Einsatzfahrzeuge dominieren die Farbwelt der nächtlichen Idylle, sie streichen über die benachbarten Grundstücke und Häuser. Hinter einigen Fenstern brennt Licht, dort ist man offenbar neugierig geworden.
Noch bevor Jessica den Mund aufmacht, merken die Streifenbeamten, dass etwas nicht stimmt.
»Alles in Ordnung?«
»Wo ist er hin?«, fragt Jessica.
»Wer?«
»Der Kriminaltechniker!«
»Ach der«, sagt einer der Polizisten und zeigt mit dem Daumen auf die abschüssige Straße. »Dahin ist er gerade …«
»Gelaufen?«
»Gegangen.«
»Einer von euch kommt mit mir!«, ruft Jessica und geht rückwärts ein paar Schritte die Straße hinunter. Die im Wind schaukelnden Straßenlampen beleuchten den Weg.
»War das …«
»Und du meldest sofort bei der Zentrale, dass der Täter gerade eben zu Fuß vom Tatort geflohen ist. Wir brauchen Verstärkung, und zwar plötzlich!«, befiehlt Jessica nachdrücklich und zieht die Dienstwaffe aus dem Holster. Bei der dramatischen Geste zuckt der bärtige Beamte zusammen, als begreife er erst jetzt, dass sie es ernst meint.
Sie gehen die schneebedeckte Straße hinab; die tiefen Reifenspuren im Schnee erinnern an Straßenbahngleise. Auf dem Bürgersteig ist eine dichte Reihe frischer Fußspuren zu erkennen. Der Mann im Schutzanzug ist tatsächlich gegangen: Beim Laufen wären die Abdrücke nicht so nah beieinander. Sie werden ihn einholen, sofern er nicht damit rechnet, dass sie ihm schon so bald folgen. Dennoch gerät Jessica in den wenigen Sekunden, während sie den Fußabdrücken zur Kreuzung folgen, aus der Fassung. Der Mörder weiß, dass sie ihm nachsetzen. Genau das hat er ja offenbar gewollt: Er hat sich vor Jessica aufgebaut und den Mund aufgemacht, statt in aller Ruhe das Haus zu verlassen. Wenn sie schon bei dieser Begegnung kapiert hätte, dass der Mann kein Kriminaltechniker ist … Jessica bekommt eine Gänsehaut. Sie hat dem Mann, der Maria Koponen getötet hat, in die Augen geblickt. Und jetzt ist er irgendwo hier draußen, frei und triumphierend.
»Weit kann er nicht sein«, sagt der stämmige Streifenbeamte. Jessica hält ihre Pistole mit beiden Händen, als sie sich der Kreuzung nähern. Eine hohe, verschneite Fichtenhecke versperrt die Sicht auf die Querstraße. Jessica verlangsamt ihre Schritte, gibt dann dem Polizisten neben ihr, dessen Bewegungen ein Spiegelbild ihrer eigenen sind, mit den Augen ein Zeichen. Sie späht an der Hecke vorbei, sieht aber nur die leere Straße und die beidseits parkenden Autos.
»Verdammt«, murmelt sie und sucht mit dem Blick nach Fußspuren. Es sind keine zu sehen. Die Straße ist kürzlich vom Schnee geräumt worden, und der Flüchtige hat möglicherweise seinen Weg auf der Fahrbahn fortgesetzt, wo er keine auffälligen Spuren hinterlässt. Jessica hört die Sirenen der näher kommenden Streifenwagen. Aus der Ferne dringt das dumpfe Poltern des Schneepflugs an ihr Ohr.
»Er kann sich hinter den Autos versteckt haben. Oder darunter«, flüstert der Polizist und nähert sich langsam dem ersten Fahrzeug.
»Das würde er nur tun, wenn er es eilig hätte, sich zu verbergen«, sagt Jessica in fast normaler Lautstärke.
»Hat er denn keine Eile?«
Jessica antwortet nicht. In Gedanken verflucht sie die langen Sekunden, die sie gebraucht hat, um zu begreifen, dass der Mörder sich unbehelligt vom Tatort entfernt hat, obwohl das Haus längst abgeriegelt war.
»Wie heißt du?«, fragt Jessica, während sie vorsichtig von einem Auto zum nächsten gehen.
»Hallvik. Lasse Hallvik. Wachtmeister.«
»Okay, Lasse. Check alle Autos. Aber sei auf der Hut. Verstärkung ist unterwegs«, sagt Jessica und beginnt, die hell beleuchtete Straße entlangzulaufen.
»Willst du ihn etwa allein verfolgen?«
Jessica gibt keine Antwort, sondern holt mit der einen Hand ihr Telefon hervor; in der anderen Hand hält sie immer noch die Pistole. Sie läuft mitten auf der Fahrbahn und weiß, dass Hallvik ihr Rückendeckung gibt. Zumindest solange sie auf diesem Teil der Straße ist.
»Hallo?« Die wachsame Stimme, die sich am Telefon meldet, gehört Jessicas Vorgesetztem, Kriminaloberkommissar Erne Mikson, der erst vor einer halben Stunde zum Ermittlungsleiter in diesem Fall ernannt wurde.
»Ich weiß nicht, ob die Zentrale die Nachricht weitergeleitet hat, aber wir müssen die Zufahrten zur Brücke nach Kulosaari sperren. Sofort«, sagt Jessica und spürt die Aufregung in ihrer Stimme.
»Was läuft dort?«
»Ich verfolge den Mörder zu Fuß.«
»Mit wem?«
»Allein.«
»Jessica!«
»Er ist gerade erst hier langgelaufen. Ich muss sehen … Verdammt, warte mal.« Jessica steckt das Handy in die Jackentasche und packt ihre Glock wieder mit beiden Händen. Einen Moment lang ist sie sicher, dass sie einen Menschen auf der Erde sieht. Doch der weiße Overall flattert leer auf der Straße, wie ein Michelin-Männchen, dem man mit einem Messerstich die Luft abgelassen hat. Das eine Hosenbein weht im Wind, als wolle es die Richtung anzeigen, in die sein Besitzer sich höchstwahrscheinlich entfernt hat. Jessica blickt sich um und sieht den Polizisten, der sich hundert Meter hinter ihr zwischen den Autos bückt. Sie steckt die Fingerspitzen in den Mund und pfeift, um ihn auf sich aufmerksam zu machen.
»Lasse! Pass auf, dass keiner hier drüberfährt!«, ruft sie, ohne zu wissen, ob der Kollege sie im Gegenwind hören kann. Hallvik steht jedoch auf und eilt herbei. Jessica geht weiter und denkt über ihren nächsten Zug nach, als sie hört, dass das Sirenengeheul lauter wird. Ein unbestimmbarer Instinkt lässt sie stehen bleiben und flüstert die unangenehme Wahrheit: Der Mann wird nicht gefasst. Nicht in dieser Nacht. Jessica stößt einen tiefen Seufzer aus. Dann holt sie das Handy wieder aus der Tasche.
»Erne?«
»Verdammt nochmal, Jessica! Ich dachte schon, dass …«
»Ich hab’s vergeigt, Erne.«
Sie hört die Stimme ihres Vorgesetzten, doch ihr Verstand ist bereits auf das kreisende Karussell gesprungen, auf dem während der Fahrt kein neuer Gedanke Platz findet. Der Mann, der das Lächeln auf Maria Koponens lebloses Gesicht gezaubert hat, beobachtet sie womöglich aus der tiefen Dunkelheit heraus. Er ist nirgends zu sehen. Dennoch ist er überall.
7
Kriminaloberkommissar Erne Mikson wird schon seit gut zwei Wochen von einer hartnäckigen Erkältung geplagt, doch der Eigengeruch des Wageninneren, eine seltsame Mischung aus Marzipan, abgewetztem Leder und versengter Kupplung, dringt durch seine verstopfte Nase. Erne hört einen leisen Signalton und zieht das digitale Fieberthermometer unter der Achsel hervor. 37,4. Verdammt. Um 0,3 Grad gestiegen, seit er sich vorhin in Pasila in den Wagen gesetzt hat. Er blickt auf die Uhr, zieht ein kleines Notizbuch aus der Brusttasche und trägt das Resultat in die nächste freie Zeile ein. Das dicke Heft dient ihm schon seit mehreren Jahren und fällt bald auseinander.
Erne schreckt auf, als die Beifahrertür des alten 3er BMW aufgeht und die dreiunddreißigjährige schwarzhaarige Frau einsteigt. Ihre grimmige Miene und die spärliche Beleuchtung betonen die Konturen ihres hübschen Gesichts. Eine Weile schauen sie beide nach vorn: Vor dem hundert Meter entfernten Haus parkt ein Dutzend Wagen. Näher bei ihnen versperrt ein quer gestellter Streifenwagen die Straße, blau-weißes Absperrband unterstreicht dieses Signal.
»Der Zirkus ist in Kulosaari«, sagt Erne Mikson schließlich, steckt das Heft in die Brusttasche und drückt ein Stück Nikotinkaugummi aus der Folie direkt in seinen Mund. Die beruhigende Wirkung der Zigarette, die er vor zehn Minuten bei halboffenem Fenster geraucht hat, ist schon verflogen. Im Übrigen ist es spätestens jetzt höchste Zeit, weniger zu rauchen. Oder sogar ganz aufzuhören. Ob das noch etwas bringt, wird sich herausstellen, wenn sein Arzt anruft und ihm die Ergebnisse der Probeexzision mitteilt.
»Willst du nicht reinkommen?«, fragt Jessica leise und lehnt den Kopf an die Nackenstütze.
»Nein. Wenn es nicht sein muss«, antwortet Erne, und seine Augen scheinen zu gähnen. Dann lässt er das Seitenfenster ein kleines Stück herunter und fährt fort: »Ein Mann um die vierzig, normale Statur, relativ breitschultrig, eins achtzig groß, blaue Augen und … für das Wetter zu leicht gekleidet?«
»Ich glaub nicht, dass ein dicker Mantel unter den Overall gepasst hätte.«
»Wir haben sechs Typen aufgesammelt, auf die deine Beschreibung passt, allerdings hatten alle dicke Mäntel oder Jacken dabei. Einen auf der Straße, drei in der Kneipe im Einkaufszentrum. Und dann noch zwei an der Bushaltestelle am Ostring. Wir haben die Festnahmen in einem Radius vorgenommen, der die Strecke abdeckt, die der Mann laufend zurücklegen konnte. Fünf Minuten später, und wir hätten auch den nächsten Stadtteil, Herttoniemenranta, durchkämmen müssen. Und dann wären uns die Ressourcen ausgegangen«, sagt Erne, sieht die neben ihm sitzende Frau an und fährt fort: »Du hast alles genau richtig gemacht, Jessi.«
Jessica lächelt bei den Worten ihres Chefs, die sie allerdings nicht trösten. Erne spricht mit ihr wie ein Trainer mit einem Fußballspieler, den er nach der ersten Halbzeit ausgewechselt hat. Der empathische Tonfall ändert nichts an der Tatsache, dass auf dem Platz nicht alles perfekt gelaufen ist.
»Sag mal, Erne«, beginnt Jessica, schluckt laut und spricht weiter: »Wie lange bist du schon bei der Einheit? Und wie oft in den gefühlt tausend Jahren hat ein Ermittler am Tatort mit dem Mörder gesprochen und ihn dann gehen lassen?«
»So kannst du es sehen, wenn du dich quälen willst.«
»Wie könnte ich es anders sehen?«
»Na, zum Beispiel so, dass der Kerl vielleicht die Waffe gezogen und euch alle erschossen hätte. Ich meine, wenn dir in der Situation ein Verdacht gekommen wäre und du eine Festnahme versucht hättest. Kann gut sein, dass keiner schnell genug reagiert hätte«, sagt Erne und stellt das Radio leiser. Es ist Jessica am Gesicht abzulesen, dass seine Worte ein Körnchen Wahrheit enthalten. Bei der Begegnung mit dem mutmaßlichen Mörder wähnte sie sich in Sicherheit, und der Mann hätte ohne Weiteres jeden im Haus verletzen oder töten können. Nicht nur Maria Koponen.
»Sechs Verdächtige?«, fragt sie schließlich und zieht den Reißverschluss ihrer Jacke auf.
»Die Fasern im Overall werden mit der DNA der Männer verglichen.«
»Was ist mit dem Mundschutz?«
»Der wurde nicht gefunden. Liegt bestimmt in irgendeiner Mülltonne. Oder der Täter hat ihn bei sich.«
»Das ergibt keinen Sinn«, widerspricht Jessica leise.
»Weil er den Overall auf der Straße zurückgelassen hat?«
»Ja.«
»Jetzt hör mir mal zu, Jessi«, mahnt Erne, um die nutzlosen Spekulationen zu unterbrechen. Er fixiert einen Mann, der aus dem Gartentor des gegenüberliegenden Hauses tritt und dem Jusuf bedeutet, Abstand zu halten. Die neugierigen Nachbarn haben das Aas gerochen.
»Glaubst du, du würdest seine Stimme erkennen?«, fragt Erne, während einer der Ermittler beginnt, die Aussage des Mannes, der einen dicken Mantel, eine Pyjamahose und hohe Stiefel trägt, aufzunehmen.
»Natürlich. Aber ich wette, dass der Täter keiner von denen ist, die ihr auf Band habt.«
»Eine Pessimistin wird nie enttäuscht.« Erne reckt sich nach der Ledertasche auf dem Rücksitz und entnimmt ihr ein Tablet, das er nach einer Weile an Jessica weiterreicht.
»Sechs Videos. Sechsmal derselbe Satz«, erklärt er. Die erste ist erledigt. Jessica sieht sich die Videoclips an, lauscht auf die Stimmen und blickt jedem tief in die Augen. Kann sie an ihnen den Täter erkennen, der ihr vor einer Dreiviertelstunde im Wohnzimmer der Koponens gegenübergestanden hat? Zwei der Männer sind sichtlich betrunken, was laut Kommentar am unteren Bildrand per Messgerät bestätigt wurde. Einer zeigt eine seltsame – wenn auch nicht wirklich verdächtige – Gelassenheit, und die restlichen drei wirken frustriert. Kein Wunder, es würde jeden fuchsen, im hellen Lampenlicht zu stehen und einen von der Polizei diktierten Satz auf Band zu sprechen, ohne die geringste Ahnung zu haben, worum es geht. Irgendwer hat mehr als nur eine Ahnung. Aber wie Jessica vermutet hat, ist er nicht unter den Männern auf dem Video.
»Nein«, sagt sie und reicht Erne das Tablet zurück.
»Bist du sicher?«, fragt Erne, obwohl er weiß, dass die Frage keine Antwort verdient. Nach kurzer Stille streicht er seine dicken grauen Haare nach oben und hüstelt, um die Stimme freizubekommen. Doch das tief im Hals sitzende Rasseln lässt sich nicht weghusten.
»Hier. Rasmus hat alles Wesentliche über Maria Koponen herausgesucht.« Er reicht Jessica ein Blatt Papier. Der Lebenslauf der toten Frau, die wichtigsten Fakten über ihr abrupt beendetes Leben. Jessica nimmt den Bogen und liest Zeile für Zeile.
»Alter: 37. Ausbildung: Doktor der Pharmazie. Beruf: Produktentwicklungsleiterin, Neuropharm AG.«
»Ich weiß nicht, ob etwas Nützliches dabei ist.«
»Mal sehen«, sagt Jessica, faltet den Bogen zusammen und steckt ihn in die Tasche. Ein weißer Hase springt über die Straße. Vielleicht sollte man auch ihn verhören.
»Ich muss jetzt nach Pasila, die Pressemitteilung schreiben«, erklärt Erne.
»Darum beneide ich dich nicht.«
»Eine Ausnahmesituation. Wir müssen die Menschen warnen.«
»Wovor? Dass sie keinen Kriminaltechniker ins Haus lassen sollen?«, murmelt Jessica und streicht über ihre Fingerknöchel. Erne lacht freudlos auf. Schwarzer Humor gehört zum Job, aber Jessica versteht es meisterhaft, ihn auf die Spitze zu treiben. Eine Weile sitzen sie schweigend im Wagen und sammeln ihre Gedanken.
»Die Fahndung muss ausgeweitet werden. Und dann steht noch die Befragung von Roger Koponen an«, sagt Erne schließlich, dreht das Fenster hoch und fährt fort: »Ich erledige das alles. Deine Aufgabe ist jetzt, herauszufinden, was in dem Haus passiert ist. Wie es aussieht, werden schon die Nachbarn befragt. Vielleicht hat irgendwer etwas gesehen.«
»Okay«, sagt Jessica und stößt die Tür auf. »Versuch, keinen Herzinfarkt zu kriegen, Ser Davos.«
»Wenn irgendwer mir einen beschert, dann du, Arya.«
8
Roger Koponen hockt am Tisch, die Finger um sein leeres Wasserglas gelegt, und starrt auf die Stirn der Frau, die ihm gegenübersitzt. Kurz zuvor hat der Sozialarbeiter den Raum verlassen und gesagt, er warte nebenan, falls Roger über den Vorfall reden wolle. Kriminalkommissarin Sanna Porkka greift nach der Karaffe und schenkt Roger Wasser nach.
»Ich sollte jetzt wohl nach Helsinki fahren«, murmelt Roger, ohne seinen glasigen Blick von der Decke abzuwenden.
»Verstehe«, sagt Porkka und lehnt sich gemächlich zurück. »Vorher müssten Sie allerdings einen Alkoholtest machen. Vermutlich haben Sie ja beim Abendessen einiges getrunken.«
»Das darf ja wohl nicht wahr sein«, schimpft Koponen ungläubig.
»Eigentlich wäre es uns lieber, wenn Sie über Nacht in Savonlinna bleiben würden, wie ursprünglich geplant.«
»Warum?«
»Was Sie gerade erfahren haben, wäre für jeden ein Schock. Sie haben eine lange Fahrt bei schlechten Straßenverhältnissen vor sich, und in Helsinki gibt es nichts, wobei Sie heute Nacht helfen könnten.«
»Stimmt. Dafür ist es wohl zu spät«, sagt Roger Koponen fast flüsternd und lächelt schwach, aber nur mit dem Mund. Porkka weiß, dass Angehörige sich oft seltsam und inkonsequent verhalten. Aus ihren Reaktionen kann man selten brauchbare Schlüsse ziehen. Der starre, funkelnde Blick, die blasse Haut und die beschleunigte Atmung zeugen jedoch von einem echten Schock.
»Hat man den Mann gefasst?«, fragt Roger Koponen nun etwas resoluter und setzt mit zitternden Händen das Wasserglas an den Mund. Sanna Porkka überfliegt ihre Notizen, um zu überprüfen, wie viel dem Ehemann des Opfers bisher mitgeteilt wurde. Offenbar wurde Roger Koponen nur darüber informiert, dass seine Frau in ihrem Haus im Helsinkier Vorort Kulosaari tot aufgefunden wurde und dass die Polizei von einem Verbrechen ausgeht. Porkka konzentriert sich wieder auf Koponens Frage.
»Wieso glauben Sie, dass es sich um einen Mann handelt?«, fragt sie zurück und bemüht sich, den Eindruck zu vermeiden, sie wolle ihr Gegenüber verhören. In diesem Stadium hat die Polizei keinen Grund zu der Annahme, dass Roger Koponen irgendetwas mit dem Tod seiner Frau zu tun hat, aber es kann schwierig werden, diese Alternative endgültig auszuschließen, wenn man bei dem Verhör Flüchtigkeitsfehler macht. Eigentlich ist Sanne Porkka nicht an den Ermittlungen beteiligt, sondern hat nur die Aufgabe, den prominenten Autor, der seine Frau verloren hat, eine Weile im Auge zu behalten. Die Versuchung, ihm einige fundamentale Fragen zu stellen, ist jedoch zu groß.
»Ich weiß nicht. Ist das nicht ziemlich wahrscheinlich?«, antwortet Roger Koponen langsam und stellt das Glas auf den Tisch. Sein Blick wird ein wenig klarer, als wäre er stolz auf seine Bemerkung. Porkka presst die Lippen zusammen und nickt. Wenn man an die Statistiken denkt, hat Koponen recht. In Finnland ist der Mörder in neun von zehn Fällen ein Mann. Der Anteil ist noch größer, wenn Täter und Opfer sich nicht gekannt haben.
»Die einzige Bestrebung ist jetzt, den Täter zu fassen. Und die Kollegen in Helsinki glauben, dass Sie ihnen per Computer am besten helfen können. Hier in Savonlinna auf der Polizeistation, wo wir alles für Sie bereitstellen, was Sie wollen. Nicht im Auto, wo Sie infolge von Müdigkeit und Erschütterung Ihre eigene Sicherheit und möglicherweise auch die anderer Verkehrsteilnehmer gefährden«, sagt Porkka, kneift die Lippen zusammen und hofft, dass sie empathisch genug wirkt. Dann gibt sie das Passwort in den Laptop ein.
»Wie soll ich am Computer nützlich sein?«, fragt Roger Koponen stirnrunzelnd.
»Erne Mikson, der Ermittlungsleiter in Helsinki, möchte über Skype mit Ihnen sprechen«, antwortet Porkka ruhig und verschränkt die Arme auf dem Tisch. Roger Koponen blinzelt ein paarmal, als wäre der Vorschlag völlig absurd. Seine Körpersprache lässt jedoch keine direkte Weigerung erwarten.
»Per Skype?«, murmelt er und scheint intensiv über die Idee nachzudenken.
»Wie gesagt, das einzige Ziel ist es …«
»Gerade eben haben Sie von Bestrebung gesprochen.«
»Bitte?«
»Sie haben vorhin gesagt, die einzige Bestrebung sei es, den Mörder meiner Frau zu fassen. Nicht das Ziel«, erklärt Koponen und kratzt sich an der Augenbraue. Eine kleine Hautschuppe schwebt herunter und landet neben dem Glas auf dem Tisch.
»Richtig. So habe ich mich wohl ausgedrückt«, sagt Porkka und bemüht sich, verständnisvoll zu lächeln. Sie überlegt, ob es besser wäre, den Mann in Ruhe zu lassen. Doch die Zeit drängt. Vor einer halben Stunde hat sie einen Bericht bekommen, wonach der Verdächtige immer noch auf der Flucht ist. Der Minutenzeiger der viereckigen Wanduhr springt auf die Zwölf.
»Entschuldigen Sie mich, ich bin gleich wieder hier«, sagt sie. Mit einigen Sekunden Verzögerung nickt Koponen zustimmend.
Sanna Porkka schließt die Tür hinter sich und bedeutet dem diensthabenden Polizisten, sie im Auge zu behalten. Sie wirft einen Blick auf den jungen Sozialarbeiter, der vor dem geräuschvoll Kaffeebohnen mahlenden Getränkeautomaten steht, und geht in ihr Dienstzimmer.
»Ist Koponen bereit?«, fragt Erne Miksons müde Stimme am Telefon. Im Hintergrund ist Motorengeräusch zu hören.
»Er ist ziemlich neben der Spur.«
»Trotzdem müssen wir mit ihm reden.«
»Natürlich.« Porkka tritt ans Fenster. Die aus der Dunkelheit hereinstarrenden kahlen Birken winken mit ihren mageren Ästen ins Warme.
»Es wäre natürlich besser, von Angesicht zu Angesicht mit ihm zu reden«, beginnt Erne, und Sanna Porkka hört eine Folie rascheln. Dann verstummt er und konzentriert sich darauf, Kaugummi zu kauen. Schließlich fährt er heiser fort: »Es kommt mir irgendwie respektlos vor, einen frisch Verwitweten per Skype zu befragen, aber wir müssen sofort so viele Informationen bekommen wie nur möglich.«
»Okay«, sagt Porkka und hat das Gefühl, dass sie das Wort gewählt hat wie ein unsicherer Teenager, der die Sprache der Erwachsenen zwar versteht, aber nicht sprechen kann.
»Fünfzehn Minuten. Dann bin ich am Computer. Kümmere dich bis dahin um den Mann.«
»Sorry, noch was …«, wirft Porkka ein, bevor der Kriminaloberkommissar auflegen kann.
»Ja?«
»Roger Koponen … Er brennt darauf, seine Frau zu sehen. Wenigstens ein Foto vom Tatort.«
»Natürlich«, sagt Erne nach kurzem Schweigen. Das Motorengeräusch erstirbt, und Sanna Porkka glaubt zu hören, wie der Mann etwas ausspuckt. Dann wird die Tür des Autos zugeschlagen, ein Feuerzeug knackt, ein tiefer Atemzug verrät, dass der Kommissar seine Lunge mit Rauch füllt. »Klar, dass er das will. Aber glaub mir, es ist besser, damit noch eine Weile zu warten.«
9
Jessica Niemi zieht neue Überschuhe, einen weißen Overall, Handschuhe und Atemschutz an. Plötzlich fühlt sie sich in dem Haus schutzlos, obwohl es nach dem Zwischenfall gründlichst unter die Lupe genommen wurde. Sie geht erneut ins Wohnzimmer und sieht, dass die Ermittler ihr Suchgebiet um den Tisch herum ausgeweitet haben. Maria Koponen sitzt getreulich auf ihrem Platz am Tischende, auf ihrem Gesicht liegt weiterhin das irre, triumphierende Grinsen. Es sieht aus, als wäre die Hausherrin die Einzige, die die Nachricht über den Mord nicht bekommen hat.
Normalerweise wäre die Leiche in dieser Phase bereits in einen Sack gesteckt und weggebracht worden, aber offenbar hängen zu viele Fragen in der Luft. Fragen, deren Beantwortung der Abtransport des leblosen Frauenkörpers entscheidend erschweren könnte.
»Haben wir irgendeine Ahnung, was hier passiert ist?«, fragt Jessica. Mit einer Handbewegung hat sie den Leiter der Spurensicherung angehalten, den sie mit Sicherheit als Mitglied des Teams identifiziert hat. Nach der Begegnung mit dem verkleideten Mörder ist sie auf der Hut.
Der gutaussehende Mann heißt Harju und sieht Jessica aus seinen braunen Augen beruhigend an.
»Eine ziemlich schwache Ahnung«, seufzt er und nimmt den Atemschutz ab.
»Nichts?«
»Sicher ist nur, dass nicht eingebrochen wurde. Der Täter ist durch die Schiebetür im Wohnzimmer hereingekommen. Und hat sie hinter sich zugeschoben. Sie war nicht verriegelt und ist immer noch offen.«
»Nicht verriegelt«, murmelt Jessica.
»Oder Opfer und Täter kannten sich, und das Opfer hat ihn ins Haus gelassen.«
»Irgendwie schwer zu glauben. Der Täter hatte einen weißen Overall dabei und«, sagt Jessica, geht an Harju vorbei und fährt fort: »und irgendwas, womit er dieses Kunstwerk geschaffen hat.«
»Das Gesicht der Frau ist hart wie Stein.«
»Was?«
»Es ist quasi in diese Position gezwungen. Schwer zu sagen, ob …«
»Hat er ihr was injiziert?«, fragt Jessica. Sie kneift die Augen zusammen und merkt jetzt, dass Maria Koponens Kopf leicht schräg liegt. So muss er die ganze Zeit gelegen haben.
»Vermutlich. Aber das klärt sich erst bei der Obduktion.«
»Sag mir sofort Bescheid, wenn ihr etwas Überraschendes entdeckt.«
»Natürlich.«