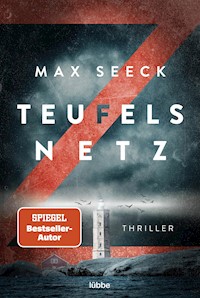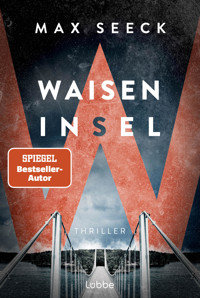
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Jessica Niemi
- Sprache: Deutsch
Kommissarin Jessica Niemi gerät in eine Auseinandersetzung, wird handgreiflich und prompt von einem Passanten gefilmt. Das Video geht viral und sie wird beurlaubt. Um Abstand zu gewinnen, fährt Jessica auf die zwischen Finnland und Schweden gelegenen Åland-Inseln. Dort trifft sie auf eine Gruppe älterer Menschen, die als Kinder während des Krieges fliehen mussten und hier auf der Insel in einem Waisenhaus lebten. Nun treffen sie sich wieder. Als einer der Alten tot aufgefunden wird, beginnt Jessica zu ermitteln. Denn bereits zuvor kamen zwei Menschen auf dieselbe mysteriöse Weise ums Leben. Alle drei Opfer scheinen mit der Legende um »Das Mädchen im blauen Mantel« im Zusammenhang zu stehen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumWidmungVersProlog12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091Über dieses Buch
Kommissarin Jessica Niemi gerät in eine Auseinandersetzung, wird handgreiflich und prompt von einem Passanten gefilmt. Das Video geht viral und sie wird beurlaubt. Um Abstand zu gewinnen, fährt Jessica auf die zwischen Finnland und Schweden gelegenen Åland-Inseln. Dort trifft sie auf eine Gruppe älterer Menschen, die als Kinder während des Krieges fliehen mussten und hier auf der Insel in einem Waisenhaus lebten. Nun treffen sie sich wieder. Als einer der Alten tot aufgefunden wird, beginnt Jessica zu ermitteln. Denn bereits zuvor kamen zwei Menschen auf dieselbe mysteriöse Weise ums Leben. Alle drei Opfer scheinen mit der Legende um »Das Mädchen im blauen Mantel« im Zusammenhang zu stehen …
Über den Autor
Max Seeck war zunächst im Vertrieb und Marketing einer finnischen Firma tätig. Mittlerweile widmet er sich jedoch ganz dem Schreiben. Mit großem Erfolg: HEXENJÄGER war sein internationaler Durchbruch, und er ist inzwischen der erfolgreichste Thriller-Autor Finnlands. Als einer von wenigen europäischen Autoren stand er auf der NEW-YORKTIMES-Bestsellerliste. Max Seeck lebt mit seiner Familie in Helsinki.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel der finnischen Originalausgabe:
»Loukko«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2022 by Max Seeck
Original edition published by Tammi publishers, 2022
German edition published by agreement with
Max Seeck and Elina Ahlback Literary Agency, Helsinki, Finland
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2023/2025 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Ingola Lammers, München
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille
Einband-/Umschlagmotiv: © shutterstock: nblx | photosoft
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-4787-5
luebbe.de
lesejury.de
Für Oma Sinikka(1935-2022)
Die verlorene Zeit fällt mir wieder ein.Endlich umarmen sich Vater und Sohn.Mit dem stillen Wissen kommt man leichter davon.Man fühlt sich klein, will größer sein.Dann baust du ein Haus, heiratest die Frau.Bist wieder da, wo die Kinder waren.Tob da jetzt bloß nicht rum.Alte Leute werden wieder trotzig.Akzeptier, was gut ist,auch wenn das Herz ein bisschen motzt.Die langen Tage hier ziehen sich, ziehen sich hin.Bei der Arbeit die alte Platte, hör nicht hin.Die Zeit vergeht, hinter den Himmel geht sie.Und eh du es merkst, ist deine vorbei.Manchen bereitet der Abschied Schmerz.Vor der Welt zerreißt vor Sehnsucht das Herz.
ASA: DIELANGENTAGEHIER
Prolog
29. September 1982
Martin Hedblom faltet die Zeitung zusammen, legt sie auf den Tisch und gähnt. Er hat den Sportteil der Nya Åland schon zweimal durchgeblättert, aber die Lektüre war auch diesmal kein besonderer Genuss. Die im vorigen Frühjahr gegründete Lokalzeitung ist zwar mehr nach seinem Geschmack als das Konkurrenzblatt Tidningen, aber eine New York Times ist auch sie nicht. Martin kratzt mit dem Fingernagel an dem Kringel, den die Kaffeetasse auf der Vorderseite hinterlassen hat, und legt dann die Füße auf den Tisch. Er wirft einen Blick auf die Wanduhr: Gleich wird der Minutenzeiger auf die Zwölf springen, und dann ist es zwei Uhr, was bedeutet, dass erst die Hälfte der Nachtschicht um ist. Er sieht sich selbst in der Glaswand der Kabine und wendet den Blick schnell wieder auf die Zeitung, als wäre ihm sein Spiegelbild zuwider. Es zeigt wahrhaftig nicht denselben Martin, der vor fast vier Jahrzehnten seine Arbeit als Nachtwächter des Kinderheims begonnen hat. Sein Gesicht ist aufgequollen wie Hefeteig, von der Körpermitte ganz zu schweigen. Und auch wenn die Koteletten, die in den Stoppelbart übergehen, immer noch dicht und buschig sind, wächst auf dem Kopf seit Jahren kein einziges Haar mehr.
Martin ist 55, ein schwungloser und träger Junggeselle, der sein Leben lang im selben Winkel von Åland gewohnt hat, abgesehen von einer kurzen Phase, in der er sich als Schlagzeuger erprobte und auf den Fähren nach Schweden auftrat. Nach einer Weile war er jedoch in den Job zurückgekehrt, den er kannte und der – noch wichtiger – für einen Lahmarsch wie ihn leicht und mühelos genug war. So unverblümt hatte sich sein Vater, ein Professor, ausgedrückt und seinen einzigen Sohn damit leider treffend beschrieben.
Martin trinkt einen Schluck mit Limonade gemischten Schnaps aus seiner grauen Feldflasche und betrachtet die leeren Flure. Alle Kinder schlafen tief und fest in ihren Zimmern, und sein Einsatz wird während der Nacht wohl nicht gebraucht. Er wird ja selten gebraucht, wenn überhaupt jemals. Tatsächlich könnte er an seinem Tisch saufen, so viel er will, oder auch die ganze Nacht schlafen und trotzdem sein Gehalt einstecken, wenn die kommunalen Sozialarschlöcher keine unangemeldeten Inspektionen machen würden. Martin ist schon zwei Mal bei einem Nickerchen erwischt worden, und das nächste Mal könnte fatal sein. So kurz vor dem Rentenalter lohnt es sich einfach nicht mehr, das Risiko einzugehen.
Die Uhr knackt leise und zeigt die volle Stunde an.
Martin wirft einen Blick auf die Schublade, in der unter den Schnellheftern ein Pornoheft liegt. Es kommt ihm immer ein bisschen bedenklich vor, während der Nachtschicht zu wichsen, aber eines der Kinder übernachtet mit Sondererlaubnis bei den Nordins und die anderen drei schlafen in ihren eigenen Zimmern, sodass ihn niemand überraschen kann. Mit dem intimen Moment verbindet sich nämlich nicht der Wunsch, überrascht zu werden, und auch keine andere perverse oder anrüchige Absicht, das redet Martin sich jedenfalls ein. Er möchte nur in Gesellschaft von Desiree West und Laura Sands ein wenig Zeit totschlagen.
Martin öffnet den Gürtel und zieht die Schublade auf. Schon der Gedanke an die Mädchen auf der mittleren Doppelseite hat sein Blut in Wallung gebracht. Heute wird er es ihnen ordentlich besorgen, zumindest in seiner Fantasie. Das Taschentuch hat er auch schon parat …
Aber gerade als seine Finger nach dem Pornoheft greifen, klingelt das schwarze Telefon auf dem Tisch. Martin lässt das Heft los und nimmt schnell den Hörer ab, damit das fordernde Klingeln niemanden im Haus weckt, vor allem jetzt nicht, wo er mit offenem Hosenstall am Tisch sitzt.
»Smörregård barnhem«, meldet er sich heiser und räuspert sich. Mit der freien Hand schnallt er hastig den Gürtel zu, als könnte der Anrufer ihn sehen.
Aus dem Hörer dringen jedoch nur gleichmäßige Atemzüge an sein Ohr.
»Hallo?«, sagt Martin.
Jetzt hört er eine Stimme, die etwas zu trällern scheint. Eine melancholische Melodie, die ihm vage bekannt vorkommt. Verflucht. Martin spürt Ärger aufsteigen: Irgendein Arschloch ruft mitten in der Nacht im Kinderheim an, um ihn zu foppen. Es ist natürlich keins der Kinder, denn im ganzen Gebäude gibt es nur zwei Telefone – das eine hält er gerade in der schweißnassen Hand und das andere steht hinter verschlossenen Türen im Dienstzimmer der Heimleiterin Boman. Außerdem hat kein Kind sein Zimmer verlassen, seit das Licht gelöscht wurde, nicht einmal, um aufs Klo zu gehen.
»Wer ist da?«, fragt Martin und macht Anstalten, den Hörer auf die Gabel zu knallen. Die leise Melodie, die der Anrufer singt, hält ihn jedoch zurück. Er hat sie seit Jahrzehnten nicht mehr gehört, erinnert sich aber immer noch genau. Zugvögel.
Plötzlich verstummt der Gesang. Martin presst den Plastikhörer immer fester ans Ohr. Die Sprechmuschel riecht nach getrocknetem Schweiß.
»Bist du bereit?«, fragt die Stimme. Sie ist leise und könnte ebenso gut einer Frau wie einem Mann gehören, oder auch einem Mädchen oder Jungen.
»Was? Wozu?«, knurrt Martin und spürt die Angst in seiner Stimme. »Wer ist da?«
Einen Augenblick lang hört er nur ruhige Atemzüge.
»Es ist zwei Uhr«, fährt die flüsternde Stimme fort.
Martin wirft instinktiv einen Blick auf die Uhr.
»Was zum Teufel soll das?«
»Ich warte hier. In einem blauen Mantel. Komm und hol mich«, sagt die Stimme und beginnt dann erneut dieselbe Melodie zu trällern. Einige Sekunden später endet der Anruf mit einem mechanischen Schnalzen, und Martin hört nur noch ein rasches Tuten, das immer noch in seinen Ohren nachklingt, nachdem er den Hörer aufgelegt hat.
Er schiebt die Schreibtischschublade zu. Während er gerade eben noch an das rothaarige Mädchen auf der Doppelseite gedacht hat, an dessen verführerischen Blick, den gewölbten Rücken und die festen Titten, haben jetzt ganz andere Gedanken die Oberhand gewonnen. Kalte Schauder laufen ihm den Rücken hinunter, während er den Blick durch den leeren Flur und über die geschlossenen Türen wandern lässt, hinter denen die Kinder schlafen. Oder jedenfalls schlafen sollten.
Es ist zwei Uhr … In einem blauen Mantel.
Martin beißt die Zähne zusammen und kann sich nur mit Mühe davon abhalten, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Jede einzelne Tür in dieser verdammten Bruchbude aufzutreten und die Kinder auf den Flur zu kommandieren. Das würde die Leiterin tun. Eines der Kinder muss auf irgendeine Art dahinter stecken. Ein geschmackloser Scherz. Geschmacklos, aber genial beängstigend. Das muss Martin zugeben. Wer immer der kleine Scheißkerl auch ist, Martin wird ihm zeigen, wer Angst hat und vor wem.
Er legt die Finger auf den Hörer. Eine Minute vergeht, aber nichts geschieht. Das Telefon steht stumm auf dem Tisch, als hätte jemand den Stecker gezogen.
Hier bin ich.
Martin denkt an die Worte, die er gerade gehört hat, und merkt, dass sich die Härchen auf seiner Haut aufgerichtet haben. Das Lied, das der Anrufer geträllert hat, lässt ihn nicht mehr los. Das kann doch nicht möglich sein.
Jemand will mir nur Angst einjagen, denkt Martin. Und das ist ihm gelungen, verdammt noch mal.
Trotzdem muss er die Sache überprüfen, er muss nach draußen gehen und einen Blick auf den Bootssteg werfen, sonst geht ihm das Ganze nicht mehr aus dem Kopf. Die Möglichkeit, dass jemand …
Martin nimmt den Schlüsselbund vom Tisch und steht auf. Er geht aus seiner Kabine auf den Flur. Alle Zimmertüren sind geschlossen, auch die Küchentür am Ende des langen Flurs. Die Stille wird nur durch den Herzschlag gebrochen, der in seinen Ohren hämmert.
Seine Schritte hallen dumpf durch den leeren Flur. Martin blickt sich nach allen Seiten um und tritt auf die Treppe. Einige Stufen führen nach unten zu der massiven Tür. Dahinter erstreckt sich der Rasen, und weiter links befinden sich die roten Bootsschuppen und der T-förmige Anleger. Während Martin die kurze Treppe hinuntergeht, überlegt er, ob er vorsichtshalber doch in die Zimmer hätte spähen sollen, um sich zu vergewissern, dass alle drei Kinder wirklich in ihren Betten liegen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Kind zum Fenster hinausklettert und ausreißt. Für seinen Schabernack hätte der Ausreißer allerdings ein Telefon finden müssen, und davon gibt es auf der Insel nicht viele. Vielleicht eins im Haus der Nordins zwei Kilometer von hier am Südufer der Insel und … Steckt etwa der kleine Scheißer, der bei den Nordins übernachtet, dahinter …
Martin öffnet die Tür und geht nach draußen. Nach dem Nieselregen glitzert der Rasen in der Septembernacht, die die Lampen auf dem Hof und der klare Halbmond am Himmel erhellen. Die Plane, die über die an Land geholten, kieloben neben den Bootsschuppen liegenden Ruderboote gebreitet wurde, flattert im Wind, sodass er den Anleger nicht sieht. Martin wischt sich über die nasse Nase und macht sich entschlossen auf den Weg ans Ufer. Bald überläuft ihn wieder eine kalte Welle. Die Silhouette des Kindes, das auf dem Bootssteg steht, zeichnet sich wie ein Schattenriss vor der Mondsichel ab.
Nein, zum Teufel …
Am liebsten würde Martin auf dem Absatz kehrtmachen, ins Haus zurücklaufen und die Tür verriegeln. Jemanden anrufen und … Aber wen? Ein Kind, das mitten in der Nacht in einem dünnen Mantel auf dem Bootssteg friert, ist kein Fall für die Polizei, sondern eher für die Sozialbehörden. Und bei genauerem Nachdenken kommt Martin zu dem Schluss, dass die mit dem Gesicht zum Meer stehende Gestalt eins der vier Kinder sein muss, für die er von Amts wegen verantwortlich ist. Er muss seine Arbeit tun und das Kind in Sicherheit bringen. Auch wenn die Situation eine grausige Ähnlichkeit mit einer Geschichte hat, die Martin nur allzu gut kennt. Mit einer Geschichte, die jeder, der in dieser Gegend wohnt, vom Hörensagen kennt oder mit eigenen Augen gesehen hat. Martin ist einer dieser Augenzeugen. Er erinnert sich so genau, als wäre es gestern passiert.
»Hallo?«, sagt er, doch die Gestalt rührt sich nicht. Der Saum des blauen Mantels flattert im Wind. Es muss eins der beiden Mädchen sein … »Milla, bist du das?«
Martin hält den Atem an, geht weiter und wundert sich selbst über seine Entschlossenheit. Die gerstenbraunen Haare des Mädchens sind zu einem Pferdeschwanz gebunden, der im Wind schaukelt. Es ist ein Mädchen, so muss es sein. Eins der beiden. Milla oder Laura.
Die Umrisse der weniger als anderthalb Meter großen Gestalt werden mit jedem Schritt deutlicher. Der Nacken ist ein wenig schief, der Kopf neigt sich eine Spur nach rechts, steif wie bei einer starren Leiche.
»Laura?«
Das Kind reagiert nicht.
Martin betritt den Anleger und spürt, wie er auf den langen Pontons schwankt. Er spricht lauter und merkt, dass seine Stimme vor Spannung zittert.
»He! Lass den Quatsch! Das ist nicht lustig«, ruft er. Er ist unwillkürlich stehen geblieben. Warum dreht sich das Mädchen nicht um, hört es ihn nicht? Der Wind lässt die Plane über den Ruderbooten knallen. Martins Herz rast.
Vorsichtig nähert er sich dem Mädchen. Der Bootssteg ist wacklig und schwankt unter seinen Schritten wie Floßholz, bereit, ihn in das kalte Wasser zu werfen.
Das passiert nicht wirklich, denkt er und erwägt wieder, sich umzudrehen und wegzulaufen. Denn auch wenn es sich um ein Kind handelt – und es ist ja unverkennbar ein Kind –, ist die Situation irgendwie gruselig. Nicht zuletzt deshalb, weil er irgendwann vor langer Zeit an genau derselben Stelle ein kleines Mädchen gesehen hat. Es stand dort Nacht für Nacht. Und schließlich verschwand es spurlos.
Martin geht weiter, nähert sich der Gestalt und hebt die Hand, um sie zu berühren.
Gerade als er seine Finger auf die Schulter des Mädchens legt, den knochigen Körper an den Fingerspitzen fühlt, spürt er einen heftigen Schmerz am Hals und fällt auf die Knie. Er kann nicht mehr schreien, und keines der Kinder aus dem Smörregård barnhem taucht am Fenster des Hauses auf. Als er auf dem Bootssteg liegt, sieht er die im Wind flatternden gerstenbraunen Haare und das ausdruckslose weiße Gesicht. Dann weichen die nächtliche Meereslandschaft und die Mondsichel völliger Dunkelheit.
1
2020
Das Surren ist so leise, dass es eigentlich nicht stört. Dennoch kann Jessica es nicht überhören.
Die Frau wartet darauf, dass sie spricht, sie wartet schon seit fast einer Minute. Der Gedanke in Jessicas Kopf ist überaus klar, aber es erfordert Mühe, ihn auszusprechen.
»Ich versuche wohl zu sagen, dass … Ich hatte mein Leben an einem anderen Menschen verankert«, beginnt Jessica und wundert sich über den selbstsicheren Klang ihrer Stimme. »Ich habe es aus der Perspektive eines anderen gesehen. Verstehen Sie?«
Die Frau, die Jessica auf einem beigen Sessel gegenübersitzt, antwortet nicht gleich, sondern nutzt die Stille als Ansporn, den Gedanken weiterzuführen. Sie versteht sich darauf, die Führung zu übernehmen: Die Sitzung scheint vorgegebenen Schrittzeichen zu folgen, statt dass sich auf den Sesseln zwei ebenbürtige Menschen gegenübersitzen, die sich ohne Agenda miteinander unterhalten. Alles ist klinisch und koordiniert, doch Jessica lässt sich davon nicht stören. Sie wusste, worauf sie sich einließ, als sie vor einem Monat mit den Therapiesitzungen begann.
»Bevor ich Erne kennenlernte … Ich war verloren. Auch wenn ich das damals nicht verstanden habe. Und jetzt …« Jessicas Stimme stockt plötzlich, gerade so, als dürfte sie nicht mehr sagen. Als würde es ihr jemand verbieten.
Die Frau drängt sie nicht, sondern setzt sich in ihrem Sessel zurecht, fasst den Kugelschreiber fester und knipst die Miene hinein und wieder heraus. Die in kurzen Abständen wiederkehrende Bewegung könnte unter anderen Umständen auf Ruhelosigkeit hindeuten, aber die Psychiaterin wiederholt sie kontrolliert.
Jessica betrachtet die kantigen Fingerknöchel und die hellblau lackierten Fingernägel der Frau. Der Nagellack ist erstaunlich glänzend und deshalb irgendwie anmaßend für eine Fachärztin der Psychiatrie. Vielleicht sollte die Patientin, die in dem Sessel ihr Herz ausschüttet, das Recht haben, etwas Konservativeres zu erwarten. Etwas Dezenteres. Mitfühlenderes. Etwas, das zum Ausdruck bringt, dass die Frau nicht über der Situation steht.
»Jessica?«, sagt die Frau, und Jessica hebt den Blick auf ihr Gesicht.
»Was?«
Jessicas Gedanke ist abgebrochen, vielleicht sucht ihr Gehirn in den visuellen Reizen einen Vorwand, mit dem Sprechen aufzuhören.
Ein sanftes Lächeln legt sich auf das gebräunte Gesicht der Frau.
»Sprechen Sie nur weiter. Sie haben gerade gesagt, Sie waren verloren und jetzt …«
Jessica braucht einen Moment, um ihre Gedanken wieder zu ordnen. Eigentlich will sie der Frau – oder überhaupt irgendwem – ihre Erkenntnis nicht enthüllen, aber gleichzeitig brennt sie darauf, die Schlussfolgerung auszusprechen, die Worte von einer Expertin beurteilen zu lassen. Sie will wissen, ob ihre Dämonen dem aufmerksamen Blick der Psychiaterin ausweichen und sich geschickt verstecken oder ob sie sich auch ihr durch diese plötzliche Erkenntnis offen zeigen.
»Ich habe mein Leben wohl nie gemocht. Oder genauer gesagt, mich selbst. Und dann hatte ich plötzlich jemanden, der mich auf seine Weise bewunderte. Mich liebte. Wie ein Vater seine Tochter. Und das gab meinem Leben einen Sinn«, sagt Jessica und lauscht ihren Worten nach, als würden sie in der Stille widerhallen. Plötzlich überfällt sie Scham. »Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es darum geht, dass ich Erne verloren habe. Oder darum, dass ich eine für mich wichtige Perspektive verloren habe. Darum, dass ich nicht nur Erne geliebt habe. Sondern eher mich, so wie Erne mich sah«, fährt sie fort, obwohl die Vernunft ihr rät, zu schweigen.
Die Frau legt ihr Notizbuch auf die Sessellehne und drückt die Fingerspitzen gegeneinander. Ihre Miene ist ernst.
»Meiner Meinung nach haben wir jetzt einen wichtigen Punkt erreicht.«
Jessica kann nicht umhin, aus dem Satz ein riesiges Klischee herauszuhören. Ist das jetzt der Durchbruch, von dem in Fernsehserien immer geredet wird?
»Aber?«, fragt sie.
Die Frau lächelt wie zur Belohnung für die intelligente Frage.
»Aber ich mache mir auch ein wenig Sorgen.«
Jessica schüttelt den Kopf, denn sie ist sich nicht sicher, was die Frau meint. Auch wenn sie es ahnt.
»Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Leben nach Ernes Tod keinen Sinn mehr hat?«, fragt die Frau. »Ist es mit Erne gestorben?«
Jessica sieht die Frau an, deren Miene Besorgnis verrät. Vielleicht eine rein berufliche Besorgnis, aber immerhin.
Und da Jessica schweigt, fährt die Frau fort: »Haben Sie das Gefühl, dass Sie irgendwann begonnen haben, Ihr Leben nur noch für Erne zu führen?«
Jessica runzelt die Stirn, die aufkommende Übelkeit brennt im Hals. Sie greift nach dem Glas, trinkt einen Schluck von dem zimmerwarmen Wasser und blickt zum Fenster. Die kahlen Äste der großen Eiche schaukeln im Wind, sie krümmen sich wie fleischlose Finger. Die Deckenlampen leuchten schwächer, und im Zimmer wird es immer dunkler. Das Surren nimmt zu, als würde die elektromagnetische Spannung im Raum wachsen.
»Es ist typisch, dass Menschen anderen gefallen wollen, zum Beispiel den eigenen Eltern, und wenn diejenigen, für die man diese Anstrengungen – die manchmal in starkem Widerspruch zum eigenen Selbstbild stehen – unternommen hat, endgültig aus unserem Leben verschwinden … hinterlässt ihr Tod ein gewaltiges Vakuum. So ein Vakuum enthält außer Sehnsucht auch Sinnlosigkeit. Der Mensch kann oder will nicht mehr nur für sich selbst leben. Bin ich auf der richtigen Spur?«
Jessica antwortet nicht. Sie betrachtet immer noch die draußen tanzenden Zweige und sieht, wie sie durch die weiß gestrichenen Fensterrahmen nach drinnen dringen, ohne die Scheiben zu zerbrechen. Sie schlängeln sich durch das Zimmer, wickeln sich um ihre Knöchel wie glänzende schwarze Schlangen und drücken allmählich immer fester zu.
»Denn wenn das der Fall ist«, fügt die Psychiaterin hinzu, »müssen wir die Sache ernst nehmen.«
Jessica blinzelt ein paarmal, und die Beleuchtung im Zimmer wird wieder normal.
Die Schlangen ziehen sich zurück, verschwinden auf die andere Seite des Fensters und erstarren wieder zu Holz wie in einer umgekehrten Entropie. Einen Augenblick lang wirkt das gelbe Licht im Zimmer blendend hell.
Die Psychiaterin greift wieder nach ihrem Notizbuch und ihrem Stift und schreibt etwas auf. Jessica sieht, wie die Hand der Frau den Stift bewegt, ist sich aber nicht sicher, worum es in dem Text geht. Hat die Frau gerade die Worte depressiv und möglicherweise selbstzerstörerisch in ihr ledergebundenes Buch geschrieben? Das wäre eine ziemlich treffende Beschreibung, was wiederum bedeutet, dass die Seelenklempnerin ihre Stundentaxe verdient hat.
»Wer muss?«, fragt Jessica und stellt das Wasserglas auf den Tisch. Die Übelkeit hat ihren ganzen Körper erfasst, sie wühlt im Magen und brennt in der Speiseröhre. Jessica würde am liebsten zur Toilette rennen und sich übergeben, doch sie beherrscht sich und schluckt ein paarmal.
»Was meinen Sie?«
»Sie haben gesagt, wir müssen es ernstnehmen.«
»Sie und ich«, präzisiert die Frau und rückt ihre schmale Brille zurecht. »Wir haben einen Monat lang über vieles gesprochen und einige wichtige Beobachtungen gemacht, aber heute höre ich zum ersten Mal etwas, mit dem wir uns unbedingt ernsthaft befassen müssen. Ich würde es als Hoffnungslosigkeit bezeichnen. Aus diesem seelischen Zustand muss man sich herauskämpfen, auch wenn es nicht ganz leicht ist.«
Draußen im Frost halten die Zweige einen Moment lang still, bis ein laut heulender Windstoß sie wieder zum Leben erweckt. Diesmal stören sie Jessicas Konzentration jedoch nicht.
»Tuula?«, sagt Jessica und merkt, dass der Name in ihren Ohren seltsam klingt. Es ist wohl das erste Mal, dass sie die Psychiaterin beim Vornamen nennt.
»Ja?«
»Allein in den letzten zwei Jahren habe ich ein Dutzend Totschläge und Morde untersucht. Wenn man ein Loch in eine Wand schlägt und dahinter die Leiche einer schönen jungen Frau findet … Oder einen zu Tode gesteinigten Mann sieht, einen zerschlagenen Schädel, den blutige Haare bedecken. Oder wenn man den Fleischgeruch eines lebendig verbrannten Menschen riecht … was einen daran denken lässt, dass irgendwo auf der Welt Hunde lebendig gekocht werden, weil das Adrenalin, das der Schmerz und das Entsetzen freisetzen, ihr Fleisch mürber macht …«
Die Psychiaterin wirkt konsterniert. Wahrscheinlich würde sie Jessica gern bitten aufzuhören, um dem Gespräch einen klareren Rahmen zu geben, doch sie kann ihre Patientin nicht unterbrechen, gerade jetzt nicht, wo sie mehr von sich preisgibt als je zuvor.
»Verstehen Sie, worauf ich hinauswill?«, fragt Jessica und fährt fort, bevor die Frau reagieren kann: »Ich habe nie Hoffnung gehabt. Niemand von uns hat Hoffnung. Aber früher konnte ich damit vielleicht besser umgehen. Ich hatte die Bedeutungslosigkeit meines Lebens akzeptiert.«
Die Psychiaterin schlägt ihr Notizbuch zu und legt es auf den Schoß.
»Jessica. Wir müssen jetzt über die Möglichkeit nachdenken, dass …«
Eine Welle der Übelkeit überrollt Jessica, und sie springt mitten in den Worten der Psychiaterin auf. Der Brechreiz, der schon auf dem Weg nach Katajanokka begonnen und sie während der ganzen Sitzung geplagt hat, wird immer unerträglicher.
»Ich muss gehen.«
»Es ist erst halb«, sagt die Frau verwundert und blickt an Jessica vorbei auf die Wanduhr.
»Sorry. Ich zahle natürlich für die ganze Stunde.«
»So war das nicht …«
»Danke, Tuula.«
Die Psychiaterin wirkt verblüfft, fasst sich aber schnell und fragt:
»Legen wir den nächsten Termin fest?«
Jessica antwortet nicht. Sie wirft einen raschen Blick auf die Zweige der Eiche, die am Fenster kratzen. Wir sehen uns wohl nicht wieder. Lebwohl.
2
Jessica hört über das Heulen des Windes hinweg, wie die massive Holztür hinter ihr ins Schloss fällt. Der Himmel über den hohen Häusern an der Kruunuvuorenkatu ist grauweiß. Die nassen Straßenbahnschienen, die die schmale Straße zerschneiden, verkünden dröhnend, dass sich eine Bahn nähert.
Wässrige Schneeflocken heften sich an Jessicas Gesicht, und sie zieht den Schal höher. Ihr Blick fällt auf die kroatische Flagge über der Tür, doch der Mageninhalt, der ihr in die Kehle steigen will, zwingt sie, den Kopf zu senken. Sie atmet die frische Luft durch die Nase ein, in der Hoffnung, dass sie die zunehmende Übelkeit dämpft, aber der schneidende Wind steigert das Brennen, das sie schon auf der Nasenschleimhaut gespürt hat, als sie sich in den Sessel der Psychiaterin setzte.
Jessica weiß, dass sie nicht bis nach Hause durchhält. Sie wirft einen Blick auf die Hauseinfahrt, deren dekoratives Eisentor geöffnet ist. In dem langen Bogengang, der auf den Innenhof führt, ist keine Menschenseele zu sehen. Der Hof ist ihre einzige Hoffnung: Weiter schafft sie es nicht.
Jessica geht mit unsicheren Schritten durch das Tor und will sich gerade noch einmal umsehen, als die Magensäfte mit unbezwingbarer Kraft nach oben sprudeln und auf den Asphalt spritzen.
Sie wischt sich über den Mund, beugt sich vor und erbricht sich erneut.
Auf der Straße rattert die Straßenbahn vorbei. Jessica flucht lautlos, hebt den Kopf und prüft, ob es ihr besser geht. Sie würgt die letzten Reste des Erbrochenen aus dem Hals und spuckt die nach Galle schmeckenden Klumpen auf die Erde.
Dann hört sie platschende Schritte auf dem Hof. Jemand kommt.
Sie richtet sich schnell auf und stützt sich an die Wand, aber der bärtige Mann, der hinter der Teppichstange auftaucht, hat schon mehr als genug gesehen.
»Was geht hier vor?«, fragt der in einen neongelben Overall gekleidete Mann und bleibt in sicherer Entfernung stehen, die Hände in die Seiten gestemmt. Seine Stimme klingt nicht besorgt, sondern eher vorwurfsvoll: Er wirkt wie ein Lehrer, der gerade ein paar Fünfzehnjährige beim Rauchen erwischt hat.
»Wonach sieht es aus?«, gibt Jessica zurück und wischt sich den Mund am Jackenärmel ab.
»Dass du dich nicht schämst.«
»Sorry. Aber ich hab mir die Übelkeit nicht bestellt.«
Der Mann verzieht angewidert das Gesicht, und seine Miene wird noch finsterer.
»Wohnst du überhaupt hier?«, bellt er und greift zu der Schneeschaufel, die an der Wand lehnt. »Ich hab dich noch nie …«
Jessica wendet sich wortlos ab und will gehen.
»He, antworte gefälligst! Bist du besoffen, verdammt? Den Dreck räumst du selber weg!«
Jessica bleibt am Tor stehen und blickt zurück. Sie hat keinen Grund, störrisch zu reagieren. Im Gegenteil, sie müsste sich jetzt so verhalten, wie es ihren Wertvorstellungen entspricht: sich entschuldigen und erklären, dass ihr einfach schlecht geworden ist. So ist es ja. Natürlich wird sie für die Aufräumarbeit bezahlen, auch mit einem Schmutzaufschlag, wenn sie damit den Zerberus, der sein kleines Reich bewacht, besänftigen kann.
»Scheiße, du bist blau«, stellt der Mann fest und mustert Jessica angewidert von Kopf bis Fuß.
Mit seinem Verhalten schafft der Hausmeister – das ist ja vermutlich der Beruf des diensteifrigen Kerls – eine wacklige Basis für die weitere Dynamik der Begegnung.
»Und wenn?«, sagt Jessica.
Der Mann lacht auf. Der Mund in seinem pockennarbigen Gesicht verzieht sich zu einem schadenfrohen Grinsen.
»Das ist mir egal, aber unseren Hof verschandelst du nicht, verdammt.«
»Es tut mir leid, mir ist schlecht geworden«, sagt Jessica und will weitergehen, aber der Mann gibt nicht nach.
»He, Mädchen«, ruft er. Er ist wieder einen Meter näher gekommen.
Mädchen. Irgendetwas schwappt in Jessicas Innerem über.
Sie dreht sich um und spürt im selben Moment, wie sich die dicken Finger des Mannes um ihr Handgelenk legen.
»Lass mich los«, sagt sie leise, doch der Griff wird noch fester.
Der Mann schiebt sein Gesicht näher heran, als wollte er in ihrem Atem nach Schnapsgeruch fahnden. Offenbar hat er keine Angst vor Bakterien, Jessica hat sich immerhin gerade erst übergeben. Das spöttische Lächeln verrät eine herablassende Lüsternheit, die Jessica längst zu erkennen gelernt hat, die zu ertragen sie aber nie lernen wird.
»Loslassen«, wiederholt sie und versucht sich aus seinem Griff zu befreien.
Der Mann schüttelt den Kopf und hebt die Schaufel.
»Du gehst hier nicht weg, ehe du sauber gemacht hast. Oder soll ich die Polizei rufen?«
»Lass mich los«, fordert Jessica resolut, aber erfolglos. Sie könnte natürlich erklären, dass sie selbst Polizistin ist – der Dienstausweis steckt in ihrer Brieftasche. Doch sie will nicht, dass der Kerl mehr über sie erfährt als nötig.
Der Blick des Mannes bohrt sich tief in Jessicas Augen, die nach den vielen durchwachten Nächten zweifellos gerötet sind. Der Mann hält sie vermutlich für eine verluderte Stadtstreicherin, zumal sie abgelatschte Turnschuhe, einen grauen Collegeanzug und eine schmuddelige schwarze Steppjacke trägt.
»Du verdammte Junkieschlampe. Solche wie dich kenne ich …«, beginnt der Mann, und in den wenigen Sekunden der Stille, die darauf folgen, flammt in seinen Augen etwas auf: vielleicht Machtgefühl, vielleicht Wut über die unerwartete Situation. Vielleicht auch der Wunsch, das betrunkene Mädchen zu bestrafen. Jessica schmeckt das Erbrochene in ihrem Mund, als sie die dicken Wangen und den rauen Stoppelbart des vierzigjährigen Mannes betrachtet. Seinen triumphierenden Blick.
»Und ich kenne solche wie dich«, sagt Jessica, packt mit der freien Hand den Arm des Mannes und verdreht ihn mit ihrem ganzen Körpergewicht. Nein, sie ist nicht betrunken, sondern durchaus fähig, die Gewaltmaßnahmen einzusetzen, die sie an der Polizeischule gelernt hat.
Der Mann brüllt auf, sackt in die Knie und lässt Jessicas Handgelenk los. Da befreit Jessica seinen Arm aus der schmerzhaften Umdrehung und tritt ihm mit dem Knie gegen die Brust. Der Hausmeister fällt rücklings in den nassen Schnee und flucht.
»Hure …«, stöhnt er, schnappt nach Luft und versucht aufzustehen, doch Jessica versetzt ihm einen Tritt in die Seite. Dann noch einen zweiten. Ihre Augen trüben sich, sie betrachtet den Mann voller Wut.
»Wenn du mich noch einmal Hure nennst …«, faucht sie und ist sich nicht sicher, ob sie hofft, dass der Mann weiterstrampelt. Denn wenn er ihr noch einmal Anlass gibt, ihn zu treten, wird sie es mit Freuden tun und dem Arschloch dabei womöglich ein paar Rippen brechen.
Aus den Augenwinkeln bemerkt sie eine Bewegung auf einem der Lüftungsbalkone. Sie glaubt zwei Menschen zu sehen, die in ihrem getrübten Blick zu einem Klumpen verschmelzen. Ich muss hier weg. Ein Auto rast an der Einfahrt vorbei. Jessica kämpft gegen die Übelkeit an, kehrt aus der Einfahrt in das fahle Tageslicht zurück und geht mit schnellen Schritten den Fußgängerweg entlang. Über dem Park am Ende der Straße ragen die roten Türme, die Kupferdächer und die goldenen Zwiebeln der Uspenski-Kathedrale auf.
Ihr Kopf füllt sich mit einem immer lauter werdenden Rauschen, in das sich die Rufe des Hausmeisters mischen.
Ihr rechter Fuß fühlt sich plötzlich kalt an, und sie merkt, dass sie den Turnschuh irgendwo verloren hat, höchstwahrscheinlich im Hauseingang beim letzten Tritt gegen die Flanke des Hausmeisters. Ein älteres Paar, das ihr entgegenkommt, betrachtet Jessicas ungleichmäßigen Gang und ihren Fuß, den nur ein klatschnasser Strumpf bedeckt. Geh. Geh weiter. Vergiss den Schuh.
Sie holt das Handy aus der Tasche, um ein Taxi zu rufen, doch es fällt aus ihrer zitternden Hand auf einen Gullideckel.
Da! Haltet sie an!
Sie hebt das Handy auf und versucht es zu entsperren, aber das Display ist im Schnee nass geworden und ihre Finger sind starr vor Kälte. Nichts passiert.
Aus der Gegenrichtung kommen eine Straßenbahn und eine Autoschlange, an deren Ende ein Streifenwagen dahinzockelt. Ausgerechnet.
Jessica beschleunigt das Tempo. Der Streusand sticht durch den nassen Strumpf. Wenn sie es in den Park schafft, kann sie ihre Verfolger vielleicht abhängen.
Polizei!
Die Stimme ist gedämpft, aber als Jessica die Kreuzung an der Satamakatu erreicht, sieht sie, dass das Blaulicht des Streifenwagens, der vor der Hauseinfahrt hält, eingeschaltet wird. Schneeflocken fallen in ihren offenen Mund. Ihr Kinn fühlt sich schwer an, das Atmen bereitet ihr Mühe. Der Kopf tut ihr weh, und ihr wird schwarz vor den Augen.
Ich habe nie Hoffnung gehabt. Niemand von uns hat Hoffnung.
Jessica läuft über die Straße und sucht hinter den Bäumen am Rand des Tove-Jansson-Parks Schutz.
Sie stützt sich mit der Hand an einen Baumstamm und spürt erneut den Zwang, sich zu übergeben.
Während sie sich erbricht, hört sie die näherkommende Sirene des Streifenwagens und sieht, wie das Blaulicht über die dünne Schneedecke auf dem Rasen und die niedrigen Zweige der Bäume streift. Und dann senken sich die Zweige, sie verlieren ihre Form und legen sich biegsam wie Weidenruten über sie.
3
Helena Lappi, genannt Hellu, die Leiterin der Einheit für Schwerverbrechen bei der Helsinkier Polizei, trägt eine gelbe Plastiktüte bei sich, als sie dem in einen Overall gekleideten Polizisten folgt. Während der Fahrt nach Pasila hat sie das Lenkrad krampfhaft umklammert und versucht, sich mit den Atemübungen, die ihre Frau ihr beigebracht hat, zu entspannen. Jetzt ist es wichtiger denn je, die Fassung zu bewahren, obwohl sie auch ohne dieses verdammte Durcheinander mehr als genug zu tun hätte.
Der Polizist öffnet die Zellentür, und Hellu bleibt auf der Schwelle stehen. Sie sieht die auf der Matratze sitzende Frau, das kleine Fenster und die Kloschüssel. Der klaustrophobe Anblick erfüllt sie mit Ekel.
»Gehen wir.« Hellus Stimme ist farblos und dringt in den Raum wie die Kälte aus einer gerade geöffneten Tiefkühltruhe.
»Warum? Ich fühle mich hier ganz wohl«, sagt Jessica.
Hellu seufzt leise und tritt langsam in die Zelle. Der Polizist macht kehrt und lässt die beiden allein.
»Niemi, was zum Teufel soll das jetzt wieder?«, fragt Hellu und lehnt sich an die Wand. In der engen Zelle riecht es überraschenderweise nicht nach Urin, sondern nach WC-Spray mit Eisblumenduft. »Ich bin sofort losgefahren, als ich gehört habe, was passiert ist, aber du hättest der Streife doch sagen können, wer du bist. Dann wäre dir die Zelle wahrscheinlich erspart geblieben, und ich hätte nicht mitten in der Besprechung bei der Zentralkripo losrennen müssen, um dich hier rauszuholen.«
Jessica streicht sich die Haare aus dem Gesicht und blickt auf. Rund um die müden Augen über den hochroten Wangen liegen Reste der Wimperntusche. Hellu hat Jessica noch nie so gesehen, in einer derart entwurzelten und unberechenbaren Verfassung. Jessica wirkt wie eine Wilde, die man gegen ihren Willen aus dem Dschungel in die Stadt verschleppt und hinter Gitter gesperrt hat.
»Hast du getrunken?«, fragt Hellu, obwohl sie diese Frage nicht stellen möchte und obwohl ihr die Möglichkeit nicht besonders wahrscheinlich vorkommt. Jessica hat zweifellos 99 Probleme, aber Rauschmittel gehören, soweit Hellu weiß, nicht dazu.
Sie wirft einen Blick auf die Füße der Kriminalhauptmeisterin, von denen der eine nackt ist und der andere in einem nassen Strumpf steckt. Die Schuhe – oder in diesem Fall wohl nur einer – wurden ordnungsgemäß in Gewahrsam genommen, als Jessica vor einer Stunde in die Zelle gebracht wurde.
»Nein«, antwortet Jessica schließlich. »Ich habe nicht getrunken. Nichts. Jedenfalls keinen Alkohol.«
Hellu hebt die linke Hand und betrachtet ihre Fingernägel, die sie gestern Abend gefeilt hat. Die elektrische Nagelfeile, die ihre Frau gekauft hat, ist wider Erwarten ausgesprochen brauchbar.
»Ein schwungvoller Hausmeister in Katajanokka behauptet, dass du auf dem Innenhof geferkelt und ihn plötzlich angegriffen hast. Passt nicht so ganz zu der stubenreinen und analytischen Jessica Niemi, die mit mir in der Einheit für Schwerverbrechen arbeitet.«
»Ich habe in dem Haus Bekannte besucht.«
»Wen?«
Jessica runzelt die Stirn und sieht einen Augenblick lang so aus, als wollte sie auf den Boden spucken.
»Spielt das eine Rolle?«
Hellu zuckt mit den Schultern, und Jessica fährt fort:
»Als ich ging, wurde mir plötzlich schlecht.«
»Da auf dem Hof?«
Jessica nickt.
»Aber wie ist der Hausmeister …«
»Sagen wir mal, er war nicht ganz unschuldig daran, dass die Situation eskaliert ist.«
Hellu schüttelt seufzend den Kopf. Sie weiß nicht, was sie glauben soll. Wenn sie ehrlich ist, muss sie zugeben, dass eine Frau mit Jessicas Äußerem leichter in unangenehme Situationen mit aufdringlichen Männern gerät als sie selbst. Aber der Hausmeister dürfte kaum versucht haben, Jessica am helllichten Tag auf dem Innenhof zu vergewaltigen.
»Ist er schlimm verletzt?«, fragt Jessica, und jetzt schwingt in ihrer Stimme Reue mit.
Wieder schüttelt Hellu den Kopf.
»Ich habe mit dem Streifenbeamten gesprochen, der dich festgenommen hat, und den Eindruck gewonnen, dass es bei dem Kerl eher an der Einstellung hapert. Bei der Befragung hat er dich unter anderem als Drogenhure bezeichnet und so weiter. Normalerweise bräuchte ich dieses Gespräch also gar nicht mit dir zu führen.«
»Aber jetzt musst du es tun?«
»Es gibt zwei Augenzeugen, die ausgesagt haben, dass du den Mann getreten hast, als er schon am Boden lag. Und da du der zufällig vorbeigekommenen Streife nicht sagen wolltest, wer du bist und worum es im Einzelnen ging, blieb ihnen nichts anderes übrig als …«
»Ja, ich weiß«, sagt Jessica und legt die Hände auf den Bauch. »Das war dumm von mir. Ich konnte nicht klar denken.«
Hellu wirft einen Blick zur Seite, stellt fest, dass in der Türöffnung niemand steht, und dämpft ihre Stimme fast zum Flüstern.
»Was ist los, Niemi? Ich mache mir verdammt große Sorgen.«
»Alles wäre bestens, wenn ich in der verfluchten Einfahrt in Ruhe hätte kotzen dürfen.«
»Ich habe das Gefühl, dass noch etwas anderes dahintersteckt. Normalerweise hättest du dich nicht derart provozieren lassen, dass …«
»Er hat mich festgehalten, Hellu«, erwidert Jessica in scharfem Ton und rollt den Ärmel hoch. Am Handgelenk sind jedoch keine blauen Flecken zu sehen, was sie zu ärgern scheint. Vielleicht hat sie gehofft, der Mann hätte deutliche Spuren hinterlassen, die ihre Worte bestätigen.
»Verstehe. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Seit dem Fall Zetterborg lebst du irgendwie in deiner eigenen Welt. Ich brauche die Gewissheit, dass du nicht …«
»Dass ich nicht was?«
»Du weißt, wovon ich spreche, und meine Sorge ist ganz und gar berechtigt.«
Jessica blickt wütend auf die Kamera an der Deckenkante.
»Wir können woanders weiterreden«, sagt Hellu und wirft die Plastiktüte neben der Matratze auf den Boden. »Ich hab dir Turnschuhe mitgebracht, damit du draußen nicht auf einem Bein zu hüpfen brauchst.«
4
Jessica blickt von der Tasse auf, um die sie die Finger gelegt hat. Die hellen Lampen, die im Inneren des gläsernen Bartischs glühen, zwingen sie, die Augen zusammenzukneifen. Das Lokal ist ausgesprochen originell: Am Fenster flimmert eine Leuchtreklame im Yankee-Diner-Stil, um die roten Tische stehen grellgelbe Stühle, und aus den Lautsprechern dröhnt Musik, deren Text unverständlich bleibt, er könnte ebenso gut chinesisch oder rätoromanisch sein. Angesichts des unruhigen Milieus wirkt es ironisch, dass Hellu nur Jessicas sämiges Getränk, das leicht nach Spinat riecht, misstrauisch beäugt.
»Was hast du denn da bestellt?«
»Matcha Latte.«
Hellu verdreht die Augen. Jessica hat nie gelernt, Kaffee zu mögen, und ihr ganzes Erwachsenenleben hindurch Hagebuttentee getrunken, aber nach einem spontanen Experiment vor einigen Wochen ist sie schlagartig ein Fan des grünen japanischen Tees geworden, den man in den traditionellen Cafés der Innenstadt kaum bekommt.
Eine Weile widmen sich beide wortlos ihren Getränken. Dann räuspert Hellu sich vernehmlich, eher um das Schweigen zu brechen, als um die Stimme klar zu machen.
»Ich will nicht so tun, als wären wir beste Freundinnen, Niemi. Und du brauchst dich mir nicht anzuvertrauen. Aber das, worüber wir schon bei dem Fall Yamamoto gesprochen haben … Dass ich gewisse Ereignisse aus deiner Vergangenheit wissentlich begraben habe, um unnötige Komplikationen zu vermeiden …«
»Nicht sehr tief.«
»Bitte?«
»Du hast alles ziemlich schnell wieder ausgegraben, sobald ein bisschen Gegenwind aufkam.«
Hellu wirkt beleidigt. Sie nimmt ihre Brille mit dem dicken blauen Gestell ab und poliert die Gläser mit einem Wildledertuch. Dann setzt sie die Brille wieder auf, legt das Tuch ins Etui und beugt sich vor. »Wenn der Kerl beschließt, die Episode an die große Glocke zu hängen, müssen wir ernsthaft überlegen, ob es besser wäre, dass du eine Weile in den Hintergrund trittst. Es geht um die Glaubwürdigkeit der Mordkommission. Ohne die kann keiner von uns ordentlich arbeiten. Das begreifst du wohl?«
Jessica sieht Hellu lange an. Sie würde gern widersprechen, versteht aber sehr gut, was Hellu meint, und weiß, dass sie einen Fehler gemacht hat.
»Eine leichte Misshandlung ist kein Grund für eine offizielle Anklage«, wendet sie trotzdem ein. Hellus Blick macht ihr klar, dass dieser Punkt nicht relevant ist.
»Aber wenn bei dem Kerl auch nur eine Rippe gebrochen ist, sieht die Sache anders aus. Dann kann man den Vorfall als schwere Misshandlung einstufen, und Anklage wird auch dann erhoben, wenn der Betroffene es nicht verlangt.«
Jessica spürt plötzlich einen Kloß im Hals. Die eventuellen Folgen des Zwischenfalls werden ihr erst jetzt klar, als die Hauptkommissarin ihr die Fakten unter die Nase reibt.
»Und dann kann ich dich ganz einfach nicht für die Ermittlungsarbeit einsetzen, selbst wenn ich es wollte.«
»Aber …«
»Auch damit würden wir klarkommen, es braucht nur Zeit … Aber ich komme nicht über dieses größere, fundamentale Problem hinweg. Darüber, dass sich irgendetwas in deinem Leben entscheidend verändert hat. Du benimmst dich in letzter Zeit wirklich seltsam. Ich meine jetzt nicht dein naseweises und mitunter unsoziales Verhalten – das vermisse ich sogar ein bisschen –, sondern etwas Dunkleres. Und da überlege ich natürlich, ob es ein Teil …«
»… meiner Krankheit ist?«
Hellu nickt widerstrebend.
Es folgt eine kurze Feuerpause, in der beide nervös über ihre Tassen streichen.
»Als wir im Dezember zuletzt darüber gesprochen haben, habe ich dich gefragt, ob du Schwierigkeiten hast, zu erkennen, was real ist und was nicht.«
»Und ich habe nein gesagt.«
»Aber du hast diese …«
»Halluzinationen? Visionen? Manchmal«, sagt Jessica, obwohl sie weiß, dass ihr Zustand noch vor ein paar Monaten erheblich besser war als jetzt. Es hat sich tatsächlich etwas verändert. Sie hat ihre tote Mutter, die sie durch ihr ganzes Leben begleitet hat, seit längerer Zeit nicht mehr gesehen, aber stattdessen ist etwas anderes aufgetaucht. Der Wahnsinn – so nennt Jessica ihn selbst – ist urplötzlich und zum ersten Mal völlig unkontrollierbar geworden. Genau davor hat sie sich immer am meisten gefürchtet: dass die Wahnvorstellungen unberechenbar werden. Dass sie sich gegen sie kehren und alles zum Einsturz bringen.
»Ich habe angefangen, mit jemandem zu reden«, sagt Jessica schnell, wie um das Thema zu wechseln, obwohl sie das Gespräch damit näher an den Kern bringt. Hellu scheint jedoch nicht gleich zu verstehen, was sie meint.
»Mit einer Psychiaterin«, präzisiert Jessica.
»Gut«, meint Hellu, nachdem sie die Neuigkeit verdaut hat, wirkt aber nicht erleichtert. »Das kann sicher nichts schaden.«
»Von da kam ich gerade«, fügt Jessica hinzu, obwohl sie nicht weiß, ob diese Information die Lage vielleicht noch verschlimmert.
»Hat die Therapie die physische Übelkeit ausgelöst?«
Jessica sieht Hellu an. Es kommt ihr allmählich so vor, als wäre auch dieses Gespräch eine Art Therapie, als müsste sie von nun an bei jeder Unterhaltung ihrem Gegenüber beweisen, dass sie nicht in eine geschlossene Anstalt gehört.
Jessica wendet den Blick zum Fenster. Sie hat nicht die Absicht, der Hauptkommissarin die Mechanismen ihres Körpers und ihrer Psyche darzulegen, die Koordinaten der psychischen und physischen Schmerzpunkte. Auch wenn es für alle nützlich sein könnte, die Situation zu verstehen. Die Wahrheit ist, dass sie Hellu nicht erklären kann, wie ihr Kopf funktioniert, weil sie es selbst nicht versteht.
Hellu trinkt von ihrem Kaffee und sieht Jessica über den Tassenrand hinweg bedeutungsvoll an.
»Geh nach Hause, Niemi.«
»Warum?«
Hellu stellt die Tasse ab, wirft einen Blick auf ihre Armbanduhr und verschränkt dann die Hände auf dem Tisch.
»In Pasila liegt momentan nichts Wichtiges an.«
»Was? Darf ich erst wieder zur Arbeit kommen, wenn ein Serienmörder frei herumläuft?« Jessica lacht spöttisch auf.
Hellu zieht die Nase kraus. Dann fährt sie sich durch die dunkel nachwachsenden, blondierten Haare und nickt.
»Dann überlege ich es mir noch mal.«
Jessica spürt einen Stich in der Brust. Sie trinkt noch einen Schluck von ihrem Matcha Latte, steht auf und zieht die Jacke über ihren grauen Hoodie.
»Danke für die Schuhe. Ich schicke sie per Post nach Pasila«, sagt sie und geht.
5
Es ist halb sieben, die Sonne ist erst vor einigen Minuten am Horizont versunken und hat die Stadt der künstlichen Beleuchtung überlassen. Auf der Straße poltert ein Schneepflug, obwohl am Nachmittag nur ganz wenig Schnee gefallen ist. Jessica schaltet den Fernseher aus, steht vom Sofa auf und macht Licht im Wohnzimmer. Einen Augenblick lang wirkt der große hohe Raum fremd: Die imposanten Gemälde in ihren vergoldeten Rahmen erinnern an ein Museum. Die weit auseinander stehenden teuren Sessel, das Sofa und der flache Glastisch könnten direkt aus einer italienischen Wohnillustrierten stammen. Jede Einzelheit, bis hin zur Platzierung der Gegenstände, der Holzart des Parketts und dem Farbton der Wände, ist genau durchdacht. Jessica blickt sich um und versucht zu verstehen, wieso sie sich bisher in ihrer massiven Wohnung wohlgefühlt hat, die ihr jetzt merkwürdig leblos und düster vorkommt.
Es klingelt. Als Jessica die Diele erreicht, sieht sie auf dem kleinen Bildschirm das freundliche Gesicht ihres Kollegen Jusuf Pepple. Sie öffnet mit dem Summer die Haustür und lässt ihre Wohnungstür angelehnt. Dann geht sie ins Wohnzimmer zurück und legt sich wieder auf das Sofa. Nach einer Weile rappelt der Aufzug im Treppenhaus, dann sind Schritte zu hören, und schließlich kommt Jusuf mit einem aufgesetzt munteren Gruß herein.
»Hallo«, wiederholt er, diesmal ruhiger, als er den Rundbogen zwischen Diele und Wohnzimmer erreicht hat. Jessica sieht die weiße Papiertüte in seiner Hand. Sie nimmt einen angenehmen Geruch wahr, den sie nicht gleich identifizieren kann.
»Hast du dir Proviant mitgebracht?«
»Nein, das ist für dich«, sagt Jusuf und geht ohne weitere Erklärungen in die Küche.
Jessica hört die Einkaufstüte rascheln, als Jusuf die Lebensmittel in den Kühlschrank legt. Sie weiß, dass er es gut meint, empfindet es aber als verdammt bevormundend, dass er ungebeten für sie eingekauft hat. Als wäre sie eine arm- und beinlose Spinnerin, die in Quarantäne dahinsiecht.
Nach einer Weile wird die Kühlschranktür zugeschlagen, und Jusuf kommt mit nachdenklicher Miene ins Wohnzimmer zurück.
»Danke«, sagt Jessica widerstrebend.
»Ich musste sowieso einkaufen, und …«
»Ja, klar doch.« Jessica lächelt spöttisch und presst dann die Lippen fest zusammen.
Jusuf sieht sich um, als bekäme er nie genug von Jessicas Luxusquartier, von den hohen Räumen, den wertvollen Kunstwerken an den Wänden und der Aussicht über die Dächer von Helsinki. Jessica selbst ist schon seit Jahren blind dafür geworden, doch die dreihundert Quadratmeter große Wohnung ist zweifellos prachtvoll. Seit ihrer Volljährigkeit ist Jessica so wohlhabend, dass sie den Überfluss schon lange als Selbstverständlichkeit empfunden hat. Wenn sie sich dessen bewusst wird, verachtet sie sich selbst. Vor allem fühlt sie sich schuldig, weil es ihr trotz ihres Reichtums seit Langem schlecht geht. Die Millionen, die sie von ihrer Mutter geerbt hat, haben ihre Probleme nicht gelöst, sondern eher verschlimmert. Das Gefühl der Einsamkeit kommt wohl daher, dass sie nicht so ist wie die anderen. Obwohl sie die Rolle der normalen, berufstätigen Kriminalhauptmeisterin spielt. Sie ist ein wandelnder Selbstbetrug.
»Beschissen, was heute früh passiert ist«, sagt Jusuf und setzt sich Jessica gegenüber auf einen Sessel. Seine Miene ist leicht besorgt, aber dahinter ist dennoch die Glut zu spüren, die im Lauf des letzten Monats zu einer Art Markenzeichen geworden ist. Mit seinem breiten Lächeln war er immer schon eine frische und energische Gestalt, aber jetzt scheint er eine ganz neue Ebene erreicht zu haben. Vor allem, weil davor eine lange düstere Phase lag, die durch die Trennung von seiner langjährigen Freundin ausgelöst wurde. In dieser Zeit war Jusuf Kettenraucher und ein fast manischer Gewichtheber. Jetzt haben die Rollen gewechselt: Damals war Jessica diejenige, die sich Sorgen machte.
»Du siehst verliebt aus«, sagt Jessica.
Jusuf senkt den Blick auf seine Füße wie ein Teenager, dem die Bemerkung peinlich ist.
»So«, brummt er.
»Vielleicht sollte ich das auch.«
»Was?«
»Mich verlieben.«
Jusuf sieht aus, als wüsste er nicht, was er erwidern soll. Das Lächeln verschwindet so schnell von seinem Gesicht, wie es aufgetaucht ist. Jessica setzt sich auf und spürt immer noch den würzigen Geruch in der Nase, obwohl die Einkäufe längst im Kühlschrank liegen. Dann begreift sie: Jusuf hat ein neues Rasierwasser. Natürlich. Sie erkennt Orangenblüten, Honig und Geranium, eine Kombination, der sie zwar schon begegnet ist, aber nie auf Jusufs Haut.
»Du findest jemanden, wenn du nur willst«, sagt Jusuf schließlich und trommelt mit den Fingerspitzen auf die Sessellehne.
»Das war nur ein Witz, Jusuf. Im Moment brauche ich nichts und niemanden«, erwidert Jessica. Sie merkt, dass sie sowohl Jusuf als auch sich selbst belügt.
»Ja, ich dachte auch nicht, dass du …«, beginnt Jusuf und streicht sich mit dem Zeigefinger über die Augenbraue.
»Bist du nur gekommen, um mir Essen zu bringen?«
Jusufs Miene verdüstert sich schlagartig, als hätte er sich plötzlich an etwas Unangenehmes erinnert. Er holt sein Handy aus der Tasche und entsperrt es.
»Du hast mit Hellu gesprochen«, stellt Jessica fest. Jusuf nickt, den Blick auf das Handy geheftet.
Jetzt erkennt Jessica, dass bei dem Duft, den Jusuf in die Wohnung gebracht hat, noch etwas anderes eine Rolle spielt als das neue Rasierwasser. Es fehlt der stechende Geruch einer gerade gerauchten Zigarette. Jessica brennt darauf, nachzufragen, sich zu erkundigen, ob Jusuf beschlossen hat, mit dem Rauchen aufzuhören, begreift aber, dass sie dann auch fragen müsste, was ihn zu dieser Entscheidung bewogen hat. Und das ist etwas, worüber sie nicht reden will. Nicht ausgerechnet jetzt. Vielleicht nie. Sie kennt die Antwort schon. Die Umstellung der Lebensweise bedeutet, dass Jusuf die Beziehung mit Tanja ernst nimmt.
»Hat sie angerufen?«, fragt Jusuf. »Hast du noch mal mit ihr gesprochen?«
»Sie hat es versucht, aber ich war zu müde, um mich zu melden.«
»Du weißt es also noch nicht?«
»Was weiß ich nicht?«
Jessica erkennt an der Körpersprache ihres Kollegen, dass die schlechtesten Nachrichten erst noch kommen.
»Was, Jusuf?«
Jusuf reicht ihr das Handy langsam, als wolle er das Unvermeidliche möglichst lange hinauszögern. Jessicas Fingerspitzen streifen sein Handgelenk.
Auf dem Display sieht sie das Logo von YouTube.
Ihr Herz setzt einen Schlag aus.
»Scheiße«, flucht Jessica so leise, dass Jusuf es kaum hört. Auf dem Freeze Frame erkennt sie die dunkelgrün verputzten Wände, die stählerne Teppichstange und das offene Eisentor. Den Mann im neongelben Overall. Die Frau in Collegehose und Steppjacke, die sich über das feucht schimmernde Kopfsteinpflaster beugt. Unter dem Video prangt der Text: Der freie Tag einer Kriminalbeamtin.
»Jemand hat vom Lüftungsbalkon aus gefilmt«, erklärt Jusuf.
»Der freie Tag einer Kriminalbeamtin? Woher wissen die, dass …«
»Scheißpech, der eine Augenzeuge ist Freelancer beim Abendblatt. Er hat dich wohl erkannt und sich mit ein paar Anrufen vergewissert«, sagt Jusuf und schaltet das Display aus.
»Verdammter Mist«, stöhnt Jessica und vergräbt das Gesicht in den Händen. Ihr Herz rast und ihre Fingerspitzen prickeln heftig. Eine Serie von Zufällen und falschen Entscheidungen haben sie zu einer viral aktiven Irren gemacht, zur öffentlich bekannten Verrückten, die nicht nur in den aufziehenden Shitstorm gerät, sondern auch vom Dienst suspendiert wird.
»Was passiert jetzt?«, fragt sie und reibt sich die Stirn.
»Solche Storys sind schnell wieder vergessen«, tröstet Jusuf. »Der Typ hat offenbar keine Verletzungen erlitten, und man sieht ja auf dem Video, dass er dich provoziert hat. Er hält dich am Handgelenk fest und …«
»Aber man sieht auch, wie ich mitten am Tag in seinem Revier kotze. Und bestimmt auch, wie ich ihn drei Mal trete. Das letzte Mal, als er schon auf der Erde liegt«, seufzt Jessica. »Außerdem ist auf der Aufnahme sicher nicht zu hören, dass er mich als Hure beschimpft.«
»Stimmt«, sagt Jusuf. »Deshalb müssen wir eine Weile warten, bis sich die Aufregung gelegt hat.«
Jessica hebt langsam das Gesicht und sieht Jusuf an, als wäre das Ganze allein seine Schuld. Und in gewisser Weise war er ja tatsächlich der Auslöser, wenn auch indirekt und völlig unbeabsichtigt. Im Nachhinein betrachtet hat Jessicas Abstieg begonnen, als der Fall Zetterborg gelöst war und Jusuf zu seiner Verabredung mit der hübschen Technikerin des kriminaltechnischen Labors ging. Als Jessica damals allein in ihrer leeren Wohnung stand, hat sie etwas erkannt, was ihr bis dahin nie in den Sinn gekommen war: Jusuf ist nicht nur ein vertrauter Freund und Kollege, sondern viel mehr. Das hatte Jessica nur nie begriffen. In ihrer Vorstellung waren sie wie Fox Mulder und Dana Scully in Akte X, ein Duo, das weder die Voraussetzungen noch den geringsten Wunsch nach einem Verhältnis hat, das die Grenzen einer platonischen Beziehung überschreitet. Doch nun verstand sie plötzlich, dass sie unbewusst immer mit dem Gedanken gespielt hatte, irgendwann könnte zwischen ihnen etwas passieren, sogar während Jusufs voriger Beziehung. Und jetzt, wo Jusuf bis über beide Ohren in eine Tatortermittlerin verliebt ist, erscheint es sehr unwahrscheinlich, dass etwas passieren wird. Wird ihre Freundschaft so weiterbestehen wie bisher, wenn keine tiefere Beziehung mehr möglich ist? War die Lebensbedingung ihrer Freundschaft immer eine gewisse Spannung: die Hintertür zu etwas Romantischem?
Der Abend nach der Festnahme von Zetterborgs Mörder hatte bei Jessica ein totales Einsamkeitsgefühl ausgelöst. Plötzlich fühlte sie sich wie eine Eisscholle, die auf dem offenen Meer dahintreibt und allmählich schmilzt, bis sie ganz verschwindet, ohne dass irgendwer es merkt. Vielleicht hat gerade dieses Gefühl ihre Halluzinationen gespeist, sie immer tiefer auf die andere Seite geführt, wo die Wirklichkeit sich allmählich verzerrt.
»Du wirst bestimmt wütend, wenn ich das sage, Jessi …«, beginnt Jusuf, und Jessica hat keinen Grund, an seinen Worten zu zweifeln. »Aber ich schlage vor, dass du eine Weile verreist. Egal wohin. Du könntest um die Welt reisen, auf Bali surfen, ein oder zwei Monate in der größten Suite des Burj Al Arab wohnen.« Jusuf lacht auf. »Du könntest versuchen, deine finanzielle Unabhängigkeit endlich mal zu genießen. Niemand braucht davon zu wissen. Du könntest tun, was immer du willst …«
»Mir ist ein bisschen schlecht«, sagt Jessica und steht vom Sofa auf. Jusuf sieht sie verdutzt an. »Ich lege mich kurz hin, wenn du nichts dagegen hast.«
Jessica geht in die Küche und schaltet den Wasserkocher ein. Die leere Papiertüte liegt mitten auf der Arbeitsfläche, was sie plötzlich maßlos ärgert. Sie holt einen Porzellanbecher aus dem Geschirrschrank. Jusuf folgt ihr in die Küche und redet weiter, als hätte Jessica ihn nicht unterbrochen.
»Im Ernst, Jessi. Was fängst du mit dem Geld an, wenn du nichts damit anfängst? Kapierst du, dass für dich der Himmel die Grenze ist …«
»Jusuf!« Jessica schlägt so fest auf die granitene Arbeitsfläche, dass ihr die Hand wehtut. Dann dreht sie sich zu dem Mann um, dessen lebhaft gestikulierenden Hände mitten in der Bewegung erstarrt sind, als hätte man sie per Fernbedienung angehalten.
»Du weißt einen Scheißdreck von meinem Himmel und meinen Grenzen!«
Jusuf sieht sie entgeistert an.
»Beruhige dich doch. Ich versuche nur zu sagen, dass …«
Jessica greift nach dem Becher und schleudert ihn mit solcher Kraft an die Wand, dass die Scherben durch den ganzen Raum fliegen. Jusuf legt schützend die Hände vors Gesicht und flucht laut.