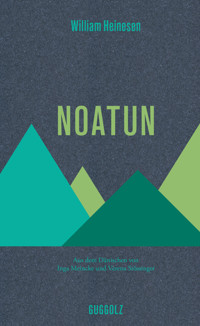Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Guggolz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
William Heinesen (1900–1991) erfasste in seinen Romanen, Gedichten und Erzählungen, was das Leben auf den Färöern ausmacht, wie kein zweiter. "Hier wird getanzt!" bietet eine Auswahl seiner besten Erzählungen, mit denen Heinesen Archaik und Moderne gleichermaßen aufgriff und in einem ganz eigenen Ton das spezifische Inselleben der Färinger festhielt. Die Erzählungen und ihre Protagonisten sind wie die Inseln und ihre Bewohner geprägt vom rauen Meereswind, zerklüftet, umspült – Menschen wie Worte gehen vor der ewigen Weite von Himmel und See eigensinnig ihren Weg. Das Leben scheint klein auf den abgelegenen Inseln im nördlichen Atlantik, auf denen gerade einmal 50 000 Menschen leben, doch die Sehnsucht nach der Ferne ist groß, und im Kleinen lässt sich der ganze Kosmos umso konzentrierter ablesen. Heinesen wuchs zweisprachig auf und schrieb Dänisch – auch um ein größeres Publikum zu erreichen. In seinen Erzählungen zeigen sich tiefe Feinfühligkeit und ein existenzieller Humor. Sie bewegen sich auf dem Grund der felsigen Inseln, reichen jedoch weit ins Reich der Fantasie, der Mythen und der Halluzinationen hinein. Manchmal fabuliert Heinesen selbstbewusst, ein anderes Mal berichtet er autobiografisch, und häufig mischt er beides ebenso wie Zeiten und Räume. Die Kontraste seien auf den Färöern stärker, sagte Heinesen einmal. In Inga Meinckes präziser Übersetzung, die den Leser das Meer und die Felsen schmecken lässt, lassen die Kontraste in Heinesens Geschichten klarsichtig auf den Grund der Dinge und das Wesen der Menschen blicken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
William Heinesen
HIER WIRD GETANZT!
Aus dem Dänischen und mit einer Nachbemerkungvon Inga Meincke
Herausgegeben und mit einem Nachwortvon Verena Stössinger
INHALT
PROMENADE IN DER ABENDDÄMMERUNG. EIN PROLOG
MEINE ROMANTISCHE GROSSMUTTER
MEIN URGROSSVATER. MARTIN CHRISTIAN RESTORFF (1816–97)
ROSENMEYER
DER TINDHÓLMUR
GAMALIELS BESESSENHEIT
DIE STUMMEN GÄSTE
MEISTER JAKOB UND JUNGFER URD
DIE STURMNACHT
STIVE STINE
DAS WUNDER
ATALANTA
DON JUAN VOM TRANHAUS
DER BELSMANN
ADVENT
HIER WIRD GETANZT!
DAS NEBELHAUS (EPILOG)
ANHANG
ANMERKUNGEN
»WORTE WIE BLUMENZWIEBELN IN GLÄSERN, MIT GRAUEN HÜTCHEN ZUGEDECKT« – WILLIAM HEINESEN ÜBERSETZEN NACHBEMERKUNG VON INGA MEINCKE
»DIE STIMME IST FÄRÖISCH, DIE FEDER DÄNISCH UND DAS FORMAT EUROPÄISCH« NACHWORT VON VERENA STÖSSINGER
VERZEICHNIS DER VERÖFFENTLICHUNGEN
BIOGRAFIEN
PROMENADE IN DER ABENDDÄMMERUNGEIN PROLOG
Eine Promenade, nun ja – doch, nennen wir es ruhig so. Das klingt so herrlich unverbindlich, als hätten wir alle Zeit der Welt und könnten uns gemütlichem Schlendern und Geplauder hingeben.
Aber es ist nun einmal so, dass das Boot wartet.
Der Fährkahn, ja. Er liegt draußen am Gråskallekai. Dort wartet er lange schon. Und auch wenn der alte Fährmann ein bedächtiger, geduldiger Mann ist …
Brechen wir lieber auf, bevor es dunkel wird.
Doch vorerst ist es ja noch hell genug. Hinter dem niedrigen Bergrücken im Westen ist eben die Sonne untergegangen, und aus der Himmelstiefe dringt ein warmer Glanz, Festlichter entzündet er in allen Westfenstern der Stadt, entflammt das herbstliche Gras auf den Dächern und den Rauch aus den wettergegerbten Schornsteinen. Um diese Stunde kehren die Menschen von der Arbeit nach Hause zurück, das Abendessen kommt auf den Tisch, und in Rücken und Lenden und müden Füßen ist die Süße des Ausruhens zu spüren, während man den Tageslauf mit seinen kleinen und großen Geschehnissen erörtert oder memoriert. Zu Hause sein, sich wohlfühlen.
Drüben vom Jordemoderhügel her, wo noch etwas Sonnenschein auf den Dächern verweilt, schallt ein wundervoller Chor spielender Kinder, hör nur! Lange Wellenrhythmen heben und senken sich, vereinen sich hier und da zu einem Stromwirbel verzückten Gejohles, einem Geysir unbändiger Lebensfreude – eine alte, unvergessene Symphonie aus der Tiefe der Kindheit und grauer Vorzeit! In diese Urzeitmusik mischt sich auch die eine oder andere Frauenstimme mit ihrem Klang nach Alltag, nach gegenwärtiger Wirklichkeit, mahnt geduldig oder schimpfelt.
»Kommt jetzt nach Hause, Kinder!«
Doch gerade wenn Abendessen und Bett rufen, schreit und heult es sich mit einer so unendlichen Lust himmelhoch in den tiefen Abendraum hinein, wo der Tag noch nicht ganz vorbei, bald jedoch unwiderruflich verloren ist.
Mitunter komponieren die Kinder ihre symphonischen Figuren selbst – meist wird irgendein kindlicher Galimathias vertont, gewinnt an Beliebtheit, bis ihn schließlich die ganze Schar in wildem Entzücken, aber mit strammem Appell im Chor singt.
Uga
Tuga
Galla-Gaj
zum Beispiel, ein kleines Thema in Moll, in absurder Seligkeit gesungen wie der ernste Ritus irgendeines wilden Stammes.
Dann dünnt der Chor allmählich aus, die Musik verweht. Die Stille, die folgt, fühlt sich wehmütig an. Etwas ist zu Ende.
Es ist Abenddämmerung und Sternanzündzeit auf unserem sonderbaren alten Planeten, diesem unserem Ausgangspunkt und Halt im All – der Erde. Diesem verdüsterten Sonnentrabanten, auf dem die Menschen wohnen, an seine Schwerkraft gefesselt, Angesicht zu Angesicht mit den ewig unergründlichen Kryptogrammen der Himmelstiefe.
Und vielleicht sind wir sogar die einzigen Wesen im Universum, die sich bewusst sind, dass ihr eigenes Schicksal wie das der ganzen Welt unbegreiflich ist.
Es ist ein weiter Weg hinaus zum Gråskallekai, dorthin, wo alles endet. Er führt durch eine tausendjährige Stadt mit vielen verborgenen Winkeln und Sackgassen.
Wir haben keine Eile, und mit Dingen wie Chronologie und Kausalität wollen wir es auf unserer späten Wanderung auch nicht zu genau nehmen. Es geht uns wie den abendmuntren Kindern, die nicht nach Hause ins Bett wollen, solange der Himmel noch hell ist und der schöne Tag nicht ganz vorbei. Und der alte Fährmann, der am Ende der Welt in seinem Boot wartet, ist ja ein lebenskluger Mann, er kennt das Menschenherz mit seinen Mucken und Grillen und seiner unzeitigen Sehnsucht nach dem Unerreichbaren, sicher gibt er uns einen kleinen Extraaufschub. Du wirst sehen, er hat sich bestimmt seine Pfeife angesteckt, macht es sich in seinem grauen Wolfspelz gemütlich und blickt mit befahrenen Augen hinaus in die Tiefe, wo Anfang und Ende sich begegnen und die Hand reichen, während die Nacht anbricht.
MEINE ROMANTISCHE GROSSMUTTER
Unterschiedlichere Menschen als meine beiden Großmütter kann man sich kaum vorstellen. Vaters Mutter war eine Bauersfrau aus dem einsamen kleinen Bergdorf Bøur, eine friedliche, schweigsame Frau mit sanften, tiefliegenden Augen und behutsam streichelnden Händen. Mutters Mutter war Kopenhagenerin, eine rastlos sehnende Seele. Erstere war tief und fest in ihrer färöischen Umgebung verankert. Die andere wurde in früher Jugend aus ihrer Stadtwelt gerissen und schlug seither nirgends Wurzeln, außer in ihren Träumen und Sehnsüchten.
Meine Kopenhagener Großmutter war erst achtzehn, als sie sich mit meinem färöischen Großvater verlobte und in Tórshavn niederließ, wo sie bald heiratete und schließlich Mutter von neun Kindern wurde. Man kann weiß Gott nicht behaupten, Großmutter sei ihrem Mann keine treu ergebene Gattin und ihren Kindern keine gute Mutter gewesen; andererseits war und blieb es für sie eine glatte Unmöglichkeit, als Kaufmannsfrau in der fernen salzigen Kleinstadt Tórshavn anzuwachsen. Nach außen hin versöhnte sie sich pflichtschuldig und artig mit ihrem Schicksal, nicht jedoch in ihrem Inneren; sie wurde eine heillose Romantikerin, eine gespaltene Seele, eine Tagträumerin.
Was nun nicht heißt, dass Großmutter grämlich oder verschlossen wurde, im Gegenteil, sie war all ihre Lebtage ein liebenswürdiger, geselliger Mensch – redete viel, fabulierte, posierte unschuldig – und blieb doch stets ein einsamer Vogel in der fremden Umgebung, in der sie gefangen war und mit der sie nie so richtig einen vertrauten Ton fand.
Ihre jüngsten Kinder waren noch klein, als Großmutter Witwe wurde. Ihr Mann, der Kaufmann, starb unversehens und hinterließ nichts als Schulden. Großmutter bestritt nun viele Jahre ihren Lebensunterhalt mit Musikunterricht. Von früh bis spät saß diese lebhafte kleine Dame an ihrem alten tafelförmigen Klavier und exerzierte die Kinder und jungen Leute des Tórshavner Bürgertums, während ein ältliches, treues Mädchen Haus und Kinder besorgte. Die Kinder liebten diese alte Tórshavnerin – sie stand ihnen mit der Zeit tatsächlich näher als die eigene Mutter, die so sehr mit ihrer Unterrichtsarbeit beschäftigt war und ihren Interessen.
Großmutter war nicht nur musikalisch, sie hatte auch einen Sinn für Literatur. Ihre übermöblierte Wohnstube war voller Bücher. Auf dem Klavier standen kleine vergilbte Büsten von Mozart und Beethoven, an der Wand dahinter hingen Porträts von Schiller, Chamisso, Byron und anderen romantischen Dichtern und von großen Bühnenkünstlern, Sängern und Ballettsternen wie Phister und Johanne Luise Heiberg. An einer anderen Wand hing eine Sammlung kleiner Handzeichnungen und Aquarelle, die von Großmutters Vater stammten. Mein Urgroßvater war passionierter Amateurkünstler. Von Beruf war er Schuhmachermeister, sein Geschäft in der Østergade war zeitweise durchaus bedeutend und hatte mehrere Gesellen und Ladenfräulein beschäftigt. Und auf Großmutters Erziehung war denn auch einiges Geld verwandt worden – sie hatte eine vornehme Schule besucht, sprach fließend Deutsch, auch Italienisch und Französisch waren ihr nicht fremd, und in der deutschen romantischen Literatur war sie ebenso bewandert wie in der des Goldenen Zeitalters Dänemarks. Hinzu kam ihre Theater- und Opernbegeisterung, die keine Grenzen kannte. Seit frühester Kindheit war Großmutter ein häufiger Gast im Königlichen Theater gewesen, wo einige ihrer Verwandten bei der Oper arbeiteten, und nie wurde sie müde, von diesem Tempel der Kunst, ja überhaupt vom Kopenhagen ihrer Kindheit und Jugend zu erzählen, das ihr in ihrem Exil mit der Zeit in einem ausgesprochenen Tausendundeine-Nacht-Märchenlicht erschien.
Nur ein einziges Mal nach ihrer Übersiedelung nach Tórshavn hatte Großmutter Gelegenheit, über das große Meer zu ziehen und noch einmal ihre Geburtsstadt zu besuchen. Mittlerweile waren drei Jahrzehnte vergangen, und das Wiedersehen mit der Stadt ihrer Kindheit soll für sie eine große Enttäuschung gewesen sein. Kaum war sie nach Tórshavn zurückgekehrt, glitt Kopenhagen aber schnell wieder an seinen rechten Platz in ihrem Bewusstsein als die alte, alles in den Schatten stellende Märchenstadt aus feenhaften Kindheitstagen. Das gefangene Vögelchen war in seinen Bauer zurückgekehrt, und nach seiner kurzen Flucht in eine veränderte, fremde Welt hinaus konnte es sich aufs Neue seinen prächtigen Träumen überlassen und munter vom Paradies der Kindheit zwitschern.
Und als ältestes Enkelkind und ständiger Gast in ihrem Heim wurde ich in diese paradiesischen Glückseligkeiten großzügig eingeweiht.
Großmutters Haus steht mir noch immer als ein unvergleichliches Märchenschloss vor Augen. Es war recht groß – mein Großvater, den ich übrigens nie kennengelernt habe, war zeitweilig ein wohlhabender Mann gewesen – und lag ein Stück außerhalb der Stadt, wie eine Art Landhaus, auf allen Seiten von grünen Wiesen umgeben, die malerisch gegen eine wilde, zerklüftete Felsküste abfielen. Zum Haus gehörte ein Garten mit untersetzten, aber üppigen Ebereschen und Ahornbäumen und dichten Johannisbeersträuchern und gleich zwei Lauben, und unter dem Blattwerk hatte ein kleiner steiniger Gebirgsbach sein Bett. Dieser wundersame Garten ging nach Norden in einen nicht minder märchenhaften Friedhof über, auch dieser voller Büsche und krummer Bäume, und auf den schmalen Gängen zwischen den Gräbern lag weißer Muschelsand.
Zur Winterzeit schäumte die Brandung gegen die romantisch zerrissene Küste, im Sommer gaben die Vögel vom Strand und aus den nahen Bergheiden über den blühenden Wiesen ihr lieblichstes Konzert, und im August, wenn das Heu eingebracht wurde, lag Großmutters Haus in einem betörenden Dunst aus Meer und Heuduft. Für all diese Herrlichkeiten scheint Großmutter nur wenig Sinn gehabt zu haben. Ich erinnere mich kaum, sie außerhalb des Hauses, geschweige denn draußen in der Natur gesehen zu haben. Großmutters Tagträumerleben entfaltete sich am besten innerhalb ihrer eigenen vier Wände, die Wohnstube mit ihren Bildern, Büchern, üppigen Erinnerungen und leidenschaftlichen Wunschträumen war ihr Reich. Sie fabelte nicht allein vom Kopenhagen ihrer Kindheit, sondern – auf echt romantische Weise – auch von Tirol, Italien, Sizilien, der Provence, alles Orte, die sie von Bildern kannte und aus Gedichten, hauptsächlich aber aus Opern und Balletten. Die nordischen Länder, auch die Färöer, interessierten sie nicht sonderlich; das Meer war in ihren Augen ziemlich geisttötend, und gegen die Alpenlandschaften aus Rossinis »Wilhelm Tell« waren die färöischen Berge ja als ein Nichts anzusehen. Auch ihr windiger Garten und die raunenden Wiesen und Bäume um ihr Haus reichten nicht heran an die Wunderwälder des Südens, »wo die Zitronen blühn«.
Großmutters Verhältnis zur Wirklichkeit war herzzerreißend! Auf gewisse Weise war sie blind und taub für den Alltag, durch den sie sich doch so tapfer hindurchkämpfte. Menschen beurteilte sie nicht nach ihren greifbaren Qualitäten; ihre bürgerlichen Namen konnte sie nicht auseinanderhalten und ersetzte sie durch Traum- und Kosenamen. Malerische alte Tórshavner Fischer nannte sie Leonardo da Vinci oder Magellan, junge Mädchen wurden zu Mignon, Gretchen oder Agnete fra Holmegård, junge Männer waren Apollon, der »junge Oehlenschlæger«, »Ambrosius« – oder, wenn sie nicht nach ihrem Geschmack waren, Mephisto oder Nureddin. Es gab allerdings nur wenige Menschen, die Großmutter nicht mochte; sie hatte einen liebenswürdigen Hang, ihre Umgebung zu vergolden. Ihre musikalischen Kinder, die viel sangen und musizierten, nannte sie Genies, die jüngsten waren Amorini und Seraphen, meine Mutter, die recht schwierige Sachen vom Blatt spielte, galt als »die große Pianistin«, zwei Söhne, die recht tüchtig auf der Geige waren, als »reine Paganinis«. Ihre Kinder ließen sich von dieser stürmischen Vergötterung jedoch nie beirren, sie waren vernünftig und bescheiden und überdies vollkommen ohne Großmutters üppigen Wortschatz und ihre umfangreichen, aber wildschweifenden Fähigkeiten.
Für mich bekam Großmutter eine Bedeutung wie der Geist der Wunderlampe für Aladdin. Als ich zur Welt kam, war sie seit zwei Jahren Witwe, und ihre Wohnstube wurde für mich schnell eine heilige Stätte, besonders dank des Reichtums an Bilderbüchern, die Großmutter mir zum Ansehen gab. Namentlich zwei davon machten einen erschütternden, unauslöschlichen Eindruck auf mich: Grimms Märchen mit ihren bekannten fantastischen, grässlichen Illustrationen und eine große gebundene Sammlung des Münchener Witzblatts »Lustige Blätter«, das Deutsche Buch, wie wir dieses farbenprächtige und unerschöpfliche Album mit seiner Fülle von markigen Karikaturen nannten (die, wie ich später las, herausragenden Zeichnern wie Moritz von Schwind, Wilhelm Busch und Oberländer zu verdanken waren). Was diese wild verzerrten, verhexten Menschenwesen bedeuteten, verstand ich natürlich nicht; für mich wurden sie zu seltsamen Dämonen, furchteinflößend und faszinierend zugleich.
Ich glaube, nie habe ich intensivere Stunden voll Genuss und Spannung erlebt als damals, da ich – müde von tagelangem Spiel in den Wiesen und am Strand – im »Deutschen Buch« blätterte, während auf dem Klavier, an dem Großmutter ihre Schüler unterrichtete, die Kerzen in ihren Ständern funkelten. Noch heute ruft das melodische Molltonleiter genannte musikalische Phänomen in mir diese Stimmung wach, die dunkle Gemütlichkeit der Stube, die Landschaft draußen vor den Fenstern: die grauer werdenden Wiesen und das meilenweite offene Meer, der dämmerige Garten und Friedhof, die stummen Sterne über dem Berg Kirkjubøreyn, der den westlichen Horizont beschloss.
Es war für Großmutters Haus überhaupt bezeichnend, dass sich alles in Musik übersetzte, was man dort erlebte. Schuberts wundervolles Lied »Gute Nacht« ist für mich seine »Erkennungsmelodie« geworden. Andere Lieder und Musikstücke lassen mich Großmutter sehen, wie sie auf einer Stuhlkante sitzt, entzückt in Erinnerungen versunken oder rastlos erzählend, ausschmückend, den Blick begeistert himmelwärts gerichtet; wieder andere rufen das Bild des treuen alten Mädchens in seiner Küche hervor, bestürmt von meinen blondgezopften jungen Tanten.
Großmutters Klavierrepertoire war im Übrigen bescheiden, es bestand überwiegend aus Opernauszügen, einzelnen Sonaten von Mozart und Beethoven, kleineren Stücken von Schumann und Mendelssohn. Dafür sprudelte in ihrem Haus ein nahezu unerschöpflicher Quell an Liedern: deutsche Volkslieder und romantische Kunstlieder, dänische, norwegische, schwedische, italienische, polnische und schottische Lieder, allerlei Opernarien, Vaudevillegesänge und Kopenhagener Gassenhauer aus Großmutters Kindheit. An so gut wie jede dieser mannigfaltigen Melodien knüpft sich für mich eine Erinnerung aus Großmutters Haus oder seiner Umgebung.
Ebenso verlegte ich bestimmte Grimm’sche Märchen in diese verzauberte Welt. Die Küche des Hauses war natürlich die Küche, in der Aschenputtel Erbsen von Bohnen trennte; im einstigen Pferdestall im Kellergeschoss saß in Gestalt des liebenswerten alten Dienstmädchens Die kluge Else, und wenn der Hahn im Hühnerhof krähte, sang Frau Holles Märchenhahn sein
Kikeriki!
Unsere goldene Jungfrau ist wieder hie!
Der höchste Baum im Garten war der Baum, auf dem Das tapfere Schneiderlein saß und dem Kampf der Riesen zusah, und der große Rosenbusch, der auf dem Friedhof den gemeinsamen Grabstein für meinen Großvater und meinen ältesten Onkel mütterlicherseits vollständig verdeckte, war ein Steckling aus Dornröschens Rosenwildnis. Unten am nach Seetang duftenden Strand beschwor der Mann aus Der Fischer und seine Frau den allmächtigen Butt vom Grund des Meeres herauf, und nicht weit davon lag auch der Schlammgraben, in dem die glänzende Laufbahn seiner hoffärtigen Frau ihr Ende fand. Auch andere Märchen – meine Mutter war wie Großmutter eine unermüdliche Märchenerzählerin – entliehen ihre Szenerien den Wiesen am Meer, dem Felsenstrand, dem Garten und dem großen, offenen Gräberhain dort draußen.
Aber in Großmutters Welt, an der alles Unheimliche gleichsam abprallte, ließen sich nur die idyllischeren dieser alten Märchen verorten. Die richtigen Räuber- und Schauergeschichten verlegte ich in mein Zuhause in der Stadt, in das alte düstere Haus, in dem mein Vater, der einige Zeit zur See gefahren war, das untergegangene Geschäft seines Schwiegervaters wiedereröffnet hatte.
Hier hausten Gevatter Tod und sein Patensohn im Keller, zusammen mit dem makabren Bruder Lustig und seinen Teufeln und Den drei schwarzen Prinzessinnen, hier drängten sich wie in einem diabolischen Zerrspiegel die Politiker und Staatsmänner der Siebziger und Achtziger aus den Lustigen Blättern. Um welche Persönlichkeiten es sich dabei gehandelt hat, weiß ich nicht – das »Deutsche Buch« verschwand, bevor ich alt genug war, darüber Betrachtungen anzustellen –, aber Bismarck war auf jeden Fall eine davon, eine andere sicherlich der russische Kaiser. Jedenfalls sollte dieser Zar – wohl Alexander III. – für mich eine große Rolle als Schreckphantom spielen. Er nahm sich die Freiheit, sich unter meinem Bett häuslich niederzulassen, wo er einen infernalischen Hof grotesker Geschöpfe in Tier- und Trollgestalt unterhielt, und bei bestimmten Gelegenheiten füllte er mit der ihm eigenen schrecklichen Raffinesse meine Bettdecke mit abgeschlagenen Menschenköpfen. Was ich mit diesem schlimmsten Mahr meiner Kindernächte durchgestanden habe, entzieht sich jeder schicklichen Beschreibung. Auch Dreyfus mit seinem Pincenez, das er mir partout aufnötigen wollte, obgleich es mir in die Augen stach, war eine Zeit lang eine Quelle meiner Qualen, und der Russisch-Japanische Krieg wie auch der Burenkrieg steuerten zu meiner Heerschar nächtlicher Plagegeister ebenfalls ihr Kontingent bei. Die färöischen Riesen, Hexen und Seetrolle, übrigens schon schlimm genug, waren die reinsten Lämmer verglichen mit diesen Ungeheuern aus der großen Politik, die ich dank meiner nichts Böses ahnenden Großmutter auf dem Hals hatte.
Ich erinnere mich, wie ich mich einmal so hartnäckig weigerte, in mein von Dämonen verwüstetes Zuhause zurückzukehren, dass ich in einem der tiefen Alkoven auf Großmutters Dachboden nächtigen durfte, gemeinsam mit meiner Mutter, die ich den Ungeheuern ebenfalls nicht zu überlassen wagte, und eine alte Melodie weckt in mir noch heute das Gefühl unendlicher Geborgenheit und Behaglichkeit, das mir dieses Arrangement vermittelte. Als ich sieben Jahre zählte, war das Schicksal so gnädig, das alte verhasste Dämonenhaus von einem Großbrand verzehren zu lassen, und bei dieser Gelegenheit gingen meine nächtlichen Verfolger großteils zu Grunde. Der russische Kaiser besaß allerdings die Frechheit, mit in unser neues Zuhause zu ziehen und sich neuerlich unter meinem Bett einzurichten; seine Macht aber war gebrochen, und mit der Zeit verduftete auch er.
Ein paar Jahre reihte ich mich unter die Klavierschüler meiner Großmutter ein. Es wurde ein Fiasko. Weder ihr noch mir gelang es, sich auf irgendeine vernünftige Arbeit zu konzentrieren; Großmutter brachte einen großen Teil der Unterrichtsstunden damit zu, mich mit Opernhandlungen vertraut zu machen – »Die Entführung aus dem Serail«, »Der Freischütz«, »Die weiße Dame«, »Die Stumme von Portici«, »Die Regimentstochter«, allen voran jedoch der »Don Juan«, den sie grenzenlos liebte und dessen Arien sie lächelnd und mit geschlossenen Augen gern zum Besten gab. Ich war ein stets williger, oftmals hingerissener Zuhörer und hatte bei meiner Großmutter auch einen ganz außergewöhnlich großen Stein im Brett, und da ich mich außerdem für Zeichnen und Malen begeisterte, erklärte sie mich zum Genie und sah in ihrem Enkelkind jenen Deszendenten, der das bildnerische Wirken seines Urgroßvaters auf herrliche Weise fortsetzen und weiterführen würde.
Auf ihre alten Tage übersiedelte Großmutter ins Haus meiner Eltern. Sie wurde eine alte Dame, ohne je ihr sorgloses, naiv schwärmerisches Wesen zu verlieren, und auch ihr Hang, ihre Umgebung zu glorifizieren, blieb bis zuletzt ungeschwächt.
Es war zur Fasnachtszeit, als Großmutters unruhiger Geist diese Welt verließ, in der sie auf gewisse Weise nie so ganz zu Hause gewesen war. Ich war damals gerade eifrig dabei, Dekorationen für einen Maskenball anzufertigen, und bevor sie bettlägerig wurde, hatte Großmutter Gelegenheit gehabt, einige dieser dilettantischen Versuche zu sehen; sie begeisterte sich derart dafür, dass sie später, als sie im Fieber lag, unentwegt von »all der herrlichen Kunst« fantasierte, die das Genie da hervorgezaubert hatte.
Als Großmutter auf ihrem Siechbett zu Ohren kam, ich wolle aus Rücksicht auf sie besagtem Maskenball fernbleiben, rief sie mich zu sich und beschwor mich, doch teilzunehmen. Ich folgte ihrem Wunsch – schweren Herzens und mit wurmigem Gewissen. Als ich Großmutter tags darauf in ihrer Kammer besuchte, lag sie verwirrt und fabulierend im Bett. Sie bat mich, ihr von dem Maskenball zu erzählen, aber ich brachte kein Wort über die Lippen. Das war auch gar nicht nötig – Großmutter ergriff selbst das Wort, sie sah das mutmaßlich prunkvolle Fest in Gedanken vor sich und beschrieb entzückt und in ausladendem Stil ihre Fantasien.
Die letzten Worte, die ich aus dem Mund meiner Großmutter vernahm, waren die begeisterten Ausrufe: »Prächtige Kunstreiterinnen auf feurigen Pferden! Mächtige Ovationen!«
MEIN URGROSSVATERMARTIN CHRISTIAN RESTORFF (1816 – 97)
Dieser Mann – der »Gamle Restorff« – nimmt unter meinen näheren Vorvätern eine ganz besondere »patriarchale« Stellung ein.
Er war Bäcker von Beruf, hatte aber, wie sich zeigte, das Zeug zu mehr, als Brotteig zu kneten und sein eigenes Küchlein zu backen. Wollte man seine Laufbahn in ihrem Kern wiedergeben, könnte man es etwa so versuchen: Irgendwann Mitte des vorigen Jahrhunderts landete ein fahrender Geselle gemischter dänisch-norwegisch-deutscher Herkunft in Tórshavn und gründete dort ein Geschäft, das zu einem der bedeutendsten der Färöer wurde. Wobei das eigentlich Interessante am »Alten Restorff« nicht unbedingt war, dass er Geschäftssinn hatte und Glück obendrein. (Das Handelshaus M. C. Restorff & Sønner wurde zu einem »psychologisch« ganz besonderen Zeitpunkt gegründet, nämlich gleich nach Aufhebung des Kgl. Monopolhandels 1856, die das färöische Wirtschaftsleben aufblühen ließ.) Das namentlich Fesselnde an diesem Mann war, dass er ungeachtet seiner recht abenteuerlichen Karriere er selbst blieb, ein forscher und ungehobelter, dabei zugleich nachdenklicher und vielschichtiger Handwerksbursche. Er scheint sich und die Welt im bürgerlichen Sinne nie ganz ernst genommen zu haben, so der unmittelbare Eindruck, den sein Leben und Treiben in Tórshavn hinterlässt. Ein Bourgeois wurde er nie, geschweige denn ein Snob, er blieb zeitlebens derselbe etwas brüske, unberechenbare, doch warmherzige Kerl, der er immer gewesen war, ausgestattet mit viel gesunder Ironie und Menschlichkeit, ein gewisses warmes, natürliches Gemeinschaftsgefühl eingeschlossen.
Fotografien vom »Gamle Restorff« zeigen eine maskuline Physiognomie, volle Haarpracht, buschige Augenbrauen, eine große Nase und einen eigentümlich spöttischen Mund; die scharf beobachtenden Augen aber – sein Blick konnte, wie Mutter (Caroline) sagte, sehr streng sein und »blitzte« häufig – lassen ein humorvolles, selbstironisches Funkeln erkennen. Das grob gemeißelte Gesicht hat eine gewisse Schroffheit, wirkt aber alles andere als brutal. Hinter seiner Barschheit lauern ein Lächeln und nicht wenig nachdenkliche Unsicherheit. Mein Eindruck ist, dass sich Gl. R. ein Stück weit einer äußeren Maske der Knorrigkeit bediente, vielleicht um eine bestimmte Empfindsamkeit zu verbergen, an der wohl auch die Unsicherheit des »Emporkömmlings« ihren Anteil hat. Eine der Aufnahmen (en face, mit dem Porträt seiner Ehefrau als Gegenstück) vermittelt eine gewisse Traurigkeit und Einsamkeit.
Urgroßvater scheint ein ruheloser, unsteter Charakter mit einer guten Portion schöpferischen Wirkungsdrangs gewesen zu sein.
Ich habe folgende Betrachtung angestellt: Vielleicht hätte dieser Drang zu wirken nicht seine rechte positive Entladung gefunden, wenn Gl. R. nicht 1848 (32-jährig) nach Tórshavn ausgewandert wäre. Als Bäcker in Kopenhagen steckengeblieben, hätte er sich womöglich zu einem misanthropischen Steifbock entwickelt, der in seinem Handwerk verkrüppelt, was man ja häufig sieht: Ein Mann macht seine Arbeit, findet für seine überschüssige Energie aber nicht das richtige Ventil und wird traurig oder boshaft, ein wenig ein Sonderling, ein wenig ein Haustyrann, vielleicht auch ein Zechbruder in Vereinen oder Wirtshäusern – alles in allem eine dieser ziemlich traurigen Existenzen, von denen man sagt: Seinen Platz im Leben hat er nie gefunden.
Gamle Restorff fand seinen Platz im Leben, ja vermutlich sogar weiter oben, als er es sich erträumt hatte.
Bereits nach Tórshavn zu kommen muss anspornend auf ihn gewirkt haben. Hier gab es ein neues, spannendes Umfeld und etwas zum Anpacken. Hier lebten Beamte und andere feine Leute, die gutes Backwerk zu schätzen wussten, und hier wimmelte es von mehr oder weniger verwahrlosten Armen, für die die neue Bäckerei, die erste der Inseln, eine Sensation war, eine Art Soria-Moria-Schloss.
Es gereicht seinem Charakter zur Ehre, dass Gl. R. nicht allein bei der Versorgung der feinen Leute mit zeitgemäßen Backwaren sein Bestes gab, nein, er öffnete auch sein Herz – wenn er auch kaum seine Maske ablegte – für die Armen der Stadt; ein im Umkreis des königlichen Handelsmonopols herangewachsenes Proletariat, zusätzlich verroht und verwahrlost durch den in jenen Tagen gewaltig florierenden Alkoholmissbrauch. Ich hüte mich davor, aus Gl. R.s Geschichte ein billiges kleinbürgerliches Rührstück zu machen. Er war beileibe kein selbstloser Idealist und natürlich bar jeder sozialen Theorie (die Geschichte des Sozialismus hatte in Dänemark damals überhaupt noch nicht begonnen). Andererseits gründet der Mythos von Gl. R.s Wohltätigkeit, der mit der Zeit entstanden ist, solide auf der Wirklichkeit. Die Armen bekamen Brot zu essen, und mit der Bezahlung wurde nicht sehr streng verfahren.
Mutter, die als junges Mädchen eine Zeit lang den Brotladen ihres Großvaters besorgte, erzählt, es sei völlig aussichtslos gewesen, eine stimmige Buchhaltung zuwege zu bringen: Stets gab es einen beträchtlichen »Schwund«, weil Großvater in rauen Mengen Ware verschenkte.
Der Bäcker veranstaltete bei besonderen Gelegenheiten außerdem großzügige »Feste« für die Armen, die sich in der Bäckerei versammelten, wo aus dem großen Braukessel Fleisch und Suppe serviert wurden. Legendär waren auch seine »Weihnachtsbäume«: heideumwundene Fassringe, die um eine Stange herum angebracht und mit allerlei Süßigkeiten behängt waren; unter diesen selbstgemachten Gewächsen erlebten die Armen der Stadt, Kinder wie Erwachsene, zum ersten Mal in ihrem Leben einen richtigen Kopenhagener Weihnachtsrummel mit Tanz, Gesang und Leckereien für alle. Wobei in diesem Zusammenhang anzumerken ist, dass Gl. R. nicht sonderlich religiös war und schon gar kein Mann der Mission.
Gl. R. pflegte scherzhaft zu sagen, er glaube an Seelenwanderung. An einem windigen Tag, erzählte Mutter, stand ihr Großvater einmal am Fenster und beobachtete ein Huhn, das drüben im Amtmannsgarten mühsam gegen den Wind ankämpfte. »Siehst du das Huhn da drüben, Caroline?«, lachte der Alte. »Das könnte wirklich gut deine Urgroßmutter sein!«
Wie bereits erwähnt, konnte das Bäckerhandwerk allein Gl. R.s Wirkungsdrang auf Dauer nicht befriedigen. Er träumte von einem größeren Unternehmen mit mehr Breite, das er dann auch auf die Beine stellte, als der Kgl. Handel 1856 aufgehoben wurde. Kapital verschaffte ihm sozusagen sein mittlerweile begründetes Renommee. Angeblich überredete er verschiedene wohlhabende Bauern, Geld in ein neues Handelsunternehmen zu stecken, dessen Hauptzweck das Trocknen und Exportieren von Klippfisch war, was ihn in die Lage versetzte, das große »Wiegehaus« am Vágsbotnur bzw. an der Frederiksvåg, wie die Hafenbucht damals offiziell hieß, zu kaufen. Das neue Handelsunternehmen lief gut, in den folgenden Jahren wurden an der Frederiksvåg viele neue Speicher gebaut, Fischerboote angeschafft, Fischtrockenplätze, Brauereien, Transiedereien und Böttcherwerkstätten errichtet, und nach und nach entstanden Filialen ringsum auf den Inseln. M. C. Restorffs Handel entwickelte sich zu einem blühenden Organismus, der auf seinem Höhepunkt siebzehn Gebäude in Tórshavn, zwei Kauffahrteischoner und gut zwanzig Fischkutter besaß und eine Heerschar an Fischarbeitern, Schauerleuten, Handelsgehilfen, Filialleitern und Seeleuten beschäftigte.
Natürlich liefen die Geschäfte nicht immer nur blendend. Einmal kamen, erzählt man, Gerüchte auf, nun gehe es mit Restorffs Firma bergab, was bei den Bauern, die Geld im Unternehmen stehen hatten, einige Panik auslöste. Einer von ihnen schnürte sein Bündel und zog gen Tórshavn, um sich durch Augenschein davon zu überzeugen. Gl. R. empfing ihn freundlich im Laden und zog ihn mit sich nach oben ins Kontor; auf ihrem Weg passierten sie eine Schublade mit Nägeln, die einen Spalt weit offen stand, und während Urgroßvater die scheppernde Lade mit dem Knie zudrückte, rief er vorwurfsvoll Richtung Laden: »Lasst verdammt noch mal nicht immer diese Geldladen offen stehen!«
Was nun M. C. Restorff selbst betrifft, erreichte er ja mehr und mehr »Stand«, mit den Jahren wurde er zu dem weitum bekannten, heute noch warm erinnerten Patriarchen »Gamle Restorff«. Seine Großzügigkeit und sein Herz für die kleinen Leute wurden im Alter nicht kleiner, genauso wenig jedoch verschliff sich seine Steifbockigkeit. Zum Beispiel entwickelte sich ein gewisses Misstrauen bei Gl. R. auf reichlich groteske Weise. Er machte sich überall Gucklöcher und betrieb seine persönliche Spionage, was er jedoch nicht verheimlichte, er machte sich selbst darüber lustig.*
Es lässt sich auch nicht leugnen, dass er mitunter – besonders seinen nächsten Angehörigen gegenüber – ziemlich tyrannisch auftreten konnte. Er neigte dazu, einige zu vergöttern und andere zu suspizieren. Dies gilt vor allem für das Verhältnis zu seinen drei Söhnen: Der Älteste, Andreas (mein Großvater), war sein Herzenskind, während der zweitälteste, Frants, das Etikett »mein Sohn der Idiot« erhielt, und was den Jüngsten, Johan, angeht, so wurde er wirklich höchst unbillig behandelt: Der Junge, eine scheue und furchtsame Natur, wurde trotz seiner mangelnden Geneigtheit zum Seeleben ohne viel Federlesens auf den maritimen Weg gezwungen und nach langen Trakasserien zum Schiffsführer des Frachtschoners »Frederiksvaag« gemacht. Merkwürdigerweise hatte auch Gl. R.s tüchtiger und vornehmer Neffe Rudolf Andersen (»Onkel Rudolf«), später langjähriger Leiter von M. C. Restorff & Sønner, bei seinem Onkel keinen besonderen Stein im Brett.
Im Übrigen war Gamle Restorff ein Mann mit schlichten Gewohnheiten. Obschon fleißig, war er kein eigentliches Arbeitstier. Er sah es gern um sich herum blühen und gedeihen und hatte ja auch das Glück, seinen Wunsch sozusagen im Übermaß erfüllt zu sehen.*
M. C. Restorff wurde einundachtzig Jahre alt. In seinen letzten Lebensjahren war er etwas hinfällig; meist saß er an seinem Fenster oder im Garten und stellte spöttische, häufig drastisch-humoristische Betrachtungen über Passanten an.
Weitere Notizen: Urgroßvater drückte sich, wie erwähnt, oft ziemlich drastisch aus – worin ihm übrigens viele seiner Nachkommen nachschlagen. Eine bestimmte Dame, die er nicht leiden konnte, nannte er »das große Scheißhaus«. Als er einmal vom schwedischen Fabrikanten Öström, dem Gründer der »Fabrik«, zum Mittagsimbiss eingeladen wurde, knurrte er: »Ach, zur Hölle mit Ihnen und Ihrem Bissen!« Derselbe Öström erbot sich einmal, berichtet eine andere Anekdote, »mit meinem Windjammer ›Fleiß‹« bei den Rettungsarbeiten zu helfen, als eines von Gl. R.s Schiffen bei Ålekjærsnæs auf Grund gelaufen war; Gl. R., der dies für höfliche schwedische Phrasen hielt, entgegnete aufgebracht: »Ach, bleibe er doch, wo der Pfeffer wächst, mit seinem Jammer und Fleiß!«
Mein Onkel Frants erzählte mir einmal, wie er als Junge, als er beim Großvater in die Lehre ging, vom Alten einen Taler in die Hand gedrückt bekam. »Das ist viel zu viel, Großvater!«, protestierte Frants höflich. »Nein«, antwortete Gl. R. mit einem vertraulichen Augenzwinkern, »du gehst sonst nur los und scheißt auf mein Grab!«
* Gl. R.s Misstrauen fand auch in anderen Drolligkeiten seinen Ausdruck. So verdächtigte er etwa einen gewissen Dreher Debes, der Poul Andreas Jacobsen (Gl. R.s Schwiegervater) während seiner letzten Krankheit pflegte, Jacobsen zu bestehlen, und sprach von ihm nur als dem »alten Leichenfledderer«.
* An seinem achtzigsten Geburtstag wurde Gamle Restorff zum Ehrenbürger der Stadt Tórshavn ernannt und war aus diesem Anlass Gegenstand allgemeiner Ehrerbietung.
ROSENMEYER
Es ist einer dieser ganz großen, seltenen Hochsommertage. Die Wolken sind herab auf die Erde gesunken und vergehen im Sonnenschein, und der sonst stets so brüske Ozean beträgt sich beinahe treuherzig, ohne doch an Würde und Machtfülle einzubüßen. Der Widerschein des sonnentrunkenen Wellenflimmers in der Bucht tanzt fröhliche Saltarelli unter den öden Speicherdächern am Hafen, und die Mäuse geben kleine Freudenmuckser von sich, während sie über die staubigen Böden flitzen. Und wenn man sich recht klein und demütig macht und die Spannleinen am Trommelfell seiner Ohren bis zum Zerreißen anzieht, hört man auch die Fische im Wasser jubeln, was etwa wie das ferne, schwirrende Summen klingt, das entsteht, wenn man an einem Klavier die Pedale herunterdrückt, ohne die Tasten zu berühren.
An solch ungeheuren Sommertagen konnte man Rosenmeyer oft an einer einsamen Stelle am Strand sitzen sehen, die Hand unterm Kinn, die Ellenbogen auf den angezogenen Knien ruhend. Hier saß er und starrte hinaus so weit.
Worauf starrte Rosenmeyer mit seinen Träumeraugen unter den schweren Lidern? Vielleicht auf nichts Bestimmtes. Vielleicht auf Luftspiegelungen. Ja, warum nicht? Luftspiegelungen zeigen sich an solch stillen, klaren Sommertagen ja gerne draußen über dem Meer. Fremde, sagenhafte Strände. Pyramiden und Wolkenkratzer. Hohe Berge mit ewigem Schnee.
(Es geht auch die Sage, dass ein Mann in einer klaren Winternacht vor über hundert Jahren Bilder brennender Häuser und Zwiebelhaubentürme sah. Diese unheilvollen Lufterscheinungen zeigten sich als Spiegelungen in einem hoch gelegenen See auf der Insel Vágar und wurden von weisen Leuten später mit dem Brand von Moskau 1812 in Verbindung gebracht.)
Doch vielleicht sah Rosenmeyer überhaupt keine Erscheinungen, weder lichte noch düstere, sondern war einfach in eigene Gedanken und Träume vertieft.
Zu anderen Zeiten, besonders sonntagmorgens, sah man Rosenmeyer an schönen Sommertagen auch zu Pferd. Nun nicht allein, sondern in Begleitung seiner Freunde Edwinsen und Hamborger-Olsen. Hin und wieder gehörte auch eine Dame zu dem kleinen Reitergefolge, Fräulein Eleonora Duse (ein Schauspielerinnenname von internationalem Klang, der älteren Lesern bekannt sein dürfte). Sie trug einen langen Rock und saß mit beiden Beinen auf einer Seite schief im Sattel, und tief in ihrem Nacken hing ein großer blumengeschmückter Strohhut an roten Seidenbändern, die unter dem Kinn zu einer Schleife gebunden waren.
Konsul Edwinsen war ein Mann von Welt in Gehrock und glänzenden Ledergamaschen – ein lächelnder Kavalier mit spitzem Vollbart und brennender Zigarre zwischen den starken, rücksichtslosen Zähnen. Hamborger-Olsen, gemeinhin »Prop« – Stöpsel – genannt, war ein Vetter von Edwinsen, bot im Vergleich zum Konsul aber einen bescheidenen Anblick, wenngleich auch er fein angezogen war: karierte Reithosen, weiße Sommerweste, Melone und an einer Schnur ein Pincenez.
Auch Rosenmeyer nahm sich gut aus zu Pferd – meinte man da, bis eines Tages jemand über ihn sagte: »Was für ein Lulatsch!«
Ich weiß noch gut, wie mir diese Worte ins Herz schnitten.
Andere nannten ihn einen Taugenichts, was ich als »Totennicker« auffasste, und nun konnte ich zu meinem Kummer auch deutlich sehen, wie der Kopf auf Rosenmeyers langem Hals so seltsam tot nickte, wenn er vorbeiritt. Aber das kam wohl daher, dass er tief in Dichtergedanken versunken war. Ich stellte mir vor, dass er sich irgendwo hoch oben in der Fjeldmark von den anderen Reitern und Fräulein Eleonora absetzte und seine eigenen einsamen Wege ritt.
Mein jüngerer Bruder Jan und ich hatten ein Spiel, das »Rosenmeyer und Prop« hieß. Die beiden Freunde lebten in dem merkwürdig verbauten Haus, wo Hamborger-Olsen sein Geschäft hatte. Hinter dem Laden befand sich ein hoher Lagerraum mit Zwischenboden – oder Hahnenboden, wie wir ihn nannten. Zu diesem halbdunklen Speicher führte eine steile Treppe hinauf, und durch eine Schiebetür im Giebel gelangte man auf eine kleine Veranda mit Glasdach. Hier oben in diesem »Sternenguckerturm«, wie wir ihn nannten (und der von unserem Dachfenster aus zu sehen war), machten es sich die beiden Freunde Rosenmeyer und Prop in sternenklaren Nächten gemütlich. War es zu kühl, zündeten sie einen Petroleumsofen an, auf dem sie Äpfel brieten.
Das spielten wir dann. Äpfel und Limonade gehörten zum Spiel dazu, aber zur Not ging es auch ohne. Wenn die Äpfel auf ihrem Rost unter dem Großen Wagen und der Milchstraße brutzelten und pfiffen, herrschte in Hamborger-Olsens Sternenguckerturm eine unfassbar liebliche Stimmung. Rosenmeyer und Prop ging es vorzüglich in ihrem Turm, sie futterten die dampfenden Äpfel, tranken ihren roten Erfrischungstrunk und sangen wonnesatte Liedchen, wie etwa »Verschlossen die Hütte, stille die Nacht« oder »An einem sternenklaren Abend im ruhenden Hain«; oder auch das mit den herrlichen Worten: »Sieh nur, sieh, wie die Nacht von Sternschnuppen funkelt«.
»Aber dann kommt das Aufregende!«, sagte Jan mit einem erwartungsvollen Schaudern.
Ja, dann kam das Aufregende.
Aufregend wurde es, wenn Rosenmeyer und Prop vom Sternenguckerturm herabstiegen und sich auf dem dunklen Hahnenspeicher vortasteten. Hier wohnte nämlich der Geist Sanherib mit dem Hahnenkopf. Sanherib hauste zwischen aufgehäuften dunkelroten Heringsnetzen; von ihm war auch bekannt, dass er »Karnüffel« hatte und ein schrilles Winseln durch die Nase ausstieß wie ein in einem Schrank eingesperrter Hund. Geriet man in die Reichweite seiner schrecklichen Karnüffel, war man so gut wie rettungslos verloren. Doch war Sanherib »feig« und ließ sich mit Drohungen und Gesang einschüchtern und auf Abstand halten.
Nun war ich Sanherib, wimmerte zum Gotterbarmen und streckte dabei mit wahnsinnig verzerrtem Gesicht meine Karnüffel nach Jan aus, der Rosenmeyer und Prop in einer Person war und mit lauter, freimütiger Stimme das erlösende Lied anstimmte:
Turrelurre dschäk dschäk dschäk,
turrelurre dschäk dschäk dschäk,
turrelurre dschäk,
das ist der Kehrreim eines färöischen Tanzliedes.
Durch des Liedes Kraft erlöst stiegen Rosenmeyer und Prop nun die steile Treppe herab, die von Sanheribs schaurigem Dachboden nach unten in den Lagerraum führte. Doch bei ihrem Abstieg treffen sie auf neue Schrecken und Gefahren, denn hier wohnen die Mallemucken.
Die Mallemucken waren eine Art Geier mit Menschengesicht und abstoßenden nackten, genoppten Hälsen, und mit ihnen war ebenfalls nicht zu spaßen. Aber wie Sanherib waren sie feige und ließen sich mit Schmährufen und Gesang auf Abstand halten. Nun war ich an der Reihe, Rosenmeyer und Prop zu sein, während Jan den Hals reckte und mit irren Augen und zähneknirschendem Mund abscheuliche Geierschreie durch die Nase ausstieß.
Nach tapfer erduldeten Fährnissen hatten die beiden Freunde schließlich wieder den sicheren Ladenboden unter den Füßen und konnten sich einem hemmungslosen Sieges- und Freudentanz hingeben; er ging nach der Schlussmelodie von Weyses Kanon »Wie schmerzt es so grässlich in meinem Bauch«, den wir von der abendlichen Benefizveranstaltung des Gesangsvereins für die neue städtische Wasserversorgung her kannten:
Nun ist er hinweg, der grausame Schmerz,
Vielen, vielen Dank für die warme Salvet.
Im Grunde war der kleine wohlbeleibte Kaufmann Prop mit seinen Schelmenäuglein und dem aufgewichsten Knebelbart für einen Dichter wie Rosenmeyer nicht die ganz passende Gesellschaft. Genauso wenig wie das überschmückte Fräulein Eleonora oder der laute, großspurige Edwinsen. Am liebsten stellte ich mir Rosenmeyer als einsamen Wanderer in der Natur vor. Meer und Wildmark, blaue Berggipfel, die hellen Nächte des Sommers, die funkelnden Sternenhimmel des Winters – das war Rosenmeyers Welt.
Im Sommer wird es nie Nacht, die Stadt wird nur menschenleer, und in den nach Norden gehenden Giebelfenstern schlummernder Häuser spiegelt sich der helle Himmel. Kein Leben regt sich in den öden Straßen, allein Rosenmeyer wandert einsam durch die schattenlose, ungeheure Nacht.
Halb zwei zeigt die vierte Kirchenuhr, die nördliche, jetzt schlägt sie: ting – ein zarter Laut im gewaltigen Nachtraum.
Der Kirchturm hat vier Uhren: die erwartungsvolle östliche, die den Morgen und den Sonnenaufgang begrüßt; die kecke südliche, die den Schiffen im Hafen und dem Alltag der geschäftigen Stadt aufmunternd zulächelt; die wehmütige westliche, die unverwandt in den Nachmittag und den beginnenden Abend hineinblickt, und die düstere nördliche, die Uhr der Nacht, die keiner abliest. In der hellen Nacht aber ballt sich auf festliche, leicht verrückte Weise alles freudenreiche Licht an der Nordseite des Turms.
Rosenmeyer zieht seine Taschenuhr aus der Westentasche.
Halb eins – das stimmt nicht ganz. Er dreht etwas an ihr. Dann ist das in Ordnung. Die große, langsame Kirchenuhr stimmt mit Rosenmeyers kleiner, hastiger Taschenuhr überein. Dann ist die Zeit in ihrem Geleise. Und alles ist gut. Gott und die Welt sind eins. Die Ruhe der Nacht ist vollkommen.
Rosenmeyer hat einen schlendernden Gang, sein grüner Regenmantel hängt lose über den Schultern, mit leeren Ärmeln, wie ein Umhang, der Kopf auf dem langen Hals ruckelt leicht, seine Glieder schlackern nach Lust und Laune, er ist allein und frei wie ein Vogel. Um seinen Mund spielt ein warmes, entspanntes Lächeln unter dem hellen Schnauzbart. Da, nun bleibt er wieder stehen, er klopft sich auf die Jackentasche, zieht ein Zigarettenetui heraus, zündet sich eine nächtliche Zigarre an, schickt blaue Rauchringe hinauf ins klare Himmelsgewölbe, wo die allerobersten Federwölkchen noch vom Abendrot glimmen, oder schon vom Morgenrot.
Weiter wandert Rosenmeyer, in entzückte Gedanken vertieft. Halb im Schlummer vernimmst du seine Schritte, glip glap, glip glap, in der hellwachen Stille zwischen den magisch beleuchteten Hausgiebeln.
Wohin wandert er in dieser verzauberten Nacht?
Nach Norden, nach Norden, über dunkle Heiden, unter dem aufglänzenden Dach des Morgenhimmels.
Vielleicht erhebt er jetzt seine Stimme und singt sein schönes Morgenlied »Wach auf und schlag an deine Saiten!«.
Weiter wandert Rosenmeyer und kommt in das ferne Tørvedal, wo tausende weißer Wollgrasköpfe in der Morgenbrise nicken.
Dann kann man dem einsamen Wanderer kaum mehr folgen, weil sich die Augen mit Wollgrasflocken und Torfdunkel füllen.
So war Rosenmeyer, so vergingen seine Nächte und Tage, aber was ich hier mit meinen dürftigen Worten zu veranschaulichen suche, gibt nur eine kümmerliche Vorstellung von der unbeschreiblichen Aura, die alle Dinge, selbst die bescheidensten und alltäglichsten, in jenen fernen Zeiten ausstrahlten.
So verhielt es sich zum Beispiel mit Schuhmacher Nikodemussens Café.
Schuhmacher Nikodemussen hatte neben seiner Werkstatt in der Havnargøta einen kleinen Laden mit Zigaretten, Lakritz, Apfelsinen und anderen Erfrischungen, darunter auch Bier und Limonade, welche man in dem kleinen Hinterzimmer hinter seinem Geschäft, dem Café, genießen konnte. Hier stand ein schwergezimmerter Holztisch, ringsum Sitzbänke ohne Rückenlehne. Sonst nichts – außer einem defekten ewigen Kalender, der an der Tür hing; er zeigte fortwährend Samstag, den 9. Mai 1903, ein Datum, das man sich einprägte und auch nie vergessen hat. Zimmerdecke, Fußboden und die nackten Wände waren aus rohem Kiefernholz mit Astlöchern und Jahresringen. Doch alles war blitzblank gescheuert und proper, dafür sorgte Nikodemussens kräftige, mürrische Frau. Durchs Fenster sah man nur den Himmel und die leeren Blechdächer von zwei weiter unten gelegenen Häusern.
Das klingt ja alles nicht gerade besonders, doch barg dieser bescheidene Ort einen unvergleichlichen Zauber. Worin dieser Zauber bestand – ja, das können, wie gesagt, Worte nicht ausdrücken, das haben sie nie gekonnt. Natürlich, so viel kann man sagen, es handelte sich hier um ein Refugium außerhalb der Zeit, ein stilles Kämmerlein, das dem Frieden des Grabes ebenso Platz bot wie einem bestimmten unbändigen, elementaren Glücksgefühl über Dasein und Gegenwart. Das reicht jedoch nicht, da war ein unsagbares Mehr, ein Element, das später verloren ging und doch in der Erinnerung spukt, als ein verhangenes und zugleich unsterbliches Siebengestirn.
In diesem göttlichen Hinterzimmer des Schuhmachers Nikodemussen sah man Rosenmeyer oft bei einem Glas Bier, einsam, das Kinn in die Hand gestützt. Ich sehe ihn in diesem Moment deutlich vor mir, wie er über die öden Dächer hinstarrt, die von Regen und aufklarendem Himmel glänzen. Entrückt folgt sein Blick den großen Haufenwolken, die langsam, mit Licht beladen, aus der Tiefe heransegeln. Über die Wellenrillen der nassen Dächer wandern schwindelnde Abgrundsfarben, und durch eine undichte Stelle in einer rostigen Dachrinne fallen perlenklare Tropfen und fangen bei ihrem Fall das Licht ein.
In stiller Freude über diese Regentropfen versunken sitzt Rosenmeyer da. Mitten in einer Welt, in der es in diesem Moment eben geregnet hat. Doch jetzt hat sich der Schauer verzogen, und der Himmel öffnet seine Wolkentore in einer segnenden Umarmung.
Lange, ja womöglich den ganzen Nachmittag konnte Rosenmeyer so dasitzen, mutterseelenallein, weil vor Abend selten Kunden in Nikodemussens kleine Wirtschaft kamen.
Rosenmeyer auf einsamer Nachtwanderung oder allein in Nikodemussens Café – dafür bei Jan Interesse wecken zu wollen ist zwecklos. Es lässt sich nicht »spielen«. Jan ist nur ganz bei der Sache, wenn es um etwas Schauriges geht. Wie zum Beispiel das neue Spiel mit dem Namen »All das Rote«.
Dieses rote Spiel geht so, dass Fräulein Eleonora neue Tapeten für ihr Wohnzimmer benötigt und Rosenmeyer nun die Tapete auswählen soll, die ihm am besten gefällt. Das klingt sehr harmlos, doch nimmt das Spiel ein schauriges Ende.
Zuerst werden die Buntstifte herausgeholt, und man macht ein »Tapetenbuch« mit Farben und Mustern. Das röteste Mohnrot, das blaueste Vergissmeinnicht-Blau, das grünste Grünalgen-Grün – Farben, die in den Augen und ganz tief im Magen kribbeln.
Was wählt Rosenmeyer?
Das röteste Mohnrot!
Lodernd rot sollen die Wände in Fräulein Eleonoras Wohnzimmer sein.
Nein, sieh nur, wie rot sie sind und in der wallenden Nachmittagssonne lodern! Und draußen in Fräulein Eleonoras kleinem Garten glühen Johannisbeeren und Vogelbeeren und wilde Rosen.
Und da kommt Fräulein Eleonora mit einem rotgeblümten Tuch, das sie über den Tisch breitet. Darauf stellt sie dann rote Tassen und eine rote Schokoladenkanne. Sie hat nämlich Geburtstag.
Da, jetzt kommen auch rote Blumen auf den Tisch! Und rote Gläser mit rotem Wein! Und das Geburtstagskind trägt ein rotes Kleid und hat rote Ohrgehänge und eine Halskette aus roten Edelsteinen!
»Nein, sie sind grün!«, protestiert Jan, dem es nun offenbar zu viel des Roten wird.
Nun wird Rosenmeyers Geburtstagsgeschenk ausgepackt. Nein, sieh nur: ein rotes Glasherz mit Licht darin!
»Ja, und dann kommt das Schaurige!«, sagt Jan.
Ja, aber zuerst singen Rosenmeyer und Fräulein Eleonora noch ihr rotes Lied!
Nun mag ich lustig tanzen geh’n,
die rötesten Rosen sie wachsen so schön.
(Dann singen wir es.)
»Ja, aber dann kommt das Schaurige!«, sagt Jan mit funkelnden Augen.
Ja, dann kommt das Schaurige. Dann muss das Schaurige geschehen, so schade es beinahe ist.
Das Schaurige besteht darin, dass Fräulein Eleonora Rosenmeyers Glasherz herunterfällt, sodass es in tausende Stücke zerspringt und das ganze Haus in Brand setzt.
Rosenmeyer wird natürlich gerettet. Er entkommt durchs Fenster ins Freie.
Aber was ist mit Fräulein Eleonora?
Ja, was ist mit ihr?
Darüber herrschen stets etwas spannende Zweifel, denn eigentlich gehört zu dem Schaurigen dazu, dass Fräulein Eleonora mitten in all ihren roten Sachen selbst in Flammen aufgeht. Das hätte zumindest leicht ihr Schicksal werden können. Aber Rosenmeyer macht da natürlich nicht mit. Er ist ja nicht feig. Tapfer hilft er der armen Eleonora durchs Fenster ins Freie und lässt ihre Hände nicht los, bevor sie nicht sicher auf die Erde dschumsen kann.
Dann erst rettet er das eigene Leben. Im letzten Augenblick und mit brennenden Kleidern …
Dieses ekstatische Brandspiel war im Grunde nicht lustig, und hinterher fühlte man sich seltsam leer und müde.
Allmählich gestalteten sich diese Traumspiele überhaupt zunehmend zäh.
Auch mit Rosenmeyer wurde es immer schwieriger. Nach seiner Rettungstat in Fräulein Eleonoras Haus trat er, versuchsweise, einige Male nicht nur als Dichter und Träumer, sondern auch als tapferer Held auf. Was in gewisser Weise damit zusammenhängt, dass man damals gerade begonnen hatte, sich für Robin Hood zu interessieren. Aber Rosenmeyer als edler Räuber im grünen Wald, das funktionierte nicht so richtig …
So verlor man Rosenmeyer eine Weile aus den Augen und verbrachte einen nassen, aber herrlich duftenden grünen Sommer im Zeichen Robin Hoods.
Dann kam der Winter, als man sich abends oft statt einzuschlafen beim Gedanken an das Schicksal im Bett wand.
»Das blinde Schicksal.« »Das Schicksal klopft an die Tür.« »Wir alle gehen unserem Schicksal entgegen.« »Manche erwartet ein grausames Schicksal.«
Sein Schicksal kennt keiner. Es lauert irgendwo, und plötzlich schlägt es seine Karnüffel in dich – wie Sanherib mit den roten Hahnenaugen. Sanherib? Pah – das war damals, das war gar nichts. Das mit dem Schicksal ist beunruhigend und schaurig auf eine völlig neue Weise, die sich weder »spielen« noch mit Rosenmeyers verwunschener roter Welt verbinden lässt, ebenso wenig wie mit Robin Hoods grüner.
Überhaupt ist nun die Zeit gekommen, da diese Märchenwelten der Kindheit langsam in den Staub sinken.
Ach, auch die Tage des Dichters Rosenmeyer sind gezählt.
Nicht in dem Sinn, dass ihn irgendein dramatisches oder tragisches Schicksal ereilt. Nein, ganz sachte gleitet er aus der gewaltig verdichteten, großartigen Unwirklichkeit der Poesie heraus, hinein in sein handgreifliches, kleines Leben und dessen bedrückende, enge Wirklichkeit.
Auf die Dauer lässt es sich ja nicht verhehlen, dass Rosenmeyer gar nicht der ist, zu dem man ihn machen wollte. Dass er einfach der hochgewachsene, blassgesichtige Mann ist, der Hamborger-Olsen bei der Buchhaltung hilft und ihm im Laden zur Hand geht. Es ist nichts Merkwürdiges an Rosenmeyer Hansen.
Nein, Rosenmeyer ist nicht der Träumer und Wandersmann, von dem man gefabelt hat. Wenn man ihn gelegentlich nachts umherschlendern sieht, dann nur, weil er sich nicht dazu entschließen kann, nach Hause zu gehen. Manche meinen auch zu wissen, dass Rosenmeyer und Fräulein Eleonora nur deshalb bei Edwinsens und Hamborger-Olsens Sonntagsausflügen mit dabei sind, weil Edwinsen »seine Karnüffel auf Fräulein Eleonora geworfen hat«.
Es lernt und prägt sich nicht ganz leicht ein, dass es wirklich so jämmerlich mit Rosenmeyer bestellt ist. Dass Rosenmeyer mit den schweren Träumeraugen nur ein etwas schlaffer, leicht erkälteter Herr ist, der sich nie zu einem Entschluss durchringen kann, nicht einmal dazu, das auch nicht mehr ganz junge Fräulein Eleonora Lundegaard zu heiraten. (Der ruhmvolle Schauspielerinnenname Duse ist ja bloß ein munterer Beiname, der sich der Tatsache verdankt, dass Fräulein Lundegaard seinerzeit in einer Amateurvorstellung zugunsten der neuen Wasserversorgung als Astrid in Hostrups »Eine Nacht in den Bergen« reüssierte.)
Trotz alledem könnte Rosenmeyer ja gut ein Dichter sein, aber nicht einmal das ist er. Der Gedanke an eine Existenz als Dichter und Träumer ist ihm völlig fern und lachhaft. Das aus seinem eigenen Mund bekräftigt zu hören ist hart. Aber es ist die unbarmherzige Wirklichkeit. Am allerschlimmsten ist, dass er auch noch falsch singt. Es ist schaurig zu hören, wie er verkehrt in das Lied einfällt, wenn sich Fräulein Lundegaard an ihr altes tafelförmiges Klavier setzt und »Armes Herz, bist müde du« singt.
Das alles geht einem allmählich auf. Oder vielleicht hat man es im Grunde immer schon gewusst und bloß von sich weggeschoben wie etwas, das man absolut nicht brauchen konnte.
Nach und nach fügt es sich also so, dass man sich notgedrungen von Rosenmeyer trennen muss, diesem seltsamen, lieben, aber schimärischen Freund. Nicht dass man froh wäre, dass es diesen Lauf nimmt. Im Gegenteil, es ist mit Schmerz verbunden, ja kann in einer Art dumpfer Verzweiflung zum Ausdruck kommen, so wie in einem der letzten Rosenmeyer-und-Prop-Spiele, das Jan und ich spielten, einem Spiel, das wir »Das Ende der Welt« nannten. Das war im Herbst 1912.
Es handelt sich diesmal um ein seltsam seelenkrankes, von Trauer und Hoffnungslosigkeit geprägtes Spiel, in dem sich deutlich die kommenden Entwicklungsjahre mit ihren fatalen Klimaveränderungen und Krisen des Gemüts ankündigen.
Dieses Mal sind die beiden Freunde Rosenmeyer und Prop also zu nichts Geringerem als dem Ende der Welt unterwegs. Auf ihren müden Pferden kämpfen sie sich über steinige Bergpfade durch Sturm und Dunkelheit dem letzten Abgrundsrand entgegen, dort, wo die Welt aufhört und die stöbernde Leere der äußersten Finsternis beginnt.
Jan graust es, ihm ist beinahe zum Weinen. Er ist erst neun.
Was weiter? Nichts?
Nein, nichts.
Doch, vielleicht eine Kleinigkeit noch. Eine ganz unbedeutende Kleinigkeit. Aber doch etwas Merkwürdiges. Denn sieh nur, hier am äußersten Steilufer, wo es keine Hoffnung mehr gibt, zieht Rosenmeyer etwas aus seiner Manteltasche.
Eine kleine Schere, oder?
Ja, so kann man dieses Dings vielleicht nennen, das aus einem Stück gewundenen Metalldrahts von einem der damals üblichen Limonadenverschlüsse besteht, die damit an der Flaschenöffnung befestigt waren, so wie man es heute noch bei Champagnerflaschen sieht. Aus so einem Stück Stahldraht hat Rosenmeyer eine Schere oder Klemme geformt, und jetzt steht er hier am Ende der Welt und schneidet in die Leere hinein.
Einfach so?
Ja. Einfach so.
Ja, man könnte in Ohnmacht fallen vor Lachen, so komisch ist es. Entsetzlich ist es aber auch, ja schlechthin mit das Schaurigste, das man je gehört hat.
Und doch hat es immer noch Überreste heimlichen Wohlgefühls an sich …