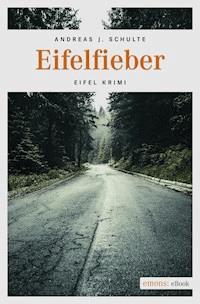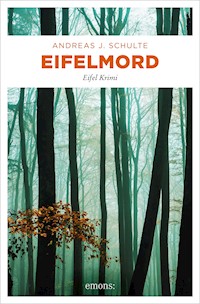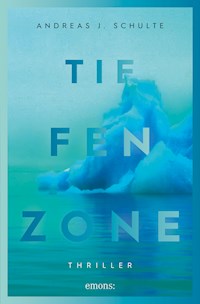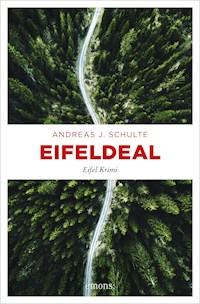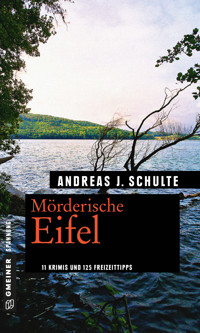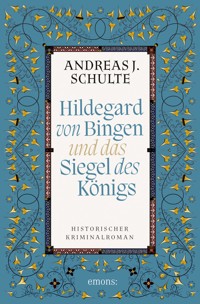
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Nominiert für den Literaturpreis Goldener HOMER 2024 – Krimispannung aus dem frühen Mittelalter: lebendig, facettenreich und bilderstark. Spätsommer 1151. Hildegard von Bingen reist ins Kloster Disibodenberg, um den Verhandlungen über die Thronfolge beizuwohnen. Begleitet wird sie von Elisabeth, einer jungen, gewitzten Novizin. Doch kurz nach ihrer Ankunft geschieht ein Mord. Ein Giftanschlag, ist sich Hildegard sicher. Sie versucht, mit ihren medizinischen Kenntnissen dem Täter auf die Spur zu kommen – bis sie selbst unter Mordverdacht gerät. Nun liegt es an Elisabeth: Kann sie die Unschuld ihrer Äbtissin beweisen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Die Handlung ist frei erfunden, wenngleich im historischen Umfeld eingebettet. Einige Personen, Ereignisse und Orte sind historisch, andere nicht. Darüber hinaus sind Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: finken & bumiller | buchgestaltung und grafikdesign unter Verwendung des Bildmotivs shutterstock/Yuliya Blonska
Lektorat: Lothar Strüh
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-012-9
Historischer Kriminalroman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literaturagentur Lesen&Hören, Berlin.
In Erinnerung an Edgar Noske (1957–
Wenn sie mehr Verstand hat, so soll sie den Anstand und die Weisheit besitzen, nicht zu zeigen, wie viel Verstand sie hat. Einfältigkeit steht den Damen gut an.
Prolog
Die steile Wendeltreppe führte hinab in den Keller. Mit jeder Stufe wurde die Luft kühler. Mit jeder Stufe stieg Gerowulfs Vorfreude. Der Keller war nach seinen Wünschen ausgebaut worden. Ursprünglich war dieser als Schutzraum für die Bewohner des Gutshofes gedacht gewesen, als Versteck für die Alten, die Weiber und Kinder, wenn feindliche Soldaten plündernd umherzogen und ganze Dörfer niederbrannten. Dieser Keller war damals ein Ort der Sicherheit gewesen. Jetzt verbreitete er Angst und Entsetzen.
Der hochgewachsene Mann erreichte das Ende der Treppe, schritt den langen Gang entlang, sein massiger Körper wurde im Schein der Fackeln als bizarrer Schatten auf die roh behauenen Wände geworfen.
Der Keller, einst eine natürliche Höhle, eine Laune der Natur, war von geschickten Baumeistern erweitert und ausgebaut worden. Sie hatten das Vorhandene als Grundlage genommen und etwas Neues geschaffen. Jetzt besaß der Raum eine hohe Decke, die von schweren Basaltpfeilern getragen wurde. Sie war gut drei Mann hoch, und obwohl seine schweren Schritte in dem Raum widerhallten, drang doch kein Laut aus diesem nach draußen. Keine Menschenseele konnte außerhalb des Gewölbekellers etwas von dem hören, was sich hier tief unter der Erde abspielte. Keine Schreie, kein Fluchen, kein Flehen drang nach außen. Deshalb hatte Gerowulf diesen Keller erwählt.
Auch der Mann, der an Ketten leblos zwischen den Pfeilern hing, hatte geschrien und um Gnade gefleht. Gerowulf blieb vor ihm stehen. Das da in den Ketten war nur noch ein lebloses Bündel Fleisch. Gerowulf sog den Atem tief ein. Schmeckte die Angst und die Schmerzen, die in der Luft lagen. Der Geruch des Blutes und des verbrannten Fleisches brachte ihn dazu, sich über die Lippen zu lecken.
Das Kohlebecken glühte noch, aber die schweren eisernen Zangen, die Geißeln und Brandeisen hatten offenbar ihre Schuldigkeit getan.
»Du warst also erfolgreich.«
Gerowulfs dunkle Stimme ließ Bernhard, den Folterknecht, herantreten.
»Ja, Herr, dieser hier war besonders standhaft, aber am Ende reden sie alle.«
»Gut, wo ist die Siegelplatte?«
Unsicherheit flackerte in Bernhards Augen, Unsicherheit und Angst.
»Siegelplatte? Da war keine Siegelplatte, Herr.«
Gerowulf fuhr herum, mit dem rechten Handrücken schlug er ansatzlos zu, hart, wütend. Bernhards Lippe platzte auf, aber er rührte sich nicht, nahm mit stoischer Miene hin, dass ihm Blut aus dem Mundwinkel lief. Gerowulf baute sich drohend vor dem anderen auf. »Ich rede von einer Bronzescheibe, eine Art Amulett, kleiner als die Handfläche eines Kindes. Du sagst, es war nicht bei den Habseligkeiten des Boten? Was hat dich dann dazu gebracht, mir die Nachricht zu senden, es sei vollbracht? Rede!«
»Da … da war etwas in den Satteltaschen des Boten, Herr. Ein Pergament, eingenäht zwischen zwei Lagen des Leders.« Bernhard deutete auf einen Holztisch. Im Schein der Fackeln war der Brief gut zu sehen.
Gerowulf ging mit zwei schnellen Schritten zum Tisch, nahm den Brief und hielt ihn ins Licht. Seine breiten Finger strichen fast zärtlich über das blutrote Wachssiegel. »Das persönliche Siegel des Schwaben«, murmelte er, »hat er sich also entschieden, den Kampf um die Krone aufzunehmen.«
»Ich versichere Euch, Herr, mehr hatte der Bote nicht bei sich, keine Siegelplatte, kein Amulett, nur diesen versteckten Brief.«
Gerowulf hob ungeduldig die Hand, die Geste ließ Bernhard verstummen.
»Es reicht. Sorg dafür, dass«, er deutete auf den Leblosen, »der Kerl verschwindet. Ich will nicht, dass seine Leiche für neugierige Fragen sorgt.«
»Ja, Herr, aber sein Pferd, der Sattel …?«
Gerowulf wusste, worauf Bernhard hinauswollte. »Nimm es als weiteren Lohn für deine Arbeit. Meinetwegen auch seine Kleider und Waffen, aber wenn du sie verkaufst, dann denke daran, was ich gesagt habe: Ich will keine neugierigen Fragen zu hören bekommen.«
»Danke, Herr, danke.«
Bernhard verbeugte sich unterwürfig, aber das sah Gerowulf schon nicht mehr, eilig strebte er der Wendetreppe zu. Der gesiegelte Brief des Schwaben bewies, dass es an der Zeit war zu handeln. Zu entscheiden, wie es weiterging, stand ihm nicht zu. Er, Gerowulf, Sohn des Bergen, diente einem höheren Herrn. Doch er wusste, dass er am Ende reich belohnt werden würde. Der Gedanke ließ ihn zufrieden lächeln.
Kommt einer neu und will das klösterliche Leben beginnen, werde ihm der Eintritt nicht leicht gewährt, sondern man richte sich nach dem Wort des Apostels: »Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind.«
Regula Benedicti
1
Die Nahe, Spätsommer Anno Domini 1151
Der Ruf des Steuermanns riss Elisabeth aus dem Schlaf. Das Boot hatte mit dem ersten Tageslicht im Morgengrauen abgelegt. Eingehüllt in ihren Wollmantel hatte sie sich auf ein Schaffell gesetzt und war, angelehnt an ein paar Getreidesäcke, eingenickt. Das stete Schaukeln des Bootes, die Flusswellen, die leise plätschernd gegen die Holzplanken schlugen, hatten sie schläfrig werden lassen.
»Obacht da vorne. Das Ufer ist steinig. Ich reiß euch die Ohren ab, wenn ihr mit euren Rudern dafür sorgt, dass dieses Boot aufsetzt.«
Statt einer Antwort erntete der Steuermann von den drei Ruderknechten nur ein lautes Lachen.
Elisabeth setzte sich auf und gähnte. Wenn sie den Hals reckte, konnte sie einen Blick über die Bordwand des Bootes werfen. Doch da war nichts zu sehen, der Flussnebel hüllte alles in ein milchiges, feuchtes Grau. Enttäuscht ließ sich Elisabeth zurücksinken. Sie war hundemüde und zugleich unfähig, wieder einzuschlafen.
Zu viert waren sie vor zwei Tagen aufgebrochen: Meister Ulrich, Verwalter und Waffenmeister der Burg Greich, Gerfried, einer der Knechte, ihr Bruder Adalbert und sie selbst.
Die erste Nacht hatten sie in einer Herberge verbracht, doch das laute Schnarchen aus allen Ecken des Hauses hatte sie ebenso wach gehalten wie die Gedanken an die ungewisse Zukunft. Nach einem weiteren Tag im Sattel hatten sie dann endlich den Fluss erreicht. Nach dem stundenlangen Ritt mussten sie sich mit einem harten Nachtlager am Flussufer zufriedengeben. Meister Ulrich hatte zwar ein Feuer angezündet, aber niemand war wach geblieben, um Holz nachzulegen und so die nächtliche Kühle zu vertreiben. Der August ging zu Ende.
Zu Hause, im geschützten Innenhof der Burg Greich, hatte sie oft in solchen Spätsommernächten in den Himmel geschaut und die Sternbilder gesucht, die ihr Pater Ansgar beschrieben hatte. Aber die zurückliegende Nacht an der Nahe war anders gewesen. Da bot kein Burgtor Schutz, da gab es keine Steinmauer, an die man sich anlehnen konnte, um die Sonnenwärme zu spüren, die die Steine über den Tag hinweg aufgenommen hatten. Am Fluss war es dunkel gewesen, außerhalb des Feuers hatten tiefe, fremde Schatten gelauert, unbekannte Tiere hatten sie mit ihren Schreien immer wieder aufgeschreckt, und die feuchte Luft am Ufer hatte sich klamm auf ihren Wollmantel und ihr Haar gelegt.
Müde und erschöpft hatten sie sich dann von Gerfried verabschiedet, der mit den Pferden zurück zur Burg reiten sollte. Der Lastkahn war im Morgengrauen wie verabredet rechtzeitig zur Stelle gewesen, um sie für die letzte Etappe auf dem Fluss mitzunehmen.
Ein leises Schmatzen ließ Elisabeth zur Seite schauen. Der Kopf ihres Bruders war zur Seite gesunken, den Mund im Schlaf halb geöffnet. Wie oft hatte sie Adalbert so schlafen gesehen? Sie schluckte trocken. Nie wieder würde sie ihn beim Schlafen beobachten können. Heute, hier und jetzt auf dem Lastkahn, war es das letzte Mal.
»Doch muss sie wissen, dass sie, auch nach dem Gesetz der Regel, von diesem Tag an weder das Kloster verlassen noch das Joch der Regel von ihrem Nacken abschütteln darf«, murmelte sie. Ja, sie kannte die Regula Benedicti, schließlich hatte sie genügend Zeit gehabt, sie zu studieren. Genügend Zeit, in der ihr Bruder Rudolf alles darangesetzt hatte, sie, Elisabeth, loszuwerden.
Wütend presste sie die Lippen aufeinander. Immer wenn sie an den Älteren dachte, begann es in ihr zu brodeln. Dass er im Recht war, machte die ganze Sache auch nicht besser. Für Adalbert, den Zweitältesten der Geschwister, war diese Reise ein einziges großes Abenteuer. Adalbert, der sich bemühte, mit seinem Bartflaum, den er beharrlich wachsen ließ, reifer als neunzehn Jahre auszusehen. Zum ersten Mal durfte er mit Meister Ulrich nach Mainz reisen. Es gab Verträge, die erfüllt werden mussten, Adalbert sollte die Familieninteressen wahren. Ihre eigene Reise würde früher enden – eine Reise, von der es für sie keine Rückkehr gäbe.
»Hoh, jetzt mehr in die Mitte, oder wollt ihr die Brücke rammen?« Wieder zerriss der Ruf des Steuermanns die Stille über dem Wasser.
Elisabeth sprang auf und lehnte sich über die Bordwand zur Seite, um möglichst nichts von dem zu verpassen, was da aus dem Nebel auftauchen mochte.
»Nicht so weit, Herrin, ich will Euch nicht aus dem Wasser der Nahe fischen müssen, nur weil Euch die Neugierde auf die steinerne Binger Brück gepackt hat.« Ohne dass Elisabeth es bemerkt hatte, war Meister Ulrich neben sie getreten und hatte seine Hand auf ihre Schulter gelegt.
»Die Binger Brück?«
»Ja, Herrin, sieben große Steinbögen quer über dem Fluss, eine Brücke, mehr als einhundertdreißig Männerschritte lang.« Meister Ulrich deutete mit der Hand von einem Ufer zum anderen. »Das ist der alte Handelsweg vom Hunsrück weiter nach Mainz. Die Brücke macht es möglich. Erbaut wurde sie bereits in der Zeit, als Willigis noch Bischof von Mainz war. Wenn Ihr mich fragt, ein Meisterwerk der Baukunst. Hab noch nirgendwo sonst eine solche Brücke gesehen. Da, schaut!«
Wie aus dem Nichts schälten sich mächtige Steinbögen aus dem Grau. Für einen Wimpernschlag war Elisabeth fest davon überzeugt, dass der Kahn an einem dieser Pfeiler zerschellen musste. Ihre Hand krampfte sich um die hölzerne Reling. Doch dann glitt der Kahn auch schon unter dem Brückenbogen hindurch. Die Binger Brück. Elisabeth schaute zurück und entspannte sich wieder.
»Die Männer auf diesem Kahn wissen, was sie tun, Herrin.« Meister Ulrich lachte leise auf. »Und der junge Herr hat die Durchfahrt verschlafen.« Meister Ulrich streckte sich und humpelte dann zurück zu seinem Bündel und den Satteltaschen. Auf dem Weg dorthin rüttelte er Adalbert an der Schulter, um ihn zu wecken. Während der langsam wach wurde, nahm Meister Ulrich die Taschen und warf sie sich über die Schulter. »Binger Brück, Ihr wisst, was das bedeutet?«
Elisabeth schloss für einen Moment die Augen und atmete dann tief durch, bevor sie nickte. »Ja, Meister Ulrich, ich bin am Ziel.«
2
Entschlossen klopfte Adalbert mit dem Griff seines Kurzschwertes gegen das Holz der Klosterpforte. Niemand öffnete, dabei hörte Elisabeth ganz deutlich das laute Hämmern auf Steinen, hörte Rufe und Stimmengewirr. Auf der anderen Seite der Klostermauer gab es Menschen, so viel stand fest. Adalbert musste ein zweites Mal gegen das Holztor schlagen, bevor sich im oberen Teil eine kleine Klappe öffnete. Misstrauisch blinzelte ihnen ein Auge entgegen.
»Wollt Ihr wohl aufhören, gegen die Klosterpforte zu hämmern, als stünde das Haus in Flammen? Was wollt Ihr?«
Die Stimme, die zu dem Auge gehörte, war tief und grollend und klang dabei, als würde die Person, zu der die Stimme gehörte, gerade ein paar Kiesel kauen. Elisabeth rechnete es Adalbert hoch an, dass er sich in keiner Weise von der Stimme beeindrucken ließ.
»Mein Name ist Adalbert, Sohn des Grafen von Greich, und neben mir steht Elisabeth, meine Schwester. Wir haben die Magistra Hildegard benachrichtigt, dass wir heute noch vor der Sext eintreffen werden.«
»Oh! Nun gut, Ihr seht mir doch einigermaßen vertrauenswürdig aus. Graf von Greich, sagtet Ihr. Gut, gut.«
Das Grollen war in ein nachdenkliches Gemurmel übergegangen. Elisabeth wechselte einen erstaunten Blick mit Adalbert. Zwei eiserne Riegel wurden zurückgeschoben, dann öffnete sich das Tor. Im ersten Moment schien es, als wäre niemand da, doch dann lugte hinter dem hölzernen Türflügel eine Nonne hervor. Eine wahrhaft winzige Person, die ungeduldig hin und her trippelte und die Ankömmlinge dabei neugierig musterte. Sie war so klein, dass Elisabeth sich unwillkürlich fragte, wie es das Nonnenauge bis zur Klappe im Tor geschafft hatte. Zusammen mit Adalbert trat sie ins Torhaus ein. Ein Blick über die Schulter offenbarte die Lösung des Rätsels. Als die Nonne das Tor schloss, wurden auf dessen Innenseite zwei hölzerne Trittstufen sichtbar.
Mit einer melodischen Altstimme, weit oberhalb der tiefen Tonlage bei der Begrüßung, sagte die Nonne: »Schwester Mathilde, ich bin verantwortlich für das Gästehaus und die Vorräte. Na ja, das mit dem Gästehaus wird wohl noch eine Zeit auf sich warten lassen. Also übernehme ich ab und an auch die Pforte.« Schwester Mathilde verbeugte sich vor Adalbert und blinzelte Elisabeth verschwörerisch zu. »Ihr müsst verzeihen, Herr, aber in den letzten Tagen gab es ein paar unverschämte Halunken, die unsere klösterliche Ruhe gestört haben. Da ist es ratsam, vorsichtig zu sein. Ihr seid bei unserer ehrwürdigen Mutter angemeldet, dann folgt mir.«
Gern hätte Elisabeth gefragt, wie es den »unverschämten Halunken« gelungen war, die Ruhe des Klosters zu stören, aber sie hielt es dann doch für ratsam, erst einmal zu schweigen. Außerdem öffnete sich jetzt der Gang des Torhauses zu einem weiten Platz, bei dessen Anblick Elisabeth schlagartig alle Fragen vergaß.
In den letzten Wochen hatte sie sich mehr als einmal das Kloster auf dem Rupertsberg vorgestellt, aber dieser Anblick übertraf all ihre Erwartungen. Der Klostergrund war groß, sehr groß, sicher annähernd zweihundert Schritte im Quadrat und damit um ein Vielfaches größer als der Innenhof der Burg Greich. Und überall – so schien es ihr – wurde gebaut. Es wimmelte nur so von Menschen. In einer Ecke brachten Steinmetze große Bruchsteine mit gezielten Hammerschlägen in die richtige Form, Maurergesellen trugen an langen Stangen große Holztröge mit Putz über eine Rampe in schwindelerregende Höhen. Zimmerleute schlugen mit Beilen in einem Tempo Holzbalken zurecht, dass die Späne nur so flogen. Dazwischen gab es Knechte, die Pferde mit Fuhrwerken voller Bretter und Steine, Schindeln und Säcke scheinbar planlos über den Platz lenkten. Planlos, wie Elisabeth im Stillen zugeben musste, nur für ihr ungeübtes Auge. Wahrscheinlich folgte hier alles einer wohldurchdachten Ordnung.
Inmitten dieses Treibens fielen ihr einzelne Nonnen in tiefschwarzem Habit auf, die zum Teil Anweisungen zu geben schienen, zum Teil aber auch tatkräftig mit anfassten.
»Ja, da staunt Ihr, nicht wahr? Seit ein paar Wochen ist der Knoten geplatzt. Jetzt kommen Handwerker von überallher, um unsere Magistra bei ihrem Vorhaben zu unterstützen«, sagte Schwester Mathilde nicht ohne Stolz. »Und verzeiht«, sie wechselte schlagartig in die tief grollende Tonlage, »die harsche Begrüßung. Ich weiß, der heilige Benedikt verlangt von uns, dass wir allen Gästen bei der Begrüßung und beim Abschied in tiefer Demut begegnen. Aber allen Ernstes, nachdem gestern Schwester Konstanze von einem aufdringlichen Reliquienhändler belästigt wurde, halte ich ein wenig Vorsicht durchaus für angeraten.« Schwester Mathilde schlug sich die Hand vor den Mund. »Herrje, ich rede und rede. Dabei fordert die Regel von uns, müßiges Geschwätz für immer zu verbannen.« Die Nonne seufzte tief. »Aber wir sind schließlich alle Sünder vor dem Herrn.« Sie schien keine Antwort zu erwarten, sondern eilte, schneller, als es Elisabeth bei einer so zierlichen Person für möglich gehalten hätte, über den Klosterhof, vorbei an den Handwerkern und Fuhrwerken.
»Schade, dass sich Meister Ulrich in Bingen um die Weiterfahrt nach Mainz kümmern muss, hier hätte er seine Freude gehabt. Unsere geschwätzige Brunhilde daheim ist ja nichts gegen diese Nonne«, sagte Adalbert. Und leise setzte er hinzu: »Aufgeregt, Schwesterherz?«
»Es … Es ist anders, als ich erwartet habe.«
»Bei Gott, da sagst du etwas Wahres. Komm, wir wollen Schwester Mathilde nicht warten lassen.«
Die Geschwister gingen schneller, um den Anschluss nicht zu verlieren, und folgten der Nonne über die große Baustelle.
In Richtung Süden des Klosterhofes stand eine kleine Kapelle. Daneben erstreckte sich ein lang gezogenes mehrstöckiges Gebäude und östlich davon ein zweites, noch längeres. Schwester Mathilde blieb so abrupt stehen, dass Elisabeth beinah in sie hineingelaufen wäre.
»Ich vermute mal, Ihr wünscht die Aufnahme als Novizin?« Die Nonne kniff bei ihrer Frage ein Auge zu und musterte Elisabeth von oben bis unten.
Die nickte, überrascht von der direkten Frage, lediglich stumm.
»Na, dann kann ich Euch auch gleich erklären, was wo steht. Viel ist es ja noch nicht. Dort drüben, das ist die Kapelle des heiligen Rupert, des Patrons dieses Berges. Dort beten wir. Weiß der Herr, wann unsere Abteikirche gebaut wird. Gleich daneben ist der Südflügel, das Refektorium, wo wir unsere Mahlzeiten einnehmen. Es folgen die Küche, darüber liegt das Skriptorium, und der Ostflügel mit Kapitelsaal, Lesesaal und dem Dormitorium. Ein großer Schlafsaal für alle – eine Verbesserung, das könnt Ihr mir glauben. Noch vor einem Jahr haben wir in Zelten geschlafen. Aber darüber will ich schweigen. Später wird unsere ehrwürdige Mutter natürlich einen eigenen Bereich besitzen, aber Ihr seht ja, es muss noch so vieles gebaut werden.«
Schwester Mathilde vollführte eine vage Handbewegung hinüber zu den gerade erst entstehenden Mauern des künftigen Westflügels. Mit einem Seufzen führte die Nonne die Geschwister zu dem östlichen Gebäude. Sie stiegen eine Holztreppe empor und folgten einem mit Sandsteinplatten ausgelegten Gang. Neugierig fragte sich Elisabeth, was sich wohl hinter all den verschlossenen Türen verbarg, da blieb Schwester Mathilde bereits vor einer stehen und klopfte an.
»Tretet ein«, tönte es von drinnen.
Plötzlich schlug Elisabeth das Herz bis zum Hals. Haltsuchend griff sie nach Adalberts Hand.
Der drückte sie aufmunternd und deutete mit einem kaum merklichen Nicken auf die Tür. »Du hast es gehört, Schwesterherz, geh du voran.«
3
Elisabeth hatte sich den Arbeitsraum der großen Hildegard, der Äbtissin des Klosters Rupertsberg, der weithin bekannten propheta teutonica, eindrucksvoller vorgestellt. Noch während sie den Raum betrat, huschten ihre Blicke über die Einrichtung. Unwillkürlich merkte sie sich Kleinigkeiten. Und wäre sie später gefragt worden, hätte sie ohne Zögern alles aufzählen können, was es dort zu sehen gab. Den Anblick mit allen Einzelheiten hätte sie sich immer wieder vor Augen rufen können. So war es schon immer gewesen.
Nun, diesen Raum zu beschreiben war kein großes Kunststück, denn er war nicht sonderlich groß und vollkommen schmucklos. Weder Wandteppiche noch Bilder sorgten für Farben, um dem Betrachter eine Abwechslung vom hellen Grau der Steine zu bieten. Ein schlichtes Kreuz aus dunklem Eichenholz hing an der Wand. Auf einem großen Tisch lagen ein aufgeschlagenes Buch – Elisabeth vermutete, dass es sich dabei um die Heilige Schrift handelte – und einige Wachstafeln. Hinter dem Tisch stand ein hoher Lehnstuhl ohne jegliches Polster oder Kissen. In einer Ecke des Raumes befand sich ein Lesepult, auf dem sich etliche Pergamente stapelten. Ein Tintenhorn sowie ein Tonbecher mit Federkielen deuteten darauf hin, dass an diesem Pult nicht nur gelesen, sondern auch geschrieben wurde.
Zur schmucklosen Ausstattung des Raumes passte die hagere, kaum mehr mittelgroße Nonne, die sich vom Lehnstuhl erhoben hatte und ihnen ein paar Schritte entgegengegangen war, um sie zu begrüßen.
Wie alt sie ist, schoss es Elisabeth durch den Kopf, sicher schon jenseits der fünfzig. Und Schmerzen hat sie, das Gehen fällt ihr schwer.
Das war also die Magistra Hildegard. Das schmale Gesicht, die tiefen Falten an den Augen … Man konnte sie beim besten Willen nicht als ansehnlich oder gar hübsch bezeichnen. Aber sie hatte Ausstrahlung, eine Ausstrahlung, die dem Gegenüber Respekt und Ehrerbietung abverlangte. Elisabeth spürte, wie ihr in ihrem Wollmantel zu heiß wurde. Am liebsten hätte sie sich umgedreht, um aus dem Raum zu flüchten. Doch dann trafen sich ihre Blicke. Die dunklen Augen der Äbtissin schienen direkt in ihre Seele zu schauen. Freundlich war ihr Ausdruck, voller Verständnis und liebevoller Hingabe. Plötzlich wurde Elisabeth ruhig und gelassen, die Anspannung fiel von ihr ab wie ein zu enges Gewand. Hildegard war eine Frau, die in sich ruhte, die ihre Stärken kannte. In der Miene der Älteren glaubte Elisabeth aber auch so etwas wie unsäglichen Kummer zu erkennen.
»Willkommen auf dem Rupertsberg«, sagte Hildegard. Ihre Stimme war leise, aber melodisch und voller Kraft.
Elisabeth hätte jeden Eid geschworen, dass es dieser Stimme mühelos gelänge, sich im Lärm der Baustelle durchzusetzen. Hildegard musste nicht laut sprechen, um sich Gehör zu verschaffen.
»Ihr seid pünktlich. Noch vor der Sext war Euer Kommen angekündigt, und es ist Euch und Eurer Schwester gelungen, Adalbert von Greich. Ich hoffe, Eure Reise verlief ohne Zwischenfälle?«
Adalbert verbeugte sich. »Habt Dank der Nachfrage. Es war eine Reise ohne große Strapazen. Ehrwürdige Mutter, darf ich Euch meine Schwester Elisabeth vorstellen, für die ich im Namen meiner Familie um Aufnahme in Eure Gemeinschaft bitte? Mein älterer Bruder Rudolf, der unserer Familie vorsteht, lässt Euch seine Grüße übermitteln. Seine Grüße und diese Mitgift.« Adalbert zog aus seiner Gürteltasche einen Lederbeutel und einen versiegelten Brief. Beides überreichte er mit einer weiteren Verbeugung.
Die Äbtissin nahm beides und schob es in eine verdeckte Tasche ihres Habits, bevor sie sich Elisabeth zuwandte. »Du bist also Elisabeth von Greich.«
Auf Elisabeth wirkt es so, als würde die Äbtissin den Namen wie alten Wein kurz auf der Zunge bewegen, um ihn besser auskosten zu können.
»Tatsächlich Elisabeth Brigitta Johanna von Greich«, murmelte Elisabeth ohne langes Nachdenken und biss sich sofort auf die Lippen. Noch während sie demutsvoll den Kopf beugte, nahm sie ein belustigtes Zucken in den Mundwinkeln der Äbtissin wahr, das aber genauso schnell verschwand, wie es gekommen war.
»Nun, künftig werden wir dich lediglich Elisabeth rufen. Die anderen Namen wirst du ablegen wie deine Kleidung und dein Hab und Gut, das du dort im Bündel trägst. Unsere Regeln verlangen eigentlich, dass wir dich erst später einkleiden, aber unser Habit ist auch ein Schutz.«
Elisabeth warf Adalbert einen erstaunten Blick zu, der als Antwort lediglich eine Augenbraue anhob. Da er es offenbar nicht für nötig hielt, nachzufragen oder etwas zu entgegnen, nickte sie schließlich stumm, um zu zeigen, dass sie verstanden hatte und zustimmte. »Die Regeln des heiligen Benedikt sind mir geläufig, ehrwürdige Mutter«, sagte sie.
»Sehr gut, das erspart uns eine Menge Arbeit. Ich müsste sonst eine Schwester damit beauftragen, dir die Regeln aufzusagen, damit sie dir im Gedächtnis bleiben, und derzeit gibt es noch so viel anderes zu tun. Leider haben wir noch kein Haus für unsere Novizinnen, und offen gestanden halte ich auch nichts davon, dich in den nächsten Tagen vor unserer Klosterpforte warten zu lassen, wie Benedikt es empfohlen hat.« Hildegard schaute Adalbert bedauernd an. »Im Moment fehlt es uns nicht nur an einem eigenen Wohnbereich für die Novizinnen, sondern vor allem auch an einem Gästehaus. Ich fürchte, ich kann Euch nicht angemessen bewirten und beherbergen.«
»Das wird auch nicht nötig sein, ehrwürdige Mutter. Ich treffe mich später mit dem Verwalter meiner Familie. Er wartet bereits in Bingen, und wir werden wohl noch heute auf einem Schiff weiter nach Mainz reisen.«
»So sei es. Ich lasse Euch nun kurz allein, um Schwester Maria zu rufen, die unsere junge Novizin neu einkleiden wird. Ihr könnt inzwischen Abschied von Eurer Schwester nehmen, Adalbert von Greich. Ich bin gleich zurück.«
Hildegard lächelte Elisabeth aufmunternd zu und verließ den Raum. »Ich bin gleich zurück.« Nur vier kurze Worte, aber sie nahmen Elisabeth eine ungeheure Last von den Schultern.
Wovor sie sich nämlich am meisten gefürchtet hatte, war ein langer, schmerzvoller Abschied von Adalbert. Der Moment, in dem sie endgültig die Brücken zu ihrem bisherigen Leben abbrach. Lange Beteuerungen, Tränen, ein paar Lügen, dass es allen leidtat, wie es gekommen war, womöglich der Entschluss, alles rückgängig zu machen.
»Ich bin gleich zurück« – das ließ kaum Raum für Wehmut, Zweifel und Ängste.
»Ich glaube, du wirst hier glücklich werden, Schwesterherz. Vergiss nie, dass du eine Familie hast, die dich liebt.«
»Abgesehen von Rudolf.«
Adalbert grinste schief. »Ach, ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Nein, ich glaube, Rudolf liebt dich auch, nur eben auf seine Weise.«
»Ja, ich weiß, Adalbert. Eigentlich weiß ich es. Richte allen meine Grüße aus. Sag ihnen, ich werde für sie beten. Ihr alle werdet stets in meinem Herzen sein.«
»Das werde ich ihnen sagen.«
Elisabeth trat zu ihrem Bruder, umarmte ihn und küsste ihn auf die Wange. Adalbert erwiderte die Umarmung. Sie spürte, wie er ihr etwas Kleines, Viereckiges in die Hand drückte. Elisabeth schloss die Finger darum und verbarg die Hand unter ihrem Mantel.
Adalbert trat zurück, räusperte sich und verneigte sich vor ihr. »Der Herr halte seine schützende Hand über dich, Elisabeth.« Er drehte sich um und verließ den Raum.
Augenblicke später kam Hildegard zurück. Sie muss vor der Tür gewartet haben, dachte Elisabeth.
»Dein Bruder scheint mir ein ernsthafter Mann zu sein.«
»Das ist er, ehrwürdige Mutter.« Mit ihrer freien Hand wischte sie sich kurz über die brennenden Augen. Sie wollte nicht weinen, nicht jetzt. Später vielleicht, aber nicht jetzt in Gegenwart der Äbtissin.
Hildegard legte ihr eine Hand auf den Arm. Eine Geste, die Verbundenheit und Trost zugleich bedeutete. »Ich weiß, dass der Gründer unseres Ordens seine ganz eigenen Ansichten darüber hegte, was mit denjenigen zu geschehen hat, die sich für unseren Weg entscheiden. Quod ei ex illa die non liceat egredi de monasterio.«
»Dass er von diesem Tage an das Kloster nicht mehr verlassen durfte«, übersetzte Elisabeth, ohne nachzudenken.
Hildegard stutzte kurz, ging aber nicht weiter auf Elisabeths Einwurf ein. »Glaube mir, wenn wir jede Verbindung zu unseren Familien abgebrochen hätten, wäre dieses Kloster nicht entstanden. Es wird kein leichter Weg sein, der vor dir liegt, Elisabeth, aber du gehst ihn mit Gottes Segen, dem Segen deiner Familie und in einer Gemeinschaft von Mitschwestern. Und dieser Weg wird sich auch immer wieder – so der Herr will – mit dem Weg deiner Familie kreuzen.«
»Habt Dank, Mater.«
»Und nun geh, draußen wartet bereits Schwester Maria. Die Glocke wird später zum Stundengebet rufen, danach setzen wir uns zusammen, um eine Mahlzeit einzunehmen. Ja, wir speisen hier alle gemeinsam, ich halte nichts davon, mich von meinen Mitschwestern abzusondern. Der Herr sei mit dir.«
Elisabeth verneigte sich und verließ die Äbtissin.
Draußen stand eine Nonne, vielleicht ein halbes Dutzend Jahre älter als sie, und begrüßte sie mit einem herzlichen Lächeln. »Willkommen, Elisabeth. Unsere Mater hat mir aufgetragen, dich einzukleiden. Folge mir, wir haben unsere Kleiderkammer im Vorratskeller unter der Küche.« Während sie gemeinsam die Treppe hinunterstiegen, fragte Schwester Maria mit einem prüfenden Seitenblick: »Und – hast du dir unsere Mater so vorgestellt?«
»Größer, ich hatte sie mir größer vorgestellt.« Elisabeth stockte kurz. »Größer … und weniger eindrucksvoll.«
4
Nachdenklich ging Hildegard zurück zu ihrem Tisch. Sie nahm den gesiegelten Brief aus ihrer Tasche, brach das Siegel und las mit Interesse, was Rudolf von Greich ihr über seine Schwester mitzuteilen hatte. Noch bemerkenswerter aber war das, worüber er nicht schrieb. Er erwähnte nichts von dem Selbstbewusstsein seiner Schwester, nichts von ihren Lateinkenntnissen.
Hildegard legte den Brief zur Seite und schaute in den Ledersack, der Elisabeths Habseligkeiten enthielt. Wie bei allen Nonnen würde dieser Sack sorgfältig aufbewahrt werden. Schließlich hatte schon der Ordensgründer verfügt, dass man einer Novizin, die sich am Ende ihres Noviziats gegen ein Leben im Konvent entschied, ihren persönlichen Besitz zurückzugeben hatte. Der Reisesack der letzten Novizin hatte noch Proviant enthalten, der erst Wochen später, als alles längst verdorben war, entdeckt wurde. Elisabeths Ledersack dagegen enthielt nichts Essbares, nur Kleidung und eine zusammenklappbare Wachstafel. Es war das erste Mal, dass sie bei einer Novizin eine solche Wachstafel fand. Sie schien Elisabeth so wichtig zu sein, dass sie sie griffbereit in ihrem Reisesack verstaut hatte. Nicht Schmuck, Untergewänder, andere Kleider, sondern die Wachstafel lag obenauf.
Elisabeth von Greich besitzt Lateinkenntnisse, und womöglich kann sie sogar mehr als nur ein paar Wörter und ihren Namen schreiben … interessant. Hildegard griff erneut zu dem Brief. Die Mitgift, die Rudolf von Greich erwähnte, war beträchtlich und der Stellung der Familie angemessen, aber Hildegard ließ sich von dieser Großzügigkeit nicht blenden. Sie ahnte den eigentlichen Grund für den Entschluss, die Schwester in die Obhut der Benediktinerinnen zu geben.
»Seid versichert, ehrwürdige Mutter, dass Elisabeth die besten Absichten hat, ein gottgefälliges Leben zu führen«, las Hildegard. »Allerdings steckt in ihr ein widerspenstiger Geist. Wir sind sicher, ein Leben unter Eurer Anleitung wird ihr helfen, sich davon zu lösen.«
Hildegard lehnte sich zurück und gestattete sich ein Lächeln. Ein widerspenstiger Geist. Dir, Rudolf von Greich, geht es nicht um das Seelenheil deiner dir anvertrauten Schwester, sondern um deinen eigenen Frieden. Und ich glaube nicht, dass sich dein Wunsch erfüllen wird.
Entschlossen faltete sie das Pergament zusammen und schob es zurück in ihre Tasche. Später würde sie den Brief in ihrer persönlichen Truhe aufheben, die in ihrer kleinen Schlafkammer stand. Sie nahm sich vor, den widerspenstigen Geist genau im Auge zu behalten.
5
Elisabeth folgte Schwester Maria durch den Staub der Baustelle. Insgeheim hoffte sie, Adalbert noch ein letztes Mal in der Ferne sehen zu können, aber ihr Bruder hatte das Kloster offenbar schon verlassen.
»Ach je, wir sollten uns beeilen«, sagte Maria. »Siehst du da drüben den Mönch?«
Neben ein paar Steinmetzen stand ein hochgewachsener Mönch und unterhielt sich mit einem der Handwerker. »Das ist Pater Volmar, unser Prior und Sekretär der Mater.«
Elisabeth musterte den Mönch neugierig. Das war also derjenige, der Hildegards Buch über ihre Visionen, das »Scivias«, letztlich zu Pergament gebracht hatte.
»Pater Volmar wird doch noch nicht auf dem Weg zur Kapelle sein? Sollte das Gebet zur sechsten Stunde schon anstehen, müssten wir das Ankleiden auf später verschieben.« Maria warf einen weiteren Blick in Richtung des Paters, der sich jetzt von dem Steinmetz mit Handschlag verabschiedete und dann dem südlichen Gebäude zustrebte.
»Oh gut, er geht noch ins Skriptorium. Es scheint, uns bleibt noch Zeit.« Maria lief zügig weiter. »Du weißt, welche Aufgabe Volmar hat?«, fragte sie Elisabeth, während sie eine steile Kellertreppe hinunterstiegen.
»Ja, er hat bereits im Kloster Disibodenberg die Visionen der ehrwürdigen Mutter niedergeschrieben.«
»Du weißt erstaunlich viel, Elisabeth. Ja, Pater Volmar steht der Mater in allen Belangen zur Seite. Das Buch ist abgeschlossen und vollendet.«
»›Scivias‹ ist vollendet? Ich hatte bislang nur von ersten Teilen gehört.«
Maria blieb überrascht stehen. »Himmel, sag jetzt nicht, du kennst die Visionen der Mater? Aber ja, um deine Frage zu beantworten, unsere Schwestern im Skriptorium haben vor ein paar Wochen eine vollständige Abschrift an den Heiligen Vater geschickt. ›Scivias‹ – ›Wisse die Wege‹ – ist nach zehn Jahren Arbeit fertig. Die Visionen unserer Äbtissin sind auf dem Weg nach Rom. Kann man sich so etwas vorstellen?«
Elisabeth konnte es nicht, schließlich war Papst Eugen im letzten Jahr aus der ewigen Stadt am Tiber vertrieben worden, aber sie schwieg vorsorglich.
»Wie hast du von dem Buch erfahren?«, fragte Maria.
»Pater Ansgar, mein … ähm … der Lehrer meiner Brüder hat davon gehört, als auf der Synode in Trier vor vier Jahren Papst Eugen die Sehergabe der ehrwürdigen Mutter offiziell anerkannt hat.«
»Das stimmt, ich war damals gerade das zweite Jahr in der Frauenklause des Disibodenbergs. Seitdem ist viel geschehen. Bei euch gab es also einen Lehrer. Mein Oheim, bei dem ich aufgewachsen bin, hat immer gesagt, Lesen und Schreiben seien die Wurzel des Übels beim Weib.« Die Nonne seufzte. »Komm, wir sollten uns sputen, sonst überrascht uns die Glocke zur Sext doch noch.«
Elisabeth folgte der Nonne in den Keller. Neben der Eingangstür brannten zwei Öllampen. Maria nahm beide Lampen von den Haken und drückte eine davon Elisabeth in die Hand. Zielstrebig durchschritt sie den Lagerraum. Elisabeth folgte langsamer, denn es gab viel zu bestaunen. Da waren zahlreiche Weinfässer in Holzgestellen an einer Wand. Mehlsäcke hingen an Ketten von der Decke, um sie vor gefräßigen Mäusen zu schützen. Drei große Käselaibe lagen in einem Holzregal. Etwas weiter baumelten getrocknete Kräuter, zu Sträußen gebunden, wie Wäsche an einer langen Leine. Die Kräuter verströmten einen würzigen Duft.
Maria deutete auf die Kräutersträuße. »Allzu starkes Sonnenlicht lässt die Kräuter schwach werden, sagt Schwester Gertrudis. Dieser Keller ist ihr Versuch, dem entgegenzuwirken. Komm hierhin, wir sind am Ziel.«
Am Ende des Lagerraums war in der Wand eine weitere kleine Holztür eingelassen. Elisabeth musste den Kopf einziehen, als sie durch die Tür ging. In der Kammer standen große Holztruhen. Maria stellte ihre Öllampe auf einen kleinen Steinabsatz, um die Hände frei zu haben. »Stell dein Licht dorthin, Elisabeth, dann können wir besser sehen.« Sie öffnete einen Deckel. »Dann wollen wir mal sehen, dass wir das Passende finden.«
Sauber zusammengefaltet lagen Gewänder aus dunklem Wollstoff in der Truhe.
»Ihr habt große Vorräte an Kleidung«, sagte Elisabeth.
Maria zog ein Untergewand aus der Truhe und hielt es in die Luft. »Nein, der Grund für die vielen Gewänder ist nicht eine vorausschauende Vorratshaltung. Seit wir im letzten Jahr Disibodenberg verlassen haben, sind sechs, nein sogar sieben Schwestern gegangen. Sie ertrugen die Strapazen und die Unannehmlichkeiten eines Klosters im Aufbau nicht. Das hier gehörte, glaube ich, Richardis, sie hatte deine Größe.«
»Richardis?«
Maria winkte verlegen ab. »Verrate bloß niemandem, dass ich dir davon erzählt habe. Richardis … Nun, sie verließ uns aus anderen Gründen. Es war eine unerfreuliche Sache, ein schwerer Schlag für die Mater. Wie auch immer, zieh dich aus. Wir werden deine Kleider waschen und sorgfältig aufheben, nur für den Fall, dass du nach der Ausbildung unser Kloster doch wieder verlassen möchtest.«
Als Elisabeth ihren Mantel ablegte, stieß Maria den Atem zwischen den Zähnen aus. Es klang, als würde eine Tonflasche mit gärendem Met zu schnell geöffnet.
»Du meine Güte, kein Wunder, dass die Mater möchte, dass du so schnell wie möglich den Habit trägst.«
Elisabeth schaute verständnislos an sich herab. War etwas falsch an ihrem nachtblauen Kleid und dem weißen Untergewand mit der Spitze? Hildegards Worte von vorhin kamen ihr wieder in den Sinn: »Unsere Regeln verlangen eigentlich, dass wir dich erst später einkleiden, aber unser Habit ist auch ein Schutz.«
Maria sah ihr ratloses Gesicht und verdrehte die Augen. »Du weißt schon, welchen Eindruck deine Gestalt auf Männer macht?«
Ja, das weiß ich, dachte Elisabeth verbittert. Das weiß ich nur zu gut. In den letzten zwei Jahren war ihr Körper üppiger geworden, zumindest an einigen Stellen. Ihre langen braunen Haare umrahmten ihr schmales Gesicht, nur ihre Nase fand sie immer ein wenig zu groß und zu spitz, zumindest wenn sie sich im Wasser der Waschschüssel oder im fein polierten Bronzespiegel der Mutter betrachtet hatte. Kind, du wirst einen Mann bezaubern, hatte die Mutter in den letzten Monaten mehr als einmal gesagt, bevor alles anders kam.
»Ja, bei dir ist der Habit auch ein Schutz«, sagte Maria, die nichts von Elisabeths innerem Aufruhr mitbekommen hatte.
»Ein Schutz?«
»Na, hör mal. Da draußen auf dem Klostergrund sind wir seit Wochen nicht mehr unter uns. Da draußen sind Männer, und damit meine ich nicht unseren ehrbaren Prior. Ein paar von denen können es gar nicht fassen, dass wir die Bräute Christi sind, da sind ein Habit und ein Schleier eine gute Erinnerung und eine stete Mahnung, dass wir für … na, was auch immer, nicht zur Verfügung stehen. Wir sind Nonnen und keine Schankmägde.«
Elisabeth ersparte sich eine Antwort. Was hätte sie auch entgegnen sollen? Dass es Männer gab, die sich auch von dem Habit einer Nonne nicht abhalten lassen würden, zu tun, wonach ihnen der Sinn stand? Dass manche Männer sich einen Dreck um Kleidung, Anstand und Ansehen scherten? Rasch zog sie sich fertig aus, nahm von Maria ein neues Untergewand entgegen, dazu Schulterkleid, Gürtel und Sandalen für die nackten Füße. Zum Schluss legte sie den weißen Schleier einer Novizin an.
Maria musterte sie und war offensichtlich zufrieden mit dem, was sie sah. »Sehr gut. Einen zweiten Satz Gewänder und eine Arbeitsschürze für den Nachmittag werde ich dir später besorgen. Und natürlich feste Schuhe, schließlich werden auch wieder kältere Tage kommen.«
Von draußen ertönte laut eine einzelne Glocke.
»Die Sext! Rasch, beeil dich. Das Gebet wartet auf uns«, drängte Maria, die eilig die Truhen verschloss. Elisabeth legte ihre alten Kleider sorgfältig auf den Deckel einer Truhe, dabei gelang es ihr, Adalberts Geschenk heimlich unter ihrem Mantel hervorzuziehen und, von Maria unbemerkt, in der Tasche ihres Schulterkleids zu verbergen. Fast hatte es den Anschein, als würde die Glocke draußen noch drängender läuten. Die beiden Frauen nahmen ihre Lampen und eilten aus dem Keller.
Neben der Kapelle läutete eine stämmige, wohlgenährte Nonne mit ernster Miene die Messingglocke, die an einem Holzgestell neben dem Eingang hing. Aus allen Himmelsrichtungen strebten Ordensfrauen der Kapelle zu.
Elisabeth folgte Maria, die, seitdem sie sich in Hörweite der Mitschwestern befanden, vollkommen verstummt war. Sie tat es Maria gleich, senkte ergeben den Kopf und betrat schweigend mit den anderen die kleine Kapelle. Als die ersten Psalmen gesungen wurden, begann ihr Magen zu knurren, so laut und vernehmlich, dass sie schon befürchtete, ihre Nachbarinnen würden es auch hören. Doch falls dem so war, ließen sie es sich nicht anmerken. Zum Glück dauerte das Stundengebet zur Sext nicht lange, und danach sollte es Essen geben. Sie hatte vor lauter Aufregung am Morgen nur einen Kanten Brot gegessen. Hoffentlich würde es mehr geben als nur eine dünne Mehlsuppe.
6
Im großen Schlafsaal der Nonnen lag Elisabeth hellwach auf ihrem Bett und überdachte den zurückliegenden Tag. Kaum eine Nonne in diesem Saal schlief völlig lautlos. Schweres Atmen, Schnarchen, ein Seufzen, gemurmelte unverständliche Worte und dazu die Geräusche der Nacht, die man durchs Fenster zu hören bekam. Elisabeth starrte mit weit aufgerissenen Augen an die hohe Decke des Saals, auf der das einsame Öllicht neben der Eingangstür flackernde Schatten warf. Die Müdigkeit des langen Tages brannte in ihren Augen, und trotzdem gelang es ihr nicht, zur Ruhe zu kommen.
Dieses Kloster war etwas Besonderes, so viel stand für sie fest. Allein der Schlafsaal. Es gab keine einfachen Strohsäcke auf dem nackten Fußboden, sondern hölzerne Bettgestelle mit richtigen Strohmatratzen, Kissen und Decken. Dabei würde der Fußboden, zumindest im Winter, angenehm warm sein, denn Hildegard hatte für das Gebäude ein Hypokaustum erdacht. Warme Luft strömte durch Röhren und Kanäle, erwärmte die Böden und Wände.
War das zu glauben? Elisabeth hatte davon bislang nur in Pater Ansgars Erzählungen aus dem alten Rom gehört. Hildegard war offenbar eine Frau, die sich in einem Alter, in dem vielen anderen nur noch wenig Lebenszeit beschieden war, nicht davon abhalten ließ, etwas Neues zu erschaffen. Ganz so, als wäre sie gerade erst zwanzig. Elisabeth konnte über den großen Plan Hildegards nur staunen.
Nach dem Mittagessen, einer kräftigen Linsensuppe, gesalzenen Heringen und grobem Roggenbrot, hatte ihr Schwester Clementia die Räume und den Klostergrund gezeigt. Clementia, die stämmige Nonne, die mit ernster Miene die Glocke zum Gebet geläutet hatte, entpuppte sich dabei als so gar nicht ernst und streng. Geduldig hatte sie Elisabeths Fragen beantwortet. Clementia gehörte zu den ältesten Nonnen des Klosters und war – wie Elisabeth nach dem Abendessen von Maria erfahren hatte – tatsächlich die leibliche Schwester der Äbtissin.