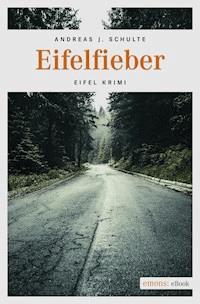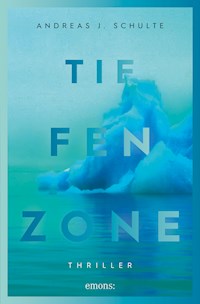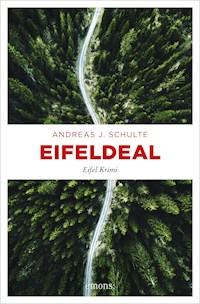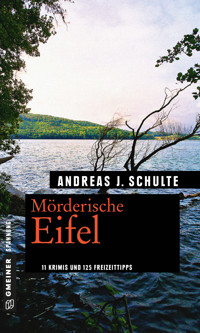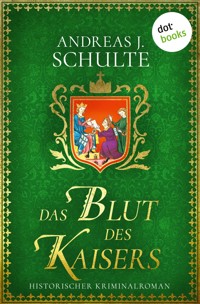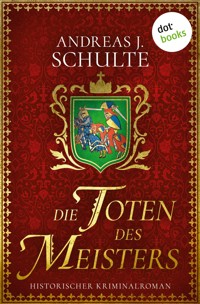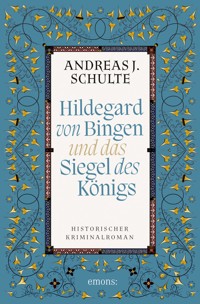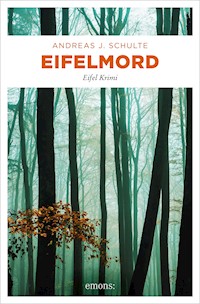
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Eifel Krimi
- Sprache: Deutsch
Der härteste Ermittler der Eifel Als in einem explodierten Wohnwagen die Leiche eines seit Langem Vermissten entdeckt wird, ruft das den ehemaligen Militärpolizisten und NATO-Sonderermittler Paul David auf den Plan. Bei seinen Recherchen stößt er auf den ersten Korruptions- und Rüstungsskandal der damals noch jungen Bundesrepublik und erkennt, dass diese Staatsaffäre lange Schatten wirft. Denn auch nach Jahrzehnten sind einige Menschen noch bereit, für Millionen über Leichen zu gehen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas J. Schulte, Schriftsteller, Jahrgang 1965, verheiratet, zwei Söhne, ist geboren und aufgewachsen in Gelsenkirchen und lebt heute mit seiner Familie in der Nähe von Andernach. Neben seinen Krimis und Thrillern schreibt und veröffentlicht er auch Kurzgeschichten und historische Kriminalromane.
www.andreasjschulte.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: dioxin/photocase.de
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Lothar Strüh
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-610-4
Eifel Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die
Literaturagentur Lesen&Hören, Berlin.
Natürlich achte ich das Recht. Aber auch mit dem Recht darf man nicht so pingelig sein.
Prolog
19. April 1956, Bonn am Rhein
Willy Klockner war es gewohnt zu warten. Seit fast sieben Jahren chauffierte er den Chef. Tag für Tag, ohne Ausnahme. Nicht ein einziges Mal war Klockner in diesen Jahren krank gewesen, er war stolz darauf. Und es gab noch etwas, worauf er stolz war: Er hatte gelernt wegzuhören. Egal, ob der Chef bei der Durchsicht eines Aktenordners etwas vor sich hin murmelte oder er einen Gast mitfahren ließ – was auf dem Rücksitz des Mercedes 300 gesprochen wurde, interessierte Klockner nicht. Natürlich hörte er zu, und natürlich machte er sich auch seine eigenen Gedanken, aber er hatte sich vorgenommen, zu schweigen. Für ihn war das eine Frage der Ehre. Er konnte sich nicht daran erinnern, wann der Chef das letzte Mal die Trennscheibe in der Limousine hochgekurbelt hatte. Umso erstaunter war er darüber, dass heute alles anders war.
Es begann schon damit, dass er in seinem Dienstzimmer angerufen wurde und man ihm mitteilte, dass der Kanzler heute früher zurück nach Rhöndorf fahren wolle. Außerdem würden noch zwei Herren mitfahren. Klockner solle die beiden in der Godesberger Rheinallee abholen und zum Bundeskanzleramt bringen, dort würde dann der Kanzler zusteigen. Es war eigentlich nicht seine Aufgabe, irgendwelche Taxidienste zu übernehmen, aber er wollte sich auch nicht einem Wunsch von oben widersetzen.
Die beiden Gäste hätten nicht unterschiedlicher sein können: der jüngere klein, korpulent und nervös, der ältere groß, hager, beinahe ausgemergelt – und sehr ruhig. Sie stiegen wortlos hinten ein. Während der Fahrt von Bad Godesberg zum Bundeskanzleramt flüsterte der kleine Dicke seinem Begleiter etwas zu, doch der schüttelte nur stumm den Kopf. Willy Klockner stieg aus und meldete am Eingang sein Eintreffen. Keine fünf Minuten später kam der Chef aus dem Gebäude, wie jeden Tag hatte er auch diesmal wieder Akten unter dem Arm. Klockner öffnete die hintere Tür der Limousine und deutete eine Verbeugung an. Er schloss die Tür, ging um das Fahrzeug herum, stieg selbst ein und startete den Motor.
»Nun, meine Herren, ich hoffe, Sie haben gute Nachrichten.«
Im Rückspiegel konnte Klockner beobachten, wie der kleine Dicke heftig nickte. »Alles ist geregelt. Was jetzt noch fehlt, ist die Bestätigung der Serienreife.«
Die Stimme des Bundeskanzlers gewann an Schärfe: »Was jetzt fehlt, meine Herren, ist etwas, das nicht aussieht wie eine Seifenkiste. Verlangen Sie wirklich, dass wir diesen Witz aus Pappe und Sperrholz akzeptieren?«
Zum ersten Mal schaltete sich der Hagere ein, seine Stimme klang heiser, fast, als könne er gar nicht laut sprechen. Willy Klockner hatte schon früher Männer kennengelernt, die so sprachen. Männer, denen im Krieg das Gas die Stimmbänder verätzt hatte.
»Man wird großzügig sein, sehr großzügig.«
»Schon das Amt Blank konnte sich keine Großzügigkeit leisten, und jetzt, wo wir endlich erreicht haben, was wir wollten, werden wir nicht damit beginnen, uns zur Witzfigur zu machen.«
Der Kanzler sagte das, als würde er über eine Einladung zum Tee plaudern, trotzdem zuckte der Hagere zusammen, als sei er gerade geschlagen worden. Aber er fing sich rasch. »Sie sollten sich trotzdem das Angebot anhören.«
»Also gut. Ich höre.«
Klockner sah im Rückspiegel, wie die beiden Männer nervöse Blicke tauschten, dann deutete der Hagere mit einer verstohlenen Handbewegung nach vorne. In diesem Augenblick rutschte sein Jackett zur Seite. Der Mann trug eine Pistole im Schulterholster. Bei Klockner, dem ausgebildeten Polizisten, schrillten sämtliche Alarmglocken, aber der Chef blieb die Ruhe in Person.
»Machen Sie sich mal um meinen Fahrer keine Sorgen.«
»Wir machen uns keine Sorgen um Ihren Fahrer, Herr Bundeskanzler, wir machen uns Sorgen um die Zukunft dieses Landes. Darüber, was passiert, wenn alles schiefgeht oder es dem Feind zu Ohren kommt.«
»Wie ich bereits sagte: Ich höre.«
»Wir reden von verschiedenen Beträgen und von einer Einzelzahlung. Eine Zahlung in Höhe von fünfzig Millionen D-Mark.«
Und dann geschah das, was Willy Klockner nicht für möglich gehalten hätte. Konrad Adenauer kurbelte die Trennscheibe des Mercedes 300 nach oben.
Mehr als sechs Jahrzehnte später
Ein Apartment in Kaiserslautern
»Komm schon, Schwesterherz, ich brauch das Geld auch gar nicht lange. In spätestens einer Woche hast du die Kohle wieder. Ich kann doch nichts dafür, dass die Bank Probleme mit meiner EC-Karte hat. Die haben mir fest versprochen, das ganz schnell zu lösen. Aber die Fachhochschule macht Stress, weil ich die Semestergebühren noch nicht überwiesen habe, wir sollen die Bücher direkt kaufen und die Exkursion im Voraus bezahlen. Habe ich alles schon mit meinem Bankberater geklärt.«
»Wie viel, Ben?« Linda Becking schaute ihren jüngeren Bruder prüfend an, suchte in seinem Gesicht nach Anzeichen einer Lüge. Im Geschichtenerzählen war Ben unübertroffen. Doch sein Gesicht war diesmal der Inbegriff von Unschuld.
»Hör mal, ich will dich nicht linken oder so. Mit wem soll ich sonst über solche Sachen sprechen? Glaubst du mir nicht?«
»Ben, sag mir einfach, wie viel.« Linda schaute aus ihrem Wohnzimmerfenster. Sie hasste sich dafür, dass sie überhaupt Zweifel hatte, aber Ben hatte zu oft ihr Vertrauen missbraucht. Auf der anderen Seite war er ihr Bruder, neben ihrem Dad der einzige Mensch, den sie in Deutschland hatte. Nach dem Unfall der Eltern hatte sie sich um Ben gekümmert. Um einen neunzehnjährigen Ben, der nicht genau wusste, was er machen wollte. Und um ihren Vater.
Am Anfang war alles glattgelaufen, Ben und sie waren ein gutes Team. Sie konnten sich blind aufeinander verlassen in diesem fremden Land, das sie nur von gelegentlichen Besuchen bei den Großeltern und aus Erzählungen kannten. Der Bruch war vor etwas mehr als einem Jahr gekommen.
Neben seinem Studium hatte Ben sich mit einem Freund selbstständig gemacht und ein kleines Start-up-Unternehmen gegründet – sozusagen eine Garagenfirma, aus der ein Weltkonzern werden sollte. Die Voraussetzungen dafür waren gar nicht schlecht gewesen. Ben war ein brillanter Informatiker, ein kluger Kopf, der bei Geschäftsverhandlungen überzeugen konnte, wenn er wollte. Wenn er wollte. Das ist der Knackpunkt, dachte Linda. Ganz häufig wollte Ben nicht. Das Geld, das Linda als Startkapital zugeschossen hatte, würde sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Es kam irgendwann, wie es kommen musste, Linda stellte Ben zur Rede. Sie bestand darauf, zumindest einen Teil des Geldes wie vereinbart wieder zurückzubekommen. Immerhin waren es ihre Ersparnisse. Ben hatte sie damals geldgierig genannt, hatte ihr vorgeworfen, dass sie kein Vertrauen in ihn setzen würde. Und sie, sie hatte sich nicht getraut, klare Grenzen zu ziehen. Danach war nichts mehr wie vorher gewesen. Danach begannen die kleinen Lügen, die Ausflüchte, das Hinhalten.
Aber verdammt, er ist immer noch mein kleiner Bruder. Linda verzog das Gesicht.
»Hey, Linda, es ist auch wirklich nicht viel: fünfhundert Euro, nicht mehr. Am Ende des Monats bekomme ich die nächste Entnahme aus der Firma. Und dann kann ich dir die fünfhundert zurückzahlen, meinetwegen sogar mit Zinsen.«
Linda schüttelte alle Gedanken an die Vergangenheit ab. Es war ganz einfach: Entweder sie vertraute ihm, dann konnte sie ihm auch die fünfhundert Euro geben, oder sie weigerte sich. Einfache Entscheidung. Zugeben, dass sie ihrem eigenen Bruder nicht mehr über den Weg traute? Nein, sagte sich Linda, so weit bin ich noch nicht. So weit will ich auch nie kommen.
»Okay, Ben, schreib mir deine Bankverbindung auf, dann überweise ich dir das Geld.«
»Cool, danke, Linda. Aber wie ich schon sagte, mit meiner EC-Karte gibt es Probleme, also kann ich das Geld dann nicht von meinem Konto abheben. Wir machen das anders. Komm, lass uns was trinken gehen, dann sind wir sowieso in der Stadt, und am Bahnhof gibt es doch einen Geldautomaten, dann könntest du mir das Geld direkt in bar geben.«
Linda Becking seufzte. Aber gesagt war gesagt, sie würde jetzt keinen Rückzieher machen. »Also gut, wir gehen was trinken, und ich hebe das Geld ab. Aber es sollte nicht zu spät werden, ich muss morgen um sieben zum Dienst.«
»Yes, Ma’am, Special Agent, Ma’am.« Ben schlug die Hacken zusammen und salutierte grinsend.
»Hör schon auf, du blöder Kerl«, sagte Linda lachend. Ben küsste sie auf die Wange und strich sich dann lässig die schwarzen Haare aus der Stirn.
»Danke, Linda.«
Das fühlte sich an wie früher. Linda nahm sich vor, sich öfter an dieses Gefühl zu erinnern.
Rechtsanwaltskanzlei Dremel
»Was soll ich sagen, Herr David, das hier ist nicht das, was ich erwartet habe. Ich hatte mir davon … ähm, mehr versprochen.«
Das glaube ich dir aufs Wort, dachte ich bei mir und sagte laut: »Nun, Frau Dr. Dremel, Sie haben die Fotos. Ich werde Ihnen in den nächsten Tagen meine Rechnung schicken.« Ich schob den Besucherstuhl zurück und nahm meine Tasche vom Boden hoch, aus der ich die Fotoabzüge geholt hatte. Diese lagen jetzt auf dem Schreibtisch der Anwältin.
»Moment, Moment, Herr David, nicht so schnell. Meine Mandantin hatte den Verdacht, dass ihr Mann eine Affäre hat, und jetzt präsentieren Sie mir Fotos, in denen dieser Mann mit einer jungen Frau Arm in Arm am Deutschen Eck am Koblenzer Rheinufer steht. Da muss es doch noch mehr Aufnahmen gegeben haben.«
Ich hatte gehofft, schnell aus diesem Büro verschwinden zu können. Der Auftrag stank zum Himmel, und ich hatte keine Lust, Teil der Spielchen von Frau Dr. Dremel zu sein. Tatsächlich war ich mir nicht mal sicher, ob ich ihr eine Rechnung schicken würde.
»Sehen Sie, Herr David, meine Kanzlei hat gute, sehr gute Kontakte hier in der Region. Ich habe finanzkräftige Mandanten in Bonn und Köln. Es wäre durchaus vorstellbar, dass ein privater Ermittler von diesen Kontakten profitieren könnte.«
Susanne Dremel, die mir schon bei unserer ersten Begegnung erklärt hatte, dass sie zu den erfolgreichsten Anwältinnen am Mittelrhein zählte, legte die perfekt manikürten Hände zusammen. Dezente Goldkette am Handgelenk, ein kleiner Diamant am Finger. Das Alter blieb irgendwo tief unter den Make-up-Schichten verborgen. Älter als fünfundvierzig, jünger als sechzig.
»Damit es keine Missverständnisse gibt, Frau Dr. Dremel: Ich verzichte auf weitere Aufträge von Ihnen oder von Mandanten, die Sie vertreten.«
Dr. Dremel zuckte zurück, als hätte ich gerade auf ihren Schreibtisch gespuckt. »Wie können Sie es wagen –«
»Es gibt keine Mandantin und keinen Verdacht auf eine Affäre. Dieser Mann dort, Eduard Köhler, lebt seit vielen Jahren getrennt von seiner Frau.«
»Bezichtigen Sie mich etwa der Lüge?«
»Genau das, Frau Doktor. Ich habe mich gefragt, warum Sie einen Ermittler mit Falschinformationen füttern und auf einen Mann ansetzen. War nicht schwer, herauszubekommen. Man muss sich nur fragen, wer ein Interesse daran hat, Eduard Köhler mit Dreck zu bewerfen.«
»Das muss ich mir nicht länger anhören. Bitte verlassen Sie mein Büro, Herr David.«
»Ich schlage vor, ich verzichte auf ein Honorar, als Gegenleistung hören Sie sich den Rest an. Dann wissen Sie auch, warum Sie mich nie mehr anrufen müssen. Was halten Sie von diesem Deal?«
Dr. Dremel presste wütend die Lippen zusammen, ich beschloss, das als ein Ja zu deuten.
»Der schärfste Konkurrent von Köhler als Immobilieninvestor ist Stefan Bauer. Übrigens der Stefan Bauer, mit dem Sie auf diversen Fotos Arm in Arm im Internet zu sehen sind, Frau Doktor. Ich empfehle Ihnen dringend: Wenn Sie eine Verbindung geheim halten wollen, sollten Sie keine Facebook-Postings veröffentlichen. Dieser Ratschlag ist übrigens kostenlos, geht sozusagen aufs Haus. Also ist klar, es gibt hier als Auftraggeber keine Frau, die eine Affäre vermutet, sondern einen Geschäftsmann, der gerne ein paar indiskrete Fotos von seinem Konkurrenten hätte. Vielleicht haben Sie ja einen Tipp erhalten, dass sich Köhler öfter mit einer jungen Frau trifft, und Sie witterten Morgenluft.« Ich deutete auf die Fotos. »Machen Sie sich wegen der Dame keine Hoffnung, das ist Tina, Köhlers erwachsene Tochter. Ich fürchte, die Fotos werden für Ihren Freund Bauer keine Munition sein, um Köhler unter Druck zu setzen. Guten Tag, Frau Dr. Dremel.«
Ich wartete keine Antwort ab, nahm meine Tasche und ließ das Büro samt fassungsloser Anwältin hinter mir. Während ich draußen auf dem Parkplatz zu meinem Auto ging, dankte ich im Stillen meinem Freund Steffen, der für mich Frau Dr. Dremel und Eduard Köhler durchleuchtet hatte. Was Steffen im Netz nicht fand, gab es nicht, so viel stand fest.
Ich hatte mich bei diesem Auftrag vor einen Wagen spannen lassen, den ich nicht zu ziehen bereit war.
»He, David, warten Sie!«
Ich schaute über die Schulter zurück und seufzte leise. Der Assistent von Frau Dr. Dremel steuerte auf mich zu. Der Knabe war noch keine dreißig, kompakt und kräftig. Seine ganze Körperhaltung strahlte Selbstbewusstsein aus. Solche Typen kannte ich, die hielten sich, weil sie selten Gegenwind bekamen, für die Krone der Schöpfung. Der Mann war offenbar für die Doppelrolle als Assistent und Bodyguard engagiert worden. Der grimmige Gesichtsausdruck ließ erahnen, was jetzt kam. Akt zwei im Schmierentheater. Frau Doktor wollte sichergehen, dass ich ausreichend eingeschüchtert wurde, um nicht auszuplaudern, welche Spielchen sie trieb.
»Hören Sie, David«, begann der Knabe und kam drohend näher, »ich soll Ihnen ausrichten, dass das, was Sie sich da zusammengedichtet haben, Blödsinn ist.« Er stieß mir mit der flachen Hand vor die Brust. »Sollten Sie das weitererzählen, könnte es ziemlich unangenehm für Sie werden.« Mit einem zweiten Stoß wollte er wohl unterstreichen, wie unangenehm es werden könnte. Ich griff zu, packte sein Handgelenk, machte einen schnellen Schritt zur Seite und drehte seinen Arm nach hinten. Die Folge davon: Mr. Assistent musste sich nach vorne beugen und knallte unsanft mit der Stirn gegen den Türrahmen meines Pick-ups. Ich bog den Arm noch ein Stückchen höher. Nur so zur Sicherheit, damit ich seine ungeteilte Aufmerksamkeit hatte.
»Es könnte unangenehm werden, ja? Dann hören Sie mir mal gut zu. Punkt eins: Wem ich was erzähle, entscheide ich. Punkt zwei: Immer schön achtgeben, wen man versucht herumzuschubsen. Haben Sie das verstanden?«
So wie Mr. Assistent da vorgebeugt stand, war er wohl nicht so richtig gewillt, länger zu plaudern.
»Beim nächsten Mal, wenn Sie mir drohen, werde ich Ihnen zeigen, was ich unter unangenehm verstehe. Alles klar?«
Ein Stöhnen als Antwort, gefolgt von einem hektischen Nicken. Ich ließ den Arm los. Der Knabe rieb sich das Handgelenk, schaute mich wütend an und machte dann ein paar Schritte rückwärts, um aus meiner Reichweite zu kommen.
»Dafür werden Sie noch büßen«, presste er hervor.
Ich stieg derweil wortlos in meinen Wagen.
Zehn Minuten später war ich auf der B 9 in Richtung Andernach unterwegs und fluchte leise vor mich hin. Ich hätte dieser Rechtsanwältin einfach telefonisch absagen sollen, das hätte mir Ärger erspart, aber wie so oft war mir mein verdammter Stolz dazwischengekommen. Wem versuchte ich eigentlich etwas zu beweisen?
Jahrelang war ich Ärger nicht aus dem Weg gegangen. Ich hatte als Militärpolizist und NATO-Sonderermittler einer Spezialeinheit gedient. Bei einem Bombenanschlag in Afghanistan hatte ich dann meinen linken Unterarm und damit die Aussicht auf weitere Außeneinsätze verloren. Meine Vorgesetzten wollten mich zu einem Schreibtischjob überreden, aber das hätte ich nicht ertragen. Der Zufall wollte es, dass mein Onkel überraschend starb und mir die Hälfte des Campingplatzes Pönterbach in der Nähe des Laacher Sees vererbte. So fand meine Karriere als Ermittler im Staatsdienst ein jähes Ende und meine Arbeit als Campingplatzmanager einen Anfang. Zusammen mit meiner Tante Helga führte ich seitdem diesen Platz. Verschiedene Zufälle sorgten dafür, dass meine Ermittlervergangenheit zu mir zurückkehrte. Nun ja, den Entschluss, eine Lizenz zu beantragen, um als privater Ermittler tätig zu sein, hatte ich schon selber und im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten gefasst. Als ich den Wagen durch das Brohltal Richtung Laacher See lenkte, fragte ich mich allerdings, ob das wirklich eine gute Idee gewesen war.
Stützpunkt der 5th Military Police Battalion/Kleber Kaserne, Kaiserslautern
»Hi, hier ist Ben. Versucht es später noch mal, oder hinterlasst mir eine Nachricht.«
»Ben – ich bin’s, Linda. Ruf mich an.« Major Linda Becking knallte den Hörer aufs Telefon. Verdammt, verdammt, verdammt.
Zum dritten Mal hatte sie nur Bens Mailbox erreicht. »Ben, wo steckst du?«, murmelte sie.
»Ärger, Linda?«
James Hilton, ihr Teampartner innerhalb des CID, der Kriminalpolizei der US-amerikanischen Streitkräfte, schaute von seiner Akte hoch.
»Ist gut, Jim.« Linda lächelte schief. »Es ist nur Ben, der wieder Ärger macht. Ich habe ihm Geld geliehen, und er hat hoch und heilig versprochen, es Anfang der Woche zurückzuzahlen. Angeblich gab es Probleme mit seiner EC-Karte.«
»Angeblich?«
»Ich weiß nicht mehr, was ich ihm glauben soll, und der Vertrauensverlust schmerzt mich mehr als das fehlende Geld. Bei Ben läuft nur die Mailbox. Es ist zum Verrücktwerden.«
»Ja, so sind sie, die kleinen Brüder. Bestimmt hat er das Geld noch nicht zusammen und traut sich jetzt nicht, den Anruf anzunehmen.«
»Er hat mir gesagt, dass er schon vor Tagen eine größere Summe erwarten würde. Außerdem kennst du Ben nicht. Der macht keinen Rückzieher oder verschwindet, sondern vertraut darauf, dass er dich bequatschen kann. Und um ehrlich zu sein, das ist ihm bislang auch immer wieder gelungen.«
»Geh nicht zu hart mit ihm ins Gericht. Sieh mal, außer dir und deinem Dad hat Ben doch niemanden. Ich wette, in Kürze steht er vor deiner Tür und entschuldigt sich.« Jim stand auf. »Ich hol mir einen Kaffee, willst du auch einen?«
»Oh ja, bitte.«
Jim verließ den Raum, und Linda versuchte, sich auf einen Rundbrief zu konzentrieren, der an alle Abteilungen gesendet worden war. Doch ihre Gedanken schweiften immer wieder zu der Frage ab: Warum geht Ben nicht ans Telefon?
Sie wollte in der Dienstzeit und Jims Gegenwart keine unnötigen privaten Telefonate führen, aber weil sie gerade allein war, konnte sie ebenso gut schnell anrufen. Rasch suchte sie im Internet nach der Telefonnummer und wählte.
»Comtech – guten Tag.«
»Ja, hallo, mein Name ist Linda Becking. Ich bin die Schwester von Ben. Ich hätte gerne mit Mark gesprochen.«
»Augenblick, ich schau mal, ob der Chef frei ist.«
Linda seufzte in die Pausenmusik hinein. Mark und Ben hatten beide viel in diese Firma gesteckt, aber Mark war jetzt offenbar der Chef. Wo stand Ben in der Hierarchie? Hätte er sich nur ein bisschen mehr engagiert, würde sie jetzt vielleicht mit seiner Sekretärin telefonieren.
»Linda? Hi du, das ist ja ein Ding, dass du anrufst.« Mark klang höflich mit einem Hauch Bedauern.
»Wieso?«
»Na ja, ich habe schon ein schlechtes Gewissen wegen Ben. Ich hab mir schon seit Tagen gesagt, du musst unbedingt mal Linda anrufen.«
Linda versuchte, die Informationen in ihrem Kopf zu ordnen.
»Du wolltest mich wegen Ben anrufen? Okay, das ist nett, aber wir telefonieren doch sonst auch nicht miteinander. Und warum hast du ein schlechtes Gewissen?«
»Weil ich ohne lange zu diskutieren auf seinen Vorschlag eingegangen bin. Vor drei Monaten brauchte er Geld, und er hat mir dafür seinen Anteil an der Firma überschrieben. Hey, und jetzt haben wir einen dicken Auftrag an Land gezogen, wir starten gerade richtig durch, und eigentlich ist das auch Bens Verdienst. Er hat schließlich einen Großteil der Software programmiert.«
»Moment mal, Mark. Ben hat dir seine Firmenanteile überschrieben, und zwar schon vor drei Monaten?«
»Drei Monate oder lass es vier sein, die Zeit fliegt, wenn du so viel zu tun hast wie wir. Ich wollte dich anrufen, um mich bei dir nach Ben zu erkundigen. Vielleicht hätte er ja Bock, als Freelancer für uns zu arbeiten.«
»Du hast keinen Kontakt zu Ben?« Linda bemühte sich, das Schrille wieder aus ihrer Stimme zu nehmen.
»Nö, wie gesagt, ich wollte dich längst anrufen, weil auf seinem Handy nur die Mailbox rangeht.«
Ja, das weiß ich selber, dachte Linda.
»Hör mal, Mark, Ben hat mir in der letzten Woche gesagt, dass er eine größere Geldsumme von dir erwartet.«
»Echt? Da hast du ihn bestimmt falsch verstanden. Ich meine, du kannst nicht Firmenanteile verkaufen und trotzdem Entnahmen erwarten.«
»Ja, mag sein. Du, ich muss Schluss machen, wir haben gleich ein Meeting.«
»Ist gut, Linda. Aber was wolltest du denn eigentlich von mir?
»Ich … ich hatte eine Frage zum Thema Start-ups und … ähm, na ja, ich hatte gehofft, ich könnte dein Know-how nutzen. Aber das eilt nicht. Ich würde mich einfach nächste Woche noch mal melden.«
»Jederzeit, Linda. Und wenn du mit Ben sprichst, dann sag ihm, er soll anrufen.«
»Ich werde es ihm ausrichten.«
Linda zeichnete nachdenklich mit ihrem Bleistift kleine Kreise auf ihren Notizblock. Sie hatte ganz sicher nichts falsch verstanden. Ben hatte gelogen, wieder einmal. Sie wollte im Grunde gar nicht wissen, was er mit dem Geld aus dem Verkauf der Anteile gemacht hatte – vor vier Monaten!
Vielleicht war es ganz gut, dass er gerade nicht ans Telefon ging, ansonsten hätte er eine ziemliche Standpauke zu erwarten.
»Hier ist dein Kaffee. Alles okay?«
Linda nahm den Becher entgegen und lächelte halbherzig. »Ja, alles gut. Und – danke für den Kaffee, Jim.«
Nichts ist gut, dachte sie, zumindest nicht, wenn es nach meinem Bauchgefühl geht. Der Kaffee war heiß, stark und süß, aber er konnte den fahlen Geschmack von Betrug nicht wegspülen.
Ein Büro in Bonn
Er hatte sein Netz gespannt. Über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Ein ganzes Netz von virtuellen Stolperdrähten. Wie richtige, reale Stolperdrähte schlugen sie Alarm. Eine Anfrage in einer Datenbank, ungewöhnliche Polizeimeldungen, Hinweise in Lageberichten, Feedback von Informanten – lauter einzelne dünne Stolperdrähte, die ihn warnen sollten.
Aber mit den Jahren war es ruhig geworden. Einschläfernd ruhig. Seine Aufmerksamkeit hatte nachgelassen. Er gewöhnte sich an die Sicherheit. Vorbei, das war jetzt Geschichte. Weil nicht einer seiner Drähte Alarm ausgelöst hatten, sondern gleich mehrere hintereinander.
Verärgert schloss er sein Computerprogramm und griff zum Telefon. Er hatte immer noch die richtigen Kontakte. Als jemand am anderen Ende der Leitung den Anruf annahm, verzichtete er auf eine Begrüßung. Reine Zeitverschwendung, denn sein Name wurde ja im Display angezeigt.
»Wen haben wir aktuell hier vor Ort?«
»Schmitt und Heller.«
»Sind die beiden gut?«
»Wären sie es nicht, würden sie nicht für uns arbeiten.«
»Sie sollen sich umgehend mit mir in Verbindung setzen. Ich habe einen Auftrag für sie, aber er könnte schmutzig werden.«
»Das wird ihnen egal sein.«
»Umso besser.«
Keine Begrüßung, keine Verabschiedung. Wozu auch? Er hatte einen Auftrag erteilt, und er erwartete, dass er erfüllt wurde.
Campingplatz Pönterbach
Unseren Campingplatz konnte man recht schnell erreichen. Von der A 61 einfach die Ausfahrten Wehr, Mendig oder Kruft nehmen und dann Richtung Laacher See und Andernach-Kell fahren. Und obwohl der Platz verkehrsgünstig höchstens eine Viertelstunde von der Autobahn entfernt lag, hätte man nicht im Traum darüber nachgedacht, so ruhig war es hier. Wenn nicht gerade irgendwo im Wald eine Kettensäge heulte oder auf den Wiesen im Tal ein Traktor herumkurvte, konnte man mit Fug und Recht behaupten, dass das Pöntertal ein wirklich ruhiger Flecken war.
Ich hatte diese Ruhe in den letzten Jahren schätzen gelernt. Mein Freund Kalle Seelbach dagegen behauptete immer, dass diese Ruhe nicht förderlich für das Geschäft eines Ermittlers sei. Er musste es wissen: Kalle war erstens aus Kell und damit im Gegensatz zu mir ein Einheimischer und zweitens Polizist in Andernach und damit vom Fach. Er war es auch, der mir monatelang in den Ohren gelegen hatte, ich solle doch endlich wieder als Ermittler arbeiten. Was ich nun schon seit ein paar Monaten ganz offiziell tat, wenn auch nebenberuflich. Hauptjob Campingplatzmanager, Nebenjob Privatdetektiv – das gab es wahrscheinlich auch nicht alle Tage. Als ich aus dem Pick-up stieg, den wolkenlos blauen Sommerhimmel über mir und den harzigen Kiefernduft in der Nase, atmete ich einmal tief durch. In einer Sache war ich mir sicher. Auf solche Kunden wie Frau Dr. Dremel und ihre Mandanten konnte ich gut verzichten. Da mähte ich doch lieber den ganzen Tag lang die Zeltwiese, als dass ich mich mit solchen Auftraggebern herumschlug.
»Hallo, Paul, na, wie war es?« Helga kam die Außentreppe des Haupthauses herunter. Im letzten Jahr war sie siebenundfünfzig geworden, aber das hatte nichts zu sagen. Diese kleine Frau mit ihren grauen kurzen Haaren war ein wahres Energiebündel.
»Ich habe, denke ich, ziemlich überzeugend deutlich gemacht, dass ich an dieser Art von Aufträgen nicht interessiert bin.«
Helga kannte die Hintergründe, wir hatten keine Geheimnisse voreinander – zumindest, was mein Leben hier betraf. Ein paar Dinge aus meiner Vergangenheit würde Helga allerdings nie erfahren.
Den Fall Dremel hatten wir besprochen. Aus gutem Grund, Helga war eine begnadete Zuhörerin und stellte die richtigen Fragen.
»Glaubst du, dass diese Anwältin Ärger machen wird?« In Helgas Frage klang weniger Besorgnis als vielmehr Neugierde mit.
»Ich denke nicht. Sie weiß, dass sie mehr zu verlieren als zu gewinnen hat.«
Ich drehte mich Richtung Laden um. Hier war nicht nur die Rezeption unseres Platzes untergebracht, man konnte auch Zeitungen und Zeitschriften, Brötchen, Getränke, Eis und ein paar Grundnahrungsmittel kaufen. Außerdem lag im hinteren Bereich des Ladengebäudes meine kleine Wohnung – und genau dorthin zog es mich.
»Nicht so schnell, mein Lieber. Wo willst du hin?«
»Na ja, ich dachte an umziehen, Milchkaffee trinken, etwas ausruhen und danach Hecke stutzen.«
»Ach, die Hecke hat Zeit, und ausruhen kannst du dich später. Nein, nein, wir werden jetzt zusammen nach Koblenz fahren.«
»Was willst du denn in Koblenz?«
Erst jetzt fielen mir ein cremefarbener Umschlag in ihrer Hand und ein unternehmungslustiges Blitzen in ihren Augen auf.
»Das hier ist heute früh mit der Post gekommen.« Helga wedelte mit dem Umschlag. »Polizeioberkommissar Karl-Günther Seelbach und Polizeikommissarin Tanja Dievenbach geben ihre Verlobung bekannt. Wir sind am Samstag eingeladen. Und deshalb solltest du die Hecken warten lassen und mit deiner alten Tante nach Koblenz fahren. Ich glaube, als künftiger Trauzeuge solltest du dir ein neues Sakko oder vielleicht sogar einen Anzug gönnen, und ich möchte mir für die Hochzeit noch ein Sommerkleid kaufen.«
Den Begriff »alte Tante« meinte Helga natürlich nicht ernst. Sie hatte so wenig mit einer alten Tante gemeinsam wie ich mit einem Anzugträger. Schon vor Jahren hatte sie mir verboten, sie Tante zu nennen, so alt wäre sie noch nicht.
»Kalle und Tanja heiraten?«
»Dafür, dass du als Ermittler wirklich ein schlauer Kopf bist, stellst du manchmal ausgesprochen dumme Fragen.« Helga zwinkerte mir zu. »Hattest du denn Zweifel, dass sie es einmal tun werden?«
Ich dachte daran, wie rasant sich die Beziehung zwischen Kalle und Tanja in den letzten Monaten entwickelt hatte. Mein Freund war schwer verliebt, was man ihm nicht übel nehmen konnte. Tanja war eine tolle Frau: gut aussehend, klug und mit einem wunderbaren Sinn für Humor. Dazu kam, dass sie eine bemerkenswerte Polizistin war. Daher fand ich es eigentlich nicht überraschend, dass die beiden heiraten wollten. Was mich überraschte, war die Tatsache, dass ich jetzt nach Koblenz fahren musste, statt in aller Ruhe an der frischen Luft ein paar Hecken zu kürzen.
»Das hat doch alles bestimmt noch Zeit«, sagte ich.
»Hat es nicht, heute ist es ruhig, die nächsten Gäste haben sich erst für morgen und übermorgen angemeldet, und wie ich dich kenne, würdest du am liebsten auf formelle Kleidung jeglicher Art verzichten. Dass du einmal mit Freuden Uniform getragen hast, kann ich mir kaum vorstellen. Und jetzt werden wir losfahren, unterwegs kann ich dir dann noch den Rest erzählen.«
»Den Rest?«
»Ja, ich habe mit Kalles Mutter telefoniert, du wirst als Trauzeuge auch eine Rede halten müssen.«
Gott bewahre, da jagte ich doch lieber ein paar verrückte Mörder.
»Ach Paul, wenn du jetzt dein entsetztes Gesicht sehen könntest«, lachte Helga. Ich seufzte und hielt ihr die Beifahrertür auf. Mit Kalle würde ich mal ein ernstes Wort reden müssen. Trauzeugenrede – der hatte sie ja nicht alle.
»Lass uns versuchen, möglichst schnell wieder zurück zu sein. Nicht wegen der Hecken, sondern weil ich Kalle noch den Hals umdrehen muss.«
Koblenz am Rhein
»Ich finde, dieser Anzug passt Ihnen wie angegossen.« Die Verkäuferin wuselte um mich herum und zupfte am Rücken der Anzugjacke, um ihre Aussage zum »perfekten« Sitz noch zu unterstreichen. »Außerdem haben Sie eine hervorragende Stoffqualität gewählt.«
Okay, sie hatte nicht ganz unrecht, der dunkelgraue Anzug sah wirklich gut aus. Ich hatte aber einfach nach einem grauen Anzug gefragt und ihn angezogen, von der gezielten Auswahl der Stoffqualität konnte wirklich keine Rede sein. Abgesehen davon war ich ziemlich zufrieden, denn für mich das Passende zu finden, war nicht einfach. Mit meinen eins dreiundneunzig brachte ich gerade mal fünfundachtzig Kilo auf die Waage. Normalerweise waren bei Anzügen in meiner Größe entweder die Ärmel und die Hosenbeine zu kurz, oder die Schultern schlabberten. Dieser Anzug dagegen saß tatsächlich perfekt.
»Es ist eine gute Idee, dass wir Hose und Jacke in unterschiedlichen Größen kombinieren können, da bewährt sich unser Baukastensystem«, sagte die Verkäuferin stolz. Das klang so, als wäre sie die Erfinderin dieser Idee gewesen. Der Preis der Perfektion aus Stoff war übrigens auch nicht ohne.
»Die Zeiten, in denen ein Mann unbedingt BOSS tragen musste, sind ja auch vorbei. Die Designer unserer Anzugmodule haben sogar in Mailand für Aufsehen gesorgt.«
Glaubte ich unbesehen. Für den Preis dieses Anzugs, pardon, der Module Hose und Jacke, hätte ich auch in Mailand Urlaub machen können.
»Da bin ich wieder.« Helga kam mit einer Einkaufstasche in der Hand aus dem Aufzug. Sie blieb stehen und musterte mich mit schräg gelegtem Kopf. Dann nickte sie anerkennend. »Der sitzt aber wirklich gut, Paul, den solltest du nehmen.«
»Nicht wahr«, bestätigte die Verkäuferin, »ich sagte gerade Ihrem … ähm …«
»Neffen«, soufflierte ich.
»Ihrem Neffen, dass wir hier mit einer ganz besonderen ägyptischen Wollmischung ein ausgesprochen knitterfreies Gesamtbild haben.«
Von ägyptischer Wolle und knitterfreiem Gesamtbild hörte ich gerade zum ersten Mal. Aber ich hatte auch keine Lust auf weitere Anproben.
»Wissen Sie was, den nehme ich. Ach, und packen Sie doch bitte noch ein weißes und ein schwarzes Oberhemd in Kragenweite dreiundvierzig mit dazu.«
Für einen Moment hatte ich die Verkäuferin aus dem Takt gebracht, denn sie hatte sich wohl noch auf eine längere Diskussion eingestellt. Aber hey, der Anzug saß gut, und ich konnte hier möglichst schnell wieder raus – da war jeder ausgegebene Euro ein gewonnener Euro.
»Krawatten und Anzugschuhe –«
»Habe ich, herzlichen Dank«, unterbrach ich die weitere Angebotsaufzählung und ging zur Umkleidekabine.
Im Spiegel sah ich, wie Helga lächelnd den Kopf schüttelte. Aber sie sollte sich nicht beschweren. Wir hatten, was wir wollten, und das in Rekordzeit.
Kaiserslautern
Linda hatte in Rekordzeit alles zusammen – nur war es nicht das, was sie wollte. Verärgert lehnte sie sich zurück. Die Fakten auf ihrem Notizblock erzählten eine unerfreuliche Geschichte. Ben hatte nicht nur die Firmenanteile versilbert, er hatte auch sein Studium geschmissen. Das Auto, zu dem sie übrigens auch einen Anteil beigetragen hatte, war verkauft worden. Dafür besaß Ben jetzt ein altes Wohnmobil. Diese Information stammte von Bens WG-Mitbewohner Hendrik, der Linda auch bereitwillig berichtet hatte, dass Ben schon seit vier Tagen nicht mehr zu Hause gewesen sei, und das, obwohl er mit dem Putzen des Treppenhauses an der Reihe gewesen wäre.
Bens Treppenhaus kann mir gestohlen bleiben, dachte sie, ich will wissen, wo der Kerl steckt. Noch beunruhigender als Bens Verschwinden aus der WG war nämlich die Information, dass sein Bankkonto leer war. Linda hatte sich daran erinnert, dass sie eine Verfügungsberechtigung für sein Konto hatte, ein Überbleibsel aus der Zeit, als sie noch mit Ben zusammengelebt hatte. Ein Anruf bei der Bank brachte es an den Tag: Es hatte nie Probleme mit dem Konto oder einer EC-Karte gegeben.
Er hat mich nach Strich und Faden belogen und manipuliert. Die Kleiner-Bruder-in-Not-Nummer hatte wieder mal funktioniert. Linda war wütender auf sich selbst als auf Ben.
Das Handy auf ihrem Schreibtisch klingelte.
»Linda Becking!«
»Linda, hi, ich bin’s, Ben.«
»Ben, wo bist du? Sag mal, hast du sie noch alle? Du belügst mich, du verkaufst deine Firmenanteile, du –«
»Hoho, mal langsam, Schwesterherz. Das mit Mark kriege ich schon wieder auf die Reihe. Seine Vorstellung von Ruhm teile ich nicht. Der wollte aus unserer Firma eine stinknormale Softwareschmiede machen. Öde Einrichtung von Netzwerken und Computern verbunden mit langweiliger Warenwirtschaft. SAP für Arme sozusagen. Da habe ich besser einen Schlussstrich gezogen. Ich wollte dich nur nicht beunruhigen. Ich hätte dir das schon noch beim nächsten Mal erzählt.«
»Mich nicht beunruhigen? Du spinnst ja komplett. Mich beunruhigt, dass ich dir kein einziges Wort mehr glauben kann, weil du mich ständig anlügst.«
»Echt jetzt, mach mal langsam und komm wieder runter. Ich bin schließlich keine zwölf mehr. Also: Ich ruf nur kurz an, um dir zu sagen, dass ich für ein paar Tage an die Mosel fahre. Mit dem Womo, einfach mal den Sommer genießen. In unserer WG mit Lou und seinem Schlagzeug auf der einen Seite und Hendrik mit seinem Putzfimmel auf der anderen Seite finde ich einfach keine Ruhe. Ich verbinde also das Angenehme mit dem Nützlichen, lass mir die Sonne auf den Bauch scheinen und lege den Grundstock für den nächsten Erfolg, ich habe dabei ein super Gefühl. Auf dem Campingplatz in Treis-Karden ist für mich ein Stellplatz reserviert. Ich ordne meine Gedanken, und wenn ich wieder da bin, lege ich los.«
»Du legst los? Womit?«, fragte Linda ungläubig.
»Ich soll für ein Münchener Unternehmen ein neues Sicherheitsprogramm konzipieren, das ist aber nur der Anfang. Den Rest verrate ich dir, wenn wir uns wiedersehen. Du wirst staunen, Schwesterherz, versprochen.«
»Nein, warte. Ich –«
»Ciao, Linda.«
Ben hatte aufgelegt. Linda starrte auf ihr Smartphone, und mit einem leisen Wutschrei warf sie es auf den Couchtisch. Sie boxte in ein Sofakissen – das half ihr jedoch auch nicht weiter.
Ben, das ist jetzt echt einmal zu viel gewesen, dachte sie. Mir reicht’s, sieh du zu, dass du eine andere Dumme findest.
Auf dem Tisch klingelte und vibrierte das Smartphone gleichzeitig.
»Ben, wenn du glaubst, dass du so einfach –«
»Entschuldigen Sie, spreche ich mit Linda Becking? Hier ist Schwester Katrin aus dem Marienstift. Sie sollten, wenn es Ihre Zeit erlaubt, möglichst bald zu uns kommen. Ihrem Vater geht es nicht gut.«
Mister C
Das »Mister C« war seit zwei Jahren einer der angesagtesten Nachtclubs der Region. Nicht, dass es eine reichliche Auswahl gegeben hätte, aber unter den wenigen war das »Mister C« eindeutig der König. Selbst an einem Mittwochabend war die Tanzfläche im Keller voll, die Bar im Stockwerk darüber war belagert, und die wummernden Bässe aus den Boxen waren so laut, dass die Drinks auf der Theke zitterten.
Carsten Höpper nickte rhythmisch mit dem Kopf. Er liebte das »Mister C«, allein schon wegen des Namens, es war ja fast so, als wäre es sein eigener Laden – C wie Carsten. Er schaute sich um, erhaschte einen Blick auf eine Frau, die etwas abseits stand und sich gerade mit einer lässigen Bewegung die langen braunen Haare hinter das Ohr strich. Hübsche Beine, nette Figur, kein hässliches Gesicht, nein, ganz und gar nicht hässlich.
Carsten schob sich unauffällig näher. Sie nahm gerade einen Cocktail von Fred, dem Barkeeper, entgegen und bemerkte Carsten offenbar aus den Augenwinkeln. Mit einem Lächeln wandte sie sich ihm zu. Hoppla, dachte Carsten, doch älter, als ich gedacht hatte. Hätte ich auf den ersten Blick gar nicht vermutet. Carsten korrigierte seine Einschätzung von Mitte zwanzig kurzerhand um zehn Jahre nach oben. Eigentlich schade, damit war sie in seinem Alter. Er schätzte die etwas Jüngeren, die waren einfach leichter zu beeindrucken. Aber das warme Lächeln wirkte nicht abweisend, da konnte er ebenso gut weitermachen.
»Hi, bin der Carsten, Carsten mit C wie in ›Mister C‹, alles klar?«
In acht von zehn Fällen war er mit diesem Spruch erfolgreich. Ein paar von seinen One-Night-Stands waren sogar noch am nächsten Morgen davon überzeugt gewesen, mit dem Clubbesitzer persönlich die Nacht verbracht zu haben. Nicht sein Problem.
Der eher neutrale Blick signalisierte, dass er dieses Mal mit seiner Clubbesitzer-Masche bei der schönen Unbekannten keinen Treffer gelandet hatte.
»Hi, Carsten mit C.«
Ihre Stimme ist der Hammer, dachte Carsten. Da schwang Erfahrung mit, so etwas leicht Rauchiges und Verruchtes, als wüsste sie ganz genau, was sie heute noch tun wollte. Carsten schluckte trocken. Für einen Moment dachte er daran, sich zurückzuziehen, aber der Blick, mit dem sie ihn anschaute, war geradezu magisch.
Außerdem hatte er ja noch gar nicht richtig angefangen.
»Lust auf einen weiteren Cocktail? Fred an der Bar macht einen wirklich passablen Manhattan.«
»So, macht er das? Und was nennst du einen passablen Manhattan, Carsten mit C?«
»Ich würde dafür zwei Teile ordentlichen Rye Whiskey nehmen, keinen billigen fünf Jahre alten Fusel. Dazu einen Teil roten Wermut und zwei Spritzer Angosturabitter. Alles kommt in ein mit Eiswürfeln gefülltes Rührglas. Am Ende würde ich den Cocktail durch ein Barsieb in einen vorgekühlten Martinikelch abseihen. Nebenbei: Fred besteht ja auf seiner Cocktailkirsche, aber auf die könnte ich zur Not verzichten, Hauptsache, die Zutaten sind erstklassig. Ich trinke meinen Manhattan übrigens straight up, also ohne Eis im Glas. Zufrieden?«
Die unbekannte Frau lehnte sich zurück. Carsten sah, wie ihr enges T-Shirt über den Brüsten spannte, und er bereute es nicht, sie angesprochen zu haben.
»Klingt in meinen Ohren mehr als akzeptabel. Davon nehme ich einen. Ich bin die Ellen. Mit E. Vielleicht wollen wir uns ja da drüben hinsetzen.« Ellen deutete auf einen Zweiertisch, der eben von einem Pärchen geräumt worden war.