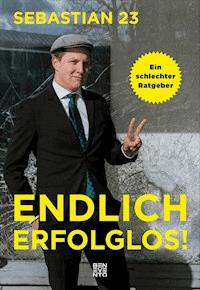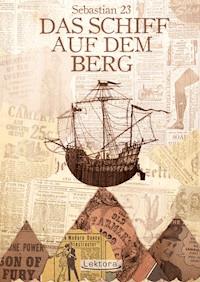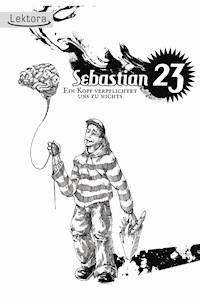Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lektora
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Dies ist ein Buch von und mit Sebastian 23, der im Jahr 2000 erstmals bei einem Poetry Slam auftrat. Das ist lange her, damals war Poetry Slam ein subkulturelles Phänomen und in wilden, kleinen Bars und Kneipen beheimatet. Auf der Bühne waren noch Holzkeulen und Säbelzahntiger erlaubt. Heutzutage gibt es Poetry Slams immer noch in schummerigen Nischen, aber mittlerweile ebenso auf großen und gut ausgeleuchteten Theaterbühnen, im Fernsehen oder gar Open Air vor tausenden Zuschauern. Und mittendrin findet man noch immer Sebastian 23. Dieses Buch versammelt seine besten Texte der letzten Jahre, bunt gemischt, wie ein Poetry Slam: mal lustig, mal ernst, mal wild, mal albern, mal nachdenklich. Geschichten, Gedichte, Dialoge und Dinge, die sich jeglicher Einordnung verweigern. Aber was weiß ich schon – Ich bin ja nur ein Klappentext.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sebastian 23
Hinfallen ist wie Anlehnen, nur später
Erste Auflage 2016
Alle Rechte vorbehalten
Copyright 2016 by
Lektora GmbH
Karlstraße 56
33098 Paderborn
Tel.: 05251 6886809
Fax: 05251 6886815
www.lektora.de
Covermotiv: Simon Höfer
Covermontage: Simon Höfer
Lektorat: Lektora GmbH
Layout Inhalt: Marvin Ruppert
ISBN: 978-3-95461-086-0
Inhalt
Teil 1 – Dada und Coco
Vokalgedichte 1: Iris
Vokalgedichte 2: Huhu Uhu!
Die Ruhr tickt
Zeit für Lyrik
Schwarz auf Weiß
Numerisches Meeting
Baums Zeugen
Die Funklochprinzessin
Glatzenkalender
Garage
Teil 2 – Gruben graben und grübeln
Am Rande bemerkt
Am Ufer des Überflusses
Frank und Freiheit
Pflichtflucht
Die Karte
Rezept für Jetzt
All das schrieb mir Maria
Ebene
Die Uhr als Ventilator
Angeleint sein
Teil 3 – Lachmöwen im Landeanflug
Vom Leben und vom Schreiben
Gesprochene Verbrechen
Faust 4
Politisch korechts
Unken ist Silber
Der Unrat der Sprache
Die Dudenbuche
Clown des Grauens
Ex und Hopp
Logischer Beweis
Aprioritäten
Kunst durch Sprache
Der milde Westen
Bochums Sehenswürdigkeiten
Teil 4 – Ernst als Vorname
Tagedieb
Alles fließt
In Worte fassen
Schwermut und Wohlkraft
Trojanische Worte
Das erste Mal
Kirsche
Ukiyo
Fisch und Feuer
Teil 5 – Heimatt
Euer Opa
Wenn dann, wann denn?
Zeit für Reprise
Prag pragmatisch
Das Gnu aus Ulm, Teil Fünf
Über sieben Krücken
Wutmehl
Silben switchen
Prock und Lotschow
Das Rätsel der Socke
Die Rede wendet sich
Der Hurensohn
Zwei Körperteile: Hals Maul
Der Schlüssel zum Eichenrebell
»Du rennst, aber der Boden antwortet nicht.Er hat keine Lust und du bleibst stehen.«
(Sylabil Spill)
Teil 1
Dada und Coco
»Sind Diskos eigentlich so doof, wie ich denke –oder bin ich der Doofe?«
(Martin Kippenberger)
Vokalgedichte
Einleitung Eins
Vokalgedichte sind keine Gedichte, die nur aus Vokalen bestehen, obwohl die auch schön sind. Sie klingen so: »AAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUUUUIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEEIIIIIIIIIUUUUUUIIIIIIII.«
Immer ein bisschen wie ein Blauwal, welcher eine Frage hat.
Aber Vokalgedichte gehen anders – es sind Gedichte, in denen nur ein Vokal vorkommt. Ein bekanntes Beispiel ist das Gedicht »Ottos Mops« von Ernst Jandl. Da kommt nur das »O« drin vor und es enthält solche Sätze:
»Ottos Mops hopst«,
oder
»Ottos Mops kotzt«.
Genial.
Ich wollte aber gerne mit einem anderen Vokal arbeiten und bin bei meiner Recherche nach einem möglichen Vokal nach zwei Wochen auf das »I« gestoßen, den jüngeren, schlankeren Bruder des »O«:
Iris
IIIIIIIIIH!
Wie fies!
Gierig griff Iris in ihr Bier
Dies irritiert mich
Wie ist Sinn hierin?
Misst sie, wie tief ihr Bier ist?
Schwimmt ihr Ring im Drink?
Wird sie irrsinnig?
Kifft sie viel?
Kiffi, kiffi, Iris?
Ich ließ sie, mit Birgit im Blick
Birgit ist Iris’ Liebling
Birgit spricht:
»Iris ist nicht dicht!
Ihr Griff ins Bier ist wirr!
Sie stiert ins Licht!
Sie spinnt und grinst wie Tillidin!
Iris ist nicht richtig im Wirsing!«
»Ist sie wirklich nicht«, insistier ich
Wisst ihr, wie tief Iris’ Bier ist?
Vierzig Inch
Wirklich tief, schien mir
Really deep, it seems
Iris winkt
Sie sinkt im Drink
Vokalgedichte
Teil 2
Nun kommen aber Leute zu mir und sagen: »Hey Sebastian! Im Text ›Iris‹ war ja gar nicht nur das ›I‹ drin. Da war ja auch ein Dehnungs-E drin, z. B. im Wort ›Bier‹.«
Das stimmt natürlich! Ich nehme Kritik immer ernst und habe ein weiteres Vokalgedicht geschrieben, in dem ich nicht mehr so frech mogele!
Um ein bisschen mysteriöser zu wirken, verrate ich diesmal aber nicht im Voraus, mit welchem Vokal ich diesmal arbeite:
Huhu Uhu!
Du fluchst:
»Zum Kuckuck!«
Gudrun schubst uns rum!
Pusht uns zum Sumpf!
Lust, Unfug zu tun!
Wut-Kultur!
Gudruns Mund brummt: »Huuh! Huuh!«
Um Gudrun drumrum Tuch und Mull!
Gudrun spukt!
Du guckst zur Uhr
Just null Uhr!
Gut zur Unzucht rund um Busch und Frucht
Du Fuchs!
Du suchst Gudruns Mund zum Kuss
Du schnurrst und schmust!
Fuß sucht Schuh!
Lust pur!
Nur: Gudrun tut stur
Gudrun grunzt stumpf: »Huuuh! Huuuuh!«
Spukt ungut
Stubst und schubst uns rum!
Und plumps!
Null Zukunft!
Sumpf schluckt uns!
Buch zu!
Die Ruhr tickt
»Wenn eine Hode sich aus dem Hodensack löst und ins Innere des Körpers wandert, spricht man von einer Hodentorsion. Viele denken ja, bei einer Torsion verknoten sich die beiden Hoden im Sack«, sagte ich.
Ein gutes Gesprächsthema für ein erstes Date zu finden, war noch nie meine Stärke.
Lena runzelte die Stirn und versuchte, das Thema zu wechseln:
»Äh, ja … Sag mal, wo kommst du eigentlich her?«
Ich lächelte dankbar.
»Aus dem Ruhrgebiet, aus Bochum.«
Lenas Gesicht nahm einen Ausdruck an, den ich nicht zu deuten wusste. Dann sagte sie leise, aber bestimmt:
»Erzähl mir mehr von Hodentorsionen.«
Ich bin derartige Reaktionen gewöhnt. Wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, erntet man mitleidige Blicke von Leuten aus Hoyerswerda oder Delmenhorst. Leute aus Berlin fragen, wo denn dieses »Ruhrjebiet« nochmal liegt – und Münchner setzen sich an einen anderen Tisch. In einer anderen Bar. Dort versuchen sie, sich die traurige Tatsache, dass im Ruhrgebiet tatsächlich Menschen leben müssen, aus dem Kopf zu saufen. Tränen der Sehnsucht nach einer besseren Zukunft tropfen in ihr Weißbier.
Dabei wissen die meisten so gut wie gar nichts über das Ruhrgebiet, spätestens, wenn man ihnen erklärt, dass Köln nicht dazugehört. Köln ist eine Stunde entfernt. Es sagt ja auch keiner, dass Leipzig zu Berlin gehört oder Hamburg zu Delmenhorst.
Ein Mann aus Leipzig hat mich übrigens mal gefragt, ob wir in Bochum überhaupt einen Fluss haben. Ich gab ihm den Tipp, dass unser Fluss so heiße wie eine Infektionskrankheit.
Er sagte: »Aha.«
Und dann: »Bochum … Bochum an der Aids?«
Nun ja, es stimmt schon, die Ruhr hat nicht den besten Namen der Welt erwischt. Sie ist quasi der Jimi Blue Ochsenknecht unter den Flüssen. Aber dennoch ist sie ein sanft geschwungener, ruhig fließender Strom inmitten grüner Hügel. Man kann im Sommer sehr schön darin schwimmen gehen, ohne Gefahr zu laufen, dass einem hinterher Körperteile fehlen – oder neue wachsen.
Sofern einem kein Schwan in den Unterleib tritt, ist nicht einmal mit Hodentorsionen zu rechnen.
Die Bewohner des Ruhrgebiets sprechen eine sehr direkte Sprache. Meine Großmutter sagte beim sonntäglichen Kaffeekränzchen auf feinbespitzter Tischdecke immer:
»Reich mir den Marmorkuchen, sonst reiß ich dir mit dem Tortenheber ein zweites Kackloch, du Fickfehler.«
Ach ja, die Oma.
Wir machen aber auch schöne Sachen mit Sprache, zum Beispiel praktische Verkürzungen: Aus den fünf Wörtern »Kommst du um die Ecke« werden bei uns drei: »Kommse umme Ecke«.
Aus »Horch auf, junger Kamerad!« (eine häufig genutzte Wendung) wird bei uns »HÖMMA!«. Und aus »Schau nur, der Oberbürgermeister reitet auf einem goldenen Kamel durch die Stadt!« wird bei uns »KUMMA!«.
Isso.
Auch um die Bausubstanz ist es nicht so schlecht bestellt, wie man immer denkt. Das weiß nur niemand, weil wir keinen Tourismus haben. Die Menschen kennen das Ruhrgebiet nur aus den Medien, wo es oft fragwürdig dargestellt wird. Ich habe mal in der Süddeutschen Zeitung den folgenden Satz gefunden (und ich zitiere wörtlich):
»Bochum sieht aus wie die architektonische Fantasie eines besoffenen Frettchens.«
Das ist zugegebenermaßen schon ein bisschen lustig. Ich möchte auch mal einen solchen Satz versuchen: »Die Süddeutsche Zeitung liest sich, als ob einem ein bekiffter Habicht mit stumpfem Schnabel und einer gewissen Vorliebe für Steppdecken einen äußerst kostspieligen Frappuccino serviert.«
Wie auch immer, heute sieht es im Ruhrgebiet längst nicht mehr so aus wie vor 50 Jahren. Ich kläre euch gerne über den aktuellen Status quo auf:
Die heutigen Bewohner des Ruhrgebiets leben vornehmlich in hölzernen Baumhäusern inmitten wiederaufgeforsteter Wälder. Die simpel gehaltenen Hütten sind durch ein komplexes Brückensystem miteinander verbunden, weil wir das in StarWars, Episode VI, auf dem Planeten der Ewoks gesehen haben und tierisch cool fanden.
Oben in den Baumwipfeln hüpfen wir von Ast zu Ast, nackt, wie der Strukturwandel uns schuf. Dabei essen wir Bananen, die wir aus Äpfeln geschnitzt haben. Arbeit hat von uns keiner mehr, aber wir sagen nicht arbeitslos, weil das nicht mehr politisch korrekt ist. Wir sagen »zeitlich sehr flexible ethnische Minderheit«.
Unsere Wipfelwelt verlassen wir nur an besonderen Feiertagen: Dann klettern wir in farbenfroher Gesichtsbemalung und mit Gewändern aus Alabaster, Smaragden und Pfauenfedern bekleidet die Stämme der Bäume hinab auf den Boden der Tatsachen.
Unten, in den übriggebliebenen, größtenteils mit Moosen und Flechten überwucherten Fabrikhallen, machen wir dann die sogenannte »Kultur«: Wir tanzen um das Grubenfeuer, lauschen den Gesängen der räudigen Grunzbarden oder gehen zu Poetry Slams.
Im Anschluss gehen wir dann anne Bude und trinken Plörre ausse Dose, bis die einbrechende Nacht vom Gesang unserer Ahnen erfüllt ist:
»Hömma, kumma, ne!
Kumma, kumma, wa!
Hömma, kumma, ne!
Watt is datt denn da?«
Das alles hab ich Lena während des restlichen Dates noch erzählt.
Dass sie zwischenzeitlich gegangen war, störte mich nur geringfügig.
Zeit für Lyrik
Bäume sind Büsche auf Balken
Schrauben sind Nägel mit Falten
Flüsse sind Meere auf Reisen
Zugfahren ist Fließen auf Gleisen
Träume sind Schlaf mit Ideen
Igel Kakteen, die gehen
Fenster sind gläserne Mauern
Berge sind Wellen, die dauern
Pogen ist Tanzen mit Prügeln
Kamele sind Pferde mit Hügeln
Regen sind Wolken, die welken
Regeln Vorschläge, die gelten
Netze sind Tücher mit Löchern
Pfaue sind Vögel mit Fächern
Biere sind Räusche in Bechern
Schnecken sind Schlangen mit Dächern
Säulen sind Bäume aus Steinen
Tische sind Böden auf Beinen
Schuhe sind Mützen für Füße
Kekse sind Brote mit Süße
Beine sind Arme zum Laufen
Mauern sind sehr grade Haufen
Eier sind werdende Hennen
Sekunden sind Stunden, die rennen
KOMA ist AMOK im Spiegel
Kakteen sind fußkranke Igel
Schränke sind Häuser für Sachen
Weinen ist trauriges Lachen
Wolken sind Pfützen, die fliegen
Zs sind Ns, wenn sie liegen
Weizen sind Gräser mit Ähre
Schwimmen ist Fliegen für Schwere
(Heißer Dank gebührt an dieser Stelle Lars Ruppel, der zahlreiche Zeilen zum Text beitrug; und natürlich der einzig wahren Poetry-Slam-Boygroup SMAAT.)
Schwarz auf Weiß
Das war nicht unbedingt die Gegend, in der man wollte, dass die Tanknadel mit einem theatralischen Knall auf den Nullpunkt sank und das Auto seinen letzten Tropfen Benzin durch den Motor jagte, eine letzte kleine schwarze Wolke auspuffte und dann schlicht stehenblieb, nach langer und schöner Fahrt, aber leider zu früh, genau wie dieser Satz, der ja auch ziemlich lang war, aber dann plöt…
Dr. Amuru Mbenga seufzte und stieg aus, um nachzusehen, ob er im Kofferraum einen Benzinkanister hatte, mit dem er sich auf den Weg zur nächsten Tankstelle machen konnte. Immerhin hatte er es noch von der A 17 runter und bis kurz vor eine kleine Stadt geschafft. Von seiner Stirn troff der Schweiß, es war ziemlich warm, vor allem, weil er noch den dreiteiligen Anzug anhatte, den er für die Neurochemie-Tagung in Prag getragen hatte.
Vielleicht hätte er doch fliegen sollen, dachte Amuru, diese Autofahrt zurück nach Berlin zog sich ziemlich hin. Und wenn einem Flugzeug das Kerosin ausgeht, dann muss man wenigstens nicht mehr zur Tankstelle laufen.
Dr. Mbenga hatte den Kanister schnell gefunden, das Auto abgeschlossen und sich zu Fuß auf den Weg gemacht. Nach ein paar hundert Metern konnte er das Ortseingangsschild lesen: Pirna, Sächsische Schweiz, Sachsen stand da. Insbesondere die mittleren Worte sahen schwierig aus. Er hatte zwar ein bisschen Deutsch in der Schule gehabt, aber lebte und forschte erst seit sieben Monaten in Berlin, am Fraunhofer-Institut. »Saksisse Sweiz« murmelte er, begleitet von einem leichten Kopfschütteln.
Er wollte gerade weitergehen, als ihm eine Gruppe von jungen Männer entgegentrat.
»Ach, guck mal«, dachte Amuru, »Nazis«.
Von denen hatte er gehört. Das waren aber einige prächtige Exemplare, allesamt Männchen, in aufgeplusterten Bomberjacken, weißen Schnürsenkeln und mit kurzgeschorenem Gefieder. Dr. Mbenga folgerte aus der aufwändigen Aufmachung, dass wohl Balzzeit sein musste. Vermutlich suchten diese Männchen nach gebärfreudigen Weibchen.
Und richtig, schon stieß das Größte der Männchen, er mochte gut und gerne zwei Meter von der Springerstiefelsohle bis zur Glatze messen, einen der typischen Brunftschreie aus: »Sieg Heil!«, rief er, gefolgt von einem langgezogenen Rülpsen.
»Gut gesagt, Langer«, kommentierte ein Kleinerer, der im Gegensatz zu seinen Kollegen einen Seitenscheitel und einen Robert-Mugabe-Bart trug. In seinem Mund lauerten kleine spitze Zähne, in allen Farbtönen zwischen cremeweiß und anthrazit. Der Karieshai schien eine Art Alpha-Tier zu sein, zumindest stand das so auf seiner Jacke.
»Wen haben wir denn hier?«, fragte der Hai in Richtung Amuru.
»Dit is’ ein Ausländer«, rief der Lange, gefolgt von einem langgezogenen Rülpser. Dr. Mbenga erkannte da ein Muster.
»Ich glaube, das ist ein Neger!«, fiepste ein korpulenter Dritter, der offensichtlich in jüngerer Vergangenheit mit dem Hoden in eine Drechselmaschine geraten war. So klang zumindest seine Stimme und er sah auch ziemlich grimmig aus.
Bevor Amuru etwas antworten konnte, ergriff wieder der Hai das Wort.
»Nein, das kann kein Neger sein, weil der ist weiß.«
»Stimmt!«, rief der Lange, gefolgt von einem langgezogenen Rülpser.
»Doch, das ist ein Afrikanenser, guck doch mal, die platte Nase!«, fiepste der Dicke.
»Komm schon, der Lange hat doch auch ’ne platte Nase!«, gab Hai zu bedenken.
»Ja, aber das kommt von der Keilerei mit den Pollacken.«
»Vielleicht hat der hier sich auch mit den Pollacken geprügelt«, äffte Hai den Fiepser nach.
»Pass bloß auf, sonst hast du gleich auch ’ne platte Nase.«
Dr. Amuru Mbenga hatte den Eindruck, die Chance verpasst zu haben, den Herrschaften mitzuteilen, dass er sehr wohl aus Uganda kam, aber eben an Albinismus litt. Nun gut, dachte er und lauschte weiter fasziniert den Dominanzkämpfen in der Rudelhierarchie.
»Ach, halt die Backen. Der Typ hier ist schneeweiß, das ist doch kein Neger nich’!«
»Also, wenn du das nicht erkennst, bist du ein ganz schlechter Rassist. Du bist ein ganz schlechter Rassist!«, brüllte der Fiepser, mittlerweile sichtlich erregt.
»Nein, du bist ein schlechter Rassist, wenn du hier Weiße umklatschen willst.«
»Aber der klaut mir meinen Arbeitsplatz.«
»Du bist seit dem Hauptschulabschluss arbeitslos, Dirk.«
Aha, der Fiepser hieß also Dirk, was für ein schöner Name, dachte Amuru.
»Ja, genau, ich bin arbeitslos wegen so Negern wie dem da!«
»Das ist kein Neger, der ist nicht schwarz!«
»Vielleicht hat er Albinismus«, rief der Lange, gefolgt von einem langgezogenen Rülpser. Dr. Mbenga begann, ihn zu mögen.
»Albismus?«, fiepste Dirk.
»Albalismus, du Trottel«, korrigierte ihn der Hai.
»Es heißt Albinismus und ist eine Sammelbezeichnung für angeborene Störungen in der Biosynthese der Melanine (das sind Pigmente oder Farbstoffe) und die daraus resultierende hellere Haut-, Haar- und Augenfarbe«, erklärte der Lange, gefolgt von einem langgezogenen Schweigen.
Der Hai und der Fiepser sahen sich an und dann wieder den Langen.
»Ist das jetzt ein Schwarzer, oder nicht?«, fragte Hai. »Das ist echt ’ne wichtige Frage, weil wir ja sonst nicht wissen, ob wir ihn hassen.«
»Naja, seine Haut ist ja nicht schwarz.« Diesmal rülpste der Lange zweimal, weil er es vorhin einmal vergessen hatte.
»Aber vielleicht ist er darunter noch ein Neger.«
»Unter der Haut?«
»Ja klar.«
»Das macht doch gar keinen Sinn, du Fettsack!«
»Doch, vielleicht ist er ja vom Charakter her ein Ausländer. Mein Vater sagt, da muss man immer auch auf die inneren Werte achten.«
»Du kannst mich mal an meinen inneren Werten lecken!«, schrie Hai.
Und es kam, wie es kommen musste, eine wüste Schlägerei brach los. Der Fiepser schlug Hai tatsächlich die Nase platt, im Gegenzug trat ihm Hai die Füße weg. Der Lange schlug sich derweil aus Verunsicherung selbst ins Gesicht.
Dr. Amuru Mbenga sah noch eine Weile lang zu und während er später auf dem Weg zur Tankstelle den Blick in den Sonnenuntergang schweifen ließ, lächelte er. Er würde demnächst öfter mal auf NPD-Demos gehen.
Numerisches Meeting
Einst in der
Zweigstelle einer
Dreisten
Firma
Fünf ent-
Sechsliche Gestalten ver-
Sieben aus
Achtlosigkeit den
Neun Trend der
Szene.
Denen war nicht mehr zu
’elfen!
Baums Zeugen
Ich bin nicht so der Morgenmensch.
Ich bin mehr so ein Morgenmufflon.
Mein morgendlicher Kaffeekonsum hält die Konjunktur Kolumbiens stabil, denn ich brauche so viel von dem Zeug, dass dem deutschen Durchschnittsbürger schon beim Zusehen die Herzkammer flattern würde.
Das ist wichtig, denn manchmal habe ich morgens dringende Sachen zu erledigen, wie z. B. einen Anruf bei meiner Krankenkasse, und wenn ich vorher nicht genug Kaffee hatte, kann es schon mal sein, dass ich aus Versehen die Faxnummer wähle und mich eine halbe Stunde mit dem Piepton unterhalte.
Und weil Kaffee allein irgendwann nicht mehr reicht, hat mir Andy Strauß einen Rezepttipp gegeben, ein Milchmischgetränk aus Wald- und Wiesenbewohnern, das noch effektiver ist. Andy hat immer ganz originelle Rezeptideen, von ihm stammt auch der Spanspanier – das ist so ähnlich wie ein Spanferkel, nur halt mit einem der putzigen Bewohner der iberischen Halbinsel.
Eines Morgens jedenfalls, ich schob gerade einen Fuchs in den Mixer, klingelte es unerwartet an der Tür. Ich ließ ab von meinem rostroten Milchshake und stellte mir drei Fragen:
1. Wer mochte das sein?
2. Wen kenne ich, der so früh schon wach ist?
3. Warum geben wir Miley Cyrus nicht einen Kescher und sagen ihr, dass sie erst wieder an Land darf, wenn kein Plastikmüll mehr im Ozean ist?
Doch blieb mir keine Zeit für etwaige Erwägungen, denn ich eilte zur Pforte und schon schob ich sie auf. Davor standen zwei unscheinbare Herren in graubenadelstreiften Anzügen. Der Größere der beiden trug einen Schnauzbart, sah damit aus wie ein Horst und hielt zudem eine Art Laserpistole in der Hand.
»Guten Morgen«, sagte der Kleinere der beiden, nennen wir ihn Hobbit, denn er war barfuß. Währenddessen richtete Horst sein Laserding auf mich.
»Guten Morgen?«, entgegnete ich fragend.
»0,36 Sekunden«, rief Horst mit leicht sächselndem Tonfall.
»Das ist eindeutig zu schnell!«
»Was?«, fragte ich.
»0,28 Sekunden, noch schneller!«, rief Horst.
Der Hobbit erklärte: »Kruse, mein Name, Polizeidirektion Dortmund-Wumpe. Mein Kollege und ich haben bei Ihnen eine deutlich überhöhte Reaktionsgeschwindigkeit festgestellt.«
Es dauerte ein paar Atemzüge, bis seine Worte bei mir angekommen waren.
»Was?«, fragte ich erneut.
»4,5 Sekunden«, kommentierte Horst mit Blick auf sein Messgerät, das dann wohl doch keine coole Laserpistole war.
»Guter Versuch«, ergänzte Wachmeister Kruse, »aber das macht Ihre Hektik von gerade eben nicht ungeschehen. Ich fürchte, Ihren Führerschein werden wir einziehen müssen.«
»Aber ich habe gar kein Auto und nicht mal einen Führerschein.«
»3,7 Sekunden«, sächselte Horst.
Der Hobbit namens Kruse dachte nach.
»Dann geben Sie uns Ihr Fahrrad.«
»Hab ich auch nicht.«
»1,2 Sekunden! Aufpassen, du!«
»Dann geben Sie uns Ihre Schuhe.«
»Wieso denn meine Schuhe?«
»0,9! Schon wieder zu schnell!«
»Jetzt hören Sie doch mal auf damit! Was wollen Sie mit meinen Schuhen?«
»Mit dieser rasanten Reaktionsweise sind Sie auch als Fußgänger eine Gefahr für die Gesellschaft. Darum her mit den Tretlingen, sonst nehmen wir Sie gleich mit auf die Wache.«
Der Hobbit klang bedrohlich, also zog ich meine Pantoffeln aus und reichte sie ihm.