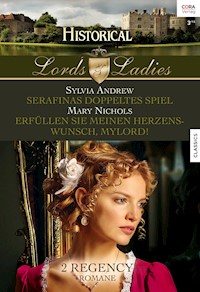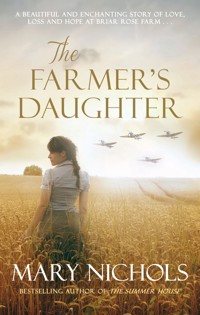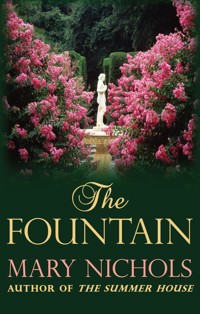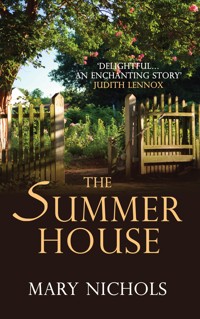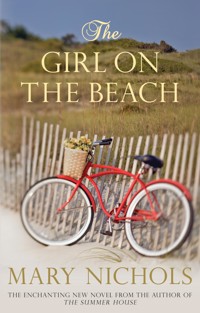5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CORA Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historical Lords & Ladies
- Sprache: Deutsch
DAS GEHEIMNIS DES ITALIENISCHEN GRAFEN von MCCABE, AMANDA
An Verehrern mangelt es der betörenden Thalia nicht. Doch ihr Herz ist schon vergeben. Seit sie dem geheimnisvollen Marco, Conte di Fabrizzi, auf Sizilien begegnet ist, verzehrt sie sich nach seinen zärtlichen Küssen. Leider muss sie nach England zurückkehren. Doch schon bald sieht sie Marco unverhofft wieder: Er kommt nach Bath - in Begleitung einer berüchtigten Kunstdiebin! Hat sie sich in einen Schwindler verliebt?
EIN EARL VERLIERT SEIN HERZ von NICHOLS, MARY
Die unkonventionelle junge Erbin Charlotte Cartwright denkt nicht ans Heiraten, seit Roland Temple, Earl of Amerleigh, sie vor sechs Jahren schändlich sitzen ließ. Doch nun ist er zurück und stürzt sie in einen Aufruhr der Gefühle. Nicht nur, weil ihr Herz plötzlich lichterloh in Flammen steht - sondern auch, weil er unverzüglich um ihre Hand anhält! Ist er vielleicht nur auf ihr Erbe aus? Charlotte wird misstrauisch …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Amanda McCabe, Mary Nichols
HISTORICAL LORDS & LADIES BAND 72
IMPRESSUM
HISTORICAL LORDS & LADIES erscheint in der HarperCollins Germany GmbH
Neuauflage by HarperCollins Germany GmbH, Hamburg, in der Reihe: HISTORICAL LORDS & LADIES, Band 72 – 2019
© 2009 by Amanda McCabe Originaltitel: „To kiss a Count“ erschienen bei: Mills & Boon, London Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l. Übersetzung: Petra Lingsminat Deutsche Erstausgabe 2011 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg,in der Reihe MYLADY, Band 538
© 2008 by Mary Nichols Originaltitel: „The Earl and the Hoyden“ erschienen bei: Mills & Boon, London Published by arrangement with HARLEQUIN ENTERPRISES II B.V./S.àr.l. Übersetzung: Corinna Wieja Deutsche Erstausgabe 2010 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg,in der Reihe MYLADY HOCHZEIT, Band 1
Abbildungen: Harlequin Books S. A., TravelPics / Getty Images, alle Rechte vorbehalten
Veröffentlicht im ePub Format in 03/2019 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.
E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 9783733737221
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.
Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, TIFFANY
Das Geheimnis des italienischen Grafen
PROLOG
Sizilien
Oh, Miss Thalia, wir können unmöglich morgen abreisen. Da gibt es immer noch so viel zu tun.“
Thalia blickte von den Büchern und Papieren auf, die sie gerade einpackte, und sah ihre Zofe Mary durch das Zimmer eilen, die Arme voller Kleider. Am Boden standen mehrere geöffnete, halb gefüllte Truhen, aus dem Schrank und den Schubladen quollen Kleidungsstücke und Schuhe.
Lachend schüttelte Thalia den Kopf. „Also wirklich, Mary, in letzter Zeit sind wir so oft umgezogen, dass Sie eine wissenschaftliche Methode entwickelt haben müssten, um unsere Sachen zu packen.“
„So eilig hatten wir es noch nie“, klagte Mary. „Wenn ich alles ordentlich machen soll, brauche ich mehr Zeit.“
Thalia stimmte ihr zu. Normalerweise ging ihr Vater, Sir Walter Chase, seine Reisen etwas geruhsamer an. In gemächlichem Tempo waren sie durch Italien gefahren, hatten alle Sehenswürdigkeiten besichtigt und seine gelehrten Brieffreunde getroffen. Schließlich hatten sie sich in Sizilien niedergelassen. Aber nun war seine Arbeit in diesem Landesteil fast beendet. Er hatte die Ausgrabung der antiken Stadt gründlich studiert und danach einige seiner Aufzeichnungen den ortsansässigen Archäologen übergeben.
Inzwischen hatte Thalias ältere Schwester Clio ihre große Liebe geheiratet, den Duke of Averton, und mit ihm die Hochzeitsreise in orientalische Länder angetreten.
Auch Sir Walter hatte wieder den Bund der Ehe geschlossen und sich mit seiner langjährigen Gefährtin Lady Rushworth vermählt. In diesem Sommer würden sie mit seiner jüngsten Tochter Terpsichore, genannt Cory, nach Genf fahren. Sie hatten angenommen, auch Thalia würde mitkommen. Aber nach all den Ereignissen in den letzten Wochen war sie der Reisen müde und wollte nach Hause, nach England, zurückkehren. Ihre älteste Schwester Calliope, Lady Westwood, erwartete ihr erstes Kind und hatte in letzter Zeit jammervolle Briefe geschrieben, in denen sie wiederholt fragte, wann sie ihre Familie endlich wiedersehen würde.
Thalia glaubte, Calliope würde Clios Gesellschaft vorziehen, denn die beiden ältesten Chase-Musen standen sich sehr nahe. Und Clio war ungewöhnlich tüchtig. Aber da sie gerade ihre Hochzeitsreise unternahm, musste die werdende Mutter sich mit der zweitjüngsten Schwester begnügen, die als kapriziös und dramatisch galt. Perfekt geeignet, um Modistinnen zu besuchen oder Amateur-Theateraufführungen einzustudieren, aber nicht, um während einer Niederkunft von Nutzen zu sein …
Oder um schurkische Diebe einzufangen …
Sie schaute in den Spiegel über dem Toilettentisch. Durch die Fenster strömte das intensive Licht der sizilianischen Sonne ins Zimmer und verlieh ihrem offenen Haar die goldene Farbe von Sommernarzissen. Ihr herzförmiges Gesicht, die großen blauen Augen und den rosigen Teint fand sie hübsch genug. Natürlich lockte sie Bewunderer an – alberne Verehrer, die ihr selbst verfasste, miserable Gedichte widmeten und sie mit Porzellanschäferinnen und Frühlingstagen verglichen.
Diese Ansichten schienen ihre Verwandten zu teilen. Sie priesen ihre Schönheit, lächelten sie an, verwöhnten sie, doch sie dachten offenbar, hinter ihren blauen Augen würde sich nichts verbergen. Nur seidene Bänder und seichte Romane würden sie interessieren. Cal und Clio waren die gebildeten Mädchen, die Erbinnen, die eines Tages die Arbeit ihres Vaters fortsetzen sollten. Und Cory bewies ihr Talent als ernsthafte Malerin. Sie selbst hingegen galt nur als amüsant, ein hübsches Wesen, das die Mutter „belle fleur“ genannt hatte, ihre „schöne Blume“.
Oh, das sagten sie ihr selbstverständlich niemals ins Gesicht. Sie applaudierten ihren theatralischen Auftritten und tolerierten ihre schriftstellerischen Bemühungen. Aber was sie wirklich von ihr hielten, las Thalia in ihren Augen und hörte es aus dem Tonfall ihrer Stimmen heraus.
Zweifellos war sie anders, keine richtige Chase.
Sie wandte sich vom Spiegel ab und zog ihren Schal enger um die Schultern, als wäre der dünne Kaschmirstoff ein Panzer – ein Schutz vor Enttäuschungen.
In den letzten Wochen hatte sie gehofft, die seltsamen Ereignisse würden ihre Verwandten eines Besseren belehren und ihnen zeigen, wozu sie fähig war. Als Clio sie um Hilfe bei der Festnahme Lady Rivertons gebeten hatte, der Diebin eines seltenen, kostbaren hellenistischen Tempelsilbers, war Thalia überglücklich gewesen. Endlich konnte sie sich nützlich machen! Nun würde sie beweisen, dass sie eine echte Chase war.
Zunächst schien ihre List zu wirken und Lady Rivertons Komplizen aus der Reserve zu locken.
Doch dann ging alles schief. Lady Riverton war geflüchtet, vermutlich mitsamt dem Silber, und jetzt mussten Clio und ihr Ehemann die Frau aufspüren. An dieser Verfolgungsjagd nahm Thalia nicht teil. Weder für ihre Schwester noch für ihren Vater hatte sie sich als hilfreich erwiesen.
Und auch nicht für den Mann, den sie ganz besonders beeindrucken wollte – Conte Marco di Fabrizzi, ihr Partner bei den Theateraufführungen und diversen Streitereien. Nie zuvor hatte sie einen attraktiveren Mann gekannt als den italienischen Archäologen und Aristokraten. Bedauerlicherweise glaubte sie, er wäre hoffnungslos in Clio verliebt.
Die Schwestern neckten sie, weil sie alle Verehrer abwies. Aber keiner konnte sich mit Marco messen. Ihr Pech – endlich hatte sie einen leidenschaftlichen, wundervollen Mann gefunden, und er liebte ihre Schwester!
Seufzend ergriff sie wieder ihre Bücher und Papiere und packte sie in die Truhe. Ein Manuskript entglitt ihren Händen, einzelne Blätter flatterten auf den Teppich hinab. Während sie niederkniete, um sie einzusammeln, fiel ihr Blick auf die Titelseite. „Das dunkle Schloss des Grafen Orlando – eine italienische Romanze in drei Akten“.
Dieses Theaterstück hatte sie zu schreiben begonnen, als ihr Marco begegnet war, am Anfang des Abenteuers um das gestohlene Tempelsilber. Eine grandiose Geschichte aus der italienischen Renaissance, voller Wirrungen um eine aufkeimende und verlorene Liebe, um niederträchtige Schurken, Geister und Flüche. Durchdrungen von einer Leidenschaft, die alles andere übertraf. So begeistert war sie gewesen. Und jetzt? Alles umsonst.
Sie glättete die Blätter, umwand das ganze Manuskript mit einer Schnur und legte es in die Truhe. Vielleicht würde sie es eines Tages herausnehmen und über ihre törichten Fantasien von Abenteuern und wahrer Liebe lachen. Jetzt musste sie Mary helfen, die restlichen Sachen einzupacken. In England wartete das wirkliche Leben.
Vor dem Fenster frischte die Brise auf, die Blätter des Zitronenbaums raschelten. Thalia ging zum Fenster, um es zu schließen, und schaute in den Garten hinab, zu den pastellfarben gestrichenen Häusern jenseits der Pforte. So schön war die sonnenhelle alte Stadt Santa Lucia – und voller Geheimnisse. Werde ich im kühlen grünen England diese schläfrige Hitze, den strahlend blauen Himmel und die felsigen Hügel vermissen? fragte sich Thalia.
Während die Kirchenglocken läuteten und die Stunde anzeigten, trugen die Dienstboten die Truhen und Koffer nach unten und stapelten sie im Garten neben dem Brunnen. Über das Fensterbrett gebeugt, beobachtete Thalia, wie sich immer mehr Gepäck anhäufte – wie ihr die Zeit in Santa Lucia davonlief. Die Brise wehte ihr das Haar in die Stirn. Ungeduldig wischte sie die Strähnen beiseite – und da sah sie ihn, Marco. Langsam ging er zur Gartenpforte.
Sie hatte gehört, nach Clios Hochzeit sei er abgereist. Aber da war er. Jetzt lehnte er sich an die Pforte und schaute dem geschäftigen Leben und Treiben vor dem Haus zu, das attraktive gebräunte Gesicht völlig ausdruckslos. Auf dem gewellten blauschwarzen Haar schimmerte das Sonnenlicht.
Ohne lange zu überlegen, eilte Thalia aus dem Zimmer, die Treppe hinab und zur Vordertür nach draußen. Sie wich den Lakaien aus, die noch mehr Gepäck in den Garten schleppten. Schließlich blieb sie vor Marco stehen. Nur das niedrige schmiedeeiserne Gatter trennte sie von ihm. Genauso gut hätte es ein Meer sein können.
Marco richtete sich auf und lächelte sie an. Wie wundervoll er aussah mit den hohen, markanten Wangenknochen, der edlen italienischen Nase, den glänzenden schokoladenbraunen Augen … Nur die dunklen Bartstoppeln rings um das Kinn störten seine klassische männliche Schönheit ein wenig. Wie ein griechischer Gott in seinem Tempel, ein römischer Eroberer auf einer antiken Münze, dachte sie. Und wie mein Graf Orlando in seinem dunklen Schloss …
In den letzten Jahren war sie schon vielen attraktiven Männern begegnet – ihren Schwägern, ihren eigenen Verehrern. Aber Marco hatte noch mehr zu bieten als seine gewinnende äußere Erscheinung – eine feurige Leidenschaft, kaum verschleiert von höflicher Galanterie. Eine scharfe Intelligenz. Und Geheimnisse. Viele Geheimnisse, die Thalia ergründen wollte.
Trotz der berühmten Chase-Hartnäckigkeit bezweifelte sie, dass es ihr jemals gelingen würde, seine verborgene Seele zu erforschen. Viel zu geschickt versteckte er sich hinter seinen hervorragenden schauspielerischen Fähigkeiten. Selbst wenn sie zehn Jahre Zeit dafür hätte, niemals könnte sie sein wahres Ich entdecken.
Und ihr blieben keine zehn Jahre, nicht einmal zehn Minuten. Wehmütig erinnerte sie sich an die gemeinsamen Stunden im alten Amphitheater, an Diskussionen, Gelächter – vorgetäuschte Liebe bei den Proben des Theaterstücks. Goldene Stunden, die sie niemals vergessen würde.
Ihn würde sie niemals vergessen.
„Ich dachte, du hättest Santa Lucia verlassen, Marco“, sagte sie leise.
„Und ich dachte, du wärst abgereist, Thalia.“ Wieder schenkte er ihr sein herzzerreißendes Lächeln mit dem Grübchen neben einem Mundwinkel. Ihr Renaissancefürst. Der zufällig ihre Schwester liebte. Entschlossen schaute sie weg und bot ihre eigenen schauspielerischen Fähigkeiten auf – alles, was sie in den letzten aufregenden Wochen erlernt hatte, um ihre wahren Gefühle vor Marco zu verbergen. Wie gut erinnerte sie sich an seine traurige Miene bei Clios Hochzeit – und das verlieh ihr die Kraft, das Lächeln scheinbar sorglos zu erwidern.
„Für eine überstürzte Abreise mussten wir zu viele Sachen packen, wie du siehst“, erwiderte sie und zeigte auf die Truhen und Koffer. „Die Skizzenbücher meiner Schwester Cory, die umfangreichen Notizen meines Vaters über seine Arbeit …“
„Und deine ‚Antigone‘-Kostüme?“
„Ja, die auch.“ Nun wandte sie sich wieder zu ihm. Mit seinen dunklen Augen schien er sie aufmerksam zu mustern. Doch sie las nichts darin, keine Spur jener sonderbaren Freundschaft, die auf der alten Bühne entstanden war. Keine Vergangenheit, keine Zukunft. Jetzt gab es nur noch diesen einzigen, kurzen gemeinsamen Moment.
„Tut mir leid, dass wir das Schauspiel des Sophokles nicht aufführen konnten, Thalia.“
„Mir auch. Dafür haben wir genug andere dramatische Szenen erlebt, nicht wahr?“
Lachend nickte er. Und dieses wundervolle heitere Gelächter weckte den Wunsch, einzustimmen, ihre Arme um seinen Nacken zu schlingen und ihn niemals, niemals loszulassen. Bald würde sie in ein Leben der grauen, banalen Realität zurückkehren. Dann würde sie wieder die hübsche, unnütze, launische Thalia sein – und ihr Abenteuer in Sizilien nur mehr ein schöner Traum, eine warme Erinnerung für kalte Nächte.
„Sicher bist du der schrecklichste Geist, der jemals in Sizilien gespukt hat“, meinte er.
„Was für ein zauberhaftes Kompliment! Einen so gespenstischen Ort wie diesen habe ich nie zuvor gesehen. Vielleicht …“ Ihre Stimme erstarb, und sie wich seinem Blick erneut aus.
„Vielleicht – was?“
„Wenn es auch eigenartig klingen mag – vielleicht werde ich eines Tages als Geist hierher zurückkehren“, sprudelte sie hervor. Ihr Herz schien am Rand eines Abgrunds zu schwanken. Wenn es einfach hinabstürzen würde – zu ihm … Ihre Familie hielt sie für furchtlos und entschlossen. Aber irgendetwas, ein verborgener Hang zur Vorsicht, hielt sie zurück. In die emotionale Tiefe schienen winzige Kieselsteine zu rieseln. „Ich frage mich, ob mein wahres Selbst zurückbleiben – und verloren um die Ruinen der alten Agora herumwandern – wird.“
Behutsam berührte Marco ihre Hand – eine federleichte Liebkosung, nur Fingerspitzen auf ihrer Haut. Trotzdem entfachte die Zärtlichkeit wilde Flammen – ein Feuer, das sie ersehnte, obwohl sie wusste, es würde sie verzehren und jenen bleichen Geist zurücklassen, den sie fürchtete.
„Was ist dein wahres Selbst, Thalia?“ Sein sonniger italienischer Humor verwandelte sich in beängstigende Intensität. Konnte er in ihre Seele schauen? „Obwohl du eine hervorragende Schauspielerin bist, glaube ich etwas zu sehen …“
„Thalia!“, hörte sie ihren Vater von der Haustür her rufen. „Mit wem sprichst du da?“
Einerseits war sie dankbar für die Störung, andererseits trauerte ihr Herz diesem letzten Moment der Zweisamkeit nach. Noch immer wartete der Abgrund. Doch vorerst würde sie nicht hinabfallen. „Conte di Fabrizzi, Vater!“, antwortete sie und starrte immer noch Marcos Hand auf ihrer eigenen an.
Jetzt zog er seine Finger zurück, der magische Augenblick war vorbei.
„Bitte ihn doch herein!“, sagte ihr Vater. „Ich möchte ihn nach seiner Meinung fragen – es hängt mit den Münzen zusammen, die Clio gefunden hat.“
„Natürlich.“ Thalia lächelte Marco an. „Was es zu sehen gibt, bleibt dir nicht verborgen“, flüsterte sie. „Ich bin ein offenes Buch.“
„In meinem Leben habe ich schon viele Lügen gehört, Thalia. Aber eine so ungeheuerliche noch nie. Deine Schwester Clio – ja, sie ist ein offenes Buch. Aber du, Thalia, gleichst dem sizilianischen Himmel – eben noch stürmisch, im nächsten Moment strahlend, niemals berechenbar.“
Schätzte er sie tatsächlich so ein? Wenn ja, hatte ihr noch niemand ein schöneres Kompliment gemacht. Aber er sah und verstand sie noch immer nicht. Nicht ganz. „Du hast mich unter höchst ungewöhnlichen Umständen kennengelernt, Marco. Zu Hause, in meinem wahren Leben, bin ich so berechenbar wie der Mond.“
„Noch eine Lüge, nehme ich an. Vielleicht werde ich dich eines Tages in diesem ‚wahren Leben‘ sehen und die wahre Thalia Chase beurteilen.“
Wenn es doch so wäre – wenn sie einander wirklich noch einmal begegnen würden und sie ihm beweisen könnte, Clio wäre niemals die Richtige für ihn gewesen … Dann würde sie ihm ihre echten Gefühle zeigen, ihm verraten, was er ihr bedeutete.
Nur ein hoffnungsloser Traum … Während sie Sizilien verließ und nach England segelte, würde er in seine Heimatstadt Florenz zurückkehren. Sicher würden sie sich nie wiedersehen.
Und in den nächsten Jahren würde sie mit ihren Erinnerungen an Marco leben.
1. KAPITEL
Bath
Ist es möglich, dass ich erst vor wenigen Monaten in Sizilien war?, schrieb Thalia in ihr kleines Tagebuch mit dem Ledereinband. Während die Kutsche dahinpolterte, lag es auf ihrem Schoß. Es muss ein Traum gewesen sein. Denn wenn ich jetzt aus dem Wagenfenster schaue, weiß ich es – ich bin zweifellos erwacht.
Das frische Grün der Hecken, die von Hecken umgebenen Felder und die Dörfer mit den Fachwerkhäuschen – einen größeren Unterschied zu den sizilianischen Ebenen, die sich unter einer sengenden Sonne erstreckten, konnte es nicht geben. Sie schloss die Augen, und sekundenlang glaubte sie Zitronenduft in heißer Luft zu riechen, eine warme Brise auf ihrem Arm zu spüren, wie eine flüchtige Liebkosung.
Aber dann holperte die Kutsche durch eine Furche in der englischen Straße und riss sie aus ihren Erinnerungen.
Wehmütig hob sie die Lider und lächelte ihre Schwester an, die ihr gegenübersaß. Calliope de Vere, Lady Westwood, erwiderte das Lächeln. Trotz der Decken und Kissen, die sie einhüllten, trotz des Tees und der Hühnersuppe, die sie ihr immer wieder aufdrängte, war sie viel zu blass. In dem bleichen Gesicht wirkten die braunen Augen übernatürlich groß.
Diese Blässe gehörte zu den Gründen für die Reise nach Bath. Von der langwierigen, problematischen Geburt ihres Töchterchens Psyche hatte Calliope sich noch immer nicht erholt. Wegen ihres mangelnden Appetits musste sie sich zum Essen zwingen. Und ihr fehlte die Energie, um wie üblich alles zu organisieren und ihre Mitmenschen herumzukommandieren. Nun hoffte Thalia, ihr Schwager Cameron würde recht behalten. Er hatte erklärt, das Heilwasser in Bath würde die Genesung seiner Gemahlin beschleunigen. Letzte Woche war er vorausgefahren, um ein passendes Haus zu mieten.
Inzwischen hatte Thalia die Reisevorbereitungen getroffen, eine Kinderfrau und Personal engagiert und das Londoner Haus geschlossen. Über all der Hektik hatte sie Sizilien und Marco beinahe vergessen. Nur beinahe.
„Was schreibst du da?“ Calliope inspizierte den Korb, in dem Psyche zwischen Satindecken schlummerte. Glücklicherweise war die Kleine eingeschlafen, nachdem sie stundenlang gejammert hatte. „Ein neues Theaterstück?“
„Nur ein paar Notizen in mein Tagebuch“, antwortete Thalia und steckte den kleinen Band in ihre Reisetasche. „Mit einem neuen Drama habe ich noch nicht angefangen.“
„Leider ist das meine Schuld“, seufzte Calliope. „Seit deiner Rückkehr aus Italien habe ich dich dauernd beansprucht. Deshalb hast du kaum Zeit zum Atmen gefunden.“
„Das stört mich kein bisschen. Wozu sind Schwestern da, wenn sie einander in schweren Zeiten nicht helfen?“
„Dann dürfen wir uns glücklich schätzen, weil wir so reich mit Schwestern gesegnet sind!“ Calliope lachte leise. „Und jetzt gibt es auch noch Nichten und Stiefmütter.“
„Jedenfalls sind wir eine großteils weibliche Familie.“ Thalia betrachtete Psyche, die auf trügerische Weise engelsgleich aussah, von rosa Spitze umgeben, mit den weichen schwarzen Löckchen, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte. Als Thalia eine Strähne aus der kleinen Stirn strich, rümpfte das Baby die Nase. „Schon jetzt hat sich deine kleine Tochter als echte Chase erwiesen.“
Lächelnd nickte Calliope. „Zumindest besitzt sie einen eisernen Willen.“
„Und passende Lungen.“
„Ich fürchte, sie wird sich ihr Leben lang entschieden bemerkbar machen.“
„Wird sie ihrer Tante Clio nacheifern?“
„Einer Duchess? Vielleicht.“ Calliope ordnete die Deckchen um Psyches Schultern. Dann lehnte sie sich in die Polsterung ihres Sitzes zurück. „Wie ich gestehen muss, war ich verblüfft über Clios Heirat. Unsere Schwester und Averton konnten einander nicht ausstehen! Nach allem, was in Yorkshire passiert war …“
Thalia erinnerte sich an Clios Hochzeit in der protestantischen Kirche von Santa Lucia. Glückstrahlend hatte die Braut die Hand ihres Dukes ergriffen und das Ehegelübde gesprochen. Dann hatte er ihren Schleier gehoben und sie geküsst, und die beiden waren in ihrer eigenen sonnenhellen kleinen Welt versunken. „Unter dem italienischen Himmel können magische Dinge geschehen.“
„Offensichtlich.“ Unter der schmalen Hutkrempe musterte Calliope ihre Schwester, die den prüfenden Blicken unbehaglich auswich.
In der Kindheit hat Calliope stets Bescheid gewusst, wenn ich unartig war, erinnerte sich Thalia, und mir mühelos schuldbewusste Geständnisse entlockt. Daran hatte sich nichts geändert.
„Und du, meine Liebe?“, fragte sie. „Wurdest auch du von der italienischen Magie beeinflusst?“
Thalia schüttelte den Kopf. „Unglücklicherweise nicht – ich bin dieselbe wie zuvor.“ Sie merkte, dass Calliope ihr nicht glaubte, aber anscheinend zu ermattet war, um sie zu bedrängen.
Vorerst. „Arme Thalia! Nach diesem wundervollen Urlaub musst du meine Pflegerin spielen. Jetzt verschleppe ich dich auch noch in das verstaubte alte Bath. Ich fürchte, die Upper Rooms sind der Faszination alter Ruinen nicht gewachsen. Oder dem Charme italienischer Männer und ihren dunklen Augen!“
Thalia wandte sich zu ihr und versuchte herauszufinden, was der Hinweis auf die „dunklen Augen“ bedeuten mochte. Weiß sie etwas, und will sie mich hänseln? Aber Calliope schenkte ihr nur ein unschuldiges Lächeln.
„Oh, keine Bange, ich setze gewisse Hoffnungen in Bath“, erwiderte Thalia leichthin. „Das Theater, die Parks, die römischen Ausgrabungen. Und reiche Männer, die Erlösung von ihrer Gicht und junge Gemahlinnen suchen, die sie in den Rollstühlen umherschieben. Vielleicht werde ich einem übergewichtigen deutschen Fürsten begegnen und Clio noch ausstechen! Fürstin Thalia. Wäre das nicht nett, Callie?“
Calliope lachte. Endlich erschien ein rosiger Hauch in ihren bleichen Wangen. „Vielleicht wird es nett klingen, bis du in einem zugigen hessischen Schloss landest. Und das würde dir gar nicht gefallen.“
„Da hast du sicher recht. Eisige Wintertage und kalte Schlösser können mich nicht begeistern.“
„Nachdem du die italienische Sonne genossen hast?“
„Genau. Aber ich werde mich in Bath wohlfühlen – vor allem, wenn ich sehe, wie du wieder zu Kräften kommst. Die Heilquelle wird dir guttun.“
„Hoffentlich. Ich bin es so müde, ständig müde zu sein.“
Zum ersten Mal hörte Thalia eine Klage aus dem Mund ihrer Schwester. Besorgt neigte sie sich vor und strich die Decke über Calliopes Knien zurecht. „Hast du Schmerzen? Sollen wir anhalten? Willst du dich ausruhen? Dieses infernalische Holpern und Schwanken …“
„Nein, nein.“ Calliope hielt Thalias Hand fest und beendete die fürsorglichen Bemühungen. „Sicher ist es nicht mehr weit bis Bath. Bevor die Dunkelheit hereinbricht, werden wir unser Ziel erreichen. Und ich sehne mich nach Cameron.“
„So wie er sich nach dir sehnt.“ Seit der Hochzeit hatten Calliope und ihr Ehemann sich nur selten getrennt. So innig hingen sie aneinander. Wie sie das aushielten, verstand Thalia nicht.
„In seinem letzten Brief erwähnte er ein schönes Haus direkt am Royal Crescent, das er gefunden hat. Dort sind wir in der Nähe aller wichtigen Schauplätze. Natürlich sollst du dich amüsieren und nicht ständig neben meinem Krankenbett sitzen.“
Lachend verdrehte Thalia die Augen und versuchte ihre Sorge zu überspielen. „Welches Krankenbett? Du wirst frisch und munter durch die Trinkhalle promenieren. Und ich möchte nur mit dir und der kleinen Psyche zusammen sein. So lange haben wir uns nicht gesehen.“
„Viel zu lange. Wenn doch Clio auch hier wäre!“ Calliope drückte Thalias Hand. „Dann wäre unser kleines Trio wieder vollständig.“
Diesen Moment wählte Psyche, um zu erwachen und einen schrillen Schrei auszustoßen, der die mit schimmernder Seide verkleideten Innenwände der Kutsche erschütterte.
„Jetzt wären wir ein Quartett“, stöhnte Calliope und hob ihre Tochter aus dem Korb.
Thalia schaute aus dem Fenster. Nun rollte der Wagen eine der Brücken entlang, die über den Avon nach Bath führten. Fünf imposante Brückenbögen boten einen Ausblick auf die Stadt und die Hügel dahinter.
Trotz der dramatischen italienischen Landschaften, die sie bewundert hatte, musste Thalia auch die Schönheit von Bath anerkennen. Terrassenförmig zog sich die Stadt an den Hängen empor, die Häuser aus hellem goldgelbem Stein errichtet, und glich den Schichten einer fantasievollen Hochzeitstorte. Als eine Chase, die Tochter und Enkelin hervorragender Altertumsforscher, wusste Thalia die klassischen Linien zu schätzen, die geordneten Säulenreihen und stilvollen Häuser.
Aus der Ferne nahm sie den Schmutz und den Lärm nicht wahr, jene unangenehmen Dinge, die zu allen Städten gehörten. Von der Brücke aus betrachtet erschien ihr Bath wie eine Puppenstadt, nur zum Vergnügen errichtet, für geruhsame Spaziergänge, höfliche Konversation, Gesundheit und Geselligkeit. Oder für neue Träume – wenn sie hier zu finden wären.
Während Psyche unentwegt schrie, fuhren sie von der Brücke in die Stadt. In einem schier endlosen Verkehrsstrom holperte die Kutsche über gepflasterte Straßen. Thalia musterte elegant gekleidete Menschen in Landauern und sah flotte junge Paare auf hohen Phaetons sitzen. Auf den Gehsteigen führten die Fußgänger ihre modischen Extravaganzen vor, verfolgt von beflissenen, mit Einkaufspaketen beladenen Dienstmädchen.
In den Schaufenstern prangte eine Vielfalt erlesener Waren – weicher Samt und schimmernde Seide, Hüte, Bücher und Lithografien, Porzellan, funkelnde Pyramiden aus Süßigkeiten. Melancholisch erinnerte Thalia sich an das staubige kleine Santa Lucia, die alten Märkte, die winzigen Läden. Sie öffnete das Fenster und atmete das Potpourri der Gerüche ein – Leder, Pferde, Zimt aus einer Bäckerei, das schwache metallische Aroma des Heilwassers, das über der ganzen Stadt hing. In der Tat, jetzt war sie unendlich weit von Sizilien entfernt. Und keiner der Männer, die sie dahinschlendern sah, glich Marco di Fabrizzi.
Beruhigend wiegte Calliope das Baby hin und her. Die Stadt schien sogar Psyche zu interessieren. Schließlich verstummte das Gebrüll, und sie sah sich mit großen braunen Augen um.
„Da siehst du es, Thalia, so übel ist Bath gar nicht“, bemerkte Calliope. „Das findet sogar Psyche. Schau doch, da hängt ein Plakat – nächste Woche wird im Theatre Royal ‚Romeo und Julia‘ aufgeführt! Da müssen wir unbedingt hingehen. Ein bisschen Italien, mitten in Bath.“
Thalia lächelte ihre Schwester und Psyche an, die ihre winzigen Finger in den Mund steckte, während sie, so schien es zumindest, das Sonnenlicht auf dem goldgelben Bath-Gestein bewunderte. „Natürlich gehe ich sehr gern ins Theater, Callie. Aber du darfst dich nicht überanstrengen. Etwas später können wir uns die Aufführung immer noch anschauen.“
„Pah! Wenn ich im Theater sitze, wird es mir wohl kaum schaden – es sei denn, jemand wirft mir eine Orange an den Kopf.“ Entschlossen hob Calliope ihr Kinn. „Falls du glaubst, ich lasse mich ans Bett fesseln, irrst du dich.“
Nun verließen sie die belebten Straßen und erreichten die komfortable Stille des Royal Crescent. Der exklusive Stadtteil, den Cameron für den Aufenthalt gewählt hatte, bestand aus dreißig bogenförmig angeordneten Häusern, in täuschend schlichtem palladianischem Stil für die wohlhabendsten und vornehmsten Bewohner von Bath errichtet. Wie verwirrt wären die snobistischen Bauherrn, dachte Thalia, könnten sie die Ankunft zweier Blaustrümpfe und eines brüllenden Säuglings beobachten! Selbst wenn Cal eine Countess ist … Noch nie hatten sich die Chase-Mädchen mit spießigen Gedanken befasst – reine Zeitverschwendung.
Aber wie sie zugeben musste, passte die schöne Straße zu ihren antiken Studien. Langsam folgte die Kutsche der sanften sichelförmigen Kurve, vorbei an makellos geschrubbten Eingangsstufen und strengen Säulenreihen. Die Häuser strahlten eine Aura von Stille und Wohlstand aus, perfekt für Calliopes Genesung.
„Hier können wir am Morgen spazieren gehen.“ Calliope zeigte auf einen Weg, der gegenüber der Häuserreihe an einem ausgedehnten Rasen vorbeiführte. „In den Crescent Fields.“
„Nur wenn es früh genug ist! Natürlich wollen wir nicht von der fashionablen Hautevolee überrannt werden, die hier so gern promeniert.“ Thalia beobachtete ein Paar, das dahinschlenderte – die Dame in einem bestickten gelben Spenzer über einem türkisblauen Kleid, auf dem Kopf einen Hut mit wippenden Federn, die Leine eines eifrig trippelnden Mopses in der Hand. Unter der breiten Hutkrempe war ihr Gesicht verborgen; sie nahm sogar teilweise die Sicht auf das Profil ihres hochgewachsenen Begleiters.
Trotzdem erschien er ihr irgendwie bekannt. Die breiten Schultern in edlem dunkelblauem Wollstoff … Kannte sie ihn?
Doch Thalia fand keine Zeit, um darüber nachzudenken, denn die Kutsche hielt vor einem Haus nahe dem Ende der geschwungenen Häuserzeile. Ein Lakai eilte die Eingangsstufen herab und öffnete den Wagenschlag, dicht gefolgt von Calliopes Ehemann.
Cameron de Vere, der Earl of Westwood, ist genau der Richtige für meine Schwester, dachte Thalia wie schon so oft. Beide dunkelhaarig und attraktiv, herzensgut und dem Studium des klassischen Altertums treu ergeben. Während der Earl humorvoll und lebensfroh war, neigte Calliope zu intensivem Ernst. Dadurch ergänzten sie einander perfekt. Zweifellos führten sie eine überaus glückliche Ehe.
Diesmal wirkte auch Cameron ungewöhnlich ernst, als er die Hand seiner Frau ergriff und ihr behutsam aus der Kutsche half. Thalia hielt Psyche im Arm und beobachtete, wie Calliope und Cameron einander umarmten, ohne die Passanten auf dem Crescent zu beachten. So vorsichtig drückte Cameron seine Gemahlin an sich, als wäre sie eine kostbare Skulptur aus antikem Alabaster.
Und Calliope schmiegte sich an ihn, den Kopf auf seiner Schulter, und erweckte den Eindruck, sie wäre nach langen Irrwegen endlich heimgekehrt.
Bei diesem Anblick verspürte Thalia einen schmerzhaften Stich im Herzen; das Gefühl qualvoller Einsamkeit übermannte sie. Wie gut die beiden zueinander passten! Wie zwei Hälften einer römischen Münze. Und wie allein ich bin …
Doch sie wollte ihre Zeit nicht mit Selbstmitleid vergeuden. Das entsprach nicht ihrem Charakter. Außerdem war es sinnlos, einem Traum nachzutrauern, der sich nicht erfüllen würde. Und es gab so vieles, was sie besaß, so viel, was sie zu tun vorhatte.
Der Lakai half ihr auf die Straße, und sie überreichte Psyche der wartenden Kinderfrau, die den Herrschaften mit den anderen Dienstboten im zweiten Wagen gefolgt war. Während das Baby ins Haus getragen wurde, brüllte es lauter denn je.
„Thalia!“ Der Schwager küsste ihre Wange. „Wie gesund und hübsch du aussiehst, meine Liebe. Schon jetzt scheint die Luft von Bath dir gutzutun.“
Spielerisch schlug Calliope auf den Arm ihres Ehemanns. „Oh, sie ist hübsch und sieht blühend aus – und ich, deine arme Gemahlin, bin eine blasse Kranke?“
„Niemals habe ich behauptet, du wärst arm …“, protestierte Cameron scherzhaft.
„Also nur bleich?“
„Keineswegs. Wie immer bist du meine griechische Rose. Und jetzt, meine Schöne, lass dir dein neues Heim zeigen.“ Er hob Calliope auf seine Arme, trug sie die niedrigen Stufen hoch und unter dem klassizistischen Portikus ins Haus. Obwohl Callie protestierte, merkte Thalia ihr an, wie müde und dankbar sie für die Hilfe war.
Am Straßenrand stand eine Hutschachtel, die ein Lakai zurückgelassen hatte. Thalia hob sie hoch und eilte hinter dem Ehepaar über die Schwelle. Die Eingangshalle – kühl und dunkel nach dem sonnigen Tag, mit einem Fliesenboden und einer Tapete, die hellem Marmor glich – roch nach frischen Blumen und Zitronenpolitur. Durch einen Torbogen erreichten sie eine innere Halle mit hoher Decke, wo eine geschwungene Treppe zu den oberen Etagen führte. Irgendwo da oben war Psyche bereits angelangt und protestierte lautstark gegen die neue Umgebung.
Cameron trug seine Frau in einen Salon, dessen Wände mit goldfarbenem Damast bespannt waren. Die Vorhänge bestanden aus dem gleichen Stoff. Um einen Teetisch gruppierten sich Sofas und Sessel, mit korallenroter Seide bezogen. Für die Neuankömmlinge waren bereits Erfrischungen angerichtet worden.
Zwischen den Fenstern standen ein Pianoforte und eine Harfe. Als Cameron seine Frau auf ein Sofa setzte, inspizierte Thalia die Instrumente. „Sehr schön“, meinte sie. Ihre Finger glitten über die Klaviertasten, eine kleine Melodie erklang. „Abends werde ich euch etwas vorspielen, Cal. In Italien habe ich viele neue Lieder gelernt.“
„Schon immer habe ich dir gerne zugehört, Liebes“, antwortete Calliope und nahm von ihrem Ehemann eine Tasse Tee entgegen. Dann schlug sie seine Hand weg, als er eine Decke über ihre Knie breiten wollte. „Aber du verdienst ein größeres Publikum für dein Talent. So ein schönes Zimmer – hier müssen wir Kartenpartys oder musikalische Soireen veranstalten, sobald wir genug neue Bekannte in Bath gefunden haben.“
„Callie, du musst dich ausruhen!“, riefen Thalia und Cameron wie aus einem Mund.
Dann lachten sie alle, und Cameron fuhr fort: „Vergiss nicht, was die Ärzte gesagt haben. Viel Ruhe und Stille. Und jeden Tag Heilwasser.“
Ungeduldig winkte Calliope ab. „Beim Jupiter, ihr beide führt euch auf, als hätte ich soeben verkündet, ich würde den Kanal in einem Ruderboot überqueren! Eine kleine Kartenparty wird mich gewiss nicht überfordern. Und Thalia braucht ein bisschen Amüsement, sonst wird sie uns bald verlassen und nach Italien zurückkehren.“
„Natürlich verlasse ich dich nicht, Callie. Stattdessen werde ich hierbleiben und dich betreuen. Umso schneller wirst du genesen.“ Thalia nahm ihren Hut ab und schaute durch ein Fenster zum Park hinüber. Viele Leute wanderten vorbei. Aber nicht der hochgewachsene Mann im dunkelblauen Gehrock – der ihr so vertraut erschienen war.
Sicher nur ein Trugbild ihrer Fantasie …
2. KAPITEL
Marco warf seinen Hut auf den nächstbesten Tisch und sank auf den einzigen Stuhl in seinem Zimmer. Die Stirn gerunzelt, beobachtete er, wie sich die Schatten auf dem polierten Boden verlängerten. Um diese Stunde war es ruhig im White Hart Inn, denn alle Gäste hatten sich in ihre Räume zurückgezogen, wo sie ihre Vorbereitungen für die Konzerte oder Partys des Abends trafen. Nicht einmal in den Korridoren und den Salons herrschte das übliche Kommen und Gehen.
Aber Marco hegte keineswegs ruhige Gedanken. Stattdessen wirbelten sie in wildem Aufruhr durch sein Gehirn, gefangen in einem Labyrinth, aus dem es anscheinend kein Entrinnen gab. So erging es ihm seit seiner Ankunft in Bath, der hellen Stadt auf den Hügeln, die angeblich so respektabel und langweilig war. Nichts dergleichen! Philosophische Lektionen und Promenaden durch die Trinkhalle schienen dazu zu dienen, dunkle Tiefen zu verbergen. Oder eher Menschen mit Geheimnissen und fragwürdigen Absichten.
Seit über einer Woche hielt er sich hier auf und versuchte sich mit Lady Riverton anzufreunden, ihr Vertrauen zu gewinnen – oder wenigstens an ihre Papiere und ihren Tresor heranzukommen, der so sorgsam in ihrer Villa am Stadtrand bewacht wurde. Wo versteckte sie das Tempelsilber aus Santa Lucia? Bisher hatte ihm seine Mühe nur Kopfschmerzen eingebracht, die vom unentwegten Gejaule ihres Mopses herrührten.
Und vom unschätzbar wertvollen antiken Silber war er weiter entfernt denn je.
„Maledetto“, murmelte er. Vielleicht war er ein Narr gewesen, weil er geglaubt hatte, mit Charme und Schmeicheleien würde er diese wichtige Mission besser bewältigen als mit brutaler Gewalt. Nämlich auf wirksamere, unerwartete Weise. An den Umgang mit raubeinigen tombaroli, die Antiquitäten aus unentdeckten Ruinen und Gräbern stahlen, war Lady Riverton immerhin gewöhnt. Einen Verehrer, der mit ihr flirtete, würde sie nicht erwarten.
Und tatsächlich, sie schien ihn zu mögen. Es gefiel ihr, wenn er sie auf ihren Spaziergängen durch Bath begleitete. Aber wenn er das Silber nicht in absehbarer Zeit rettete, musste er eine neue Taktik anwenden. Weil er sich wie ein idiotischer Gigolo vorkam, während er um eine kichernde Frau herumscharwenzelte, die er verachtete!
Manchmal, wenn sie seinen Arm nahm und ihn anschmachtete, sah er nicht ihr Gesicht, von braunen Ringellöckchen umrahmt, sondern Thalias herausfordernde blaue Augen. Ein klares, strahlendes Blau, das sich stürmisch verdüsterte, wenn sie mit ihm stritt – oder im Kerzenlicht die Farbe grauen Nebels annahm … Keine Frau hatte ihn so sehr fasziniert, seit er in Maria verliebt gewesen war. Arme Maria – so schön, so unglücklich in ihrer Liebe …
In Sizilien hatte ihn die zauberhafte, intelligente Thalia Chase tief beeindruckt. Wüsste sie, wie behutsam er jetzt bei Lady Riverton vorging, würde sie geringschätzig seufzen. An seiner Stelle würde sie einen energischen Kampf vorziehen, vielleicht mit gutem Grund. Diese bedeutsame Mission konnte er nur mit zielstrebigen, kämpferischen Methoden zum Erfolg führen. Das würden ihm auch seine alten Freunde in Florenz und Neapel empfehlen, die seinen Traum von der Unabhängigkeit Italiens, von der Rückkehr zum einstigen Ruhm teilten. Aber dummerweise hoffte er immer noch auf eine andere, weniger martialische Strategie. Deshalb musste er das Silber finden.
Er stand auf und ging zu dem Schreibtisch in einem kleinen Alkoven. Darauf häuften sich Bücher und Papiere, die Seiten der Abhandlung, die er gerade verfasste. Darin verarbeitete er seine Erkenntnisse in Santa Lucia, die Erinnerung an eine friedliche, wohlhabende griechische Stadt mit einer großen Agora und einem Amphitheater. Eine fruchtbare, schöne Gegend, wo die Bauern Gerste, Oliven und Trauben geerntet, wo reiche Familien ihre Ferienvillen gebaut hatten. Eine wunderbare Kultur, mit der Verehrung Demeters und ihrer Tochter Persephone im Mittelpunkt …
Dank dieser Verehrung war das kunstvolle Tempelsilber entstanden. Reich verzierte Becher, Schüsseln für Trankopfer, Schöpfkellen und Weihrauchgefäße – geheiligte Gegenstände, der Erdgöttin gewidmet, die diesem Land seinen Reichtum geschenkt hatte. Bis die friedliche Gemeinde von den römischen Eindringlingen und ihren Söldnern vernichtet worden war. Grausam hatten sie alles geplündert, niedergebrannt, getötet und die Überlebenden versklavt. Kurz vor der Invasion des römischen Heeres hatte ein frommer Bauer das Silber aus dem Tempel geholt und in seinem Keller versteckt.
Dort hatten es die tombaroli, von Lady Riverton angeheuert, ausgegraben. Nun ergänzte es ihre heimliche Sammlung kostbarer gestohlener Altertümer aus der hellenistischen Periode, Stücke von hohem symbolischem Wert. Das Erbe einer erhabenen Kultur, die barbarische Eindringlinge zerstört hatten, ein weiterer verlorener Teil von Italiens Vergangenheit …
Marco setzte sich an den Schreibtisch und griff nach der Feder. Diese Geschichte musste er niederschreiben. Aber noch wichtiger wäre es natürlich, das Silber zu erringen. So viele andere würde es zum Einsatz für die große Sache inspirieren. Seit er erwachsen war, weihte er sein Leben der glorreichen Vergangenheit und der Zukunft Italiens, der Wiedergewinnung verlorener Kunstschätze, der verlorenen Geschichte. Auch das Silber würde er aufspüren, mochte es kosten, was es wollte.
Ach, wenn ihn doch die Erinnerung an Thalias Augen, die alles sahen, bloß nicht mehr verfolgen würde …
3. KAPITEL
Wie üblich herrschte um zehn Uhr morgens dichtes Gedränge in der Trinkhalle. Thalia und Calliope traten in den Säulengang und mischten sich unter die Menschenmenge. Im hellgrauen Licht des bewölkten Tags erfüllten Gelächter und lebhafte Gespräche den großen weißen Raum, einzelne Wortfetzen drangen zu den beiden Schwestern.
„Was für ein vulgärer Hut …“
„In den Assembly Rooms bekam ich kaum Luft …“
„Der Doktor meint, ich müsste …“
„Und hier soll man genesen und neue Kräfte sammeln?“, fragte Calliope skeptisch und wich dem Rollstuhl einer alten Dame aus, der gerade vorbeigeschoben wurde. „Inmitten dieser Massen, die unsinniges Zeug reden? Genauso gut hätten wir in London bleiben können.“
Thalia ergriff den Arm ihrer Schwester und zog sie näher zu sich heran. Später würden sie Cameron bei der Wassertheke treffen – falls sie die Halle unbeschadet durchqueren konnten. Ihr Schwager hatte sich entfernt, um die Namen seiner Begleiterinnen und seinen eigenen ins Gästebuch einzutragen.
Obwohl Thalia nicht allzu groß war, wusste sie sich einen Weg zu bahnen. Mit ihrem schlanken, von blauer Seide umhüllten Arm drängte sie einige der Schwätzer beiseite. Oder sie musterte die Leute mit einem ruhigen Blick, bis sie Platz machten. „Die Londoner Luft tut dir nicht gut, Callie“, betonte sie, während sie Schlange standen, um Wassergläser zu holen. „Und der kleinen Psyche auch nicht. Hier wirst du dich ausruhen und erholen. Niemand stellt Forderungen an dich, keine Antiquities Society, keine Ladies Artistic Society, kein einziger dieser zahllosen Vereine …“
„Lady Westwood? Miss Chase?“
Die beiden Schwestern drehten sich zu Lord Grimsby um, einem Freund ihres Vaters, der ebenso wie Sir Walter der Antiquities Society angehörte. Schwerfällig stützte er sich auf seinen Gehstock.
„Oh, Lord Grimsby!“, rief Calliope. „Was für eine nette Überraschung!“
„Sicher sind Sie nicht so überrascht, wie wir es waren, als wir von der Heirat Ihres Vaters und Lady Rushworths hörten“, erwiderte er und lachte. „Sir Walter schrieb uns, Sie würden Bath bald besuchen. Wenn meine Frau und meine Tochter erfahren, dass Sie schon hier sind, werden sie sich freuen. In dieser Stadt findet man nur selten akzeptable Gesellschaft.“
Thalia schaute sich im Getümmel um. „Das sehe ich.“
„Natürlich müssen Sie am nächsten Treffen der Classical Society teilnehmen. So zahlreich wie bei der Londoner Antiquities Society sind die Mitglieder nicht. Aber wir veranstalten oft Vorträge, Debatten und Exkursionen zu den römischen Kunstschätzen. Rings um Bath gibt es so viele Ausgrabungen.“
„Wie wundervoll das klingt, Lord Grimsby!“, meinte Calliope. „Was würden wir nur ohne unsere diversen wissenschaftlichen Gesellschaften anfangen …“
„Sogar in Bath wollen wir einen gewissen Standard aufrechterhalten, Lady Westwood. Welch ein Glück, zwei Chase-Mädchen in unserer Mitte zu wissen. Werden Sie nächste Woche unsere Versammlung besuchen?“
„Das würden wir sehr gern tun“, beteuerte Thalia. „Aber die Ärzte haben meiner Schwester unbedingte Ruhe verordnet.“
Lord Grimsby lachte wieder, diesmal so heftig, dass seine altmodische Perücke verrutschte. „Ja, das reden sie uns allen ein, Miss Chase – wir müssen uns ausruhen. Was soll man in Bath auch anderes machen? Doch das bedeutet keineswegs, auch unser Geist würde der Ruhe bedürfen. Da würde mir Ihr Vater gewiss zustimmen. Außerdem geht es bei unseren Zusammenkünften sehr ruhig und angenehm zu. Morgen wird Lady Grimsby Sie besuchen. Bis dann, meine Damen!“
Während Seine Lordschaft davonhumpelte, gab Calliope dem Bediensteten an der Wassertheke die erforderlichen Münzen und nahm zwei gefüllte Gläser entgegen. „Hier werden keine Forderungen an mich gestellt, nicht wahr?“, wisperte sie, und Thalia lachte.
„Vaters Freunde trifft man überall an, das hatte ich vergessen. Wahrscheinlich könnten wir auf dem Gipfel eines Bergs kampieren, und jemand würde vorbeikommen und uns zu einem wissenschaftlichen Vortrag einladen.“
„Nun, nachdem Cameron sich mit den vermaledeiten Ärzten verbündet und mir sämtliche Tanzabende verboten hat, muss ich mich eben auf andere Art amüsieren.“ Calliope nippte an ihrem Wasser und rümpfte die Nase.
„Trink das Glas leer, Callie“, mahnte Thalia. Misstrauisch schnupperte sie an ihrem eigenen Wasser. „Schwefel und Eisen. Köstlich!“
Auch Calliope lachte. „Kein französischer Champagner …“
„Nein, Bath-Champagner, der dir neue Kräfte spenden wird.“
Calliope hob ihr Glas. „Prost! Mögen wir uns alle gut genug fühlen, damit wir nächstes Jahr wieder nach Italien fahren können.“
„Darauf trinke ich.“ Thalia stieß mit ihrer Schwester an. Unwillkürlich erinnerte sie sich an ein dunkles Augenpaar, ein fröhliches Lächeln, an einen Mann, der die Wärme und Freiheit Italiens zu verkörpern schien. Das wahre Leben – wirr und kompliziert und wundervoll.
Nicht dieser bleiche Abklatsch einer Existenz. Nicht die ständige hohle Einsamkeit, nicht das Gefühl, ziellos in der Welt umherzutreiben …
Sie nahm einen Schluck Wasser. So schal und langweilig wie alles, nachdem sie Sizilien und den Conte Marco di Fabrizzi verlassen hatte. Über den Rand des Glases hinweg betrachtete sie die Halle, die Menschenmenge, die sich unablässig bewegte.
Und plötzlich war sie müde. Müde des Selbstmitleids, in dem sie seit der Rückkehr nach England versank. Wenn man dauernd Trübsal blies, erreichte man gar nichts. Das wusste sie nur zu gut.
„Hör mal, Callie – wenn wir vorerst nicht nach Italien reisen können, holen wir Italien einfach hierher.“
Calliope hatte missmutig in ihr Glas gestarrt. Jetzt erhellte sich ihre Miene. „Wie denn, Schwesterherz?“
„Geben wir eine Party, so wie du es wolltest, unseren eigenen venezianischen Ridotto.“
„In unserem winzigen Salon?“
„Dann arrangieren wir eben einen Miniatur-Ridotto, mit Musik, Wein und Spielen. Du trägst ein schönes neues Kleid, sitzt königlich auf einer Chaiselongue und überwachst die Festivitäten. Damit wären sogar die Doktoren zufrieden. Ich studiere Theaterszenen ein – aus Shakespeares ‚Kaufmann von Venedig‘ und Thomas Otways ‚Venedig aufbewahrt‘.“
„Fabelhaft! Oh ja, ich wünsche mir ein neues Kleid, in dem ich zeigen kann, dass ich endlich wieder eine Taille habe. Wen laden wir ein?“
Thalia schaute sich wieder um. „Großer Gott, ich fürchte, das wird ein ziemlich öder Ridotto. Hier gehören wir offenbar zu den verschwindend wenigen Leuten unter fünfzig.“
„Egal, eine Party ist eine Party.“ Enthusiastisch stürzte Calliope sich auf die Aktivität, die sie am besten beherrschte – irgendetwas zu organisieren.
Als Cameron sich zu den beiden Frauen gesellte, mit weiteren Wassergläsern gerüstet, hatten sie bereits ihre Pläne geschmiedet.
„Da siehst du es, Liebste“, sagte er glücklich. „Auf deinen Wangen blühen schon wieder Rosen.“
„Weil sie mich herumkommandieren kann“, behauptete Thalia, „eine perfekte ältere Schwester.“
Calliope schnitt eine Grimasse. „Nie im Leben habe ich irgendwen herumkommandiert. Ich bin so nett und freundlich wie ein Sommertag.“
Thalia und Cameron wechselten heimlich einen ironischen Blick.
„Wer steht heute im Gästebuch?“, fragte Thalia.
„Noch nicht allzu viele Namen“, antwortete Cameron. „Nur wenige Leute aus unserem Bekanntenkreis. Da wäre eine Lady Riverton. Könnte sie die Witwe des alten Viscount Riverton sein, des Altertumsforschers? Dem bin ich nie begegnet. Aber mein Vater erwähnte die griechische Münzensammlung dieses Mannes und meinte, die sei fantastisch.“
Thalia umklammerte das Glas etwas fester. „Sagtest du … Lady Riverton?“, stammelte sie.
Verwirrt wandte Calliope sich zu ihr. „Kennst du sie?“
Was in Sizilien geschehen war, hatte ihre Schwester nur teilweise erfahren. Thalia wusste nicht, wie sie die Ereignisse schildern sollte. Wie erklärte man gestohlene antike Silberschätze, Geister, einen nächtlichen Einbruch? Das alles würde einfach zu verrückt klingen. Deshalb ahnte Calliope nichts von Lady Rivertons Missetat. Diese Frau hatte skrupellose Diebe beauftragt, das antike Silber von Santa Lucia zu stehlen, und war damit geflohen.
Und jetzt hielt sie sich ausgerechnet in Bath auf? Wie war das möglich? Sie tauchte hier auf, trug sich dreist ins Gästebuch ein? Anscheinend fühlte sie sich sicher, in der Gewissheit, Marco di Fabrizzi, Clio und der Duke of Averton würden in weiter Ferne weilen. Sie musste nicht befürchten, jemand würde herausfinden, was sie verbrochen hatte. War sie in diese Stadt gekommen, um das Silber zu verstecken? Oder wollte sie sich andere Antiquitäten aneignen? Lord Grimsby hatte zu Recht auf die römischen Ausgrabungen in der näheren Umgebung hingewiesen.
Nun, offensichtlich rechnet Lady Riverton nicht mit mir, dachte Thalia. Und das würde ihr Ruin sein … Sie war daran gewöhnt, unterschätzt zu werden. Wegen ihrer blonden Locken und blauen Augen glaubten die meisten Leute, sie wäre oberflächlich und hohlköpfig. Und sie wusste, wie sie solche Einschätzungen zu ihrem Vorteil nutzen konnte.
Oh ja, Lady Riverton würde ihre Reise nach Bath bitter bereuen.
„Thalia?“, fragte Calliope. „Kennst du diese Lady Riverton?“
„In Sizilien traf ich eine Dame, die so hieß“, sagte Thalia leichthin. „Was für eine lächerliche Frau – mit verrückten Hüten und einem schmachtenden cicisbeo namens Mr. Frobisher, der ihr auf Schritt und Tritt folgte …“
Frobisher zählte zu Lady Rivertons düpierten Opfern. Jetzt büßte er für seine Habgier. Aber Thalia sah keinen Grund, das zu erwähnen.
„Vermutlich wart ihr keine Busenfreundinnen“, bemerkte Cameron trocken.
„So könnte man es ausdrücken.“
„Vielleicht war es eine andere Lady Riverton“, meinte Calliope. „Im Augenblick würde ich die Begegnung mit einer solchen Kreatur hassen. Lächerliche Hüte und dieses Wasser – das wäre zu viel für meine zarte Konstitution.“
„Entschuldigt mich für ein paar Minuten …“ Thalia reichte einem Bediensteten, der gerade vorbeiging, ihr leeres Glas. „Da sehe ich jemanden, mit dem ich reden muss.“
Sie schlenderte davon, dann blieb sie am Rand der Halle, wo kein so dichtes Gedränge herrschte. Langsam begann sie den Raum zu umrunden, lächelte und nickte einigen Bekannten zu, als hätte sie keinerlei Sorgen. Dabei musterte sie alle Frauengesichter, jeden auffälligen Hut. Falls Lady Riverton tatsächlich hier war, würde sie ihr nicht entrinnen.
Seit der Abreise aus Sizilien war sie nicht mehr so froh und aufgeregt gewesen. Endlich gab es wieder ein Ziel, eine Mission, die Gelegenheit, etwas Nützliches zu vollbringen. Oh, wenn Clio hier wäre! Dann würden sie wieder zusammenarbeiten, wie bei der Geisterszene im Amphitheater von Santa Lucia, die Mr. Frobisher und die wahre Verbrecherin, Lady Riverton, aus der Reserve gelockt hatte. Wenn doch bloß …
Wenn doch bloß Marco hier wäre! Trotz aller Streitigkeiten waren sie bei jener Theateraufführung ein großartiges Gespann gewesen.
Aber jetzt musste sie allein in der Trinkhalle umherwandern, Gehstöcken und Rollstühlen und angebotenen Wassergläsern ausweichen. Nur von mir hängt jetzt alles Weitere ab, dachte Thalia.
Keine Spur von Lady Riverton. Allmählich gab Thalia die Hoffnung auf eine erfolgreiche Mission auf. Und da entdeckte sie endlich einen braunen Satinhut mit hoher Krone, verziert mit grellblauen und gelben Federn, die wie kleine Leuchttürme über der Menschenmenge schwankten. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und spähte zu dem geschmacklosen Hut hinüber.
Nicht zum ersten Mal wünschte Thalia, sie wäre etwas größer, so wie Clio. Aber sie erblickte nur Schultern, die ihr die Sicht versperrten. Schließlich benutzte sie wieder ihre Ellbogen und erkämpfte sich einen Weg zur Wassertheke, zu einer Stelle, die nicht so dicht bevölkert war.
Die Dame mit dem Federhut nahm gerade ein gefülltes Glas entgegen. Zunächst sah Thalia nur eine braune Satinpelisse, einen Gemmenohrring und kastanienbraune Ringellöckchen. Und dann lächelte sie. Nur zu gut erinnerte sie sich an dieses schreckliche, schrille Kichern. Ohne jeden Zweifel. Sie hatte Lady Riverton gefunden.
Aus einem ersten Impuls heraus wollte sie zu der Frau stürmen, ihr den grässlichen Hut vom Kopf reißen – zusammen mit einer Handvoll Haare – und fragen, wo das Silber versteckt sei. Aber trotz ihres ungestümen Chase-Temperaments erkannte sogar Thalia, es würde ihr nichts nützen, wenn sie in der Trinkhalle eine hässliche Szene heraufbeschwor. Damit würde sie einen Skandal verursachen und – noch schlimmer – die Diebin warnen und zur neuerlichen Flucht veranlassen.
Nein, sie durfte nichts überstürzen, und sie musste all ihre Maßnahmen sorgsam planen. Noch einen Fehlschlag wollte sie nicht erleiden.
Unauffällig pirschte sie sich näher an Lady Riverton heran, die lebhaft mit ihrem Begleiter plauderte, als hätte sie außer modischen Sünden nichts verbrochen. „… und deshalb müssen Sie tout de suite Theaterkarten beschaffen, mein Lieber. Sicher gibt es in Bath keine günstigere Gelegenheit, jemanden kennenzulernen. Gewiss, in den Upper Rooms herrscht ein furchtbares Gedränge. Aber in den Theaterlogen sitzen nur die besten Leute.“
Fast hätte Thalia laut aufgelacht. Was stellte sich die Frau unter den „besten Leuten“ vor? Und wer mochte der arme Mann sein, der gezwungen wurde, diesem Unsinn zu lauschen? Nicht Mr. Frobisher, der war von kleiner Statur. Außerdem saß er immer noch im Gefängnis von Santa Lucia. Jetzt ergriff Lady Riverton den Arm ihres Gefährten, und sie schlenderten durch das Getümmel.
Hastig eilte Thalia in dieselbe Richtung und stolperte beinahe über das Vorderrad eines Rollstuhls. Beim Jupiter, was für bedrohliche Vehikel! Endlich trat sie Ihrer Ladyschaft gegenüber und sah deren Begleiter …
Marco. Der Conte di Fabrizzi höchstselbst, schön und imposant wie ein römischer Gott.
Sekundenlang konnte sie ihn nur verblüfft anstarren. War das möglich? Vielleicht hatte er einen Zwillingsbruder – einen kriminellen Zwilling, der mit albernen Frauen in europäischen Kurstädten lustwandelte und ihre Juwelen stahl, wenn sie nicht hinschauten. Von solchen Männern hatte sie gelesen.
Aber noch während ihr der absurde Gedanke durch den Sinn ging, wusste sie, dass es Marco war, der vor ihr stand. Solche Augen besaß kein anderer.
Nun weiteten sich diese dunklen Augen. Sichtlich erstaunt, lächelte er sie an. In der glatten sonnengebräunten Wange zeigte sich das markante Grübchen. Dann schien er sich plötzlich an die pikante Situation zu erinnern, und sein Lächeln erstarb. Auch das Funkeln in seinem Blick erlosch. Misstrauisch musterte er Thalia. Dachte er an die Nacht, in der sie in sein Haus eingebrochen war? Fragte er sich, ob sie wieder einmal etwas Unberechenbares tun würde?
Höflich lächelte sie und schlug ihren liebenswürdigsten Ton an. „Lady Riverton! Conte di Fabrizzi! Welch eine wundervolle Überraschung, Sie beide hier zu sehen! So lange sind wir uns nicht mehr begegnet.“
Lady Riverton erwiderte das Lächeln. Als sie Thalia zunickte, wippten die Hutfedern frenetisch. Immer noch ernst und zurückhaltend, verneigte sich Marco.
„Wenn das nicht Miss Thalia Chase ist!“, flötete Lady Riverton. „Und Sie sehen noch genauso aus wie bei unserem letzten Treffen im schönen Santa Lucia. Wie geht es Ihrer bezaubernden Schwester, der neuen Duchess?“
„Vielen Dank, Clio und ihrem Gemahl geht es ausgezeichnet“, antwortete Thalia und schenkte dem bizarren Paar ein noch süßeres Lächeln. „Sie befinden sich immer noch auf ihrer Hochzeitsreise durch Europa.“
„Tut mir so leid, dass ich die Trauung versäumt habe“, beteuerte Ihre Ladyschaft. „Aber ich musste ganz plötzlich abreisen und einen kranken Freund in Neapel besuchen. Dort sah ich den Conte di Fabrizzi wieder. So ein aufmerksamer Begleiter!“ Kokett schaute sie zu Marco auf und krallte ihre behandschuhten Finger fester in seinen Arm.
Entzückt strahlte er sie an und schaute ihr tief in die Augen, als könnte er sich nicht an ihr sattsehen, gar nicht genug von ihrer Gesellschaft bekommen.
Solche Blicke hat er auch mir in Santa Lucia zugeworfen und mit seinem provozierenden Lächeln so verwirrende Emotionen geweckt, erinnerte sich Thalia. Heiß und kalt hatte sie sich gefühlt, schwach und unbesiegbar, heiter und unerträglich ernst – alles gleichzeitig.
Nun wünschte sie sich, sie würde immer noch ein Glas mit dem grauenhaften Heilwasser in der Hand halten, das sie in Marcos Gesicht schütten könnte. Erst Clio, jetzt Lady Riverton! Dieser – dieser Schuft!
„Wie glücklich müssen Sie sich schätzen, Lady Riverton, weil Sie die großartige Gabe besitzen, überall Freundschaften zu schließen“, säuselte Thalia. „Wohin auch immer Sie reisen …“
„Ja, in der Tat – mein lieber Ehemann, der verstorbene Viscount Riverton, pflegte zu betonen, dies sei mein wunderbarstes Talent. Oder eines von vielen.“ Kichernd stützte sich Ihre Ladyschaft auf Marcos Arm.
Anscheinend hatte er nichts dagegen, bemerkte – im Gegensatz zu ihr – nicht die neugierigen Blicke, die seine Begleiterin und er auf sich zogen.
„Da wir gerade von Freunden reden, Miss Chase“, fuhr Lady Riverton fort, „sind Sie etwa allein hier? Die grandiose Heirat Ihrer Schwester muss Sie deprimiert haben. Hoffentlich wird das gesunde Wasser von Bath Ihre Wangen wieder erblühen lassen.“
Thalia spürte, wie sich ihre „blühenden“ Wangen erhitzten. „Ganz im Gegenteil, Lady Riverton. Unsere ganze Familie freut sich, weil Clio einen Ehemann gefunden hat, der sie genauso liebt und schätzt wie wir alle. Und ich habe meine älteste Schwester, Lady Westwood, nach Bath begleitet. Vor Kurzem wurde sie von einer Tochter entbunden.“
„Ach, tatsächlich? Nun, dann bin ich froh, dass Sie nicht allein hier umherwandern und eine Verwandte auf die Schicklichkeit achtet. Wenn ich mich recht entsinne, waren Sie in Santa Lucia oft zu beschäftigt, um an solche Dinge zu denken?“
War es schicklich, kostbare Altertümer zu stehlen? Die Geschichte Siziliens zu zerstören? Neuer Zorn stieg in Thalia auf. Am liebsten hätte sie das selbstgefällige Lächeln aus Lady Rivertons Gesicht geschlagen – oder Marco geohrfeigt, der diese infame Person wie ein verliebter Idiot anzuhimmeln schien.
Oder trieb er irgendein absurdes Spiel mit ihr? Wenn ja, welches? Thalia vermochte es nicht zu ergründen, und das ärgerte sie maßlos.
„Würdest du uns mit deinen Freunden bekannt machen, Thalia?“
Hinter ihr erklang Calliopes Stimme. Dankbar drehte sie sich zu ihrer Schwester um. Schon immer war Callie die vernünftigste der Chase-Töchter gewesen, die den anderen alle verrückten Flausen ausgetrieben hatte.
Aber warum starrte sie Marco mit großen Augen an, als könnte sie sich seine Anwesenheit nicht erklären? Kannte sie ihn? Wohl kaum. Sie war nicht in Sizilien gewesen. Und sie wusste nichts über das Tempelsilber-Fiasko.
Cameron trat an ihre Seite, ergriff ihre Hand, und die beiden wechselten einen langen, bedeutsamen Blick.
Mit jeder Minute wuchs Thalias Verwirrung. War sie in eine fremde Welt geraten, wo nichts mehr einen Sinn ergab?
„Darf ich euch die Viscountess Riverton vorstellen?“ Automatisch formten ihre Lippen die höflichen Worte. „Und Conte di Fabrizzi. Das sind meine älteste Schwester und mein Schwager, Lord und Lady Westwood.“
Knickse und Verbeugungen, alles perfekt und konventionell. Aber Thalia spürte immer noch die seltsame Spannung in der Luft – als könnte die Fassade der guten Manieren plötzlich zusammenbrechen und sie alle in ein Chaos stürzen.
„Wir freuen uns immer so sehr, wenn wir Freunde von Thalia kennenlernen“, versicherte Calliope. „Hoffentlich werden wir Sie noch öfter sehen, während wir uns in Bath aufhalten.“
„Oh ja, Lady Westwood!“, zwitscherte Lady Riverton. „Am Dienstag besuchen wir die Assembly Rooms. Und ich möchte demnächst eine Kartenparty in meiner Villa geben. Natürlich schicke ich Ihnen eine Einladung.“
„Das wäre wundervoll.“
„Aber nun müssen Sie uns leider entschuldigen“, wandte Cameron ein. „Heute Nachmittag hat meine Frau einen Termin im Thermalbad.“
„Wie schön, das wird ihr sicher guttun“, meinte Lady Riverton. „Dann sehen wir uns ja sicher bald wieder.“
Nicht, wenn ich es verhindern kann, dachte Thalia.
Fast schmerzhaft packte Calliope ihren Arm und zog sie von der unentwegt lächelnden Lady Riverton weg. Neben dem Conte, der eine unergründliche Miene zur Schau trug, blieb sie abrupt stehen und zischte: „Falls Sie glauben, ich würde mich nicht an Sie erinnern, täuschen Sie sich, Marco. Hoffentlich haben Sie Ihre Brechstange diesmal daheim gelassen. Ich werde Ihnen nicht erlauben, auch eine andere meiner Schwestern in Schwierigkeiten zu bringen.“
„Lady Westwood, niemals würde ich …“, begann er. Aber Calliope ging bereits weiter. Energisch zog sie Thalia und Cameron mit sich.
Trotz der dicht gedrängten Leute, die Thalia von Marco trennten, spürte sie seinen intensiven Blick im Nacken, ein warmes Prickeln auf ihrer Haut.
„Also kanntest du Marco?“, wisperte sie.
Calliope warf ihr einen scharfen Blick zu. „Nennst du ihn beim Vornamen?“
„Nun, ich … ich …“, stammelte Thalia. Wie konnte sie ihr erklären, was geschehen war? Unmöglich. Nicht jetzt, nicht hier.
Aber allem Anschein nach hatte Callie selber einiges zu erklären. Lächelnd schaute sie geradeaus und presste ihre Finger in Thalias Arm. Bis ihrer jüngeren Schwester nichts anderes übrig blieb, als ebenfalls zu lächeln.
„Hier werden wir nicht darüber reden“, flüsterte Calliope. „Erst wenn wir daheim sind.“
Cameron drückte Thalia noch ein Glas Wasser in die Hand. Sie starrte es an und wünschte, es würde etwas Stärkeres enthalten, vielleicht hausgebrannten sizilianischen Grappa, der ihr für kurze Zeit Vergessen schenken würde …
Ja, das würde sie jetzt brauchen. Stattdessen nahm sie einen Schluck Heilwasser und verzog das Gesicht.
4. KAPITEL
Noch nie habe ich jemanden so verändert gesehen wie Miss Thalia Chase!“, bemerkte Lady Riverton und umklammerte Marcos Arm, während sie die Trinkhalle durchquerten. „In Santa Lucia erschien sie mir nicht so bleich und schwach.“
Marcos Kinnmuskeln verkrampften sich. Aber er behielt sein unbeschwertes Lächeln bei. Zu seinem Drahtseilakt gehörte eine stets heitere Fassade. Schwach – das allerletzte Wort, das er benutzen würde, um Thalia zu beschreiben. Wo er doch fürchtete, die feurigen Funken, die aus ihren blauen Augen sprühten, würden ihn verbrennen …
Nachdem sie so plötzlich vor ihm gestanden hatte, fühlte er sich immer noch nervös und beunruhigt. Wie leicht konnte ihre Anwesenheit sein Kartenhaus niederreißen … Und was sollte er dann machen? Ohne das Silber, ohne die gerechte Strafe Lady Rivertons und ihrer Komplizen? Und ganz gewiss ohne Thalia …
Mühsam bezwang er den Impuls, über die Schulter zu spähen und herauszufinden, ob sie ihn immer noch mit diesem verächtlichen Blick beobachtete. Er ging an Lady Rivertons Seite weiter, nickte einigen Bekannten zu und lächelte, als würde ihn nur sein Amüsement interessieren und sonst gar nichts.
Immerhin wurde das von allen Italienern erwartet. Strahlende Lebensfreude. Ungetrübter Genuss. Keinerlei Probleme. Und dieses romantische Vorurteil diente seinen Zwecken geradezu großartig. Denn er würde sein Ziel viel leichter erreichen, wenn man seinen Aktivitäten keine Bedeutung beimaß und ihn nicht ernst nahm.
Und trotzdem – irgendwie bedrückte ihn Thalias Missbilligung.
„Andererseits ist Miss Chases Kummer verständlich“, fügte Lady Riverton hinzu. „Ihre älteren Schwestern sind verheiratet, beide haben fabelhafte Partien gemacht. Sogar ihr exzentrischer alter Vater ist zum zweiten Mal vor den Traualtar getreten. Nur Miss Thalia, das arme Ding, hat keine Aussichten.“
„Wenn eine junge Dame so aussieht wie Miss Chase, ist sie wohl kaum ein hoffnungsloser Fall.“ Diesen Einwand konnte Marco sich nicht verkneifen.
Lady Riverton runzelte die Stirn unter ihrem albernen Hut. „Also finden Sie das Mädchen hübsch?“
Gleichmütig zuckte er die Achseln und schenkte ihr sein spezielles Lächeln, das er allmählich hasste.
Aber die Frauen versicherten ihm immer wieder, sein Lächeln sei nahezu unwiderstehlich. Warum sollte er diesen Vorteil nicht nutzen?
Und tatsächlich – Lady Rivertons Stirn glättete sich, dann lockerte sie ihren harten Griff um seinen Arm und strahlte über das ganze Gesicht.
„Nun, ich bin ein Mann“, entgegnete er. „Deshalb habe ich keine Wahl – ich muss Miss Chase hübsch finden. Den meisten Männern würde das genügen. Mir nicht.“
„Wirklich nicht?“
„Nein. Bei einer Dame lege ich Wert auf andere Vorzüge. Intelligenz. Erfahrung.“ Verstohlen drückte er ihren Arm an sich. „Verborgene Tiefen.“
„Wie amüsant Sie sind, Conte di Fabrizzi!“, flötete sie.
„Oh, ich möchte Sie einfach nur erfreuen.“
„Und das gelingt Ihnen, mein Lieber“, gurrte sie und schaute sich in der Menschenmenge um. Zufrieden atmete sie auf, nachdem sie registriert hatte, wie viele Leute zu ihnen herüberstarrten. „Alle Damen beneiden mich um Ihre Gesellschaft.“
Genau das war seine Absicht gewesen, als er die Bekanntschaft mit Lady Riverton erneuert hatte. Er musste sie betören. Auf andere Weise konnte er das gestohlene Silber nicht aufspüren, denn ihre Domizile wurden allesamt gut bewacht. Sie war nicht dumm, obwohl sie manchmal die Naive mimte.
Aber sie war auch eine Frau und empfänglich für die Schmeicheleien eines attraktiven Mannes. Fast schon hatte er ihr Vertrauen gewonnen. Daran zweifelte er keine Sekunde lang.
Und dann tauchte Thalia auf, draußen vor der Trinkhalle.
Lady Riverton ließ seinen Arm los, entschuldigte sich und ging davon, um mit einer Bekannten zu sprechen. Dadurch verschaffte sie ihm die Gelegenheit, die er ersehnt hatte – endlich konnte er ihr entkommen.
Im Lauf der Jahre hatte er seine schauspielerischen Fähigkeiten im Dienste seiner großen Mission vervollkommnet. Einen Zigeuner konnte er spielen, einen König oder einen Mann, der eine Frau nach allen Regeln der Flirtkunst umgarnte. Aber in der Glashausatmosphäre von Bath wurde dieses Talent auf eine harte Probe gestellt. Hinter der freundlichen, vornehmen Geselligkeit und den endlosen netten Amüsements lauerte eine beklemmende Spannung – das Gefühl, jedermann würde die Ereignisse beobachten und darauf warten, dass etwas explodierte.
Zum Beispiel mein Kopf.
Er flüchtete in den Kirchhof der benachbarten Abteikirche hinaus. Auch hier herrschte dichtes Gedränge. Wenigstens konnte er unter dem perlgrauen Himmel frische Luft atmen. Noch hatte es nicht zu regnen begonnen, wie so oft in dieser verdammten Stadt. Deshalb wollten zahlreiche Menschen die Gunst der Stunde nutzen und sich möglichst lange im Freien aufhalten.
Über den Hof hinweg, vorbei am Kirchengebäude und der ständig bewegten Menschenmenge, entdeckte er eine hellblaue Pelisse. Thalia war vor dem Schaufenster eines Geschäfts stehen geblieben. Ihre Schwester und ihr Schwager waren nirgendwo zu sehen.
Ohne nachzudenken, ohne auch nur kurzfristig die unbestreitbare Tatsache zu beachten, er sollte sich besser von ihr fernhalten, eilte er zu ihr. Unwiderstehlich fühlte er sich zu ihr hingezogen, als wäre ihr blondes Haar ein Leitstern, der an diesem grauen Tag Licht und Wahrheit verhieß. Ein Strahl beruhigender Ehrlichkeit in einer trüben, schmutzigen Welt.