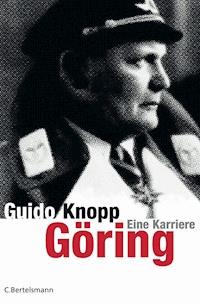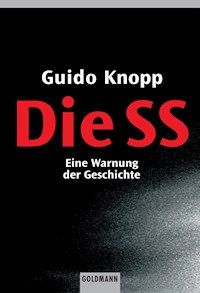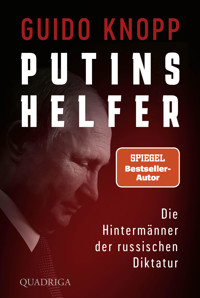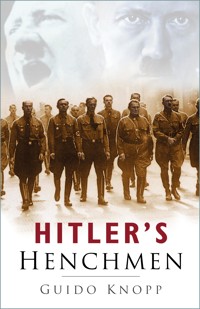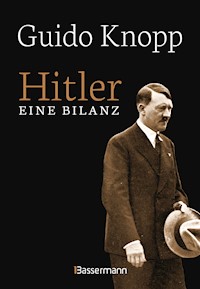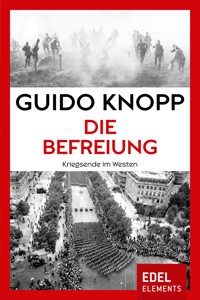Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die NS-Propaganda stilisierte ihn zum Propheten, der wie aus dem Nichts in die Geschichte trat. Er selbst verstieg sich in den Wahn von der "Vorsehung", die seine "deutsche Mission" beschütze: Adolf Hitler. Mehr als einhunderttausend Bücher wurden über ihn geschrieben, tausende Filme und Dokumentationen haben versucht, sein Wesen zu ergründen. Doch auch nach über neun Jahrzehnten "Nachdenken über Hitler" ist noch immer rätselhaft: Wie konnte ein gescheiterter Künstler, ein menschenscheuer Außenseiter, ein Mann ohne wirkliche Eigenschaften binnen weniger Jahre zum allmächtigen "Führer" eines scheinbar zivilisierten Volks mutieren, der als Diktator schließlich einen ganzen Kontinent unterjochte und den in der Weltgeschichte beispiellosen, systematischen Völkermord an den europäischen Juden in die Tat umsetzte? Guido Knopp hat sich über 25 Jahre intensiv mit Hitler, seinen Helfern und Widersachern, seinem Volk und dem von ihm angezettelten Krieg beschäftigt. "Hitlers Welt" ist eine Zusammenfassung seiner Arbeiten über die NS-Zeit, die über den Tag hinaus gültig sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Hitlers Leben – Die große Leere
Hitlers Geld – Der Krösus
Hitlers Kinder – Die Verführung
Hitlers Paladin – Hermann Göring
Hitlers Frauen – Eva Braun
Hitlers Helfer – Alfred Jodl
Hitlers Manager – Albert Speer
Hitlers Holokaust – Die Entscheidung
Hitlers Täter – Die SS
Hitlers Wehrmacht – Die Verbrechen
Hitlers Krieg – Der Feuersturm
Hitlers Krieger – Erwin Rommel
Hitlers Gegner – Der Widerstand
Hitlers Geiseln – Die große Flucht
Hitlers Ende – Der letzte Akt
VORWORT
Dieses Buch ist gleichsam eine Quintessenz meiner Arbeit über die NS-Zeit – im Fernsehen ebenso wie in all den Publikationen, die ich in den Jahren 1995 bis 2010 veröffentlicht habe.
Es begann im Jahre 1989 mit dem hundertsten Geburtstag jenes Mannes, dessen Wirken Thema dieses Buches ist. Alle Welt machte Dokumentationen über Hitler, die BBC mit ihrer weltweiten Verbreitung eine zweistündige Serie, und auch die ARD ließ sich nicht lumpen. Ich wurde vorwurfsvoll gefragt: Warum machen Sie denn nichts? Ich ging ins heute journal des ZDF und begründete meine Weigerung: Ein Film zum hundertsten Geburtstag eines Massenmörders, sagte ich, beleidige seine Opfer. Wenn schon Beschäftigung mit Hitler, sagte ich, dann allenfalls zum Jahrestag des Krieges, den er ausgelöst hat. Ich erklärte weiterhin: Wenn wir uns schon mit dem sogenannten »Dritten Reich« beschäftigen, dann machen wir es systematisch, analog zu einer Pyramide. Wir beginnen mit dem Herrscher, dem Tyrannen an der Spitze, und erörtern filmisch die verschiedenen Aspekte seiner Herrschaft. Dann gehen wir auf die zweite Stufe, auf die Ebene der Helfer und Träger des Systems: Hitlers Helfer, Krieger, Täter. Und am Ende widmen wir uns dem Fundament, den Organisationen, in denen viele Menschen dem System gedient haben: SS und Wehrmacht. Hierzu gehören dann auch die mörderischen Konsequenzen, der Holokaust, aber auch der Vernichtungskrieg im Osten und die Vertreibung der deutschen Bevölkerung.
So geschah es. Es begann im Jahre 1995, zum 50. Jahrestag der Kapitulation, und es endete 2010. All die Filme und dazu veröffentlichten Bücher fanden weltweit große Resonanz – in über 50 Sprachen und in bislang 140 Ländern. Es schien, als ob die Welt geradezu darauf gewartet hätte, dass eine ernsthafte Beschäftigung mit Hitlers Welt aus Deutschland kommen musste.
Was ist das Fazit aus all dem? Allzu viele haben damals weggesehen. Allzu viele wussten sicherlich genug, um ganz genau zu wissen, dass sie nicht mehr wissen wollten. Wir, die nach dem Krieg Geborenen, sind für all das nicht verantwortlich zu machen. Aber wir sind umso mehr verantwortlich für das Erinnern, gegen das Vergessen und Verdrängen. Keine Kollektivschuld, aber Kollektiv-Verantwortung.
Ich danke dem Verlag, der sich die Mühe machte, aus meinen diversen früheren Werken die Ausschnittrechte zu erwerben. Und ich danke Mario Sporn, der daraus eine Schneise durch den Dschungel der Geschichte schlagen konnte. Dieses Buch ist auch sein Buch.
HITLERS LEBEN
DIE GROSSE LEERE
Das Privatleben dieses Mannes war belanglos, arm. Alles, was ein Menschenleben ausmacht, was es adelt, fehlte: Bildung, Freundschaft, Liebe, Ehe. Zwar hat er ungeheuer viel gelesen, ja verschlungen, Militärisches besonders. Aber was nicht in sein Weltbild passte, nahm er nicht wahr. Hitler war der geborene Narziss. Nur was ihn interessierte, das galt. Was ihn vor allem ausmachte, ist das Absolute und zugleich Verhuschte seines Wesens – die forcierte Form, mit der er frühere Misserfolge kompensierte. Die Fähigkeit zum konstruktiven Dialog mit anderen besaß er nicht. Widerspruch ertrug er anfangs kaum, am Ende gar nicht mehr. Sein Wesen war früh festgelegt, blieb starr. Der monomane Wüterich der späten Kriegsjahre, der seine Generale anschrie, weil sie seinen Idiotien widerstrebten, war derselbe Mensch, der als Junge von seinem Vater gebrochen wurde. Als Junge hatte er sein Selbstvertrauen verloren. Als Mann lief er ihm hinterher. Er brauchte Erfolge, zunächst nur den Beifall der Massen, dann die Süße der Macht, am Ende den Rausch, Millionen Tote verursacht zu haben. Er war ein kranker Schweinehund, der seine Frustrationen kompensierte und dafür ein ganzes Volk missbrauchte.
München, September 1930: »Diese Leute dürfen nicht wissen, wer ich bin, sie dürfen nicht wissen, woher ich komme und aus welcher Familie ich stamme!« Adolf Hitler fürchtete in der Stunde seines ersten großen Erfolges unangenehme Enthüllungen. Bei den Reichstagswahlen war seine Partei gerade zur zweitstärksten Fraktion im deutschen Parlament aufgestiegen – ganz Deutschland wollte nun mehr über den Führer der NSDAP wissen. Doch um sein Privatleben hatte Hitler bislang konsequent den Mantel des Schweigens gehüllt – der Nimbus des Propheten, der aus dem Nichts in die Geschichte getreten war und sich nun anschickte, Deutschland umzuwälzen, musste um jeden Preis verteidigt werden. Eben diese Fassade schien im Herbst 1930 zu bröckeln, der Mythos ins Wanken zu geraten. Je mehr der Agitator des Rassenwahns ins Rampenlicht trat, umso mehr fragten NS-Gegner nach der Herkunft des politischen Aufsteigers. Hitler bekam zu spüren, dass er im Glashaus saß. »Dieser junge Londoner Büroangestellte, William Patrick Hitler, ist ein Neffe von Adolf Hitler, dem neuen politischen Führer in Deutschland.« Jene Zeilen in der britischen Presse sorgten im NS-Hauptquartier für Beunruhigung. Der Diktator im Wartestand musste mit Enthüllungen rechnen. Hitler bestellte den Neffen aus England eilends nach München, um ihn und seinen ebenfalls herbeizitierten Vater, Hitlers Halbbruder Alois, zur Raison zu bringen. Mit 2000 Dollar Schweigegeld im Handgepäck reiste die lästige Verwandtschaft ab, nicht ohne vorher das Versprechen gegeben zu haben, das Verwandtschaftsverhältnis künftig zu leugnen.
Nach seiner »Machtergreifung« im Januar 1933 fiel es dem NS-Diktator leichter zu diktieren, was sein Volk wissen durfte und was nicht. Das Buch Mein Kampf, ein paar zensierte Biografien und Zigarettenbilderalben mit Klebebildern gaben die offizielle Lesart wieder: Die Mär von armer Leute Kind, von harter Jugend, früher Berufung und entsagungsvollem Aufstieg. Wie oft sind diese Fragen schon gestellt worden: Wo liegt der Ursprung der bösen Tat? Wie wuchs das »Schlangenei« des späteren Tyrannen? Was machte ihm zum Hasser nicht nur aller Juden, sondern aller Menschen, die nicht seinem wahnverzerrten Weltbild entsprachen? Wie kam es zur Metamorphose vom gescheiterten Künstler zum Massenmörder? Der NS-Diktator hat versucht, die Spuren zu verwischen, die Forschung hat viel getan, um ihm den Triumph nicht zu gönnen.
»Kaum eine Erscheinung der Geschichte hat sich so gewaltsam, mit so pedantisch anmutender Konsequenz stilisiert und unauffindbar gemacht.«
Joachim Fest, Hitler-Biograf
Über seiner Familiengeschichte lag der Schatten einer ungeklärten Herkunft; auch Spekulationen über Inzest und Polygamie machten die Runde. Hitler wurde als viertes Kind nach dem Tod dreier älterer Geschwister geboren; von den beiden Jüngeren überlebte nur seine Schwester Paula – sie sollte auf Hitlers Geheiß ihren Namen ändern. Seine Familie hatte seit Generationen im Waldviertel, einer armen, hügeligen und waldreichen Gegend im nordwestlichen Zipfel Niederösterreichs gelebt. Hitler, Hiedler, Hüttler – im 19. Jahrhunderte variierten die Schreibweisen von Namen. Im Waldviertel hieß Hüttler nichts anderes als »Kleinbauer«. Die Tochter eines dieser Kleinbauern, Anna Maria Schicklgruber, bekam 1837 ein uneheliches Kind von einem nicht näher bekannten Mann. Das Kind wurde im nahegelegenen Döllersheim auf den Namen Alois Schicklgruber getauft. Fünf Jahre später heiratete Anna Maria den Müllergesellen Johann Georg Hiedler. Das uneheliche Kind wuchs bei einem Bruder Hiedlers auf, dem Bauern Nepomuk Hiedler, der den jungen Alois nach dem Tode von Mutter und Stiefvater de facto adoptierte. Im Jahre 1876 veranlassten Nepomuk und Alois beim Gemeindepfarrer von Döllersheim eine Namensänderung: Aus Alois Schicklgruber sollte Alois Hiedler werden. Der Vermerk »unehelich« wurde gestrichen, in die Spalte »Vater« trug der wohl etwas schwerhörige Pfarrer den Namen Johann Georg Hitler ein. Damit kam der Mann, der Anna Maria Schicklgruber geheiratet hatte, etliche Jahre nach seinem Tode zu Vaterehren – ein ungewöhnlicher Vorgang.
Sein »Sohn« Alois Hitler, vormals Schicklgruber, sollte später Vater jenes Sprösslings werden, den die Welt heute als Jahrhundertverbrecher bezeichnet – Adolf Hitler. Das einzige Rätsel, das nie gelöst wurde, war die Frage, von wem Anna Maria 1836 tatsächlich geschwängert wurde. War es der besagte Johann Georg Hiedler? Oder etwa ein jüdischer Geschäftsmann aus Linz – was oft unterstellt, jedoch nie bewiesen wurde? Heute ist sicher, dass das nicht stimmt. Doch Hitler wusste es nicht. Das mag ihn insgeheim gepeinigt haben.
»Die Legende von angeblichen jüdischen Vorfahren Hitlers ging sogar in die wissenschaftliche Literatur ein. Heute weiß man aber, dass es keine ernst zu nehmenden Hinweise für jüdische Vorfahren in Hitlers Familie gibt.«
Brigitte Hamann, Historikerin
Natürlich verschwieg er das in seiner autobiografischen Schrift Mein Kampf – auch, dass sein Vater während der ersten Ehe seine spätere zweite Ehefrau schwängerte. Noch bevor die zweite Frau an einer schweren Krankheit starb, bekam die künftige dritte Frau, Hitlers Mutter Klara, ihr erstes Kind. Weil Alois und Klara Hitler weitläufig einander verwandt waren, brauchten sie eine kirchliche Sondergenehmigung zum Eheschluss.
Hitler äußerte einmal Genugtuung darüber, dass er nicht den Namen Schicklgruber, sondern Hitler trage. Gedankenspielereien zur Bedeutung des Namens »Hitler« für seine »Karriere« sind keineswegs völlig abwegig. William L. Shirer fragte nicht zu Unrecht: »Kann man sich etwa vorstellen, dass die fanatisierten deutschen Massen ›Heil Schicklgruber‹ geschrien hätten?« Was Hitler in Mein Kampf umständlich verklausulierte: der geborene Alois Schicklgruber stammte aus einfachen Verhältnissen und war ein Aufsteiger. Er hatte es zum Zollamtsoberoffizial gebracht. Seine Kollegen beschrieben ihn als streng, genau und pedantisch. Über weite Strecken des Familienlebens schien er der typische Haustyrann gewesen zu sein, der seine Frau unterdrückte und seine Kinder prügelte. Sein ältester Sohn Alois, Hitlers Halbbruder, büxte im Alter von 14 Jahren aus und kam nie mehr zurück. Hitlers Mutter Klara litt unter ihrem Mann, fügte sich aber in die Rolle der genügsamen und fürsorglichen Hausfrau. Die Mutter versuchte, den Kindern nach besten Kräften zu geben, was ihnen der Vater vorenthielt: liebevolle Zuwendung. Ihre ersten drei Kinder starben früh, so wurde Adolf als das erste überlebende besonders liebevoll behandelt – verhätschelt, geradezu angebetet. Viel spricht dafür, dass diese ambivalente Beziehung zu Mutter und Vater den Sohn in einen Zwiespalt trieb. So mag die Verwöhnung durch die Mutter bei ihm Größenwahn und Ich-Kult, die Brutalität des Vaters hingegen Hass und Vorurteil hervorgerufen haben. Was Hitler in seiner Jugend erlebte, war keineswegs untypisch für die Zeit: mütterliche Anbetung, Verwöhnung, Unterwürfigkeit einerseits; väterliche Härte und autoritärer Zwang andererseits. Doch das sind nur Bruchstücke im komplizierten Mosaik des Psychogramms von Adolf Hitler.
Während der Grundschulzeit im bäuerlichen Leonding gebärdete sich der Muttersohn gern als Anführer unter den Spielgefährten. Der Eintritt in die Realschule in Linz veränderte sein Leben. Unter den Bürgerkindern der Stadt mag er sich zeitweise minderwertig gefühlt haben, jedenfalls konnte er die alte Rolle nicht mehr weiterspielen. Hitler wurde zweimal nicht versetzt, der dritte Anlauf gelang nach einer Wiederholungsprüfung.
»Hitler war entschieden begabt, wenn auch einseitig, hatte sich aber wenig in der Gewalt, zum mindesten galt er für widerborstig, eigenmächtig, rechthaberisch und jähzornig, und es fiel ihm sichtlich schwer, sich in den Rahmen einer Schule zu fügen.«
Eduard Huemer, Lehrer Hitlers, 1924
Er selbst nannte Protest gegen den Vater als den eigentlichen Grund für sein Schulversagen. Der Streit drehte sich um seinen Lebenstraum. Hitler wollte Künstler werden: »Ich glaubte, dass, wenn der Vater erst den mangelnden Fortschritt in der Realschule sehe, er gut oder übel eben doch mich meinem erträumten Glück würde zugehen lassen.« Das war nicht nur Ausrede, zweifelsohne waren Neigung und Begabung für die Malerei vorhanden. Hitlers Vater jedoch wollte den Sohn dazu zwingen, Beamter zu werden. In der Tischrunde berichtete Hitler später von einem aufgenötigten Besuch im Linzer Hauptzollamt, wo er »voller Abscheu und Hass« nur den »Staatskäfig« zu erkennen vermochte, in dem »die alten Herren aufeinandergehockt gesessen seien, so dicht wie die Affen«. Ein Motiv, das sein ganzes Leben durchzieht, tritt zutage. Hitler lehnte jede festgefügte Ordnung als Maßstab für sich ab. Künstler zu werden, das hieß für ihn zum einen unkonventioneller Lebensstil, zum anderen aber auch in Freiheit, völlig ungehindert, schöpferisch tätig zu sein. Das bedeutete zugleich, die Freiheit zu haben, Geschaffenes jederzeit wieder zu verwerfen. Aufrichten und Niederreißen – das war ein Leitmotiv im Leben des Adolf Hitler. Schon früh zeigte sich eine Konstante: Unwillen, wenn nicht gar Unfähigkeit zu regelmäßiger und intensiver Arbeit, auch Ausdruck seiner Abneigung gegen jede Form von Konvention, sofern er sie nicht selbst schuf. Hitler stempelte zum Feind, wer von ihm forderte, dass er sich einfügte. Den Vater, die Lehrer; er verwarf das ganze Schulsystem und den gesamten Habsburgerstaat gleich mit – wie er später alles verwarf, was sich ihm tatsächlich oder vermeintlich in den Weg stellte.
Hitler war 13 Jahre alt, als der Vater starb. Seine Pläne, Künstler zu werden, bekamen neuen Auftrieb. Dem Willen der Mutter, zuvor ordentlich die Schule abzuschließen, entsprach Hitler jedoch nicht.
»Die träge Lebensführung, die grandiosen Phantasien, die mangelhafte Disziplin für regelmäßige Arbeit – alles Merkmale des späteren Hitler – in den beiden Jahren in Linz waren sie schon sichtbar.«
Ian Kershaw, Hitler-Biograf
In seiner Heimatstadt Linz spielte er von nun an den Stenz, promenierte durch die Gassen, berauschte sich an den Opern Richard Wagners und füllte seine Zeichenblöcke mit neuen Skizzen. Ein neues Talent trat zutage. Hitler entwarf prachtvolle Bauten, Villen, Theater, Musentempel, monumentale Brücken und gruppierte schließlich das ganze Stadtbild von Linz zu neuer »Größe«. Später ließ er es sich nicht nehmen, jene »Nibelungenbrücke« selber einzuweihen, die er als 15-Jähriger auf dem Zeichenblock entworfen hatte.
Von einem Brotberuf hielt er nichts, er steigerte sich in immer neue Traumgebilde. Häufige Opernbesuche leisteten dieser Neigung Vorschub.
»Von der Stunde an, da Richard Wagner in sein Leben trat, ließ ihn der Genius dieses Mannes nicht mehr los.«
August Kubizek, Jugendfreund Hitlers
In geradezu ekstatische Stimmung geriet er nach einer Aufführung des »Rienzi« im Linzer Stadttheater. Noch ganz berauscht von der Musik Richard Wagners und dem heldischen Epos, habe Hitler ihn nach der Aufführung auf einen nahegelegenen Berg geführt, berichtete später sein Jugendfreund August Kubizek, ein nur wenig älterer Tapezierersohn. Dort habe Hitler mit erregter Stimme von einer Mission gesprochen, die er einst von seinem Volke empfangen werde. In schillernden Farben habe er seine und seines Volkes Zukunft ausgemalt. 30 Jahre später habe der »Führer« ihm dann gestanden: »Hier begann es.« Ob Legende oder nicht – es entsprach der Neigung des NS-Diktators, die Berufung zum Politiker auf »Erweckungsmomente« zurückzuführen und für die großen Entscheidungen seines Lebens nachträglich die »Vorsehung« zu bemühen.
Viel ist über Hitlers »Logorrhoe« geschrieben worden, seine krankhaft anmutende Redesucht, auch über seinen ungestümen Geltungsdrang und den manischen Zwang zur Selbstdarstellung. Sein Gemütszustand schwankte zwischen Selbstüberhöhung und Selbstverwerfung – die Mitte schien zu fehlen.
»Er musste eben sprechen und brauchte jemand, der ihm zuhörte. Ich staunte oft, wenn er vor mir allein mit lebhaften Gesten eine Rede hielt. Niemals störte es ihn, dass ich allein das Publikum war. [ … ] Solche Reden, meistens irgendwo im Freien, unter den Bäumen des Freinberges, in den Auwäldern an der Donau, wirkten oft wie vulkanische Entladungen. Es brach aus ihm, als dränge etwas Fremdes, ganz anderes in ihm empor.«
August Kubizek, Jugendfreund Hitlers
Die Neigung, vom Boden der Realität abzuheben, um dann umso tiefer in den Abgrund zu stürzen, war ebenso eine Konstante an Hitlers Leben. Einmal erwarb er ein Lotterielos, zugleich reifte der Traum vom großen Gewinn, eine Vision von Dolce Vita in hochherrschaftlichem Ambiente. Das war wochenlang für ihn die eigentliche Wirklichkeit. Dann zerschlug die Niete den schon sicher geglaubten Traum. Was folgte, war der Absturz: Hitler bekam einen Tobsuchtsanfall, wobei er nicht etwa nur das eigene Schicksal, sondern auch die Leichtgläubigkeit der Menschen, das Lotteriewesen und den betrügerischen Staat gleich mit in Bausch und Bogen verdammte. Wochenlang erging er sich in Selbstmitleid. Die Neigung, Schuld auf andere abzuwälzen, ist zunächst nichts Außergewöhnliches. Doch was der junge Hitler in seinen Gedanken aufbaute und niederriss, bestimmte beim späteren Theater das Schicksal von Millionen. Für Hitler gab es nur: alles oder nichts.
Der Fortzug nach Wien war wiederum eine Flucht vor einem »ordentlichen Beruf«. Sein Vormund hatte eine Lehrstelle für ihn ausgespäht – Bäcker hätte er werden sollen. Aus seiner Scheinwelt riss ihn das Schicksal der Mutter. Anfang 1907 erkrankte Klara Hitler an Brustkrebs. Hitler fühlte sich ihr verpflichtet und begann sein Leben in geordnete Bahnen zu lenken, bewarb sich an der Kunstakademie. Der erste Schritt glückte, er bestand die Vorauswahl. Das Urteil der Professoren über den Inhalt der von ihm eingereichten Mappe jedoch war niederschmetternd: »ungenügend«. Die Zurückweisung traf ihn »wie ein jäher Schlag aus heiterem Himmel«. Nie zuvor war er in seiner Eitelkeit so gekränkt worden.
Als sich der Gesundheitszustand der Mutter weiter verschlechterte, unterbrach er den Aufenthalt in Wien. Der jüdische Arzt der Mutter, Dr. Bloch, berichtete, dass Hitler nächtelang nicht von ihrer Seite wich. Im Dezember 1907 starb Hitlers Mutter in den Armen ihres Sohnes.
»Ich habe in meiner beinahe 40-jährigen Tätigkeit nie einen jungen Mann so schmerzgebrochen und leiderfüllt gesehen, wie es der junge Adolf Hitler gewesen ist, als er kam, um mit tränenerstickter Stimme für meine ärztlichen Bemühungen Dank zu sagen.«
Eduard Bloch, Arzt von Hitlers Mutter
Dass dieser Tod eine wesentliche Zäsur in Hitlers Leben war, ist unumstritten. Kontrovers ist freilich, was dieser Schicksalsschlag für die Psyche des späteren Diktators und Massenmörders bedeutete. Einige Psychohistoriker behaupteten, dass Hitler den Arzt bewusst oder unbewusst für den Tod der Mutter verantwortlich gemacht habe, dass er ihren Tod wie eine Tötung auffasste, dass all das später in Hass gegen die Juden umschlagen konnte. Tatsächlich spricht alles dafür, dass die Wurzeln seines Antisemitismus woanders zu suchen sind. Er blieb dem Arzt »für immer dankbar« und sorgte selbst dafür, dass Bloch der Holokaust erspart blieb – er ließ ihn 1940 in die USA ausreisen.
Der Tod der Mutter blieb nicht der einzige Schicksalsschlag. Auch der zweite Anlauf zur Aufnahme an der Akademie sollte scheitern. Sein Lebensstil blieb danach der alte. Ausgedehnte Spaziergänge, Opernbesuche, mal ein Entwurf für ein Bauprojekt, mal ein Konzept für ein Heldenepos – Traumwelt. Gewöhnlich lag Hitler fast bis mittags im Bett. Damals starben deshalb noch nicht Menschen wie später in der »Wolfsschanze«, als niemand wagte, den »Führer« zu wecken, auch wenn dringende Entscheidungen anstanden. Was Hitler über seine finanzielle Lage in den frühen Wiener Jahren schrieb, ist unwahr. Die selbstmitleidige Mär, dass er als 17-Jähriger sein Brot selbst habe verdienen müssen, gehört ins Arsenal der »Führer«-Legenden. Tatsächlich hatte er sowohl in der Linzer Zeit auch als auch anfangs in Wien ein geregeltes und ausreichendes Einkommen. Hitler bezog eine Waisenrente, hinzu kam Geld aus dem mütterlichen Erbteil. Der soziale Einbruch kam erst später.
Bei der zweiten Ablehnung an der Akademie zerbarst sein Traumschloss in tausend Stücke. Nicht nur seine Arbeitsproben wurden abgelehnt, sein Zeichentalent war generell in Frage gestellt worden. Hitler fühlte sich persönlich gescheitert.
»Die neuerliche, noch bestimmter erfolgte Zurückweisung scheint die kränkende Erfahrung des Vorjahres vertieft und befestigt zu haben.«
Joachim Fest, Hitler-Biograf
Dabei hatte der Direktor der Anstalt ihm sogar empfohlen, sein offenkundig stärkeres architektonisches Talent weiter auszubilden. Doch zog Hitler nicht die Konsequenzen. In den Tischgesprächen gab er Geldnot als Grund an – ein Scheinargument. Auch seine Begründung, dass man das Abitur brauchte, traf nicht für alle Architekturschulen in Österreich zu. Nein, für Hitler gab es keinen Weg zurück an die Schulbank. Er verweigerte sich in kindlichem Trotz. Er zog sich von seiner Umwelt zurück, verließ die gemeinsame Wohnung, die er mit seinem Jugendfreund teilte, und brach jeden Kontakt zur Verwandtschaft ab. Für Hitler begannen die »traurigsten fünf Jahre« seines Lebens. Er ließ sich gehen, fand sich bald »mit zerlöcherten Schuhen und wundgelaufenen Füßen« als Obdachloser im Asyl für gescheiterte Existenzen. Das väterliche Erbteil war inzwischen aufgebraucht. Es war ein Absturz ins Bodenlose für den von stetem Geldfluss verwöhnten Sohn eines Aufsteigers, der nicht ohne großbürgerliche Allüren war. »Sieg oder Niederlage« – das schien schon damals sein Leitmotiv zu sein: Auf den geplatzten Traum folgte ein selbstzerstörerisches Sich-verrotten-lassen. »Siegen oder untergehen« hieß der Schlachtruf 30 Jahre später – für ein ganzes Volk.
Der Umzug vom Asyl ins Männerwohnheim war der erste Schritt, um aus der schlimmsten Misere herauszukommen. Der Standard entsprach nicht einmal dem einer mittelmäßigen Jugendberge, aber immerhin, geschlafen wurde in Einzelkabinen. Hitler fand hier eine kleine geordnete Welt vor, die Heimat und Kameradschaft bot. Hier war Hitler in sicherer Umgebung, umgeben von Menschen, denen er überlegen war. Sie nahmen hin, was er sagte und widersprachen nicht, und wenn, dann nur hinter seinem Rücken. Das Motiv durchzieht sein Leben. Die Gemeinschaft im Wohnheim fand ihre Entsprechung im Kreis der Kameraden in der »Kampfzeit«, im Kreis der Entourage auf dem Obersalzberg und in der Tischrunde im »Führerhauptquartier« während des Zweiten Weltkrieges. Mit Hilfe der Malerei konnte Hitler sein monatliches Salär aufbessern. Meist fertigte er kleinformatige Bilder an, oft waren es nur Kopien von Postkarten und Stichen.
Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass er in der Wiener Zeit keineswegs der Judenhasser war, als den er sich retrospektiv ausgab. Er hatte eine ganze Reihe jüdischer Bekannter und Freunde, darunter Bewohner des Männerheims und Händler, die seine Postkartenbilder verkauften. Sicher darf man solche Indizien nicht überbewerten, doch wurden die Wiener Jahre nicht nur von zahlreichen Hitlerbiografen zur formativen Phase des Hitlerschen Antisemitismus erklärt, sondern auch vom »Sujet« selbst: »Ich bin von Wien fortgegangen als absoluter Antisemit, als Todfeind der gesamten marxistischen Weltanschauung.« Sicher gab es taktische Gründe für die Rückdatierung, um zu suggerieren, sein politisches Programm sei das Ergebnis lange gereifter Überlegung. Doch spricht auch manches dafür, dass Hitler das Trauma der Wiener Jahre auf diese Weise kompensierte, in dem er die ganze »schlimme Zeit« nachträglich einem Sündenbock aufbürdete: den Juden.
»In dieser Zeit bildete ich mir ein Weltbild und eine Weltanschauung, die zum granitenen Fundament meines derzeitigen Handels wurde. Ich habe zu dem, was ich mir so schuf, nur weniges hinzulernen müssen, zu ändern braucht ich nichts.«
Hitler, »Mein Kampf«
Antisemitismus wurde einmal die Ideologie der Zukurzgekommenen genannt. Hitler fühlte sich als ein Zukurzgekommener.
Von einem festen Weltbild während oder nach der Wiener Zeit konnte jedoch nicht die Rede sein. Seine Wahrnehmung blieb willkürlich und dumpf, eine bewusste Auseinandersetzung mit den sogenannten -ismen: Marxismus, Kapitalismus, Parlamentarismus, Antisemitismus, hat vermutlich erst nach dem Ersten Weltkrieg stattgefunden. Was von Wien blieb, waren diffuse Gefühle von Untergangsstimmung in einer morbiden Epoche, vor allem aber Fremdenhass. Nirgends in Mitteleuropa war er so spürbar wie in der Vielvölker-Metropole Wien. Aus dem privaten Erleben der Wiener Jahre ist jedoch nichts zu ersehen, was auf Hitlers späteren radikalen Antisemitismus schließen lässt. Überhaupt spricht viel dafür, dass er bis zum Ende des Ersten Weltkrieges eher unpolitisch blieb. Auch der Weggang von Wien nach München im Jahr 1913 war nicht politisch motiviert. Er war eine Flucht weg von der Stätte des Versagens, und es gab ein weiteres Motiv: Hitler entzog sich schon seit geraumer Zeit dem Wehrdienst. Das Argument, er wolle nicht dem Staat dienen, den er verabscheute, mag richtig sein. Doch rein juristisch war es ein Vergehen: Stellungsflucht, ein unpopuläres Delikt, das Hitler später nach Kräften zu verschleiern suchte.
Hitlers Tagesablauf in München erinnerte an Wiener und Linzer Jahre. Ohne sich noch zum Maler berufen zu fühlen, malte Hitler von nun an für den reinen Broterwerb. Der menschenscheue Sonderling musste hausieren gehen, wenn er seine Bilder verkaufen wollte, von Restaurant zu Restaurant. Immerhin – er hatte ein Auskommen. Die spärlichen Aussagen der wenigen Zeitgenossen, die ihn damals überhaupt kannten, zeigen, dass Hitler in München eine unauffällige Erscheinung blieb, ein seltsamer Einzelgänger. Jäh aus seiner Öde riss ihn eine Vorladung der Münchner Kriminalpolizei. Die österreichische Heeresverwaltung hatte seinen Aufenthaltsort aufgespürt und verlangte die Überstellung nach Linz. Die Musterungskommission in Salzburg, bei der sich Hitler 14 Tage später einfinden musste, befand: »Zum Waffen- und Hilfsdienst untauglich, zu schwach. Waffenunfähig.« Der Ausgemusterte kehrte nach München zurück und konnte seinem Künstlerdasein weiter frönen. Sein Leben aber blieb eintönig. Nichts Neues schien hinzuzukommen.
Der 1. August 1914 brachte die Erlösung: der Kriegsbeginn. Unzählige Menschen begrüßten den Weltenbrand als Ausbruch aus den Zwängen der Epoche – in vielen Städten Europas, auch in München. Hitler war nur einer unter Tausenden, die am Tag nach der deutschen Mobilmachung vor der Feldherrnhalle spontan der Kriegsproklamation Ovationen entgegenbrachten. Als Hitler-Fotograf Heinrich Hoffmann Jahre später seinem »Führer« eine Aufnahme von der Kundgebung am 2. August zeigte, ließ der einstige Demonstrant das Foto so oft vergrößern, bis er sich wiedererkannte. Zu sehen war, wie Hitler den Krieg mit freudig erregtem Gesicht begrüßte. Was den August 1914 für Hitler groß machte, war vor allem die Befreiung aus Öde und Leere eines ziellosen Lebens. Deutschland war seine fixe Idee, sein Traumreich, wenngleich es sich immer nur in seinem Kopf abspielte. Überhaupt schien nur etwas »Höheres«, eine höhere Gewalt seinem Leben noch einen Sinn geben zu können – er, Hitler für sich allein, hatte versagt. Er brauchte Deutschland, um überhaupt noch jemand zu sein. Jetzt bot sich die Chance, mit ihm eins zu werden – eine Art Vorwegnahme des späteren »Du bist nichts, Dein Volk ist alles« –, Symptome von Eskapismus aus einer völlig desolaten Psyche in ein Über-Ich.
Die Verkettung deutet auf das grundsätzliche Thema: Hitler und die Deutschen. Wer die bewegten Bilder jener Tage im August 1914 Revue passieren lässt, Begeisterung und Euphorie erkennt, stellt Verwandtschaft zwischen dem Sujet Hitler und der Masse fest. Krieg für Volk und Vaterland als Fluchtmotiv aus der persönlichen Umschränkung. Da war Hitler auf dem Odeonsplatz lediglich der Teil eines kollektiven Phänomens. Wie groß die Masse derer auch gewesen sein mag, die damals ähnlich empfanden wie er, Ängste, Affekte, Hass gegen das Fremde, aber auch Sehnsucht nach Sinn und Perspektive, ist nicht zu ermessen. Zum ersten Mal stand das Bedürfnis Hitlers offenbar im Einklang mit den Wünschen, Zielen, Hoffnungen der meisten Bürger. Das Private war Politikum geworden. »Ich kenne nur noch Deutsche« – die Parole Kaiser Wilhelms II., der damit vor allem politische Gegner zur Bewilligung der Kriegskredite ermuntern wollte, muss Hitler vorgekommen sein wie eine Umarmung. »Ich schäme mich nicht es zu sagen, dass ich, überwältigt vor stürmischer Begeisterung in die Knie gesunken war und dem Himmel aus übervollem Herzen dankte, dass er mir das Glück geschenkt, in dieser Zeit leben zu dürfen.«
Doch Hitler war immer noch Ausländer, und nicht Deutscher. Die Aufnahme in die bayerische Armee hatte er vermutlich der Unachtsamkeit eines Feldwebels zu verdanken. Nach der Vereidigung Anfang September 1914 marschierte Hitler im deutschen Heer mit. »Ich war leidenschaftlich gern Soldat«, erinnerte er sich 1941, mitten in dem Krieg, den er selbst entfesselt hatte. Ein Vierteljahrhundert davor war er, der Gefreite an der Westfront, ein durchaus tapferer Soldat, der nach einhelliger Meinung seiner Kameraden verdient das Eiserne Kreuz II. Klasse und auch das EK I erhielt, weil er im Granatenhagel wichtige Meldungen in vorderster Linie an den Mann brachte. Seine Heimat war das Regiment. Er aber blieb der Sonderling, der oft stundenlang in einer Ecke des Untergrunds kauerte. Der einzige wirkliche Freund war ausgerechnet ein britischer Überläufer, ein weißer Terrier, der die Fronten gewechselt hatte. Hitler nannte ihn »Foxl«. Der Vierbeiner blieb drei Jahre lang an der Seite seines neuen Herrn, bis ein Diebstahl der Frontkameradschaft ein jähes Ende bereitete. »Dieser Schweinehund, der ihn mir genommen hat, weiß gar nicht, was er mir angetan hat.« Hitler und seine Hunde – ein eigenes Kapitel. Als Soldat kam er nie über den Rang eines Gefreiten hinaus. Hitler hat sich aber auch nie von sich aus um eine Beförderung bemüht. Laut dem Zeugnis seiner Vorgesetzten habe er ohnehin keine Eignung zum Anführer erkennen lassen.
»Hitler hatte damals nach militärischer Auffassung wirklich nicht das Zeug zum Vorgesetzten. Ich sehe einmal davon ab, dass er nach den Friedensbegriffen eines aktiven Offiziers keine besonders gute Figur machte; seine Haltung war nachlässig und seine Antwort, wenn man ihn fragte, alles andere als militärisch kurz.«
Fritz Wiedemann, Regimentsadjutant im Ersten Weltkrieg
Einige seiner Kameraden mutmaßen später, er habe eine Versetzung von der Kompanie vermeiden wollen – die hätte ihm wahrscheinlich geblüht. Auch als radikaler Antisemit ist Hitler damals nicht aufgefallen, wenngleich er auch später behauptete, seinen antijüdischen Affekt bereits im Krieg gespürt zu haben.
Die Phase der entscheidenden politischen Weichenstellungen in seinem Leben begann mit einem Trauma. Im Westen hatten sich die Fronten in endlosen Materialschlachten festgefressen, im Osten aber besiegelte der Waffenstillstand mit den Russen das Ende des Zweifrontenkriegs. Noch einmal wurden alle Kräfte an die Westfront geworfen, noch einmal gab es Zuversicht, noch einmal die Illusion des Sieges – auch für Hitler. In der Nacht vom 13. auf den 14. Oktober 1918 wurde er Opfer eines britischen Gasangriffes und erblindete vorübergehend. Im pommerschen Reservelazarett zu Pasewalk offenbarte sich dem kaum Genesenden die Katastrophe: Niederlage und Revolution. Noch ganz benommen von der Gasverätzung, fassungslos und voller Wut stürzte er in tiefe Depressionen. Verrat schien im Spiel, die nationale Schmach mutete als Machwerk innerer Feinde an. Der Wahn vom Dolchstoß ergriff schon hier von ihm Besitz. In dramatischer Übersteigerung erlebte Hitler sein Ende im Schützengraben noch einmal nach: »Ich [ … ] warf mich auf mein Lager und grub den brennenden Kopf in Decke und Kissen. Seit dem Tage, da ich am Grabe der Mutter gestanden, hatte ich nicht mehr geweint. [ … ] Nun aber konnte ich nicht mehr anders. Nun sah ich erst, wie sehr alles persönliche Leid versinkt gegenüber dem Unglück des Vaterlandes.« Dann soll es zu jener legendären Entscheidung gekommen sein: »Ich aber beschloss, Politiker zu werden.«
Es nimmt nicht Wunder, dass sich um das Pasewalk-Erlebnis nicht nur Legenden, sondern auch psychohistorische Thesen ranken. Hitler projizierte in das »Erweckungserlebnis« hinein, was erst später reifen sollte, während des wirren Jahres 1919: Wenn sich überhaupt ein Schritt in die Politik datieren lässt, dann Monate danach und schon gar nicht als Ergebnis einmaliger oder gar planmäßiger Entscheidungen.
Dies höchst unwahrscheinlich klingende, gleichsam religiöse Erlebnis war Teil der Mystifikation der eigenen Person, mit der Hitler den Grundstein des Führermythos legte.
Ian Kershaw, Hitler-Biograf
Was sich in Pasewalk bei Hitler pathologisch-psychologisch abgespielt hat, ist nie ganz geklärt worden. Die Frage, wie lange er erblindet war, ist ebenso umstritten wie der fragliche Rückfall in die Blindheit nach der Nachricht von der Niederlage – dies wird gelegentlich als Hysterie gedeutet. Jedenfalls steht Pasewalk symbolisch für ein Trauma, dass so mancher Spekulationen Nahrung gab. Die zeitgleiche Vision vom persönlichen und nationalen Zusammenbruch, die Hitler mit dem Motiv vom Grab der Mutter verwoben habe, inspirierte einige Psychohistoriker zu der Annahme, dass der Patient in Pasewalk nach der Niederlage Deutschland und die Mutter schlechthin gleichsetzte und den Juden als beider Vergifter ansah.
Um den Erkenntniswert solcher Interpretationen ist viel gestritten worden. Psychologische Vorgänge bei Hitler selbst mögen dadurch vielleicht erhellt werden, doch nicht das Phänomen, warum ihm Millionen zur Macht verhalfen. Hier wird der Mensch, der Geschichte macht, in den Vordergrund gerückt, doch Hitler war in diesen Jahren eher einer, den die Geschichte formte – mit all ihren sozialen, ökonomischen, politischen, moralischen und ideellen Strömungen.
Der Erste Weltkrieg hat Hitler erst möglich gemacht. Ohne das Trauma von Krieg, Niederlage und Revolution, ohne die Radikalisierung der deutschen Gesellschaft hätte dem Demagogen das Publikum seiner hasserfüllten Botschaft gefehlt.
Ian Kershaw, Hitler-Biograf
Der Schlüssel zum Verständnis Hitlers liegt wohl eher in den Parallelen der Psychosen: Die Sehnsucht nach dem wollüstigen Rausch der Volksgemeinschaft, dem Augusterlebnis 1914, als das ganze Volk begeistert in den Krieg zog. Die Erinnerung an einen Krieg, in dem trotz aller Grausamkeit die Klassenschranken in den Schützengräben aufgehoben schienen. Das bittere Gefühl, am Ende seien alle Opfer doch umsonst gewesen. Die Legende vom Dolchstoß in den Rücken eines unbesiegten Heeres. Das Trauma eines als Diktat empfundenen Friedens von Versailles; der Schock der Revolution von 1918, der Zerfall der alten Ordnung, die Entstehung einer ungeliebten Republik; die große Angst des Bürgertums vor Bolschewismus und Chaos; die Angst vor all dem Neuen, Ungewohnten, Ungewollten, das nach dem Zusammenbruch hereinbrach – das empfanden mit Hitler Millionen verbitterte Deutsche.
So geriet er in den Strudel der Nachkriegszeit, den er keineswegs – wie später vorgegeben – zielsicher durchschwamm. Aus dem Lazarett entlassen, meldete er sich zurück in der Kaserne seines Regiments in München. Er wollte in der Armee bleiben, so lange wie nur eben möglich, ein Ausscheiden hätte ihn ins alte Dasein des Gestrandeten zurückgeworfen. Sein einziges Zuhause war das Regiment. Die politischen Wirren in der bayerischen Hauptstadt verfolgte er eher teilnahmslos. Sicher ist, dass Hitler sich über ein damals vielleicht notwendiges Maß hinaus politisch anpasste. Jedenfalls ging er weit für jemanden, dessen »granitenes Fundament« der eigenen Weltanschauung sich schon in früher Jugend ausgeprägt haben soll. Hitler war damals ein politischer Vagabund, ließ sich sogar zum »Vertrauensmann« seiner Kompanie wählen und wurde für die »Propagandaabteilung« des links orientierten Soldatenrats der Münchner Räterepublik tätig. Das belegt, dass Hitler dort zu finden war, wo sich die Macht befand. Ein Diener jener politischen Kräfte, die er wenig später schon immer gehasst haben will, ein Mitläufer ohne politisches Profil.
Als Anfang Mai 1919 Truppen der Reichsregierung die Rätediktatur zerschlugen, war das auch für Hitler das Signal zur Wende. Ein paar Tage später wechselte er die Seiten. Was folgte, war der verschlungene Aufstieg des Adolf Hitler im rechtsnationalen Milieu.
Als ich ihn das erste Mal traf, glich er einem müden streunenden Hund, der nach einem Herrn suchte.
Hauptmann Karl Mayr, warb Hitler 1919 als Propagandist für die Reichswehr
Statt dass man ihn richtig durchleuchtete, saß der Opportunist nach Fürsprache alter Kameraden bald selbst in einem Untersuchungsausschuss gegen kommunistische Umtriebe. Der Gefreite Hitler war bereit, den neuen Herren zu dienen, notfalls alte Kameraden aus der Rätezeit bei ihnen anzuschwärzen, Spitzeldienste beim Beobachten von sozialistischen Parteiversammlungen zu leisten. Wieder entging er der Entlassung aus der Armee, wieder dem drohenden Absturz in die alte Not. Hitler wurde nun von Amts wegen Propagandist, erhielt stramm antikommunistischen politischen Unterricht und erteilte selbst Lektionen. »Politik« bedeutete für ihn den Schritt aus der Isolation.
Im schwülen Klima nach Versailles kam der Hass gegen die »Novemberverbrecher« erst richtig auf, vor allem gegen jene, die den »Schandvertrag«, der als zweite Schmach galt, angeblich in verräterischer Absicht unterzeichnet hatten. Der Feind, so wurde suggeriert, sei »unter uns«. Die Tatsache, dass Juden wie Eisner, Toller und Mühsam maßgeblich an der Münchner Revolution beteiligt waren, bildete für Hitler den letzten Mosaikstein seines Weltbildes. Künftig waren sie es, die als Wurzel allen Übels galten. Das erste Dokument, in dem sich der fanatische Antisemitismus Hitlers offenbarte, stammt nicht von ungefähr aus jenen Tagen. Hier ist ein kategorischer Judenhass zu spüren, der mit Hitlers privaten Erfahrungen nicht zu erklären ist, die Übersteigerung dumpfer Eindrücke zu irrationalem Hass; Hitler verstieg sich in pseudowissenschaftlicher Manier gar zur Formel eines »Antisemitismus der Vernunft«.
Mit dem Juden gibt es kein Paktieren, sondern nur das harte Entweder-Oder.
Hitler, »Mein Kampf«
Was der 30-jährige Propagandaschüler formulierte, war die mechanische Negation der Humanität, und so mündete jener Brief vom September 1919 in die schreckliche Vision: »Letztes Ziel muss unverrückbar die Entfernung der Juden überhaupt sein.«
Die Revolution, ein Jahr Polit-Thrill, die Selbsterfahrung als Propagandaredner, das rassistische Milieu, die Lektüre antisemitischer Pamphlete, all das hatte im latenten Judenfeind den potenziellen Judenvernichter geweckt. Was jedoch entscheidend war – Hitler gewann Einfluss: »Ich konnte reden. Keine Aufgabe konnte mich glücklicher machen als diese.« Zeitgenossen hatten den Eindruck, dass Hitler sich durch Reden ständig selber neu erschuf. Er erlebte seine zweite Geburt, im Sinne von »Ich rede, also bin ich« – das war Hitler. Bis zum charismatischen Volksredner war es noch ein weiter Weg. Doch er hatte Blut geleckt. Auf einer Wahlveranstaltung der kleinen rechtsradikalen Splitterpartei DAP (Deutsche Arbeiterpartei) kam es zur Initialzündung. Dem politischen Vortrag folgt eine Diskussion, an der auch Hitler sich beteiligte – mit durchschlagendem Resultat: »Mensch! Der hat a Gosch’n«, begeisterte sich ein Funktionär, »den kunnt ma braucha.« Glasklar erkannte Hitler die Gelegenheit, der beruflich unsicheren Zukunft wieder eine Kontur zu geben.
Das Programm der DAP erwies sich als Melange aus Altbekanntem: Ablehnung der Demokratie, Hass auf die Juden und Marxisten, Tilgung der Schmach von Versailles. Nichts war neu, alles war Hitler auf seinem Weg schon einmal begegnet. Sein Motto »Alles oder nichts« vor Augen, trat er der DAP bei und formte aus ihr eine Partei, die keine andere mehr neben sich duldete, wie auch er als Parteiführer niemanden duldete, der ihm die Macht streitig machen konnte. Die braune Welt der bald NSDAP genannten Partei geriet zu seiner neuen Heimat. Sie glich der Armee: Uniform – Befehl – Gehorsam. Ebenso total, wie er zuvor Künstler war und dann Soldat, nahm er nun die Rolle als Politiker an.
Nach 1919 trieb das Trauma von 1918 seine politische Aktivität an. Sie zielte darauf, Niederlage und Revolution, die alles verraten hatten, woran er geglaubt hatte, »auszumerzen« und diejenigen »auszulöschen«, die er für verantwortlich hielt.
Ian Kershaw, Hitler-Biograf
Mit den ersten bescheidenen Erfolgen des »Trommlers« flackerte auch die Vision von Linz und Pasewalk wieder auf: Adolf Hitler glaubte nun felsenfest daran, der »Retter Deutschlands« zu sein. Ein Doppelleben: Einerseits der Demagoge in den Bierhallen, andererseits Liebling der besseren Kreise. Gönner ermöglichten ihm einen Flug nach Berlin. Dort konnte Hitler Tuchfühlung mit General Ludendorff aufnehmen und fand rasch Zugang zu völkischen Kreisen der Reichshauptstadt. Der lokale Bierhallenkönig wurde zum Hoffnungsträger reaktionärer Kräfte im ganzen Reich. Sein Fanatismus verschaffte ihm die Aktivität des Biestes. Tatsächlich aber blieb Hitler hinter der Fassade jener altbekannte Sonderling, der sich insgeheim verzweifelt an den Strohhalm seiner neuen Berufung klammerte. Das zeigt sich besonders beim Scheitern des Putschversuchs 1923. Da war nicht »die Idee« unter den Schüssen vor der Feldherrnhalle begraben worden, sondern scheinbar die Zukunft des Hauptverschwörers Hitler. Der Traum vom großen »Führer« schien mit einem Mal geplatzt. Folgerichtig sah er keinen anderen Ausweg, als sich das Leben zu nehmen. Vertrauten gelang es, ihm gerade noch die Waffe aus der Hand zu reißen.
Doch Hitler überstand nicht nur den Tiefpunkt. Er verstand ihn schließlich auch zu nutzen. Eine staunende Öffentlichkeit wurde Zeuge, wie Prozess und Haft in Landsberg für ihn nicht das erwartete und endgültige Aus bedeuteten, sondern das Gegenteil: Die Niederlage wurde zum Triumph, der Prozess geriet zum eigentlichen Sprungbrett seiner Karriere. Hitler nutzte den Gerichtssaal als Bühne und machte ihn zum Forum seiner rüden Demagogie.
Mögen sie uns tausendmal schuldig sprechen, die Göttin des ewigen Gerichts der Geschichte wird lächelnd den Antrag des Staatsanwalts und das Urteil des Gerichts zerreißen; denn sie spricht uns frei.
Hitler, 27. März 1924 vor Gericht
In der Landsberger Haftanstalt hatte Hitler genügend Zeit, dem angeblich schon längst gehegten Wunsch nachzukommen, eine eigene »Kampfschrift« zu verfassen. Hitler zählt zu jenen Häftlingen in der Geschichte, die durch die Haft an Ansehen gewonnen haben. Die Zügel der NS-Bewegung waren ihm vorübergehend aus der Hand geglitten, es brauchte Anstrengungen, bis die Partei wieder in Schwung kam und der »Führer«-Wille wieder uneingeschränkt galt. Mit dem Erscheinen von Mein Kampf stellte sich auch der Verkaufserfolg ein – nicht, weil so viele das Buch lasen, sondern weil jeder anständige Parteigenosse das NS-Standardwerk auf seinem Bücherbrett haben musste. So stieg mit der wachsenden Anhängerschar auch Hitlers privates Salär. Nun kehrte er wieder den alten Linzer Stenz heraus. Im Mercedes Kompressor tingelte er zu den Wahlveranstaltungen, kaufte sich einen Schäferhund und umgab sich am liebsten mit bayerischer Folklore. 1928 erwarb Hitler das schon vorher gemietete und später zur Residenz »Berghof« umgebaute »Haus Wachenfeld« auf dem Obersalzberg. Ein Jahr später bezog er ein Neun-Zimmer-Wohnung am vornehmen Prinzregentenplatz, die er bis zu seinem Ende behielt.
Die Krise bereitete den Boden, auf dem die Saat des Demagogen in großem Umfang aufgehen konnte. Gefährlich ansteckend wirkte seine Agitation erst im Fiebertrauma, das der New Yorker Börsenkrach im Oktober 1929 entzündet hatte, das in einer Kettenreaktion von Banken-, Betriebs- und Bauernhofpleiten und einer Explosion der Arbeitslosenzahlen zum Ausbruch kam, und das die schwindenden Kräfte der Republik von Weimar endgültig lähmte. Unsicherheit und Existenzangst ergriff nicht nur das Heer der Arbeitslosen, deren Zahl von 1,3 Millionen 1928 auf über sechs Millionen im Jahr 1932 schnellte. In Panik vor dem drohenden sozialen Abstieg suchten viele Menschen nach einem Halt. Der wirtschaftliche und politische Niedergang nahm in weiten Teilen der Bevölkerung das ohnehin schmale Vertrauen in das bestehende politische System und verschaffte dem Mann zunehmend Gehör, der sich mit ungewöhnlicher Dynamik als »Retter aus der Not« anpries.
Das politische Wunschbild eines charismatischen Führers, der die Unzufriedenheit bündelt und den Glauben an eine Erneuerung verkörpert, bestimmte auch vor und ohne Hitler die Vorstellungswelt autoritätsgläubiger Deutscher.
Das Geheimnis dieser Persönlichkeit liegt in der Tatsache, dass in ihr das Tiefste, was in der Seele des deutschen Volkes schlummert, in lebensvollen Zügen vorgebildet ist.
Georg Schott, »Das Volksbuch von Hitler«, 1924
Der Volkstribun brauchte die Rolle nur aufzugreifen und überzeugend darzustellen. Spätestens seit dem erdrutschartigen Wahlerfolg der NSDAP im September 1930, bei dem sie ihren Stimmenanteil versiebenfachte und beinahe ein Fünftel der Reichstagsmandate eroberte, begann der Mythos vom starken Führer seine Faszination auch über die Partei hinaus zu entfalten. Der Dirigent einer rechtsextremen Radautruppe stieg auf zum personifizierten Ausdruck des »Volkswillens«. Das verbreitete Monumentalgemälde eines wundersamen Erlösers mochte nur noch wenige Gemeinsamkeiten mit dem realen Modell aufweisen. Aber gerade deshalb konnte jeder seine ganz persönlichen Erwartungen auf die übermächtige Führerfigur richten und zugleich am Glanz der Erfolgsgeschichte vom unaufhaltsamen Aufstieg des kleinen Mannes aus der Anonymität zur Macht teilhaben.
Er hatte eine merkwürdige, durchaus nicht banale und nicht jedem unbedeutenden Spießer eigene Gabe, seinen eigenen Willen zu projizieren und die Leute zu hypnotisieren. Dies wirkte hauptsächlich auf die Massen, aber nicht nur auf die Massen. Es gibt eine Menge interessanter Zeugnisse von gebildeten und teilweise bedeutenden Männern, die sich während ihrer Gespräche mit Hitler geradezu hypnotisiert fühlten.
Sebastian Haffner, Publizist
Den Deutschen gegenüber inszenierte sich Hitler als anspruchsloser Asket und erster Diener seines Volkes. Sein einziger Schmuck – so schien es – waren die goldenen Manschettenknöpfe seines Vaters an der braunen Parteiuniform, die er immer öfter trug, um den mönchischen Charakter seines Daseins zu unterstreichen. Trotz der nunmehr unerschöpflichen Geldquellen, die aus der Buchvermarktung und zahlreichen »Spenden« aus der Industrie sprudelten, blieb das private Ambiente bieder. Der private Hitler war kein Monster. Die Menschenverachtung, das rücksichtslose Wesen fand man nicht in der Idylle des »Berghofs«. Hitlers Sekretärinnen schwärmten bis zuletzt von der Freundlichkeit des »Chefs«, von seinem Handkuss-Charme. Das Janusgesicht des Diktators: Hier der »Führer«, die Treuen und der Schäferhund auf der Terrasse vor bayerischblauen Himmel und Alpengipfeln – dort die Gequälten, Gemarterten, Totgeprügelten in den Vernichtungslagern. Für Tiere empfand er Mitleid, für Menschen nicht. Mord, Charme, Banales – das war in seinem Alltag vereinbar. Kein schlechtes Gewissen, wozu auch? Es gab ja die größere Sache. Wo gehobelt wird »für Deutschland«, da fallen eben Späne. Die Überhöhung des Politischen erlaubte eine schizoide Spaltung von der Privatsphäre. Hitler hat nicht einmal ein KZ besucht, nicht einmal persönlich Gewalt angewandt. Er hat das Grauen nicht an sich herangelassen.
Für Hitler war der Krieg das eigentliche Ziel seiner Politik. Er wollte wieder da beginnen, wo man 1918 »zu Unrecht« aufgehört hatte. Dem bei Kriegsbeginn schon 50-jährigen Diktator »pressierte« es, weil die private Lebensuhr ablief. Deshalb forcierte er den Kriegsbeginn. Erleichtert und wie selbstverständlich schlüpfte er in den grauen Rock und knüpfte an die eigene Tradition an. Hitlers Ersatzfamilie im Feld war die Kompanie gewesen, jetzt war es ein enger Kreis von Adjutanten, Dienern, Sekretärinnen. In den muffigen Nischen seiner ständig wechselnden »Führerhauptquartiere« herrschte der Einzelgänger mit unerbittlicher Strenge, ebenso wie einst sein Vater. Als sich das Kriegsglück Ende 1941 zu wenden begann, wirkte er vollends wie ein Abbild seines Vaters. Da saß nicht der »Führer«, das saß der Zollamtsoberoffizial auf seinem Thron und hielt mit furchtbarem Starrsinn an der einmal eingeschlagenen Richtung fest. In dieser Zeit der Wandlung fiel nun auch die letzte Schranke vor dem Genozid am Judentum. Was einst mit Drangsalierung und Diskriminierung begonnen hatte, mündete nun in Massenmord nach Plan. Es entsprach der Hitlerschen Lebensverachtung, einmal ins Auge gefasste Ziele ohne Rücksicht auf Verluste in die Tat umzusetzen. Trotz seines eigenen körperlichen Verfalls blieb Hitler in jeder Situation klar genug, um den nahen Untergang vorherzusehen und in Kauf zu nehmen. Es gab nur noch die Alternative: Siegen oder untergehen. Er ahnte das Kommende und verdammte mit kindlichem Trotz seine Generale. Denn nicht er war schuld, die anderen waren es. Ganz im Inneren aber wusste er, dass er zum Untergang verdammt war. Vor diesem Wissen floh er in die Traumwelt seiner Bauten. Am 8. Februar 1945 brachte der Architekt Hermann Giesler ein riesiges Modell der künftigen Stadt Linz von München nach Berlin. Während sich die alliierten Armeen unaufhaltsam seiner Hauptstadt näherten, sollte Hitler ganze Nächte vor dem nie verwirklichten Modell seiner Heimatstadt verweilen.
»Gegen meinen Willen bin ich Politiker geworden. Die Politik ist mir nur ein Mittel zum Zweck«, dieser Satz aus den Tischgesprächen zielt auf den Kern des Hitlerschen Politikbegriffs. Politik war für ihn auch Behelf, um seine pervertierten künstlerischen Triebe auszuleben. Der gescheiterte Künstler, der verhinderte Architekt schlüpfte in das Gewand des Diktators. Der gewaltsame Versuch, ein »Tausendjähriges Reich« zu errichten, war seine entartete Kunst.
In normalen Zeitläuften wäre Hitler ein unglücklicher, erfolgloser Kleinbürger geblieben, ein Kleinbürger, über dessen dämonische Anwandlungen nicht die Mitbürger erstaunt hätten. Ein kontaktscheuer Einzelgänger, der seine Phantasien in seinen Skizzenbüchern ausgelebt hätte.
Albert Speer
Hitler betrachtete die Deutschen als sein Privateigentum. Man kann nicht sagen, dass viele Volksgenossen versucht hätten, ihm einen gegenteiligen Eindruck zu vermitteln. »Führer befiehl, wir folgen« – wer das jahrelang hört, glaubt irgendwann selbst daran. Der Tyrann opferte Armeen kaltblütig wie Figuren auf dem Schachbrett, ließ Städte ohne Gemütsregung in Schutt und Asche sinken. Hitler ist in diesem Schreckensszenario der Künstler-Dämon, der sein Werk betrachtete, es für missglückt befand, um es dann zu zerstören. Am Ende kümmerte ihn »sein Volk« keinen Deut, denn dieses deutsche Volk hatte sich ja als zu schwach erwiesen und sollte verschwinden. Es war der Vernichtung würdig. Bis zum Schluss blieb er seiner Losung treu: Alles oder nichts.
HITLERS GELD
DER KRÖSUS
Die von Hitler selbst gestrickte Legende vom asketischen, opferbereiten, selbstlosen »Führer« im Dienste seines Volkes, der sogar auf sein Gehalt als Reichskanzler verzichtet habe, ist so langlebig wie falsch. Der NS-Agitator verfügte viel früher und umfassender über Geldquellen als noch lange nach dem Ende der NS-Zeit angenommen. Er hatte mächtige Gönner, nicht nur im In-, sondern auch im Ausland. Ohne Korruption, Willkür und mächtige, verheimlichte Geldgeber wäre Hitlers Weg zur Macht nicht vorstellbar gewesen. Heute lässt sich nachweisen, wie ungeniert sich Hitler bediente und bedient wurde. Als er 1945 Selbstmord beging, war er ein schwerreicher Mann. Schon zu Beginn seiner »Karriere« verfügte der NS-Agitator über genügend Einkünfte – wohlhabende Gönner aus der Industrie finanzierten ihn heimlich. Als er an der Macht war, schien der Geldstrom kein Ende mehr zu nehmen: Zahlreiche deutsche Großunternehmen, die mit Zuwendungen die Gunst des »Führers« erkaufen wollten, bemühten sich nach dem Krieg, kompromittierende Spuren zu verwischen. Wer gehörte alles zu den Spendern? Für welche Zwecke nutzte der Diktator sein Geld? Und wo ist sein Vermögen nach dem Krieg geblieben? Hitlers Reich geriet zu einem kaum entwirrbaren System von Korruption und Bereicherung, in dem auch Parteigänger und führende Militärs eingebunden waren.
München, Frühjahr 1934: Im Finanzamt Ost dämmerte dem Steuerinspektor Vogt, dass er ein Problem hatte. Seine Mahnungen an die Reichskanzlei waren ungehört verpufft, und nun hatte sich eine formidable Riege von Gegnern vereint, um ihn daran zu hindern, seine Arbeit zu tun. Und die bestand darin, Steuern einzutreiben. Auch die Steuern von Adolf Hitler, dem Kanzler des Deutschen Reiches. Doch der dachte gar nicht daran, seine Steuerschuld zu begleichen – und die war erheblich. Denn Adolf Hitler – vom konservativen Establishment als kleiner »Weltkriegsgefreiter« abgetan, nach eigenem Bekunden ein höchst bescheidener Diener seines Vaterlands – war im Jahr seiner Machtübernahme bereits Millionär. Die Verkäufe seines Buches Mein Kampf hatten 1933 die Marke von 900 000 Exemplaren überschritten und ihm Einkünfte von 1,2 Millionen Mark beschert. Das entsprach dem 750-fachen eines Facharbeitergehalts, das bei jährlich etwa 1600 Mark lag. Davon ahnte die Öffentlichkeit allerdings nichts. Den Menschen in Deutschland wurde suggeriert, dass endlich ein Mann des Volkes die Zügel der Regierung in der Hand hielt – einer, der die Nöte des kleinen Mannes kannte, weil er selbst Not gelitten und sich von ganz unten nach ganz oben gekämpft hatte. Sehr publikumswirksam hatte Hitler kurz nach der »Machtergreifung« auf das Gehalt des Reichskanzlers verzichtet. Schon früh strickte er an der Legende vom asketischen, opferbereiten, selbstlosen »Führer«.
Die medienwirksame Spende konnte sich der Bestsellerautor Hitler mit Leichtigkeit leisten. Doch der staatsbürgerlichen Verpflichtung, Steuern zu zahlen, wollte er nicht nachkommen. Und nun lag diese unangenehme Angelegenheit in den Händen des Münchner Steuerinspektors Vogt. Zum wiederholten Male hatte Hitlers Adjutantur nicht auf dessen Nachfragen reagiert. Hitlers Chefadjutant, SS-Obergruppenführer Julius Schaub, der die steuerlichen Angelegenheiten des Kanzlers bearbeitete, war für Vogt meist nicht zu sprechen oder gab ausweichende Antworten. Schließlich aber bewegte er sich – und fuhr schweres Geschütz gegen den kleinen Finanzbeamten auf. Schaub wandte sich an den Staatssekretär im Reichsministerium der Finanzen, Fritz Reinhardt. Der war von Hitler im April 1933 persönlich eingesetzt worden und traf im Ministerium die Entscheidungen im Steuerwesen. Reinhardt entschied kurzerhand, dass Hitler die Hälfte seiner Jahreseinnahmen als Werbungskosten absetzen konnte, damit blieb für 1933 eine Steuerschuld von 297 000 Mark, dazu kam die Forderung, für das Jahr 1934 eine Vorauszahlung von 400 000 Mark zu leisten.
Doch Hitler war immer noch nicht bereit, diese reduzierte Einkommensteuer zu bezahlen. Pünktlich überwiesen wurde nur seine Kirchensteuer. Der ansonsten zahlungsunwillige »Führer« ließ erneut seinen Finanzstaatssekretär Reinhardt von der Leine. Der trug dem Münchner Oberfinanzpräsidenten Ludwig Mirre nun auf, seinen Finanzbeamten endlich auf die Finger zu klopfen. Und so setzte Mirre Vogts direkten Vorgesetzten über eine Vereinbarung in Kenntnis, die im Finanzministerium getroffen worden war: Adolf Hitler sei »im Hinblick auf seine verfassungsrechtliche Stellung nicht steuerpflichtig«. Und am 19. Dezember 1934 schrieb Mirre an den Vorsteher des zuständigen Finanzamts: »Alle Steuerbescheide sind, soweit sie eine Pflicht des Führers begründen würden, von vornherein nichtig [ … ] der Führer ist damit steuerfrei!« Mit diesem Vermerk wurde Hitlers Akte im Finanzamt Ost im »Alten Hof« in der Burgstraße aus dem Verkehr gezogen und unter Verschluss genommen.
Es zeigt sich, dass er in seinem Größenwahn doch am Ende nur ein kleiner Steuerbetrüger ist, der keine Lust hat, überhaupt eine Steuererklärung abzugeben, geschweige denn Geld zu zahlen.
Wolfgang Zdral, Wirtschaftsjournalist
Der Deal zulasten der Staatskasse lohnte sich für Hitler – als Reichskanzler sollte er nie Steuern bezahlen. Die »Amtshilfe« lohnte sich auch für Oberfinanzpräsident Mirre. Er bekam als Dank für seine freundliche Hilfe bis 1945 2000 Mark monatlich zu seinem Beamtengehalt hinzu – steuerfrei, versteht sich. Und am 1. April 1935 wurde er zum Präsidenten des Reichsfinanzhofs ernannt.
Hitler als Steuersünder – dieser Aspekt mag angesichts der ungeheuerlichen Verbrechen, die der Diktator in seiner zwölfjährigen Amtszeit zu verantworten hatte, eher unbedeutend erscheinen. Doch gleicht diese Episode aus der Anfangszeit seiner Herrschaft der Spitze eines Eisbergs. Sie lässt ahnen, was unter der Oberfläche der allseits propagierten Einfachheit und Bescheidenheit lauerte. Die besondere Steuerregelung für Hitler ist symptomatisch für die korrumpierende Wirkung, die das NS-Herrschaftssystem von Beginn an auf die staatlichen Strukturen des Deutschen Reiches hatte. Dreist wurde stets der Vorteil der NS-Führer durchgeboxt. Und überall fanden sich in den bestehenden Strukturen bereitwillige Helfer, die gegen entsprechende Pfründe – Geld, Karriere, Einfluss – gerne mitmachten. Zugleich wirft die anrüchige Steuerbefreiung ein Licht auf Hitlers persönliches Finanzgebaren sowie auf die Tatsache, dass der Kontrast zwischen verkündeten Idealen und gelebter Realität bei ihm besonders krass war: Der nach außen zur Schau gestellte spartanische Lebensstil Hitlers, die öffentlich gepriesene persönliche Bescheidenheit des »Führers«, war Teil einer Inszenierung, die mit der Realität wenig zu tun hatte: »Ich werde meine Pläne nie an einem Mangel an Geld scheitern lassen!« Mit dieser Maxime wandte sich Adolf Hitler kurz nach dem Amtsantritt als Reichskanzler gegen die Sparappelle seines Finanzministers Lutz Graf Schwerin von Krosigk. Hitler hatte es weit gebracht mit diesem Denken.
Am Anfang seiner Karriere habe bittere Armut gestanden – so wollte es Hitler dem Leser in seinem autobiografischen Werk MeinKampf weismachen. Bekanntermaßen entsprach dies nur zu einem Teil der Wahrheit, und diese Phase des Elends war selbstverschuldet, denn der junge Adolf Hitler sah sich als Künstler und verkanntes Genie, und zeigte keinerlei Neigung, einem regelmäßigen Broterwerb nachzugehen.
Der junge, dandyhafte Hitler verachtete die Vorstellung, für das tägliche Brot zu arbeiten.
Ian Kershaw, Hitler-Biograf
Als Soldat im Ersten Weltkrieg stand er im Sold des bayerischen Staates und war aller Sorgen um Verpflegung und Unterkunft enthoben. Als Hitler 1919 nach München zurückkehrte, stellte sich für ihn wie für fast alle Heimkehrer nach vier Jahren Krieg die Frage, wo und wie sie nun ein Auskommen finden würden. Hitler besaß ein Sparbuch, auf dem 15 Mark lagen – und sonst wenig. Im September 1919 dann trat der unbedeutende Habenichts Hitler in eine unbedeutende Splitterpartei namens DAP ein, in deren Parteikasse sich zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 7,50 Mark fanden. Es war der Beginn einer höchst ungewöhnlichen Karriere – und der Anfang einer höchst lukrativen finanziellen Symbiose.
Hitler wurde zum Zugpferd der Partei. Seine Auftritte sprachen sich herum, er füllte im Jahr 1920 immer größere Säle, schließlich sogar das Zelt des »Circus Krone«. Die Rednerhonorare, die er neben seinem Wehrsold kassierte, waren ein willkommenes Zubrot. Er ahnte, dass die Politik ihm die Chance bot, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, sozial aufzusteigen, etwas aus sich zu machen. Hitler hatte ganz pragmatisch seine Karrierechance erkannt und ergriff sie. Noch bis zum März 1920 stand Hitler in Diensten der Armee und erhielt seinen Sold, doch dann beschloss er, dass er seinen Lebensunterhalt allein als politischer Redner verdienen wollte. Es war eine Karriereentscheidung, die sich buchstäblich bezahlbar machte.
Sein Agieren auf der politischen Bühne Münchens erregte die Aufmerksamkeit von Leuten, die Verbindungen in die »bessere Gesellschaft« hatten, darunter der Dichter und Dramatiker Dietrich Eckart, der von Hitler sehr angetan war. Er öffnete ihm die Türen zu den Salons wohlhabender Bürger, die ebenso völkisch, nationalistisch und antisemitisch dachten wie Hitler und Eckart.
Mächtige Gönner in München erkannten in Hitler den unverzichtbaren »Trommler« für die nationalistische Sache. Voller Stolz übernahm Hitler in den frühen zwanziger Jahren den ihm zugewiesenen Part.
Ian Kershaw, Hitler-Biograf
1920 machte Eckart Hitler in Berlin mit dem damals führenden Lokomotivenhersteller Ernst Borsig bekannt, der seine Sympathie bekundete, und in dieser Zeit einer der wenigen Großindustriellen war, die für Hitler und seine Partei spendeten. Doch die meisten frühen Förderer stammten eher aus dem wohlhabenden Mittelstand, wie etwa die Bechsteins, Inhaber der berühmten Pianofabrik in Berlin. Helene Bechstein begegnete 1920 dem im privaten Kreis eher schüchtern wirkenden Agitator mit mütterlichem Wohlwollen. Das Geld begann zu fließen. Für Hitler und die Partei brachen nun bessere Zeiten an. Helene Bechstein überließ Hitler später noch Schmuck und wertvolle Kunstobjekte, die dieser als Sicherheit einsetzte – etwa für ein Privatdarlehen von 60 000 Schweizer Franken, eine immense Summe in einer Zeit, in der die Mark durch die Inflation rapide an Wert verlor.
Ich habe ihm einige Kunstgegenstände zur Verwertung gegeben, mit der Bemerkung, dass er damit machen könne, was er wolle. Es handelt sich bei diesen Kunstgegenständen um solche von höherem Wert.
Helene Bechstein 1924 in einem Polizeiprotokoll
Heiß begehrte – weil stabile – Fremdwährung in die Kasse brachte auch Eckarts Verbindung zum Europa-Repräsentanten des Ford-Konzerns. Dessen Chef Henry Ford war ein bekennender Antisemit. Eckart gelang es, bei den Amerikanern eine Spende für die bayerischen Gesinnungsgenossen lockerzumachen – die Verbindung zwischen Ford und Hitler sollte lange andauern: Jahrelang flossen die Dollar-Spenden, nach der Machtübernahme Hitlers ließ ihm Henry Ford alljährlich als Geburtstagsgeschenk 50 000 Dollar zukommen.
Herr Hitler rühmt sich offen der Unterstützung Fords und preist Ford als großen Individualisten und großen Antisemiten. Eine Fotografie Fords hängt in Hitlers Büro.
Erhard Auer, Vizepräsident des bayrischen Landtags, 1923
Hitler bedankte sich 1938 mit einem Orden, den er dem US-Industriellen verlieh.
Im München der frühen 1920er-Jahre öffnete Eckart für Hitler die Türen zum betuchten Bürgertum und zu mittelständischen Unternehmern. Es galt als chic, den radikalen Volkstribun Hitler zu abendlichen Veranstaltungen in die Salons dieser Schicht einzuladen. Da und dort wurden Schecks ausgestellt, Spendenzusagen gemacht. Der neue Star der rechten Szene war ein überaus erfolgreicher Geldbeschaffer für die Partei – und für sich. Ein Gehalt von der Partei bekam der erfolgreiche Frontmann indes nicht, das wäre mit seiner Rolle als »Enfant terrible« nicht zu vereinbaren gewesen, so das Kalkül Hitlers. Und es nutzte seinem Ansehen, nur »ehrenamtlich« den Chefposten innezuhaben. Bei der nun florierenden Geldbeschaffung entstand eine Grauzone: Meist floss Bargeld, Quittungen wurden nicht verlangt oder gegeben. Hitler allein entschied, was er an die Parteikasse abführte. Um den asketischen Eindruck zu untermauern, blieb er auch in seiner einfachen Wohnung in der Münchener Thierschstraße wohnen.
Ansonsten war Bescheidenheit nicht seine große Stärke. Schon im Herbst 1920 hatte er von der Partei verlangt, ihm einen »Kraftwagen« zu stellen – das Automobil war damals ein teures Privileg der begüterten Schichten. Tatsächlich kratzte der Schatzmeister in der Parteikasse Geld für ein altes Vehikel zusammen, das jedoch ständig liegen blieb. Entnervt schaffte Hitler schließlich eine gebrauchte »Selve«-Karosse an – von dem ihm gespendeten Geld. Zum Ausgleich verlangte er von der Partei einen Chauffeur, den sie ihm gewährte. Derart mit den Attributen bürgerlichen Wohlstands aufgewertet, erschien Hitler schon damals manchem Parteigenossen als »König von München«.
Wirtschaftlich stellte schon Ende 1920 sein früher Mentor Dietrich Eckart entscheidende Weichen, als er dringend dazu riet, eine parteieigene Zeitung zu gründen. Er hatte schon etwas im Blick: Der Völkische Beobachter des Verlags Franz Eher Nachf. war in finanzieller Schieflage und stand zum Verkauf. Mit einer Auflage von 7000 war das Blatt in rechten Kreisen Münchens bereits gut bekannt. Der Kaufpreis sollte 120 000 Mark betragen, plus Übernahme von 250 000 Mark Schulden, doch die junge NSDAP hatte kein Geld. Der braune Poet Eckart nutze deshalb seine Verbindungen: 60 000 Mark steuerte der Reichswehrgeneral Ritter von Epp, der mit der NSDAP sympathisierte, aus einem »verdeckten« Reichswehrfonds bei – als Darlehen, für das Eckart persönlich bürgte. Fast 60 000 Mark gab das NSDAP-Mitglied Gottfried Grandel, ein Augsburger Speiseölhersteller; für diesen Betrag musste Hitler bürgen. Das Geld war eingesammelt – doch eine Partei war keine »juristische Person« und konnte nicht als Käufer auftreten. So wurde der »Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterverein« gegründet, dessen Vorsitzender Hitler wurde. Zum Geschäftsführer des Vereins machte Hitler seinen früheren Unteroffizier und Kriegskameraden Max Amann. Und dieser Amann fädelte nun einen genialen Coup ein. Im November 1921 – es war die Zeit der beginnenden Inflation – stand ein Dollar bereits bei 180 Mark. Hitler, so Amann, könne doch leicht Spenden in harter Währung einsammeln und diese in Unsummen wertloser Mark umtauschen, um dann das geliehene Geld zurückzuzahlen. Damit wäre Hitler dann in der Lage, sich zum alleinigen Anteilseigner des Verlags Franz Eher GmbH zu machen. Aus unbekannter Quelle erhielt Hitler die notwendige Summe der US-Währung – es genügten ganze 666 Dollar, in Papiermark umgerechnet, um die jeweils 60 000 Mark Schulden an den Reichswehrfonds und an Grandel zurückzuzahlen. Am 16. November vermeldete Hitler im Münchner Registriergericht, dass er nun alle Anteile am VB und am Franz Eher Verlag besitze.
»Mit Amanns Unterstützung war Hitler zu einem jener Inflationsgewinnler geworden, die er in seinen Reden stets mit radikaler Unbarmherzigkeit geißelte«, konstatiert Wulf Schwarzwäller in seiner Studie Hitlers Geld. Viel wichtiger noch: De facto war Hitler jetzt Zeitungsverleger und Verlagsbesitzer. Der Völkische Beobachter sollte noch jahrelang defizitär bleiben, die Parteikasse schoss immer wieder Unsummen zu, um die Zeitung, deren Anteile zu 100 Prozent Hitler gehörten, am Leben zu erhalten.
Mein Mann hat Hitler wiederholt finanziell zur Stützung seines Zeitungsunternehmens unter die Arme gegriffen. Dies geschah gewöhnlich, wenn Hitler uns in Berlin aufsuchte und bei dieser Gelegenheit zu erkennen gab, dass er sich mit dem VölkischenBeobachter in Schwierigkeiten befinde. Wie hoch die Beträge waren, weiß ich nicht, weil ich mich um Geldsachen grundsätzlich nicht kümmere.
Helene Bechstein 1924 in einem Polizeiprotokoll
Gleichzeitig aber war der Schatzmeister der Partei, Franz Xaver Schwarz, im Verlagsbüro nicht willkommen – diktatorisch hatte der Parteivorsitzende Hitler bestimmt, dass die Geschäfte Amanns im VB den NSDAP-Kassenwart nichts angingen. Der musste indes Geld aus der Parteikasse an Hitler auszahlen, wenn dieser »persönlichem Bedarf« anmeldete. Beträge von bis zu einigen tausend Mark wurden als »Sonderausgaben für Werbemaßnahmen« verbucht. Doch auch wenn der VB zunächst ein Zuschussgeschäft blieb – das Blatt trug erheblich zum Aufstieg der Partei bei: Es entwickelte sich rasch zu einem publizistischen Geschütz, mit dem die Weimarer Republik sturmreif geschossen wurde. Pikant war, dass sich Hitler für sämtliche Artikel, die er für den VB schrieb, Autorenhonorare auszahlen ließ.