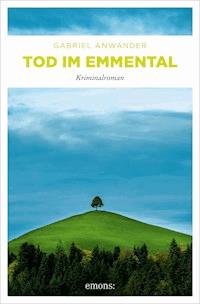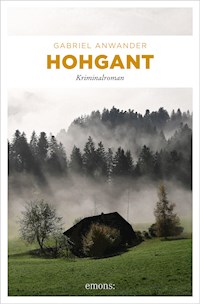
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Alexander Bergmann
- Sprache: Deutsch
Trocken, bissig und mit viel Gespür für Land und Leute. Auf den Straßen des Berner Mittellandes taucht auffallend reines Kokain auf – Gerüchten zufolge stammt es aus dem Emmental. Dabei trinkt man in der grünen Hügellandschaft höchstens Schnaps; Kokain kennen die Menschen nur vom Hörensagen. Als die Drogen ein erstes Opfer fordern, macht sich Privatdetektiv Alexander Bergmann auf die Suche nach den Hintermännern. Er ahnt nicht, dass er sich mit Gegnern anlegt, die ihn zwingen, die Grenze des Legalen zu überschreiten . . .
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Anwander, 1956 in der Ostschweiz geboren, studierte Landwirtschaft in Bern, bereiste Indien und Kanada, arbeitete in Kamerun und lebt heute mit seiner Frau im Emmental. Er begann früh, nebenher zu schreiben. Zahlreiche Geschichten wurden in Anthologien, Zeitungen und Magazinen veröffentlicht, mehrere bei Wettbewerben ausgezeichnet.
www.gabriel-anwander.ch
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Hans Wüthrich, Langnau i.E.; foto-wuethrich.ch
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Irène Kost, Biel/Bienne, Schweiz
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-777-4
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmässig über Neues von emons:
1
Ich kam die Treppe hoch, da wartete eine Frau im Schatten neben der Tür zu meiner Agentur. Sie lehnte mit dem Rücken zur Wand, ein Bein angewinkelt, die Hände in den Gesässtaschen, und musterte mich mit dunklen, wachen Augen.
Ich suchte den Schlüssel und überlegte, ob ich vergessen hatte, mich zu kämmen.
Im Gegenzug wagte ich einen Blick auf ihre Schuhe. Eine Angewohnheit von mir. Schuhe sind ein Ausdrucksmittel und geben Aufschluss über das Stilgefühl eines Menschen, über seine Neigungen und seine unmittelbaren Absichten. Das trifft nicht nur auf Clowns, Dirnen oder Bergsteiger zu.
Die Frau trug elegante Sneakers aus hirschbraunem Leder. Die Sohlen waren an den Rändern weiss, die Schuhbändel schamottfarben.
Sie gab sich einen Ruck, zog die Hände aus den Taschen und sprach mich an. «Sind Sie Herr Bergmann?»
«Ja. Und wer sind Sie?»
Sie strich sich die Haare zurück. «Petra Kürri.»
«Warten Sie schon lange?»
«Nein. Keine fünf Minuten.»
Wir gaben uns die Hand. Ihr Händedruck fühlte sich rauer an, als ich es vermutet hatte.
«Sie sind der Detektiv dieser Agentur, richtig?», fragte sie.
«So ist es.»
«Sind Sie ein Privatdetektiv?»
«Allerdings. Privater geht’s nicht.» Ich sperrte auf und trat ein.
Sie blieb vor der Schwelle stehen. «Haben Sie etwas Zeit für mich? Ich brauche Ihre Hilfe.»
«Wirklich?» Ich stiess die Tür weiter auf und warf die Gratiszeitung, derentwegen ich einen Umweg über den Bahnhof gemacht und die paar Minuten verloren hatte, zu den anderen auf dem Aktenschrank. «Kommen Sie herein.»
«Meine beste Freundin ist tot –»
«Kommen Sie rein. Und schliessen Sie die Tür.»
Die Luft war stickig. Ich begab ich mich zur Fensterfront, öffnete einen Doppelflügel sperrangelweit, beugte mich über das Sims und erlaubte mir trotz der wartenden Klientin im Rücken einen Blick auf den Dorfplatz hinunter.
Seit Tagen war kein Auftrag mehr eingegangen. Ich lungerte von morgens bis abends in meiner Agentur herum, las die Gratiszeitung, löste Kreuzworträtsel, baute Kartenhäuser und hoffte auf Klienten. Frau Kürri sollte meine Dringlichkeit nicht zu spüren bekommen, dieses Verlangen nach Aktivität, nach Verpflichtung und Einkommen.
Freitag war Markttag. Die Händler hatten ihre Stände in zwei Reihen aufgebaut. Drei Frauen flanierten zwischen den Auslagen durch und beäugten die überbordende Fülle an herbstlichen Gemüsen, an Obst und Blumen.
Eine Händlerin strich ihre grüne Schürze glatt, knipste da ein welkes Salatblatt weg, entfernte dort eine angefaulte Birne, eine aufgeplatzte Tomate und schielte zur Konkurrenz hinüber, verglich wohl jene Preise für Orangen oder Walnüsse mit ihren eigenen.
Ein fetter roter Kater wetzte seine Krallen am Stamm des Kastanienbaumes. Er hielt inne und lauschte mit spitzen Ohren auf das Geschnatter der Spatzen im Geäst.
Die ersten Strahlen der Sonne flirrten flach über die Dächer, und eine trockene kalte Bö säuselte ins Zimmer. Sie brachte die Gerüche von Ziegelstaub und Russ von den Kaminen mit sich und den bitteren Geschmack von den verdorrten Moospolstern in den Winkeln der Dachgauben.
Was hatte Petra Kürri gesagt? Ihre beste Freundin sei tot. Was könnte sie von mir wollen? Wäre ihre Freundin ermordet worden, hätte ich bestimmt davon gehört oder gelesen. Selbst wenn dies so wäre: Die Jagd nach einem Mörder war Sache der Polizei. War es ein Unfall? Wollte Petra Kürri, dass ich die Umstände, die zu ihrem Tod führten, abklärte?
Ich hob den Kopf und suchte den Himmel ab. Nirgends eine Wolke, so weit ich sehen konnte. Die kalten Winde hatten in der Nacht abermals keine Wolken ins Tal geweht und damit keine Aussicht auf Regen gebracht.
Seit ausgangs September, das heisst, seit sechs Wochen, herrschten im Emmental tagsüber eine Wärme und eine Trockenheit, wie sie im September in der La Mancha, in Don Quijotes Heimat in Spanien, üblich war. Nur so als Beispiel.
Die überdurchschnittlichen Sonnenstunden und die damit einhergehende Trockenheit trieben die Füchse und die Rehe in den Wäldern in die hintersten, noch feuchten Gräben, die Rentner mit ihren Wanderstöcken scharenweise in die goldig-leuchtenden Berge und die Milchbauern in die Verzweiflung.
Wie ich mich umdrehte, sass Petra Kürri sehr aufrecht auf der Kante des Stuhls vor meinem Schreibtisch und sah sich verstohlen um. Viel gaben die Wände meiner Agentur nicht her. Ich hatte keine Bilder aufgehängt, keine Diplome, keine Uhr, nicht einmal einen Kalender. Ich brauchte das Geld, das ich verdiente, für andere Dinge.
Frau Kürri war gross und schlank, trug gepflegte Jeans, ein kupferfarbenes Shirt, darüber eine blaue, mit Lammfell gefütterte Baumwolljacke mit riesigen Taschen und breiten, umgeschlagenen Manschetten mit Knöpfen aus Trompetengold.
Ihre schmalen Hände ruhten ausgestreckt und entspannt auf den Oberschenkeln.
Die Hände erinnerten mich an die Hände der Harfenistin am letzten Kammerkonzert in Langnau. Ich mache mir nicht viel aus Klassik. Ich besuchte das Konzert, weil mir meine Nachbarin eine Freikarte schenkte, nachdem ich ihr geholfen hatte, einen platten Reifen zu wechseln.
Die Hände der Harfenistin hatten zwischen den Sätzen gleichsam ruhig und entspannt auf den Oberschenkeln gelegen. Weder Frau Kürri noch die Harfenistin trugen Ringe an den Fingern oder Lack auf den Nägeln.
«Kaffee?», fragte ich.
«Gerne.»
Ich spülte den Tank aus, füllte ihn mit frischem Wasser, drückte den Knopf, sah zu ihr rüber und wartete auf das Ausklingen des Mahlwerks. «Es tut mir leid, dass Sie im Flur warten mussten.»
«Ach, das macht nichts.» Sie lächelte mit geschlossenem Mund.
«Nein, es tut mir ehrlich leid. Es riecht widerlich im Treppenhaus. Ist Ihnen nicht übel geworden? Ein Geruch, man könnte meinen, irgendwo liege ein totes Huhn. Das müssen Sie bemerkt haben, auch wenn Sie mit dem Lift hochgefahren sind.»
Sie nickte schwach.
«Ekelhaft. Ich habe mich beim Putzdienst beschwert. Da sei nix, hat die Frau gesagt, sie putze überall und sauber. Ich habe im Nagelstudio reklamiert, unten im Erdgeschoss. Bei denen riecht es sowieso eigenartig. Gehen Sie ins Nagelstudio? Regelmässig? Verzeihen Sie die Frage. Zuletzt habe ich der Verwaltung einen Brief geschrieben. Von Hand, wie in alten Zeiten. Ich soll mich gedulden, haben sie per E-Mail geantwortet. Wir müssten warten, bis das Ehepaar unter mir aus den Ferien zurück sei.»
Petra Kürri strich sich die Haare hinters Ohr. «Das kommt möglicherweise von weiter unten.»
«Aus dem Keller? Wir befinden uns im dritten Stock.» Ich stellte die Tassen auf den Schreibtisch, holte Milch und Zucker und setzte mich ihr gegenüber auf meinen Stuhl.
Es war ein bewährter Holzstuhl, kein Bürosessel. Wozu auch? Meine Agentur war weder eine Parteizentrale noch das Office einer Konzernleitung. Meine Agentur war nicht der Mittelpunkt des Universums. Die meiste Zeit ermittelte ich ohnehin ausser Haus – so ich denn einen Auftrag hatte.
Sie gab Zucker in die Tasse. «Ja, der Geruch kommt wahrscheinlich aus dem Keller.»
«Was macht Sie so sicher?»
«Es riecht nach Kanalisation. Gase strömen durch den Abfluss eines Waschtrogs, den länger niemand benutzt hat. Der üble Geruch verbreitet sich zuerst im Keller und von dort im ganzen Treppenhaus. Verstehen Sie?»
«Ehrlich gesagt: nein. Das verstehe ich nicht.»
«Der Siphon ist ausgetrocknet. Die Gase im Abwasserkanal können durch die Rohre ungehindert ins Haus gelangen. Bei den tiefen Temperaturen nachts, draussen wirkt der ausgetrocknete Siphon wie ein Ventil und das Treppenhaus wie ein Kamin.» Sie deutete mit den Händen eine Fontäne gegen die Decke an. «Die Gase steigen empor und verteilen sich auf jedem Stockwerk.»
Sie nahm die Tasse in beide Hände, lehnte sich zurück und kniff die Augen zusammen. Die Strahlen der Morgensonne erreichten und blendeten sie.
Das Licht erzeugte einen magischen Schimmer auf ihren schulterlangen walnussfarbenen Haaren, ihren kurz geschnittenen Stirnfransen und auf ihrem länglichen geröteten Gesicht mit den dunkelbraunen und federglatten Augenbrauen.
Ich schloss das Fenster und kurbelte die Storen hinunter, bis der Schatten über sie hinabglitt und den Zauber beendete.
Auf meine Frage, woher sie das alles wisse, antwortete sie: «Mein Vater ist Sanitärinstallateur. Er hat mich als Kind oft mitgenommen.»
Sie stellte die Tasse auf den Tisch, und ich hockte mich wieder auf meinen Stuhl. Es wurde Zeit, sie anzuhören, ich hatte sie lange hingehalten, länger als beabsichtigt. «Jetzt habe ich verstanden», sagte ich. «Nun, was führt Sie zu mir?»
«Ich brauche Ihre Dienste.»
«Na, dann lassen Sie mal hören.»
«Ein Dealer verkauft hier im Emmental neuerdings reines Kokain an Suchtkranke. Ich möchte, dass Sie ihn aufsuchen und ihn warnen.»
Um ein Haar hätte ich meinen Kaffee verschüttet. «Was soll ich tun? Einen Drogendealer warnen?»
«Ja.»
«Einen Kokainverkäufer? Hier im Emmental?»
Sie nickte.
«Sie scherzen.»
«Nein.»
«Sie meinen wohl eher, ich soll die Leute vor dem Dealer warnen. Die Eltern. Die Lehrer. Die Jugendarbeiterin. Den Pfarrer. Die Polizei. Allesamt, damit sie den Nachwuchs vor dem Lump schützen. Ist es das?»
Sie bewegte ihre Schultern, was nachsichtig aussah. «Nein. Ich meine, Sie sollen den Händler warnen.»
«Warnen wovor? Vor der Justiz?» Ich betonte die Frage zu meiner eigenen Überraschung scharf und spöttisch.
Sie biss sich auf die Unterlippe und schwieg.
«Wollen Sie, dass ich bei ihm klingle und ihm sage: ‹Werter Herr, seien Sie auf der Hut, denn das, was Sie tun, ist illegal. Das wird in aller Regel hart bestraft›?»
Sie schloss kurz die Augen und fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund.
Ich stand auf, nahm eine Karaffe aus dem Regal, füllte sie mit Wasser ab dem Hahn, stellte zwei Gläser auf den Tisch, goss ein und setzte mich wieder.
Sie trank ihr Glas in einem Zug leer und schwieg beharrlich.
Darüber geriet ich noch gehöriger in Fahrt. Nicht jedes Begehren oder besser gesagt jede Anfrage der Klienten, die mich aufsuchten, erstaunte mich; nein, seit der Eröffnung meiner Agentur vor fünf Jahren kamen Frauen wie Männer, mitunter Jugendliche, mit den abwegigsten Forderungen zu mir. Damit hatte ich mich abgefunden. Auf meiner Karte stand: «Alexander Bergmann. Ermittlungen aller Art. Privat und diskret».
Viele, die das lasen, vorwiegend jüngere Gesellen, hielten mich für ein Raubein, das für ein, zwei blaue Scheine schlechthin jeden Auftrag annahm.
Unterdessen war mir das egal, weil es der Realität ziemlich nahekam. Aber einen Drogendealer zu warnen, das überstieg dann doch meine letzten heiligsten Prinzipien.
«Womöglich verkauft der Kerl den Stoff nachts auf dem Güterbahnhof in Langnau. Wollen Sie, dass ich ihm auflauere? Soll ich, sobald er vorfährt in seinem protzigen schwarzen Auto, aus dem Schatten treten und vorsichtig an seine getönte Scheibe klopfen? Ja? Wir wissen alle, dass diese Typen den Motor laufen lassen. Weil das ihren Geltungsdrang unterstützt. Ihren Hang zur Prahlerei, ihre ständige Gereiztheit und ihre Ungeduld. Ich greife also zu, sobald er die Scheibe heruntergelassen hat. Blitzschnell. Ich packe ihn mit beiden Händen am Shirt und reisse ihn so weit aus dem Fenster, dass er die Scheibe nicht hochdrücken kann. Weil er sich sonst den Hals einklemmt. Ich brauche dadurch nicht zu brüllen, nachts, im Zentrum des Dorfes. Er fixiert mich, erst erschreckt, dann wütend, und ich raune ihm ins Ohr: ‹Mach, dass du fortkommst, du Strolch. Du Brigant. Du Schneebeutel. Wenn die Einheimischen dich beim Dealen erwischen, nehmen sie dir diese verdammte Karosse weg, ziehen dir die Schuhe und die Socken aus und prügeln dich auf nackten Füssen im Flussbett der Emme aus dem Tal›.»
Sie verhielt sich weiterhin still, traute sich kaum, das Glas auf den Tisch zurückzustellen.
Es war ihr an den glühenden Wangen, den hochgezogenen Augenbrauen, dem Schweiss auf der gekrausten Stirn unter den Fransen anzusehen, dass meine Worte in ihrem Kopf stürmische Gegenreden auslösten.
Warum sagte sie nichts? War ich eine Spur zu laut geworden? Empfand sie meinen Protest als ungerechtfertigt?
Ich hatte mich, wie bereits erwähnt, daran gewöhnt, dass die Leute irrige Auffassungen von einer erfolgreichen Ermittlung hatten und mich falsch beurteilten. Der Hauptgrund, weshalb ich bei ihr ein Stück weit die Fassung verlor, bestand wahrscheinlich darin, dass ich den Eindruck gewonnen hatte, sie schätze mich ebenso falsch ein wie die meisten anderen.
Sie hatte mich mit ihren Schuhen, durch ihr gradliniges Auftreten zu Beginn und mit ihrer festen Stimme für sich eingenommen.
Wie sagt man so schön? Ich hätte mit ihr das Pausenbrot geteilt.
Kaum hatte sie den Auftrag ausgesprochen, schlug meine Meinung um. Ich war enttäuscht, um nicht zu sagen: gekränkt. Ich erwog ernstlich, sie zur Tür zu begleiten und hinauszukomplimentieren. Danach hätte ich das Gratisblatt durchgeblättert wie an den anderen Tagen und mich beim Lesen der Kommentarspalten erneut aufgeregt. Oder gelangweilt, je nachdem.
Ihre Verschlossenheit bewog mich, sitzen zu bleiben und ein Weilchen abzuwarten. Wie könnte ich sie dazu bringen, mir zu erklären, was sie in Wirklichkeit bezweckte?
Durch die Wände war zu hören, wie der alte Lift ins Parterre hinunterruckelte. Ich spürte die Vibrationen unter den Füssen, und die Deckenlampe begann zu schlottern. Sie erzeugte ein gläsernes Klirren. Kürri schoss ängstliche Blicke zur Lampe hoch, dann starrte sie auf meine Stirn.
Ich suchte in ihrem Gesicht nach Anzeichen von Übermut, Vorwitz, Wahn, Einbildung, Naivität – was weiss ich. Alles, was ich erkennen konnte, waren Merkmale von Trauer, Eigenwille und Kleinmut.
Sie hielt meinem prüfenden Blick stand, was mich wiederum beeindruckte. Sie tat es anscheinend frei von Trotz oder Starrsinn und ohne ihre inneren Zwänge zu offenbaren. Sie wankte nicht, und sie zauderte nicht, und dies für die Dauer von mindestens fünf Atemzügen.
«Mit allem Respekt, Frau Kürri, einen Kokaindealer zu warnen, geht mir, gelinde gesagt, gegen den Strich. Ich weiss, die Welt ist kompliziert und ungerecht und das Emmental kein Sonderfall. Wenn es anders wäre, hätte ich meine Detektei längst schliessen müssen und würde mein Glück als Rosenverkäufer versuchen. Oder als Märchenerzähler. Aber einen Drogendealer zu warnen, das halte ich für verkehrt.»
Sie schaute zum Fenster hinüber. Ich tat es ihr gleich. Alles, was sie in den schmutzig-trüben Scheiben sehen konnte, war ihr Spiegelbild, dahinter alte, noch staubigere Lamellen und zwischen den Lamellen Ritzen, durch die das Licht in Form von waagrechten Strichen hereinschimmerte und ihr Spiegelbild zerschnitt. Falls in ihrem Kopf überhaupt ankam, was ihre Augen registrierten.
Ich erhob mich, ergriff die leeren Tassen, versenkte sie im Spültrog und marschierte hinter dem Schreibtisch auf und ab. «Verstehen Sie doch, ich habe eine Lizenz. Ich versuche mein Brot auf redliche Weise zu verdienen. Das ist heutzutage schwer genug. Kokain ist eine harte illegale Droge. Wenn ich mit einem Dealer in Kontakt trete, egal wie, ob ich ihn warne, ihm ein paar Gramm abkaufe, ihn verdeckt filme oder ihn fotografiere, während er einem Süchtigen ein Päckchen andreht, oder ob ich den Kerl in eine Falle locke und vor Zeugen festnagle, es spielt keine Rolle: Meine Lizenz bin ich schneller los als er sein Geld.»
Sie zeigte keinerlei Reaktion.
Ich blieb stehen und überlegte, wie weit ich gehen und ihr Hand bieten könnte. «Ich schlage Ihnen Folgendes vor: Ich mache den Kerl ausfindig. Das dürfte nicht allzu schwierig sein. Ich beschatte ihn zwei, drei Tage und Nächte und berichte Ihnen danach, wann und wo er sich herumtreibt und an wen er Kokain verkauft. Das ist das Äusserste, das ich für Sie tun kann. Was Sie mit dem Bericht anfangen, ist nicht mehr meine Sache.»
Ihre Nasenflügel bebten, und ihr Brustkorb hob und senkte sich auffallend stark. Sie drehte ihren Kopf in meine Richtung. «Warum sagen Sie nicht gleich, ich vergeude Ihre Zeit?» Ihre Stimme hatte einen kategorischen Unterton.
Ich versuchte zu beschwichtigen. «Verstehen Sie mich nicht falsch –»
«Sie sind mir empfohlen worden. Sie seien der Beste, jedenfalls ist mir das gesagt worden. Jawohl, der Beste. Ich habe mich anscheinend verhört.»
Sie klatschte mit den Händen energisch auf die Oberschenkel, liess ein «Tja» hören und erhob sich.
Ich weiss nicht, warum, aber ich wollte sie nicht ziehen lassen. «Warten Sie. Bleiben Sie. Sagen Sie mir, was ich tun soll.» Ich drehte meine Handflächen gegen oben, um meine Ergebenheit deutlich zu machen.
Sie liess sich auf den Stuhl zurückfallen. Mir fiel auf, dass ihre Augen leise und sachte einen unnatürlichen Glanz bekamen. Ich sank langsam auf den Stuhl und guckte besser hin: Frau Kürris Augen füllten sich mit Tränen.
2
Die Blicke aus Kürris geröteten, tränenvollen Augen trafen mich wie Eiswürfel mitten ins Herz. Unter der Last ihrer stummen Klage versuchte ich mich zu beherrschen und vermied jede Regung. Mag sein, dass ich die Augenbrauen zusammenzog, die Stirn leicht in Falten legte, kurz: eine schuldbewusste Miene aufsetzte. Mehr nicht.
Sie zuckte mit keiner Wimper, und ich überlegte, wie lange wir das gegenseitige Stillschweigen durchhalten würden, da bohrte sich der Pfiff einer Lokomotive vom Bahnhof her quer durch alle Räume. Hatte wohl einer wieder die Geleise überquert. Jedenfalls brach das scharfe Gedröhn den Bann zwischen uns.
Kürri atmete auf, straffte die Schultern, beugte sich leicht nach vorn und wiederholte mit überhöhter Stimme, was sie ganz zu Beginn, draussen auf dem Flur vorgebracht hatte. «Meine beste Freundin ist tot. Sie ist in meinen Armen gestorben.»
«Das tut mir leid», sagte ich und beobachtete, wie sie zur Decke blinzelte und ihre Mittelfinger an die unteren Augenlider presste. Links wie rechts entwischten ihr einzelne Tropfen. Sie kullerten über ihre Wangen und hinterliessen schwache rauchgraue Linien von der Wimperntusche.
Kürri war beileibe nicht die erste Frau, die auf diesem Stuhl sass und Tränen vergoss. Hin und wieder flennte auch ein Mann. Es war mir einerlei, ob die Klienten aus Zorn, Trauer, Hilflosigkeit, kalter Berechnung oder Selbstmitleid heulten, ich konnte es grundsätzlich nicht ausstehen. Extra für diese Fälle hatte ich einen Vorrat an Papiertaschentüchern angelegt. Frauen hatten selten ein Taschentuch zur Hand, und Männer, wenn überhaupt, ein gebrauchtes.
Ich kramte in der obersten Schublade nach einer Packung und streckte sie ihr hin. «Hier, nehmen Sie.»
Um sie nicht weiter zu verdriessen, bemühte ich mich, wenn nicht gerade tröstend, nun doch wenigstens versöhnlich zu klingen.
Sie schnappte sich die Packung, enteilte in die Toilette und kehrte nach kurzer Zeit zurück, frisch gekämmt, mit einer wohlgesinnten Ausstrahlung und einem Hauch von Seife. Sie setzte sich lockerer, freier als vorhin auf den Stuhl und wollte mir die angebrochene Packung zurückgeben.
«Ich bitte Sie, behalten Sie den Rest», sagte ich, goss Wasser nach, trank sogleich ein Glas und fragte: «Wie lange ist das her? Wann ist sie gestorben, Ihre Freundin?»
«Am Mittwochnachmittag», gab sie kurz und knapp zur Antwort.
Ich hoffte, sie würde endlich offenlegen, aus welchen Gründen sie hergekommen war, denn ich hatte immer noch keinen Schimmer, worauf sie in Wirklichkeit hinauswollte. Statt sie mit einer Frage oder einem Kommentar von Neuem in die Enge zu treiben, nickte ich ihr zur Abwechslung aufmunternd zu.
Das half. Sie holte aus. «Ich arbeite in der Fixerstube in Bern. Viermal die Woche habe ich Dienst. Von zwei Uhr nachmittags bis zehn Uhr nachts.»
Sie wählte die Worte mit Bedacht und sprach mit brüchiger Stimme, wie von einer nicht gänzlich aufgelösten Empörung angeschlagen, dennoch fliessend.
«Was tun Sie dort?», fragte ich.
«Das ist nicht einfach zu erklären. Bei uns können suchtkranke Menschen Drogen konsumieren, ohne diesen Stress auf der Strasse. Das hilft ihnen im Alltag. Sie werden weniger krank und vor allem weniger straffällig. Viele finden dadurch einen Weg zurück in ein stabiles Leben. Wir bieten drei Räume an: Im ersten können sie spritzen, im zweiten rauchen und im dritten schnupfen.»
«Helfen Sie ihnen beim Spritzen? Wie muss ich mir das vorstellen?», fragte ich.
«Oh nein, wir dürfen nicht helfen. Ich schaue bloss, dass alles einigermassen geordnet abläuft. Ich tausche neue Spritzen gegen gebrauchte. Schlichte Streit. Rede ihnen zu. Kontrolliere die Zeit, die sie auf ihrem Platz verbringen dürfen. Halte sie an, den Unrat zu entsorgen. Hinterher desinfiziere ich Tisch und Stuhl, wische den Boden auf, wenn nötig, und lasse den oder die Nächste eintreten.»
«Geben Sie Drogen ab?»
«Was denken Sie! Das wäre nicht legal. Den Stoff müssen sie mitbringen. Immer.»
Mittlerweile war meine Neugierde erwacht. Es drängte mich, mehr über sie und ihre tote Freundin zu erfahren. «Arbeiten Sie schon lange dort?»
«Ende Oktober waren es vier Jahre.»
«Wie hiess Ihre Freundin?»
«Mandy.»
«Hat Mandy auch dort gearbeitet?»
«Nein.» Sie schüttelte den Kopf. «Mandy ist süchtig gewesen. Wir sind zusammen zur Schule gegangen. Sie ist mit vierzehn in die Szene geraten. Sie hat unzählige Male versucht, damit aufzuhören, aber nein … Nein, sie hat es nie geschafft. Und jetzt ist sie tot.»
«Wie alt ist sie geworden?»
«Im März haben wir ihren dreissigsten Geburtstag gefeiert. Zu dritt: Mandy, eine Kollegin und ich. Die Kollegin hat eine Flasche Champagner hineingeschmuggelt. Wir haben in der Fixerstube eine kleine Bar. Alkohol ist zwar verboten, aber das ist es uns wert gewesen.»
Sie rupfte zur Sicherheit ein neues Taschentuch aus der Packung, tupfte sich damit die neuen Schweissperlen von der Stirn, der Nasenwurzel, den Schläfen und dem Hals, rieb sich danach die Handflächen trocken und zerknüllte das feuchte Papiertuch zwischen den Fingerspitzen. Gegen die Tränen benötigte sie es nicht mehr, auch wenn das ständige Ringen mit dem Gram sie offenbar eine Menge Kraft kostete.
«Ist Mandy an Kokain gestorben?»
«Ja.»
«Von einem Arzt bestätigt?»
«Ja. Herzversagen.»
«Ihre Freundin ist ihr halbes Leben süchtig gewesen und am Ende an einer Überdosis Kokain gestorben. Und damit kommen Sie zu mir? Was wollen Sie? Seien Sie ehrlich: Was erwarten Sie von mir?»
Sie starrte durch mich hindurch, mit leicht geöffnetem Mund, wie jemand, dem die korrekte Antwort auf der Zunge liegt. Die Zeit, die sie beanspruchte, um auf meine Frage zu reagieren, hätte mir gereicht, die Zeitung, die auf dem Aktenschrank wartete, rüberzuholen und wenigstens bis zur Sportseite durchzublättern.
Schliesslich überraschte und verblüffte sie mich statt mit einer Antwort mit einem Konter: «Sie haben nicht die leiseste Ahnung von Drogen. Stimmt’s?»
Ich empfand ihren Anwurf, manierlich gesagt, als unsachlich, und bevor ich ihn widerlegen oder vielmehr ihre Meinung zerstreuen konnte, hakte sie nach: «Geben Sie es zu.»
«Ich bin Privatdetektiv, kein Drogenfahnder.»
«Sagen Sie bloss, Sie haben nie gekifft.»
«Überlassen Sie mir das Fragen.»
Sie nickte, kicherte, gluckste, prustete, warf den Kopf in den Nacken, lachte und tupfte sich Tränen aus den Augenwinkeln. Sie beruhigte sich nach und nach, feixte ein letztes Mal und seufzte zum Abschluss laut und tief aus der Brust, schnickte das zerknüllte Papiertaschentuch in den Papierkorb, strich ihr Haar beidseitig hinter die Ohren und sah zu mir her. «Verzeihen Sie. Ich bin durcheinander …» Ihre Hände flatterten wie zwei aufgescheuchte Schmetterlinge vor ihrem Gesicht.
«Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen.» Das war der Moment, ihr mein Vertrauen auszusprechen. «Ich heisse Alexander.»
«Petra.»
«Ich nehme an, du kennst dich aus mit Drogen.»
«Ich glaube schon, ja.»
«Zurück zu Mandy. Sie ist vor zwei Tagen an einer Überdosis Kokain gestorben. Sie hat mit vierzehn damit angefangen, hast du gesagt. Hast du eine Ahnung, wie sie draufgekommen ist? Mit Kokain? Weisst du darüber Bescheid?»
«Heroin. Ihr Bruder hat sich Heroin gespritzt. Sie hat ihn bewundert und gebettelt, bis er nachgegeben und ihr einen Schuss gesetzt hat. Seitdem …»
«Bist du dabei gewesen?»
Sie raunte einen Ton, der vor keinem Gericht als ein protokollwürdiges Ja durchgegangen wäre. Ich liess es gelten und befragte sie weiter: «Hast du wegen ihr diesen Beruf gewählt?»
«Nein, nein.» Eine überdeutliche Absage.
Petra drehte den Kopf erneut zur Seite und presste die geschminkten Lippen hart aufeinander. Sie beobachtete mich immerhin aus den Augenwinkeln, und ich bekam den Eindruck, ihrem Ansinnen allmählich auf der Spur zu sein. Ein Gedanke hatte sich mir schon einmal in den Vordergrund gedrängt, ich hatte ihn unbedacht verworfen. Nun war er wieder da. Zeit, ihn auszusprechen: «Willst du ihren Tod rächen? Ist es das? Bist du deshalb zu mir gekommen? Geht es dir um Rache?»
Sie sah mich bestürzt an. «Nein, das ist nicht meine Absicht. Nein.»
«Nein? Was denn sonst? Sie ist tot, und du kommst zu mir. Warum überlässt du die Sache nicht einfach der Polizei?»
Sie biss sich auf die Unterlippe und verschränkte ihre Arme. Ihre Ohren glühten wie auch ihre Wangen.
Konnte es sein, dachte ich, dass Petra nicht nur traurig und erschüttert, sondern auch ängstlich war? War sie aus Furcht hergekommen? Sie gab nicht viel auf die Polizei, das war offensichtlich. Fühlte sie Unheil auf sich zukommen? Hatte sie eine andere Freundin, die ihrer Meinung nach mindestens so stark gefährdet war? Einen Freund vielleicht? Hatte sie deshalb weder einen Plan noch ein klares Ziel, bloss den Wunsch, diese Freundin oder diesen Freund nicht auch so zu verlieren? Dass sie Mandys Tod nicht tatenlos hinnehmen konnte, war leicht zu verstehen.
Es wäre durchaus denkbar, dass sie sich mehr von mir erhoffte, als nur den Dealer zu warnen.
Als Erstes brauchte ich alle Informationen, die sie mir geben konnte. Ich sagte: «Erzähl mir alles über Mandy und die Umstände, die zu ihrem Tod geführt haben. Erzähl mir alles, was du weisst.»
3
Petra nahm ihr Glas, nippte daran, betrachtete das Wasser, nippte erneut und begann mit gefasster Stimme zu berichten. Mandy sei praktisch jeden Tag in die Fixerstube gekommen, meistens früh am Nachmittag, manchmal vor der Dämmerung und selten kurz vor Feierabend. Sie sei jedes Mal direkt ins Schnupfzimmer gegangen und habe zwei Linien Koks hochgezogen. Wenn sie gut drauf gewesen sei – und im Sommer sei sie für gewöhnlich gut drauf gewesen –, habe sie hinterher mit jedem rumgealbert, habe auf ihre Art alle und jeden zum Lachen gebracht.
Petra schwenkte das halb leere Glas, wie wenn sich darin Medizin befände, und trank es in einem Zug aus. «Sogar meine Chefin hat mit ihr gelacht, wenn sie da gewesen ist. Immer. Mandy hat einiges durchgemacht in ihrem Leben. Ihre Mutter ist früh gestorben. Der Vater hat sie und ihren Bruder sitzen lassen. Er ist nach Australien ausgewandert. Wenig später ist ihr Bruder gestorben. Mit einundzwanzig.»
Sie stellte das Glas zurück und pflückte ein neues Taschentuch aus der Packung. «Danach hat sie jeden Halt verloren. Sie hat nichts ausgelassen. Sie ist …» Sie blähte ihre Backen auf, warf beide Arme in die Luft und liess sie seitlich fallen, ächzte dazu und schimpfte: «Ich will nicht ihr ganzes Leben erzählen.»
«Gut. Reden wir über das Kokain und ihren Tod. Woher weisst du, dass der Stoff, an dem sie gestorben ist, aus dem Emmental stammt? Hat sie dir verraten, wo sie das Zeug herhat? Hat sie es hier in Langnau gekauft? Hat sie dir auch gesagt, wann sie es gekauft hat?»
«Sie hat sich den Stoff in Bern besorgt. Am Bahnhof. Immer. Soviel ich weiss, hat sie jeden Tag praktisch ihr ganzes Geld ausgegeben. Das Geld, das sie am Vorabend angeschafft hat, ist am nächsten Tag für Alkohol, Tabletten, Zigaretten, Kokain und Crack draufgegangen. Ich habe den Kerl gefragt, der ihr das Koks verkauft hat, wo er es herhabe. Von einem Händler im Emmental, hat er geschwafelt und vorgegeben, er habe ihr gesagt, es sei reines Kokain. Doch das hat nichts zu sagen, verstehst du? Ameisen behaupten das andauernd. Kein Mensch glaubt ihnen, denn von einer Ameise bekommst du auf der Gasse nie reines Kokain. Never.»
«Aber diesmal hat er die Wahrheit gesagt, oder nicht?», warf ich ein.
«Ich glaube eher, er hat selbst keine Ahnung», gab sie zurück.
«Er hat keine Ahnung von was? Von Kokain? Vom Dealen? Von den Folgen?»
«Von Koks. Das Pulver, das die Hintermänner, also die Grosshändler, den Ameisen verkaufen und Koks nennen, ist ein Gemisch.»
«Ach so. Ja, davon habe ich gehört. Sie strecken es mit irgendwelchem Dreck.»
Das sei nicht ganz richtig, korrigierte sie und führte aus, Koks bestehe in der Regel zur Hälfte aus Kokain. Die andere Hälfte sei Milchzucker, dem zermalmte Schmerztabletten beigemengt würden. Kokain sei ein wasserlösliches Salz. Zusammen mit dem Milchzucker und den pulverisierten Schmerztabletten eigne es sich hervorragend zum Schnupfen.
«Leider», schloss sie.
Mir wurde bewusst, wie wenig ich eigentlich über Kokain wusste. «Wer stellt die Mischung her? Kommt Koks fixfertig in die Schweiz?»
«Nein. Es würde sich nicht lohnen, so viel Milchzucker zu schmuggeln. Die Banden schmuggeln hochgradig reines Kokain nach Europa. Die Empfänger, die Grosshändler in den Städten, verdoppeln die Menge. Ein besonders gerissener Grosshändler besprüht das Koks am Schluss mit einem Betäubungsmittel.»
«Was? Wozu?»
«Das Schnupfen schädigt die Schleimhäute. Sie werden überempfindlich. Sie schwellen an und sondern ständig Sekret ab. Das Betäubungsmittel dämpft den Schmerz unmittelbar. Das heisst, es lindert das Brennen und Stechen nicht erst nach und nach wie Koks mit den pulverisierten Schmerztabletten, sondern sofort. Grosshändler haben keine Skrupel und kein Gewissen. Die Ameisen fragen ihren Lieferanten nach Koks. Und sie bekommen Koks. Sie wissen, wie man damit Linien anhäuft und hochzieht. Und sie kennen den Preis und die Wirkung. Wenn das Koks die Schmerzen schnell und wirkungsvoll betäubt – umso besser. Mehr wollen die gar nicht wissen.»
Ich wollte wissen, warum Mandy nicht eigenhändig beim Grosshändler einkaufte.
«Ganz einfach», antwortete Petra. «An die Grosshändler kommst du nicht ran. Die halten sich verdeckt. Sie verkaufen nur an ein paar ausgewählte Ameisen. An Leute, die sie in der Hand haben, bei denen sie sicher sein können, dass sie sie nicht verraten. Und sie verkaufen nur grössere Mengen aufs Mal. Eine Ameise kauft, sagen wir einmal, vierzig Beutel. Jeder Beutel enthält ein oder zwei Gramm. Damit erscheinen sie absichtlich spät in den Gassen. Warten ist für alle Menschen leidig; für einen suchtkranken Menschen ist Warten eine Qual. Das verleiht den Ameisen Macht. Sie können für ein Gramm Koks einen höheren Preis verlangen. Sie sind selber süchtig und finanzieren sich mit dem Profit ihren eigenen Bedarf.»
«Wieso nennst du sie Ameisen?»
«Weil sie ständig in Bewegung sind, um nicht gefasst zu werden.»
«Mandy hat also normales Koks verlangt, aber reines Kokain erhalten.»
«Das steht fest. Sie hat einen Beutel mit einem winzigen Rest übrig gelassen. Den haben wir getestet. Hundert Prozent rein. Das Problem ist: In letzter Zeit hat sie manchmal geschnupft und geraucht.»
«Gleichzeitig?»
«Natürlich nicht. Sie hat nach dem Schnupfen so lange wie möglich gewartet. Sie hat, wie gesagt, herumgewitzelt. Manchmal ist sie den ganzen Nachmittag dageblieben, an der Bar oder im Hof, und ist, wenn sie es nicht mehr ausgehalten hat, wenn sie dem Verlangen nicht mehr hat widerstehen können, ins Raucherzimmer.»
«Zum Kiffen?»
«Nein. Zum Crackrauchen. Crack verschafft dir den totalen Kick. Ich habe –»
«Crack? Was ist Crack?»
«Kristallisiertes Kokain. Es knistert, wenn es verglüht. Daher der Name.»
«Und den Rauch atmet man ein, ich verstehe.»
«Ich habe ein Auge auf sie gehabt, soweit das möglich gewesen ist bei dem Rummel. Vorgestern hat sie ihre üblichen Linien geschnupft.»
Petra wurde von einer Rührung erfasst und hielt inne, um durchzuatmen.
Bis hierher konnte ich ihr folgen. «Sie hat doppelt so viel Kokain hochgezogen wie sonst.»
«Genau.»
«Spürt man das nicht in der Nase?»
«Ha! Uns hätte diese Dosis …» Sie stockte erneut, fuhr sich über die Stirn und fügte leise an: «Fast hätte ich gesagt: umgebracht.»
Ich hob die Karaffe und wollte Wasser nachgiessen.
Sie legte ihre Hand aufs Glas und fuhr weiter: «Du hast recht, wir hätten das Gefühl, es zerreisse uns die Nase. Danach würden in unserem Hirn Farben und Töne explodieren. Wir bekämen ein Gefühl von der Glorie, ein Übermensch zu sein. Mandy ist aus dem Schnupfzimmer gekommen, hat kein Wort gesagt und ist schon bei der ersten Gelegenheit ins Raucherzimmer.»
Sie stützte die Ellbogen auf die Knie und legte ihre Stirn auf den Händen ab. Bedauernswert sah sie aus, und der Klang ihrer Stimme erhöhte sich. «Ich hätte es merken müssen. An ihrem Taumel und diesem irren Blick. Sie hat es oft übertrieben, aber am Mittwoch muss sie unheimlich berauscht gewesen sein. Hätte ich den Grund gewusst … Diese Menge Kokain aufs Mal und obendrauf das Crack. Die Mischung hat ihr Herz aufgepeitscht bis zum Kollaps.»
Sie schniefte, richtete sich auf, streckte sich und sah in meine Richtung. Strähnen im Gesicht. Leichtes Beben der Unterlippe. Erneut gerötete Augen. «Sie ist aufgestanden und davongelaufen. Hat nicht einmal zu Ende geraucht. Jemand hat den Alarmknopf gedrückt. Ich bin ins Zimmer gerannt. Der Kerl am Tisch neben ihr sagte zu mir in aller Ruhe, er glaube, Mandy brauche meine Hilfe. Da ist sie schon fort gewesen. Ich bin ihr nachgelaufen, obwohl wir das Haus nicht verlassen dürfen. Sie ist den schmalen Weg zur Aare hinuntergewankt. Was heisst gewankt, sie ist getorkelt. Unten ist sie gestürzt und hat auf die Ufersteine und in die Aare Galle und Rotz erbrochen. Wir wissen, was in dem Fall zu tun ist. Wir erleben das oft. Jede Woche kippt mindestens eine oder einer vom Stuhl. Nur da unten an der Aare habe ich ihr nicht helfen können.»
Sie stand auf, fasste die Haare hinten zusammen, fuhr sich mit dem Ärmel über die Stirn. «Ich glaube, sie hat mich noch erkannt. Sie hat gelächelt. Ich habe ihr den Mund abgewischt, sie in den Arm genommen. Sie hat kein Wort gesagt, mich nur angelächelt. Plötzlich hat sie das Gesicht verzogen bis zur Fratze, hat heftig nach Luft gerungen, zweimal, dreimal, krampfhaft. Ich weiss es nicht mehr. Ich habe sie zum Atmen animiert, habe mit ihr geredet, plötzlich ist sie total erschlafft. Ich habe gekämpft, um sie gerungen, ihr Herz massiert, aber …»
Petra hob verzweifelt die Hände, begab sich ans Fenster, stützte sich an der Wand ab, legte die Stirn an den Fensterrahmen, spähte durch die Ritzen der Lamellen und hauchte: «Ich habe versucht, sie hochzutragen. Es ist zu spät gewesen, sie ist in meinen Armen gestorben.»
Ich trat ebenfalls ans Fenster und kurbelte die Storen hoch, um die Sicht auf den inzwischen stark belebten Markt freizugeben, auf die Kastanienbäume mit den letzten dürren Blättern, die sonnenbeschienenen Häuser gegenüber und den makellos blauen Novemberhimmel über allem. Es wurde verschwenderisch hell im Raum.
Sie überflog mit zugekniffenen Augen die friedfertige Welt da draussen, verfolgte das Gewimmel der Leute zwischen den Obst- und Gemüseauslagen, musterte den Stand mit den Blumenkränzen rechts aussen, hob den Kopf, schweifte mit dem Blick über die Dächer und blieb schliesslich an den goldglänzenden Zeigern der Kirchturmuhr hängen.
«Ich muss gehen», murmelte sie.
Ich geleitete sie zur Tür und bat sie um ihre Handynummer.
«Oh, fast hätte ich es vergessen.» Sie klaubte zwei geknickte Noten aus der Hosentasche, faltete sie umständlich auseinander und streckte sie mir hin. Es waren zwei Hunderter.
«Dein Vorschuss. Der eine Hunderter stammt von mir, der andere von der Kollegin mit dem Champagner.»
Ich nahm das Geld an, denn ich hatte mich entschieden und war bereit, der Sache nachzugehen. «Hat sie dich hergeschickt?»
«Nein, nur empfohlen.»
«Empfohlen? Kennt sie mich?»
«Kaum. Sie hat von dir gehört und gestern Abend ein Ehepaar besucht und über dich ausgefragt.»
«Ach so.»
«Die Frau habe dich gelobt, hat meine Kollegin gesagt. Du seist hartnäckig und aufsässig wie keiner. Sie habe gesagt: Du seist der Beste.»
«So?»
«Ja. Der Mann habe uns vor dir gewarnt. Du seist eigensinnig, oft grimmig und taktlos. Und du würdest keinen Finger rühren ohne Vorschuss.»
«Sonst noch was?»
«Du seist weder ein Herden- noch ein Rudeltier. Auch kein Alphatier. Eher der einsame Wolf.»
«Kann ich das Ganze schriftlich haben?»
«Die Frau habe gemeint, du seist standhaft wie eine Bergföhre. Es sei zwar schwer, dir zu vertrauen, aber im Grunde könne man sich auf dich verlassen.»
Ich drückte den Liftknopf und wollte ihr eine wichtige Frage stellen. Sie war mir entfallen, deshalb ging ich in Gedanken zurück zu unserem Gespräch über Mandy und grübelte. Sie kam mir zuvor, legte ihre Hand auf meinen Arm und sprach beinah flehend: «Alexander.»
«Ja?»
«Du wirst uns nicht enttäuschen, nicht wahr?»
Der Lift kam, ich zog die Tür auf, sie trat vor mir ein und meinte, etwas Zeit bliebe ihr noch, und bot mir an, gemeinsam im Keller nach der Quelle dieses widerwärtigen Geruchs zu suchen.
«Lass nur.» Ich drückte die Null, den Knopf fürs Erdgeschoss. «Eine üble Quelle aufspüren, das gehört zu meinem Beruf.»
Sie lächelte, leise, verhalten, auf der ganzen ruckigen Fahrt hinunter, und im Flur vor der Haustür reichte ich ihr zum zweiten Mal die Hand und versprach: «Ich melde mich. Spätestens dann, wenn ich den Kerl aufgespürt habe.»
Ihr Gesicht hellte sich noch mehr auf, sie schlüpfte hinaus und entfernte sich mit ausgreifenden Schritten und schwingenden Armen.
Ich stieg die schmale Treppe in den Keller hinunter und ertastete den Lichtschalter. Hier war ich noch nie gewesen. Die Luft war nur wenig kühler und roch grässlich.
Links und rechts im längeren Durchgang, von dem drei Türen abgingen, lagerten leere Harassen, Autoreifen, ein paar alte Ski und ein rostiges Velo, eine Matratze, und halb unter der Treppe entdeckte ich endlich einen steinernen Waschtrog. Ein Gartenschlauch, schmutzig, rissig, in ausgebleichtem Grün, hing nachlässig eingerollt am Hahn, das eine Ende am Stutzen festgeschraubt. Überall lag Staub, auch auf dem Schlauch und im Trog, und an der Deckenlampe und rund um das winzige Kellerfenster hatte es Gespinst dick wie Kaffeefilterpapier.
Ich steckte meine Nase in den Trog und schnupperte. Der Geruch schlug mir mit der Wucht einer platzenden Blase aus einer Kloake ins Gesicht und auf den Magen. Ich schreckte zurück und stiess mit der Ferse an eine leere Giesskanne aus Metall. Das Scheppern half mir, den Drang zu erbrechen unter Kontrolle zu bringen.
Mit spitzen Fingern und angehaltenem Atem schraubte ich den Schlauch vom Stutzen, drehte den Wasserhahn auf und trat zurück. Es fauchte und brodelte aus der Leitung, gefolgt von Spritzern einer rostroten Brühe, schliesslich sprudelte klares Wasser heraus, plätscherte in den Trog und verschwand gurgelnd im Abfluss.
Ich lauschte einen Moment dem Sprudeln und Plätschern, öffnete das Fenster, drehte den Hahn zu, wartete, bis ich sicher sein konnte, dass er nicht tropfte, ging hinauf in meine Agentur, langte nach der Zeitung, legte sie auf den Schreibtisch, hockte mich hin, griff zum Hörer und wählte die Nummer der Polizei.
4
Ein Mann hob ab und meldete: «Kantonspolizei, Sebastian Müller.» Er hatte eine unverbrauchte, freundliche Stimme und betonte seinen Namen wie eine Frage.
Ich grüsste ihn, nannte meinen Namen und ersuchte ihn höflich, mich mit Ursina Trummer zu verbinden.
Frau Trummer sei zurzeit abwesend, gab er zurück, worauf ich ihn fragte, ob sie auf Streife sei oder dienstfrei habe.
Darüber könne er keine Angaben machen, liess er verlauten.
Blieb mir noch die Frage nach Ursinas Handynummer. Ich fragte nach ihrer dienstlichen, nicht nach ihrer privaten, aber auch diese Auskunft verweigerte er. Ich hörte durch seine Förmlichkeit hindurch die Worte des Instruktors aus meiner Zeit in der Polizeischule: «Die Person in der Zentrale hält sich generell kurz, damit die Leitungen geschwind wieder frei werden. Und über laufende Verfahren darf sie keine Auskünfte erteilen. Habt ihr verstanden? Keine Auskünfte. Dazu seid ihr nicht befugt.»
Müller stammte gewiss taufrisch aus der Uniformpresse, wie wir es damals nannten, und hielt sich strikt an die Weisungen. Einstweilig, dachte ich für mich, denn die wenigsten hielten sich lange daran, fast alle wurden nach kürzester Zeit lasch. Ich gab ihm zu verstehen, dass ich Frau Trummer aus einem wichtigen Grund zu sprechen wünschte, und drängte ihn, ihr wenigstens eine Nachricht zu übermitteln.
«Gut. Alexander Bergmann, sagten Sie?»
«Ja.» Ich hörte Papier rascheln.
«Nun, was soll ich ihr ausrichten?» Er hatte meinen Namen auffällig laut und monoton ausgesprochen, jemand in seiner Nähe hatte offenbar zugehört und begann mit ihm zu tuscheln.
Ich hielt den Atem an und presste den Hörer ans Ohr, konnte trotzdem nichts verstehen.
Er meldete sich wieder: «Herr Bergmann …»
«Ja?»
«Ich verbinde Sie mit Karl Moser.»
Es knackte in der Leitung.
Karl meldete sich selbstgewiss wie in alten Zeiten und mit seiner durch den Hörer hindurch vernehmbaren feuchten Aussprache: «Hallo, Alexander.»
«Tag, Karl.»
«Um diese Zeit schon auf den Beinen?»
«Wieso fragst du?»
«Ich meine bloss, weil du doch jetzt dein Geld damit verdienst, Ehebrecher zu beschatten. Fotografierst du sie manchmal nachts durchs Schlafzimmerfenster?»
«Wer sagt das?»
«Ich stelle mir das aufregend vor.»
«Quatsch. Ehebruch ist seit tausend Jahren kein Scheidungsgrund mehr.»
«So?» Er lachte. «Pech für dich.»
Ich mochte ihn noch nie gut leiden. «Was willst du?», fragte ich.
«Ich? Nichts. Du hast angerufen.»
«Ich habe Ursina verlangt. Weisst du, wo sie ist? Ich möchte sie etwas fragen.»
«Privat? Dienstlich darf sie keine Auskunft geben. Auch dir nicht, das weisst du.»
Wir waren während meiner siebenjährigen Dienstzeit bei der Polizei zweieinhalb Jahre im Streifenwagen zusammen durch die Gegend kutschiert. Karl pflegte ohne Pause zu quasseln und verdrückte ganze Packungen Marzipan. Ich hatte meistens am Lenkrad gesessen. Er wartete, bis wir aus dem Dorf raus waren, fingerte eine Schachtel Backmarzipan aus der Innentasche seiner Uniformjacke, öffnete den Karton, riss die Hülle auf, zog den farblosen Block mit den Zähnen halbwegs heraus, biss ein Stück ab, kaute lustvoll und wies mit der Packung, aus der das angebissene Teil guckte, zu einer hochgelegenen Grillstelle mit Sitzbänken, deutete zuhinterst in eine Talsenke, zu einem einsam stehenden, windschiefen Heuschober mit moosüberwuchertem Dach oder auf die nächste Anhöhe, zu einer frei stehenden Linde.
«Bei ’er Linde, ’ort oben, ’iehst du sie?», schmatzte er, genehmigte sich mit unverschämter Gier zwei weitere Bissen und gab mit gefüllten Backen ein siebzigfach herumgebotenes Histörchen zum Besten.
«Was willst du von Ursina wissen?», hörte ich ihn fragen. «Was kann ich ihr ausrichten?»
Auch das war Karl, wie ich ihn in Erinnerung hatte: schonungslos darauf erpicht, über alles und jeden Bescheid zu wissen. Er verwendete reichlich Zeit darauf, zu erkunden, was gerade herumgeboten wurde, vom neusten Witz über Klatsch und Tratsch bis hin zu angekündigten Instruktionen; und natürlich kannte er immer jeden Vorschlag über voraussichtliche Beförderungen.
Ich überlegte, ob ich ihm nach fünf Jahren getrennter Wege noch trauen konnte, und gab vor, ich hätte eine Grundsatzfrage.