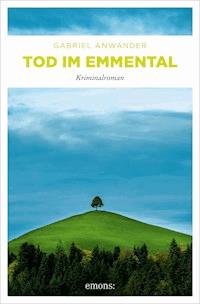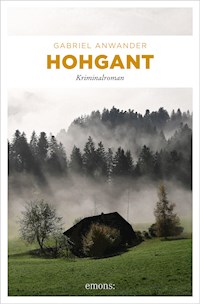Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Alexander Bergmann
- Sprache: Deutsch
Trockener Humor, bissige Dialoge, großartiges Gespür für Land und Leute. Sattgrüne Hügel, weite Wälder, kühle Tobel, naturverbundene Menschen und reines Quellwasser – das Emmental ist Idylle pur. Bis ein Tierarzt und eine junge Frau ermordet werden. Wie hängen die beiden Fälle zusammen? Privatdetektiv Bergmann nimmt die Spur auf – und stößt auf einen perfiden Plan, der das gesamte Emmental in eine Katastrophe stürzen könnte ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Anwander, geboren und aufgewachsen in der Ostschweiz, absolvierte die Fachhochschule für Landwirtschaft und arbeitete in unterschiedlichsten Berufen, unter anderem in Kanada, Indien und Kamerun. Er lebt heute gemeinsam mit seiner Frau im Emmental.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
©2020 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: Hans Wüthrich, foto-wuethrich.ch Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer Umsetzung: Tobias Doetsch Lektorat: Irène Kost, Biel/Bienne, Schweiz eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-620-3 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmässig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unterwww.emons-verlag.de
Alles Leben und unser ganzer Wohlstand
gründen auf Wasser.
1
Ich griff nach meinem Jackett, da klopfte es an die Tür.
«Ja, bitte?»
Die Tür ging langsam auf, Madame Bernard trat ein. Sie blieb mitten im Raum stehen, stützte sich auf ihren Stock und drehte ihren Kopf mehrmals hin und her. Entweder wollte sie sich vergewissern, ob ich allein war, oder sie hatte sich jemand anders erhofft.
Ich hatte sie längst erwartet, denn vor drei Wochen war ihr Lebenspartner, der Tierarzt Dr.Paul Geberal, getötet worden. Jemand hatte ihn am Steuer seines Wagens erschossen, mitten in der Nacht, auf der Holzbrücke Steinbach, zweihundert Meter ausserhalb von Trubschachen. Die Polizei suchte den Täter unter den Bauern, nahm ein paar in Untersuchungshaft, verhörte sie und liess alle wieder laufen. Der Mörder lief frei herum. Und so wich in der Bevölkerung die anfängliche Zuversicht einer Besorgnis, er würde womöglich nie gefunden. Selbst die Tatwaffe blieb bis heute verschollen.
Mich erfasste jedes Mal eine Unruhe, wenn ich daran dachte. Tun konnte ich nichts, jedenfalls nicht, solange ich keinen Auftrag in der Sache hatte.
Weil ich zu wissen glaubte, weshalb sie mich aufsuchte, sagte ich erwartungsvoll: «Guten Tag, Madame Bernard.»
«Guten Tag, junger Mann.»
Meine Agentur befand sich im Dorfzentrum von Langnau im dritten Stock eines älteren Reihenhauses. Die Glocken der reformierten Kirche, keine achtzig Meter entfernt, läuteten mit zwölf tonsicheren Schlägen den Mittag ein und auferlegten uns mit den tiefen Klängen, die mit Leichtigkeit die Wände und Fenster dieses Hauses durchdrangen, etwas wie eine Schweigeminute.
Ich zählte mit und fragte, während der letzte Glockenschlag verhallte: «Was kann ich für Sie tun?»
«Ich suche Herrn Bergmann.»
«Der bin ich.» Ich streckte ihr die Hand hin. «Alexander Bergmann ist mein Name.»
Sie stützte sich beharrlich auf ihren Stock, übersah meine Grusshand und fragte: «Sind Sie ein Detektiv?»
«Ja.»
«Privatdetektiv?» Betonung auf Privat.
«Allerdings.»
«Haben Sie eine Lizenz?»
«Sicher.»
Ich hängte das Jackett zurück an den Nagel, schloss die Tür, bot ihr einen Stuhl an und setzte mich hinter meinen Schreibtisch. Er war alt, schwer, zerkratzt und roch nach Käse, denn er stammte aus dem Nachlass eines Emmentaler Käsehändlers.
Sie kam näher, blieb stehen und fragte: «Haben Sie auch eine Pistole?»
«Selbstverständlich. Wollen Sie sie sehen?»
Madame Bernard war in jungen Jahren Jockey gewesen und hatte, gemessen an ihrer Grösse, eine reine, kräftige Baritonstimme. Und sie setzte ihre Stimme bemerkenswert forsch ein, genauso forsch guckten ihre Augen. Sie presste die Lippen aufeinander, stand einfach da, zeigte weder ein Nicken, noch hob sie die Hand zur Verneinung.
Folglich nahm ich meine Beretta aus dem Metallschrank, entfernte das Magazin, entsicherte, spannte den Hahn, zielte an die Decke, drückte ab und legte die Waffe quer zwischen uns auf den Schreibtisch.
Sie starrte die Pistole an. Ich sah, wie ihre Hand am Stock zu zittern begann, und glaubte nach dem Klicken ein Stöhnen gehört zu haben oder einen traurigen Seufzer. Deshalb nahm ich die Beretta wieder in die Hand, sicherte, legte das Magazin ein, verstaute das Ding wieder im Schrank und schloss ab.
Madame Bernard fasste sich. Sie trat ganz an die Schreibtischkante, neigte sich vor, rückte ihre Brille zurecht und musterte mich mit vergrösserten Augen für die Dauer, die meiner Grossmutter gereicht hätte, einen Wollschal zu stricken. Anschliessend legte sie den Stock auf die Tischplatte, streckte mir die jetzt freie Hand rüber. «Darf ich Sie Alex nennen?»
«Meinetwegen.» Ich stand auf und schlug ein. «Wie kann ich Ihnen helfen?»
Ihre Hand packte kräftig zu und fühlte sich doch eiskalt an.
«Ich brauche Ihre Dienste», sagte sie.
«Wollen Sie sich nicht setzen?»
Sie schüttelte den Kopf. «Simi, äh… Simon Aeugster, mein Schwiegersohn, ist versetzt worden.»
Das irritierte mich. «Ihr Schwiegersohn? Versetzt?»
«Ja, versetzt.» Sie nickte kaum merklich.
Ich hakte nach. «Von wem versetzt? Von Ihrer Tochter?»
«Non, pas du tout», antwortete sie aufgebracht. «Der Gemeinderat hat ihn versetzt. Simi ist bei der Gemeinde angestellt. Ab sofort soll er da unten arbeiten, in dieser Abwasserdingsda.» Sie schwang den Arm in einer weiten Geste von sich weg und wedelte dazu mit der Hand.
«In der Kläranlage?»
«Äh…?»
«In der ARA, der Abwasserreinigungsanlage?»
«Genau dort.»
«Wir nennen das Kläranlage.»
«Von mir aus.»
«Was hat er denn getan?»
«Nichts.»
«Nichts? Da kann er froh sein, haben sie ihm nicht gekündigt.»
Sie hob den Zeigefinger und zischte: «Ich warne Sie, Alex, machen Sie sich nicht über mich lustig.»
«Was wirft der Gemeinderat ihm denn vor?»
«Das fragen Sie ihn am besten selbst.»
«Wen? Den Gemeinderat?»
«Nein, Simi.»
«Und was wollen Sie, dass ich tue?»
«Dafür sorgen, dass er seine alte Stelle wiederbekommt. Die Versetzung muss rückgängig gemacht werden.»
Nein. Nein, das war kein Fall für eine ausgewiesene Spürnase wie mich. Die Leute kamen mit den seltsamsten Anliegen zu mir, das war nicht neu. Zwar stand auf meiner Karte «Ermittlungen aller Art. Privat und diskret», aber das, was Madame Bernard von mir verlangte, entsprach nicht dem, was ich unter einer klassischen Ermittlung verstand. Zudem fühlte ich mich zu der Dienstbarkeit, die ihr offenbar vorschwebte, nicht befähigt. Im ersten Moment war ich enttäuscht, offen gestanden, hart an der Grenze zu gekränkt.
Ich ging um den Schreibtisch herum und hob beschwichtigend die Hände. «Nein. Tut mir leid, Madame Bernard, ich bin kein Anwalt. Versuchen Sie es in der Anwaltskanzlei drüben in der Kirchgasse9. Ein Anwalt kann Ihnen besser helfen. Ich leiste keine Fürsprache.»
«Ich will keinen Fürsprecher. Was ich will, ist ein Privatdetektiv, der herausfindet, was passiert ist. Und vor allem: wer dahintersteckt. Sie seien der geeignete Mann dafür, hat mir die Dame versichert. Sie wüssten immer, was zu tun sei.»
Während ich überlegte und abwägte, zog sie ein Couvert aus ihrer Handtasche und übergab es mir.
«Hier, nehmen Sie. Die Dame hat auch gesagt, Leute wie Sie verlangten immer einen Vorschuss.»
Auf die Frage, welche Dame sie zu mir geschickt und ihr das mit dem Vorschuss verraten habe, antwortete sie: «Na, wer wohl? Die Juristin in der Anwaltskanzlei, drüben in der Kirchgasse9.»
Darauf erklärte ich, bei ihr würde ich bezüglich Vorschuss eine Ausnahme machen, aber sie konterte trocken: «Nicht nötig», und griff nach ihrem Stock.
Sie humpelte zur Tür.
Ich überholte sie, legte meine Hand auf die Klinke und versprach, sie am Abend in ihrem Haus aufzusuchen. «Wie wär’s um acht Uhr? Können Sie Ihren Schwiegersohn bitten, da zu sein?»
Sie reagierte ungehalten. «Mais non! Ich will, dass Sie mit mir kommen. Hilde hat gekocht. Sie wollten doch irgendwo zu Mittag essen, oder?»
«Jetzt gleich?»
«Ja, jetzt gleich.»
Es war Mittwoch, der 15.März. Ich wäre tatsächlich irgendwo essen gegangen, wahrscheinlich in den Gasthof zum goldenen Löwen.
Ich riss das Couvert auf, es enthielt vier neue Hunderter. Das waren vier handfeste Beweggründe, mitzugehen und den Auftrag wenigstens zu prüfen. Unverbindlich, versteht sich.
2
Ich nahm mein Jackett vom Haken, schloss die Tür und folgte ihr zu ihrem Wagen. Sie besass einen grünen Range Rover mit weissem Dach; eines dieser kantigen Modelle mit einem Anhängerhaken und Gittern vor den Schlussleuchten. Sie musste auf den Sitz hochklettern, aber hinter dem Lenkrad schien sie um Jahre jünger.
Sie manövrierte den imperialen Wagen geschickt aus dem Parkfeld, steuerte ihn zunächst die Allee-, dann die Fansrütistrasse hinauf und bog zuoberst auf der Kuppe auf einen Fahrweg ein, der als Sackgasse beschildert war und leicht aufwärts durch einen abschüssigen Wald führte.
Wir rauschten dahin, die Frühlingssonne blinkte freundlich durch die Tannen.
Nach einer Kurve wich sie auf eine Ausweichstelle aus, stoppte und wartete. Ein Fahrzeug brauste uns entgegen und wirbelte tüchtig Staub auf. Ein vanillefarbener Mercedes, eines dieser älteren Flaggschiffe mit senkrechtem Kühlergrill und ungetönten Scheiben. Es sass ein Mann am Steuer, auf dem Nebensitz eine Frau mit honigblonden Haaren und einer Sonnenbrille mit Gläsern so gross wie Untertassen. Ich vermochte nicht zu erkennen, wer die beiden waren, weil die Sonne zu sehr blendete.
Der Fahrer hielt auf gleicher Höhe an und kurbelte die Scheibe hinunter. Madame Bernard liess ihre Scheibe ebenfalls nach unten gleiten. Der Mann grüsste mit tiefer Stimme. «Colette.»
Er und Madame Bernard waren ungefähr im selben Alter.
Sie beugte sich vor, schaute zum Fahrer hinüber. «Elvira? Franz?»
Ich blieb ruhig sitzen und schaute geradeaus. Um die beiden zu sehen, hätte ich mich ducken und meinen Kopf vorstrecken müssen.
«Wie geht es dir?», hörte ich ihn fragen.
Madame Bernard liess sich Zeit mit der Antwort. «Es geht.» Ihre Finger krallten sich am Lenkrad fest.
«Können wir etwas für dich tun?»
«Ich muss selbst zurechtkommen.» Sie bewegte fast unmerklich den Kopf hin und her. «Nein, im Moment nicht. Danke.»
«Wirklich?» Er liess nicht locker.
«Géraldine, Simon, Hilde, die Pferde– ihr wisst schon. Das Leben geht weiter.»
«Sonst… Du weisst, wo du uns findest. Komm einfach vorbei.»
«Hm…» Sie nickte seitwärts.
«Also dann, schönen Tag.»
«Gleichfalls.» Madame Bernard hob die Hand, und die Mercedes-Karosse brauste davon. Sie guckte in den Rückspiegel und murmelte: «Tannmatters.»
Den Namen hatte ich schon einmal gehört. «Nachbarn von Ihnen?»
Sie sah wieder nach vorn, kippte die Sonnenblende herunter und fuhr an. «Vor bald zwei Jahren haben wir ihnen den Alpstall verkauft. Sie haben den Wohnteil in ein Ferienhaus umgebaut.» Ihre Hand richtete die Sonnenblende dienlicher ein. «Schön gelegen. Zuoberst. Am Ende dieser Strasse.» Sie gab Gas, und die Räder erzeugten auf der löchrigen, ausgewaschenen und mit losen Kieselsteinen übersäten Fahrbahn ein Rauschen, das sich mit dem Brummen des Motors im Wageninneren zu einem Dröhnen auswuchs. Wir fügten uns dem Lärm, ich ergab mich dem Vibrieren und Schaukeln und schwieg.
Ich nutzte die Zeit und rief mir in Erinnerung, was ich über sie wusste: Sie hiess Colette Bernard, galt als resolute, vermögende Dame und lebte hoch über Langnau auf einem Hof. Alle nannten sie Madame Bernard, weil sie ursprünglich aus einer Westschweizer Adelsfamilie stammte, die Rennpferde züchtete. Sie begann in jungen Jahren mit einer Stute ihres Vaters an Rennen teilzunehmen, feierte Erfolge, sogar in England, machte sich selbstständig und wurde Jockey. Zu Deutsch: Berufsrennreiterin. In St.Moritz lernte sie den Zürcher Tierarzt Dr.Paul Geberal kennen; er unterzog die Pferde einer letzten Prüfung vor dem Rennen. Es war eines dieser spektakulären Flachrennen über den gefrorenen See, dem White Turf, auf tausendachthundert Metern über Meer. Mitten im Winter. Sie gewann mit fünf Längen vor dem Zweitklassierten. Das war eine Sensation.
Bei der Siegerehrung überreichte der junge Tierarzt Dr.Geberal ihr fünf Rosen, legte den Arm um sie, beugte sich zu ihr hinunter und küsste sie auf die Lippen. Die Tatsache, dass er sie küsste, überzeugte sie mehr als alles andere, denn sie hatte sich vor dem Rennen die Lippen, ja das ganze Gesicht gegen die klirrende Kälte dick eingefettet.
Keine Ahnung, ob die Geschichte stimmte. Es kursierten im Emmental mehrere Versionen mit Unterschieden in den Zeitangaben und gespickt mit albernen und zum Teil widersprüchlichen Einzelheiten. Dass sie das Rennen gewonnen hatte, das konnte man nachlesen. Die Sache mit den Rosen und dem Kuss, da gingen die Versionen auseinander.
Vor schätzungsweise zwanzig Jahren stürzte sie kurz nach dem Start und geriet unter die Hufe des nachfolgenden Pferdes. Seither zog sie ein Bein nach und benötigte zum Gehen einen Stock.
Zu der Zeit wurde im Emmental ein Tierarzt gesucht. Geberal bewarb sich um die Stelle, und sie kauften gemeinsam den Bauernhof auf der Sonnenseite des Tales hoch über Langnau. Die beiden zogen mit ihren zwei schulpflichtigen Töchtern ein, verkauften die Kühe, bauten den Stall um, errichteten eine Halle und schafften Pferde an. Geberal und Bernard lebten ohne Trauschein wie Mann und Frau, etwas, das im Dorf und weniger unter den Bauern, deren Viehbestand er als Tierarzt betreute, anfangs für reichlich Gesprächsstoff sorgte.
Madame Bernard fuhr meistens allein ins Dorf hinunter, stellte den Wagen im Zentrum ab, humpelte durch die Gassen, suchte zuerst die Bank oder die Post auf, wohl um Geld abzuheben oder finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, und danach das eine oder andere Fachgeschäft, um Besorgungen zu erledigen.
Ich erinnerte mich an eine Begegnung mit ihr. Es war an einem Samstag Ende August oder Anfang September gewesen, circa zwanzig Minuten vor zwölf. Sie stand vor der Postfiliale und blickte verloren um sich. Sie trug ein dunkelgoldfarbenes Leinenkostüm und einen Strohhut mit roter Schleife und fragte mich nach der Uhrzeit. Samstags schliesse die Post um halb zwölf, bemerkte ich, denn sie war offensichtlich angerannt.
Heute trug sie einen eleganten anthrazitgrauen Wollmantel, einen olivgrünen Filzhut und olivgrüne Stiefeletten. Obschon ihr Körper den Mantel nicht mehr auszufüllen vermochte, war ihre Ausstrahlung nach wie vor magisch. Hornbrille, kühner Blick, die Lippen weinrot geschminkt, die Schultern leicht vorgezogen, in der linken Armbeuge eine schwarze Henkeltasche und mit der rechten Hand auf ihren Gehstock gestützt, so war sie vor einer halben Stunde in meine Agentur getreten.
Ich sass bequem im ledernen Sitz des Range Rovers, beobachtete sie von der Seite und dachte, die Person möchte ich sehen, die sich von ihr nicht hätte in den Bann schlagen und zum Mitgehen verpflichten lassen.
Sie war und blieb eine Aussenseiterin im Dorf, wenn nicht im ganzen Emmental. Sie war eine Fremde und unternahm nichts, um ihr Ansehen und ihren Ruf als mannhafte, unnahbare Madame zu entschärfen. Im Gegenteil: Den Stock oder besser seinen Griff aus Sterlingsilber schwang sie mitunter mit beiden Händen gegen Personen, die sie ärgerten. Dafür war sie weitherum bekannt. So wie neulich gegen die drei Schuljungen, die sie auf der Treppe zur Unterführung unter dem Bahnhof erschreckt hatten. Oder gegen den Taxifahrer, der sie auf dem Fussgängerstreifen vor dem Hotel Emmental im Gegenlicht der Morgensonne um ein Haar übersehen hätte. Und gegen die Reiterin, die ihr bei Wind und Regen auf dem Ilfisdamm trabend entgegengeritten kam und derentwegen sie den Pfad verlassen und sich im steilen Bord an den Stamm einer Tanne klammern musste. Sie, die ehemalige Berufsreiterin, verzieh der Freizeitreiterin diese Rücksichtslosigkeit nie.
Nach dem Tod von Geberal zog sich Madame Bernard zurück, um ihre Trauer nicht der Gefahr von geheuchelten, anbiedernden und damit herabwürdigenden Beileidsbekundungen auszusetzen, wie sie dem Pfarrer gesagt haben sollte. Heute war sie vermutlich das erste Mal wieder ins Dorf heruntergekommen.
Wir gelangten zur Hofeinfahrt.
Sie liess den Range Rover über den Vorplatz rollen und nach einem flotten Bogen in die Garage eintauchen.
Wir stiegen aus.
Ich roch die Pferde, unmittelbar und eindeutig, ihren Schweiss und auch den nach Pisse riechenden Mist. Gleichzeitig war ich hingerissen von der Aussicht auf die schneebedeckte Berner Alpenkette. Eis und Schnee schillerten in allen Farben, und die Spitzen, Kanten und Kronen der Berge zeichneten sich scharf gegen den tiefblauen Himmel ab. Der Anblick war atemberaubend. Die drei Berggiganten, Eiger, Mönch und Jungfrau, boten einen herausragenden, ja majestätischen Auftritt. Davor erhob sich der Hohgant, der Berg, der das Emmental gegen Süden abgrenzte. Links davon die auffällige Gebirgskette mit dem markanten Höcker zum Abschluss: die Schrattenfluh mit dem Schibengütsch. Sie bildeten die Ostgrenze.
Hinter dem Hohgant entsprang die Emme. Sie zwängte sich zwischen Schibengütsch und Hohgant hindurch, floss Richtung Norden und mündete nach achtzig Kilometern in die Aare.
Ich riss mich los, schaute hinunter ins Dorf und liess den Blick über ein Teilstück der Ilfis– ein Seitenfluss der Emme– und über die vielen Dächer, Strassen, Plätze und blühenden Sträucher schweifen. Zuletzt blieb ich am Kirchturm hängen, die Uhr zeigte drei Minuten nach halb eins.
Madame Bernard hatte sich die Handtasche und den Stock vom Rücksitz geangelt und stand an meiner Seite. «Kommen Sie, Hilde wartet nicht gern mit dem Essen.»
Sie mühte sich die drei Steintritte hoch, öffnete die Haustür, trat in den schmalen Flur und rief: «C’est moi!»
Die Tasche stellte sie weg, den Stock stiess sie in den Schirmständer, und den Filzhut bugsierte sie auf die Hutablage. Sie zog den Mantel aus, hängte ihn an die Garderobe und deutete mir an, es ihr gleichzutun. Im Vorbeigehen äugte sie in den Spiegel, lockerte mit den Fingerspitzen ihr volles, halblanges, silberglänzend glattes Haar, lachte über mein verlegenes Gesicht und verschwand in der Küche.
Ich hängte mein Jackett neben ihren Mantel und wartete.
Mit einem Hauch von Knoblauch und Braten kam sie zurück und führte mich in die Bauernstube.
Eine Frau und ein Mann sassen an einem Holztisch, an dem gut und gern acht Personen Platz fänden. Vier Plätze waren gedeckt.
Madame Bernard sagte: «Voilà
3
Die Frau und der Mann sassen sich gegenüber und sahen von ihren Handys auf.
Madame Bernard berührte mich am Ellbogen und sagte: «Das ist meine Tochter Géraldine, und das ist Simi, mein Schwiegersohn. Simon Aeugster.»
Die Holzdecke war niedrig. Ich musste achtgeben, um mir den Kopf nicht am Querbalken zu stossen, grüsste die beiden, hockte mich neben Simon Aeugster und sah mich um.
Milchfarbene Vorhänge vor den sechs Fenstern brachen das Licht der Sonne, nicht aber ihre Wärme. Auf der freien Seite des Tisches stand eine Vase mit einem Strauss gelber Tulpen. Die Stängel neigten sich zu allen Seiten, vermutlich durch den Stress der Wärme, verschärft durch Wassermangel. Von der Decke hing an zwei dünnen Stahlseilen eine moderne schmale Leuchte.
Eine beleibte ältere Dame mit weisser Schürze schnellte durch die Tür, einen dampfenden Topf in beiden Händen, und rief: «Vorsicht, Suppe!»
Wir begannen zu essen. Ich wandte mich an Simon Aeugster und fragte: «Sie sind versetzt worden, ist das richtig?»
«So ist es.»
«Weshalb? Was haben Sie getan?»
Er räusperte sich, rührte mit dem Löffel in der Suppe, überlegte lange, antwortete wie mit einer Gegenfrage: «Nichts?», und ass weiter.
«Soso.» Ich genoss meine Suppe. Kartoffelsuppe, angereichert mit einem Teelöffel Kürbiskernöl. Schmeckte vorzüglich.
Es gab Familien im Emmental, die redeten oder assen bei Tisch, taten aber nie beides gleichzeitig. Verstiess ich gegen ihre Sitte, wenn ich meine Fragen während des Essens stellte? Erwarteten sie, dass ich ass und schwieg und ausharrte, bis Reden angesagt war? Ich legte den Löffel in den leeren Teller und besah mir die Gesichter. Was jetzt? Wie weiter? Sollte ich ungeachtet ihrer Sitten meine Fragen stellen? Oder abwarten und den Kopf neigen wie die Tulpen?
Es war Géraldine Aeugster, die das Schweigen brach. «Meinen Mann trifft keine Schuld. Wir können das nicht verstehen. Seine Versetzung… Es gibt keinen triftigen Grund. Es ist… ungerecht.»
Sie hatte offenbar nach einem anderen, schärferen Wort gesucht. Sie rief mit aufgebrachter Stimme: «Es ist eine Gemeinheit! Jawohl, eine Gemeinheit. Hören Sie, Sie müssen uns helfen.»
Ich bemühte mich, weder gelangweilt noch verärgert zu klingen, und fragte: «Will er denn, dass man ihm hilft?»
Die beiden Frauen wechselten zuerst vieldeutige Blicke. Dann täuschte Géraldine Aeugster ein Lächeln vor, und Madame Bernard wartete ab, mit verhaltenem Atem und gerunzelter Stirn.
Simon Aeugster schob den leeren Teller von sich weg und lehnte sich zurück. Er blieb gefasst, irgendwie kühl, unbeteiligt, distanziert. Auf jeden Fall verhielt er sich mir gegenüber abweisend. War es ihm egal, versetzt worden zu sein? Oder fühlte er sich verletzt? War er beleidigt? Beschämt? Verheimlichte er etwas? Stand er über der Sache? Hatte er am Ende selbst die neue Stelle beantragt? Spielte er ein falsches Spiel?
Von der Seite betrachtet sah er besonnen aus, geradezu heiter. Sein Verhalten liess keinen Schluss auf seine Gefühle zu.
Er holte tief Luft und redete mit seinem Teller. «Ich weiss nur, dass es mir da unten nicht gefällt. Ganz und gar nicht.»
Die Dame mit der weissen Schürze trug Braten auf, Rosenkohl, Kartoffelstock, sammelte die Suppenteller ein und trippelte hinaus.
Ich trank einen Schluck Wasser, kostete den Braten, den Stock und den Kohl und sagte zu Madame Bernard: «Das Essen schmeckt ausgezeichnet. Ich beneide Sie um Ihre Köchin. Vielen Dank für die Einladung.»
Sie lächelte flüchtig und nickte. «Ja. Hilde ist uns eine grosse Hilfe. Was täten wir ohne sie.»
Darauf folgte wieder ein gespanntes Schweigen.
Ich schwitzte, dachte an die vier Hunderter und daran, dass Madame Bernard mich ausdrücklich zum Essen eingeladen hatte, und beschloss, keine Gedanken mehr über Tischsitten zu verschwenden und meine Fragen zu stellen, bevor mir der Kragen platzte.
«Wann sind Sie versetzt worden? Ist das lange her?» Ich betrachtete weiterhin Simon Aeugsters Profil.
«Gestern», antwortete er und stopfte sich ein grosses Stück Braten in den Mund.
«Oh, das ist gut», sagte ich. «Das ist sehr gut.»
«Was?» Er warf mir einen verstörten Blick zu.
«Ich meine, es ist gut, dass Sie mich gleich geholt haben.»
Er trank einen Schluck Wasser und wandte sich an die Frauen. «Es stinkt. Entschuldigt, aber es stinkt da unten wie in einem Affenhaus.»
Madame Bernard wurde weiss im Gesicht, ihre Augen verengten sich hinter der Brille zu schmalen Schlitzen, und ihre Mundwinkel sackten ab. Sie knallte Messer und Gabel hin und beugte sich weit über den Tisch, so weit, dass ich annehmen musste, sie sei von ihrem Stuhl aufgestanden. Sie schnaubte: «Was ist los, Simi? Willst du nicht auspacken? Sag es ihm. Sag ihm endlich, worum es geht. Rede!»
Es entstand eine frostige Stille in dieser unerträglichen Wärme.
Madame Bernard sank zurück auf ihren Stuhl. Simon Aeugster hüstelte gekünstelt in die Faust und sagte zu mir: «Jemand hat die UV-Anlage ausgeschaltet.»
Ich fragte: «Jemand hat was?», und setzte mich aufrecht hin, um Bereitschaft zu signalisieren.
«Die UV-Anlage ausgeschaltet.» Endlich wandte er sich mir zu, endlich konnte ich sein Gesicht aus der Nähe betrachten, seiner Mimik folgen und damit seine Redlichkeit abschätzen. Er war ein schlanker Mann mit hoher Stirn, schwarzen, gewellten Haaren und grossen, melancholischen Augen. Seine Brauen, schwarz wie Teer, waren über der Nasenwurzel zusammengewachsen. Auch die Kopfhaare, Wimpern und der Schnurrbart hoben durch ihre Schwärze die Blässe in seinem Gesicht hervor, dass man hätte glauben mögen, er habe die Haut mit Kreidestaub eingepudert. Die schmalen Hände mit den langen Fingern rundeten sein Wesen ab. Er hätte ein junger, aufstrebender Jazz-Pianist sein können, ein Modefotograf, ein Fernsehreporter, bestenfalls ein Gesangslehrer, aber bestimmt weder ein Reitlehrer noch ein Hufschmied.
«Das müssen Sie mir erklären», sagte ich.
«Ich bin Brunnenmeister.»
«Hat das etwas mit dem Trinkwasser zu tun?»
«Ja. Ich bin der Brunnenmeister der Gemeinde Langnau. Oder einfacher gesagt: Ich bin für das Trinkwasser zuständig. Brunnenmeister ist eine Bezeichnung mit langer Tradition.» Er sprach ruhig und vernünftig, gleichzeitig beschäftigten sich seine Finger spielerisch mit dem Dessertlöffel. «Die Hälfte des Trinkwassers pumpen wir aus dem Grundwasser, die andere Hälfte fliesst aus zwei Quellen– aus diesen Hügeln da oben.»
Er stand auf, trat an eines der Fenster und schob den Vorhang zur Seite. «Sehen Sie den Höhenzug dort? Alles Wald. Den kennen Sie bestimmt, den kennt jeder in Langnau, das ist der Dorfberg. In der Lichtung unter dem zweiten Buckel, man sieht ihn von hier schlecht, dort befindet sich die Quelle. Direkt in der Spitze der Schneise. Der Stollen zur Fassung führt nur wenige Meter tief in die Nagelfluh. Es ist Nagelfluh von der härtesten Sorte. Das Wasser perlt kristallklar aus winzigen Ritzen. Es rinnt in einen Kännel, und von dort leiten wir es über ein Rohr ins Reservoir da vorne. Nicht weit von hier.»
Er setzte sich wieder an den Tisch. «Die zweite Quelle befindet sich einen Kilometer östlich von hier. Leider ist das Wasser aus den beiden Quellen nicht immer völlig rein.»
Nun prüfte er mein Gesicht, überlegte wohl, wie viel ich von Trinkwasser verstand.
«Bitte reden Sie weiter», sagte ich. «Ich trinke Wasser. Abgesehen davon habe ich mich nie darum gekümmert, woher es stammt.»
«Die andere Hälfte unseres Trinkwassers pumpen wir aus dem Grundwasser. Die Pumpstation befindet sich flussaufwärts. Im Niedermoos. Wir saugen das Wasser aus vierzig Metern Tiefe herauf und leiten es in ein separates Reservoir. Das Wasser aus den beiden Quellen ist reichhaltiger an Mineralien, schmeckt auch besser als das Grundwasser, aber es ist eben wie gesagt nicht immer rein. Ab und zu können wir darin Bakterien nachweisen. Aus diesem Grund wird das Wasser aus den beiden Quellen, wenn es vom Reservoir ins Verteilnetz fliesst, mit ultraviolettem Licht bestrahlt.»
«Bestrahlt?»
«Nun, nicht wie Sie denken. Das Sonnenlicht besteht zu einem Teil aus UV-Strahlen. Das ist unser Glück auf Erden. Es wirkt desinfizierend. Nun müssen Sie sich vorstellen, das Wasser strömt in einem dicken Rohr an einer Röhrenlampe vorbei, die ultraviolettes Licht aussendet. Das ist eine reine Sicherheitsmassnahme. Dieses Licht tötet alle Bakterien und Viren ab– falls es welche hat. Das dauert weniger als zwei Sekunden. Rohwasser wird so zu Trinkwasser.»
4
«Wenn ich Sie recht verstehe», wiederholte ich Simon Aeugsters Aussage, «ist jemand in das Reservoir eingebrochen und hat diese Röhrenlampe ausgeschaltet. Das Wasser ist weiterhin ins Netz geflossen. Frank und frei. Ohne Desinfektion.»
«So ist es», bestätigte er.
Ich nahm das Wasserglas in die Hand. «Nun ist es wieder einwandfrei? Trinkbar?»
«Ja», antwortete er kurz und überzeugend.
«Ich wohne im Quartier unter dem Dorfberg. Somit haben ich und andere Leute in meiner Nachbarschaft Rohwasser getrunken. Zumindest ein paar Tage lang. Ist das so?»
Bei dieser Frage zauderte er, griff nach seinem Glas, trank es leer und presste schliesslich ein gequältes «Ja» hervor.
«Aus diesem Grund sind Sie versetzt worden?»
Er nickte schwach, sein Gesicht bekam einen Ausdruck, der schwer zu ergründen war. Auf jeden Fall war er verstimmt.
«Das scheint mir unlogisch», folgerte ich. «Mein ehemaliger Polizeichef würde behaupten, das sei folgewidrig. Sie sind bestraft worden für etwas, das Sie nicht getan haben. Erzählen Sie weiter.»
«Der Punkt ist der: Es wird mir angelastet. Wer immer es gewesen ist, dieser Jemand ist nicht ins Reservoir eingebrochen. Ich denke, er hat einen Schlüssel gehabt. Es sind keine Schäden an der Tür zu sehen.»
«An den Fenstern?»
«Die beiden Fenster sind erstens zu klein und zweitens vergittert.»
Seit seinem Abstecher zum Stubenfenster redete er hastiger und lauter, und den Dessertlöffel rührte er nicht mehr an, weil er die Hände einsetzte, um seinen Ausführungen mehr Überzeugungskraft zu verleihen.
«Der Gemeinderat nimmt an, ich hätte die Tür nicht abgeschlossen. Das werfen sie mir vor. Verstehen Sie? Sie behaupten, jemand habe bemerkt, dass ich nicht abgeschlossen habe, vielleicht mich schon länger beobachtet, jedenfalls die Situation ausgenutzt, sei eingedrungen und habe die Anlage ausgeschaltet. Jemand ‹ohne Befugnis›, haben sie gesagt.»
«Ein Lausbubenstreich?»
Er biss sich auf die Unterlippe, nahm einen Anlauf zum Sprechen, legte den Kopf in den Nacken, kämpfte sichtbar mit den Tränen, bewegte den Kopf von einer zur anderen Seite, lugte wieder zu mir, holte Luft und sagte: «Ich weiss es nicht. Ich weiss es wirklich nicht.»
Es folgte eine Denkpause, eine gefühlte Minute lang, einstweilen blieben alle Augen auf ihn gerichtet.
Er warf sich zurück, streckte die Hände in die Höhe, ächzte lautstark und beschwor alle Geister, die noch nicht aus dieser überhitzten Essstube geflüchtet waren. «Ich weiss nur, dass ich die Tür abgeschlossen habe. Da bin ich mir ganz sicher. Ich schliesse immer ab. Ich bin jeden Tag immer irgendwo am Reinigen, am Kontrollieren, am Aufzeichnen und am Abschliessen. Ich tue nichts anderes. Die Abdeckungen über den Sammelschächten, die Eingänge zu den Stollen, die Türen in den Reservoiren, das Gebäude mit der Pumpstation– ich sperre immer überall zu. Die Fenster sind alle vergittert. Wir arbeiten nach einem Sicherheitskonzept. Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Die Menschen vertrauen uns. Das verpflichtet.» Er atmete hörbar durch die Nase und wiederholte die folgenden Sätze wie ein Mantra: «Ich liebe meinen Beruf. Trinkwasser ist unser wichtigstes Lebensmittel. Es ist ein schöner, positiver Beruf.»
Er brauchte eine Pause, goss sich Wasser nach, beruhigte sich und schloss: «Eine Tür oder einen Deckel nicht abzuschliessen, wäre ein grober, ein sehr grober Verstoss gegen die Sicherheitsregeln.»
«Sind Sie immer allein unterwegs?»
«Nein. Oftmals begleitet mich jemand.»
«Sind Sie beim Hinaustreten abgelenkt worden? Hat jemand vor der Tür auf Sie gewartet? Hat Ihr Telefon geklingelt?»
«Sie haben Fragen.»
Ich betrachtete Madame Bernard, wie sie mit gefalteten Händen lauschte und ihn fragend ansah.
«Nein. Ich habe abgeschlossen und bin ins Büro gefahren.» Sein Ton hatte sich versachlicht.
Ich war noch nicht am Ende mit meinen Fragen. «Alle diese Deckel über den Schächten, Stollen oder Fassungen, die Türen bei den Reservoiren und der Pumpstation– Sie brauchen eine Menge Schlüssel. Ein ganzes Arsenal, nehme ich an, oder nicht? Tragen Sie immer alle mit sich herum?»
«Ich habe eine Handvoll Schlüssel. Die meisten Deckel haben das gleiche Schloss. Für die Türen existieren verschiedene Schlüssel.»
«Von den Schlüsseln gibt es gewiss Kopien. Wissen Sie, wie viele von welchen Schlüsseln? Und wer alles eine Kopie besitzt?»
«Ja, das ist bekannt.»
«Wissen Sie das ganz genau?»
«Warum glauben Sie mir nicht?»
Ich legte den Dessertlöffel wie eine Wippe auf den Tellerrand und wartete.
Er sagte: «Das steht alles im Handbuch. Es gibt für alle Schlüssel eine Liste. Darauf sind die Personen aufgeführt, die eine Kopie von einem Schlüssel besitzen. Sie müssen innerhalb der Gemeinde eine Funktion wahrnehmen, die mit dem Trinkwasser in Bezug steht. Mein Stellvertreter zum Beispiel, der Kommandant der Feuerwehr, fällt mir ein, wegen des Löschwassers, natürlich der Gemeinderat selbst. Jeder hat unterschrieben…»
«…und stünde in der Verantwortung.»
«So ist es.» Er schickte ein grimmiges, tief im Bauch erzeugtes «Ha» hinterher.
«Kann ich die Listen sehen?»
«Die kann ich besorgen, das ist kein Problem.»
«Von welchem Reservoir reden wir überhaupt?»
«Das habe ich doch schon gesagt. Vom Reservoir Dorfberg. Es ist das kleinste und befindet sich in der Flanke des Dorfberges. Daher der Name. Es ist nicht weit von hier.»
Hilde, die Frau mit der weissen Schürze, brachte das Dessert, sammelte die Teller ein und fragte, wem sie einen Kaffee servieren könne.
Ich hob die Hand und sagte zu ihr, das Essen habe mir geschmeckt.
«Sind Sie satt geworden?», fragte sie.
«Ja, mehr als das.»
Sie griff scheinbar nach meinem Dessert, um es wieder mitzunehmen. «Keine Lust mehr auf Dessert? Gebrannte Crème.»
«Doch, bitte, lassen Sie es da. Gebrannte Crème ist mein Lieblingsdessert– erst recht, wenn sie aus Ihrer Küche kommt.»
Sie zog ihre Hand zurück, schien sich zu freuen, ergriff den Stapel der schmutzigen Teller und schwebte hinaus.
Simon Aeugster tippte sein Handy an. Er sichtete die Uhrzeit und sprang auf. «Es ist spät. Ich muss mich beeilen, mein Chef erwartet mich um zwei Uhr. Er will mit mir die Aufgaben durchgehen und das Pflichtenheft besprechen.»
«Der Gemeinderat, der Sie versetzt hat?»
«Nein, nicht der Gemeinderat. Mein neuer Chef. Er ist Leiter der Entsorgung. Dazu gehören Kehrichtabfuhr, Sperrgut, Altmetall, Papier, Karton– das ganze Recyclingwesen. Die Kompostieranlage. Und natürlich die Kläranlage.»
«Er zeigt Ihnen die Aufgaben unten in der Anlage?»
«Oh nein. Es geht mehr ums Theoretische. Einsatzplan, Stellvertreter, Pflichtenheft. Er erwartet mich in seinem Büro. Es befindet sich über der Recyclinghalle auf dem Güterbahnhof. In der Kläranlage arbeiten zwei Angestellte, die zeigen mir laufend, welche Aufgaben wie zu erledigen sind.»
Er küsste seine Frau und verabschiedete sich von seiner Schwiegermutter.
Ich nutzte die Gelegenheit, stand auf, setzte eine freundliche Miene auf und sagte: «Ich heisse Alexander.»
«Simi.» Er gab mir die Hand und war offenbar nahe dran zu lächeln.
Ich gab ihm meine Karte. «Ruf mich an, wenn dir etwas dazu einfällt. Jederzeit.»
Er warf einen Blick darauf, steckte sie ein, schritt zur Tür und winkte flüchtig seiner Frau.
«Vom Trinkwasser ins Abwasser versetzt zu werden, klingt wie ein Scherz», sagte ich laut.
Er stutzte, brauste auf und schimpfte: «Für mich ist das kein Scherz. Nein, ich finde das nicht lustig.» Seine Stimme überschlug sich beinahe. «Ich empfinde es als eine Frechheit. Eine Beleidigung. Eine Schande. Jawohl! Eine verfluchte Schande!» Er riss die Tür auf.
«Warte! Dein Handy», rief seine Frau.
Es lag auf dem Tisch.
5
Ich setzte mich, trank in Ruhe meinen Kaffee und fragte die beiden Damen: «Verhält sich Simon immer so?»
Géraldine Aeugster fragte zurück: «Wie meinen Sie?»
«Erst ist er mir gegenüber abweisend, dann wirkt er zerfahren, dann gibt er gründliche Auskunft, und zuletzt verliert er komplett die Beherrschung. So viele Gemütsbewegungen innerhalb weniger Minuten. Das meine ich.»
«Können Sie das nicht verstehen? Wie wären Sie in seiner Situation?»
«Wie ist er normalerweise? Entschlossener? Ruhiger? Bereitwilliger?»
«Er spielt Klarinette in einer Jazzkapelle. Er hat eine künstlerische Ader und komponiert Stücke für ein Album. Ist es das, was Sie stört?»
«Seine Art stört mich nicht im Geringsten. Ich versuche ihn nach seinem Verhalten einzuschätzen, das ist alles.»
«Sie müssten ihn auf der Bühne erleben.»
«Eine andere Frage: Hat er Feinde? Liegt er im Streit mit jemandem?»
Madame Bernard legte die Hand über die Faust ihrer Tochter und sagte: «Mais non! Sie schätzen ihn falsch ein, Alex. Simi ist ein Goldjunge.»
«Ich weiss nicht, ob er mit jemandem Streit hat», warf Géraldine Aeugster ein. «Er redet nicht gern über sich und seine Sorgen.» Sie klang merkwürdig konsterniert.
«Das alles hilft uns wenig in der Sache», sagte ich.
«Was werden Sie tun?», fragte Madame Bernard.
Gute Frage, dachte ich und erlaubte mir, ihr direkt ins Gesicht zu sehen. Ich hoffte damit ihren Groll abzubauen und die Spannung, die in der Luft hing, zu mildern. «Nun, ich werde tun, was ich in solchen Fällen immer tue: Ich werde tagsüber herumschnüffeln und abends den Vorschuss mit Härdöpfeler vertrinken.»
Madame Bernard patschte mehrmals mit der flachen Hand auf den Tisch. «Sie! Sie machen sich schon wieder über mich lustig, Alex. Ich verbitte mir das!»
Ich befleissigte mich, entspannt und zugleich verlässlich auszusehen und die ganze Angelegenheit zu bagatellisieren. «Ach, das ist ein Scherz. Eine Redensart nach meinen amerikanischen Vorbildern. Natürlich werde ich tun, was ich kann.»
«Rüpel. Sie sind ein Rüpel.» Sie schalt mich aus, und ich verstand, dass mein Spruch das beabsichtigte Ziel verfehlt hatte. Sie wirkte auf mich unversöhnlich, fast verbittert. Ich hatte den Eindruck, sie bebte vor innerer Erregung wie ein Vulkan wenige Augenblicke vor einer Eruption. Aus ihren traurigen, niemals blinzelnden Augen sprühte heller Zorn. Die dicken Brillengläser waren wie Brenngläser, wie Bullaugen vor einer brodelnden Wallung aus Lava.
Géraldine Aeugster schlug sich vollends auf die Seite ihrer Mutter, meinte, ich sei ein ungehobelter Kerl, und fragte: «Werden Sie uns helfen? Seien Sie ehrlich, werden Sie etwas unternehmen?»
«Selbstverständlich. Ich werde der Sache auf den Grund gehen. Sobald ich eine Möglichkeit oder einen Weg finde, den er befolgen könnte, werde ich es Ihnen sagen. Aber helfen muss er sich letztlich selbst.»
«Was denken Sie, wie lange wird das dauern?»
«Es ist schwer, das abzuschätzen. Wie lange hat er diese Arbeit gemacht?»
«Im Mai wären es zweieinhalb Jahre.»
«Sie sagen, Sie wissen nicht, ob er Feinde hat. Hat er Freunde? Seine Kollegen von der Band sind in diesem Fall kaum von grossem Nutzen. Zumindest einen guten Kollegen bräuchten wir, einen, der für ihn und seine Zuverlässigkeit in seinem Beruf bürgen könnte. Anders gefragt: Kennen Sie jemanden, der seine Arbeitshaltung beurteilen kann? Oder der uns erklären könnte, wer ihm feindlich gesinnt ist? Und warum? Kennen Sie eine Person, der ich bei meinen Nachforschungen trauen kann?»
Géraldine Aeugster rieb sich die Stirn, stand auf, ging zur Tür und hielt sie offen. «Es stehen Reitstunden an. Kommen Sie mit zu den Pferden? Ich muss nachdenken. Mir fällt bestimmt die eine oder andere Person ein.»
Ich verabschiedete mich von Madame Bernard und dankte fürs Essen. Sie blieb sitzen, rückte ihre Brille zurecht und starrte mit ihren vergösserten Augen zu mir hoch. «Ich zähle auf Sie, Alex. Sie sind mir etwas schuldig, enttäuschen Sie mich nicht.»
Géraldine Aeugster stand im Flur vor dem Spiegel, strich sich die Haare mit Hilfe einer Bürste nach hinten, formte einen hohen Pferdeschwanz und fixierte diesen mit einem Haargummi. Sie trug dunkelbraune Reithosen, zog sich eine wattierte, schwarz glänzende Jacke über, schlang sich einen seidenen Schal in Indigoblau um den Hals, schlüpfte in schwere wildlederne Stiefeletten, griff sich ein paar Handschuhe und hielt mir die Haustür auf.
Ich nahm mein Jackett vom Bügel und folgte ihr nach draussen.
Kühle Luft hüllte mich ein. Ich genoss die Erfrischung, blinzelte in die Sonne, streckte die Arme aus und atmete tief durch. Da drinnen wäre ich beinahe erstickt. Draussen war der Geruch der Pferde allgegenwärtig, doch hier, auf der Sonnenseite des Hauses, alles andere als aufdringlich.
Wir gingen nebeneinander am Brunnen und am Miststock vorbei zu den Stallungen.
«Übrigens: Ich heisse Géraldine.» Sie lächelte versöhnlich und zeigte zwei perfekte strahlend weisse Zahnreihen.
«Alexander.» Ich schlug ein. Sie hatte die Handschuhe noch nicht angezogen.
«Kannst du reiten?»
«Ich habe es ein paarmal versucht. Ich glaube, Pferde spüren, dass ich hin und wieder Pferdefleisch esse. Sie mögen mich wohl deswegen nicht besonders.»
Ein Pferd wieherte im Stall. Ein zweites stimmte ein, kräftiger als das erste, und eines klopfte mit dem Huf an eine Holzwand.
«Sind das wilde Mustangs?»
Sie schmunzelte. «Du brauchst keine Angst zu haben, du kannst von der Tribüne aus zusehen.»
Schätzungsweise fünfzig Meter weiter hinten stand eine kapitale Halle in einer Senke. Dahinter stieg das Gelände steil an. Eine Böschung aus geschichteten Granitblöcken, darüber ein Hain mit Buschwerk, und weiter oben begann der Wald. Ein undurchdringlicher, vor Lebenskraft strotzender Nadelwald aus Fichten und Weisstannen. Er überzog die Halde bis hinauf zur Kuppe, möglicherweise darüber hinaus, und bedeckte weit mehr als die Hälfte des Höhenzugs oberhalb von Langnau.
Ein Kleinwagen raste auf den Hofplatz, zog eine so enge Kurve, dass Kies spritzte, und stoppte neben vier anderen parkierten Autos. Eine zierliche junge Frau stieg aus und knallte die Tür zu. Sie trug Reitstiefel, Reithosen und eine wattierte Jacke, schritt flink ums Heck und öffnete die Beifahrertür. Ein Mann schälte sich umständlich aus dem Beifahrersitz.
6
«Hallo, Lima», rief Géraldine Aeugster. Sie blieb stehen und wartete.
Die zierliche Frau antwortete erst, nachdem sie zusammen mit dem jungen Mann ein paar Schritte auf uns zu gemacht hatte. «Ich habe Salentin mitgebracht.»
«Ja, prima. Hallo, Salentin, schön, dass du zu uns kommst. Wie geht es dir?»
Der Mann durfte kaum zwanzig Jahre alt sein, hatte kupferrotes wirres Haar, war grösser und vor allem beleibter als seine Begleiterin. Er bewegte sich ungewöhnlich langsam auf uns zu. Er rollte seine Füsse nicht ab, er stelzte vielmehr auf den Fussballen vorwärts, was ihm nur kurze, steife Schritte erlaubte. Auch schwang er seine Arme nicht im Rhythmus seiner Schritte, er hielt sie stattdessen vor seiner Brust, die Finger unablässig aufs Neue ineinander verkrallend.
Die zierliche Frau ging achtsam neben ihm her. Das ungleiche Paar zeichnete dank der flachen Frühlingssonne zwei verschieden lange und verschieden breite Schatten auf den Platz.
Géraldine stellte uns vor. «Das ist Lisa-Marie Grädel, und der Junge ist Salentin, ihr jüngerer Bruder. Und das ist Alexander Bergmann.»
Ich reichte Lisa-Marie Grädel die Hand. «Alexander. Guten Tag, Lisa-Marie.»
«Einfach nur Lima. Alle sagen Li-Ma zu mir, abgekürzt von Lisa-Marie.»