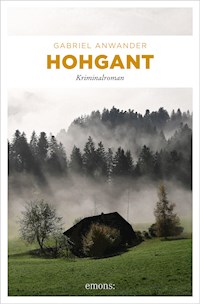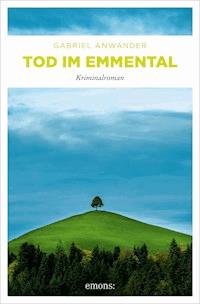
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Alexander Bergmann
- Sprache: Deutsch
Ein schwergewichtiger Krimi aus dem schönen Emmental. Der alternde Box-Champion Hammer-Joe betreibt einen Boxclub im Emmental. Eines Tages verschwindet Magdalena, seine beste Schülerin. Die Polizei kümmert sich nur verhalten darum, denn Magdalena kommt aus schwierigen Verhältnissen – sie wird schon wieder auftauchen. Joe aber befürchtet Schlimmes und beauftragt einen Privatdetektiv. Nach ersten Erfolgen eskaliert die Situation, und Hammer-Joe manövriert sich selbst in seinen vielleicht letzten großen Kampf.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriel Anwander, geboren und aufgewachsen in der Ostschweiz, absolvierte die Fachhochschule für Landwirtschaft und arbeitete in unterschiedlichsten Berufen in Kanada, Indien, Kamerun und schliesslich lange Jahre im Emmental. Dort lebt er heute gemeinsam mit seiner Frau.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2018 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: fotolia.com/berner51
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Irène Kost, Biel/Bienne (CH)
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-390-5
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmässig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für Brigitte.
EINS
Ich hatte den Eingang gefunden.
Es war eine schäbige Tür am Ende einer langen schäbigen Rampe. Auf der Tür stand in blassblauer Farbe: «Boxclub Emmental».
Die Rampe gehörte zum grössten Lagerhaus auf dem Güterbahnhof in Langnau. Es war ein graues zweistöckiges Gebäude, gross wie ein Baumarkt und alt wie der Mond; gebaut, um diese massigen Käselaibe zu lagern, ehe sie mit der Dampfbahn aus dem Herzen des Emmentals in die Welt verfrachtet wurden. Drei Familien hatten glänzende Geschäfte damit gemacht und sich eine goldene Nase verdient.
Doch das ist lange her. Heute dienen die Hallen als Umschlagplatz für Altpapier, Karton, Konservendosen, gebrauchte Batterien, Altglas, defekte Sparlampen, Plastikflaschen und ausgesonderte Bücher.
Es ging gegen vierzehn Uhr, ich wurde im Obergeschoss erwartet. Der Boxchampion von einst trainierte dort die Boxchampions von morgen. Die meisten kannten ihn unter dem Namen «Hammer-Joe», in Wirklichkeit hiess er Josef Kovács. Am Telefon hatte er mir erklärt, er vermisse einen seiner Schützlinge und suche einen Privatdetektiv, der diesen für ihn aufspüre.
Der Gestank, der die Luft weit über die Rampe hinaus verpestete, trieb mich zur Eile. Ich riss sie auf, die Tür mit der Aufschrift, trat ein, zog sie rasch wieder hinter mir zu und stieg die Betontreppe hoch. Je höher ich kam, desto stärker verdrängte der Geruch von Schweiss, Betonstaub und Ehrgeiz den Gestank der gesammelten Abfälle. Oben traf ich auf eine Pendeltür. Danach war aller Mief weg. Eine Lüftung, die anscheinend was taugte, erzeugte ein Gefühl der Frische. Zudem war es angenehm kühl, ich beschloss, meine Jacke anzubehalten.
Zwei Doppelreihen Neonröhren an der Decke sorgten für schattenfreies Licht.
Ein Mann lehnte am Ringpfosten. Das Schaben und Klatschen der Pendeltür musste er gehört haben, es liess ihn kalt. Er kehrte mir den Rücken zu und brüllte gezielt Anweisungen in den Ring. Er hatte nur Augen für den schmächtigen, sehr weissen Jungen, der mit neuen knallroten und übergrossen Handschuhen gegen einen Sportskerl anrannte. Der Sportskerl, sonnengebräunt und hochgeschossen, trug abgewetzte Schildhandschuhe, mit denen er das wilde Gehaue des Schmächtigen geschickt abwehrte.
«Lass ihn mal näher ran, Gregi», rief der Mann am Pfosten. Sein Oberkörper füllte ein blassblaues T-Shirt aus. Das Gewebe spannte sich über die Muskeln an Nacken, Schultern und Brust wie die Segel an einem Zweimaster auf offener See bei Windstärke drei, ungefähr.
Ich stellte mich neben ihn, hängte meine Arme ins obere Ringseil und sagte laut und deutlich: «Guten Tag, alle zusammen.»
Der Knabe boxte unbeholfen, ohne Wucht, ohne Stil und ohne jede Eleganz. Ein einziger Gegenschlag hätte ihn aus dem Ring und für alle Zeit aus dem Boxsport geschleudert.
«Vergiss deine Beine nicht, Bubi», rief der Mann am Pfosten.
«Der Junge boxt wie ein gekochter Spargel», sagte ich.
Der Mann drehte den Kopf in meine Richtung. Seine Augen tasteten mich ab, vom Scheitel bis zu den Schuhen, worauf sein Blick wieder hochschnellte und sich tief in meine Augen senkte.
«Boxen Sie?», fragte er.
«Ich bin Polizist gewesen.»
«Länger?»
«Sieben Jahre.»
Er verzog sein Gesicht und brummte: «Ahammm.» Es war kein Grinsen, mehr so ein mitleidvolles Lachen.
Seine Augen liessen nicht mehr von mir ab, seine Pupillen waren Teertropfen im Schnee.
«Haben Sie eine Karte?», fragte er.
Ich holte mein Portemonnaie hervor, zog eine Karte und legte sie ihm in die Hand.
Er hielt sie in den Fingern, streckte seinen Arm aus, kniff die Augen zu und las übertrieben langsam: «Alexander Bergmann. Ermittlungen aller Art. Privat und diskret».
Egal, ob er brüllte oder redete, er tat es langsam und in einer Stimmlage, die an das Brüllen und Schnurren eines Pumas erinnerte.
«Sie haben mich angerufen», sagte ich.
«Richtig», sagte er, schob seine Golfermütze in die Stirn – auch sie war in blassem Blau – und kratzte sich mit dem Daumennagel am Hinterkopf. Er wendete die Karte mindestens dreimal, um zu prüfen, ob auf der Rückseite vielleicht der Zahlencode meiner Kreditkarte stand, der Name meiner Freundin, die Adresse meiner Mutter oder sonst etwas, das man leicht vergisst.
Er rückte die Mütze wieder an ihren Platz, und da hörte ich zum ersten Mal seinen richtigen Namen: «Ich heisse Josef Kovács. Für dich nur Joe.»
«Alexander», sagte ich, und da ich keinen Hut trug, streckte ich ihm die Hand hin.
Er steckte die Karte in seine Gesässtasche und schlug ein. Ich spürte eine schwere, warme Pranke, die sehr kräftig zupackte.
«Was dagegen, wenn ich dich Alex nenne?»
«Geht in Ordnung, Joe.»
Später hatte ich herausgefunden, dass er aus Ungarn stammte. Seine Mutter war im Jahr 1972 mit drei Kindern aus Budapest in die Schweiz geflohen, hatte sich in Bümpliz niedergelassen und in Bern ein Taxiunternehmen gegründet.
Er rief dem Jungen zu: «Weiter so, Bubi, bleib in Bewegung», und mir deutete er an, ihm zu folgen.
Im Hintergrund mühten sich sieben oder acht Jugendliche mit Sandsack, Springseilen, Gummibändern und Punchingball ab.
«Ich vergesse die Namen dieser Kinder laufend», sagte er, «die meisten bleiben sowieso keine drei Monate.»
Er ging in sein Büro, das so gross war wie die Besenkammer in einem Fast-Food-Restaurant. Ich zwängte mich hinter ihm hinein und machte die Tür zu. Er bot mir den einzigen Stuhl an.
Rechts standen ein schmaler Aktenschrank und ein Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch lagen Briefe, Karteikarten, Zeitungen, ein offenes Wörterbuch und vergraben unter alldem Zeugs: ein Laptop. An der Wand hing ein Kalender, der Samstag, den 12. September anzeigte.
Ich fragte: «Ist heute nicht Sonntag, der 13.?»
«Doch. Warum?»
«Der Kalender geht nach.»
Er riss das Kalenderblatt ab und warf es zerknüllt in den Papierkorb.
An der Wand gegenüber hingen in einer langen Reihe gerahmte Fotos von Helden, die um Rang und Namen geboxt hatten, als das Schweizer Fernsehen die Kämpfe noch in voller Länge ausgestrahlt hatte, wenn auch zeitverschoben. Das heisst, nicht selten drei, vier Stunden nach Mitternacht.
In einem Glasschrank neben dem Fenster beeindruckten mindestens ein Dutzend Pokale. Darunter, in der linken Ecke, behauptete sich ein antiquierter moosgrüner Geldschrank, der genau durch das Fenster passen würde, falls das jemanden interessiert.
Er zerrte die Schreibtischschublade auf, schubste einen alten Revolver zur Seite, klaubte ein Foto heraus und gab es mir. Es zeigte das Porträt eines Mädchens.
«Magdalena», sagte er. «Gestern Morgen hätte sie antanzen sollen. Wir haben vorgehabt, eine Woche in den Jura zu fahren. Intensivtraining. Mit fünf Junioren. Ab November finden Ausscheidungskämpfe statt. Am Neujahrstag geht es um den Meistertitel. Magdalena steht zuoberst auf meiner Liste.»
Sie hatte einen kurzen Haarschnitt, eng zusammenliegende Augen, schmale Lippen und einen entschlossenen Gesichtsausdruck.
«Du trainierst Mädchen?»
«Was dagegen?»
«Wie alt ist sie? Sechzehn?»
«Achtzehn.»
«Wie heisst sie?»
«Sagte ich doch, Magdalena.»
«Mit Nachnamen.»
«Fellmer.»
«Sie hat sich’s wohl anders überlegt», sagte ich.
«Blödsinn. Die will boxen. Sie hat alles, was es dazu braucht: Disziplin, Ausdauer, Kampfgeist, Instinkt; und sie ist verdammt schnell. Sie kann jede schlagen und den Titel holen. Vorher muss sie mit uns in den Jura. Wir müssen ihr ein paar Dinge beibringen. Taktik zum Beispiel. Und ich will sie vorbereiten.»
«Vorbereiten auf was?»
«Auf ein paar unschöne Sachen.»
«Unschöne Sachen?»
«Die Meisterschaft ist kein Streichelzoo.»
«Lass mich raten: Es wird geboxt.»
«Ja, mach nur dumme Sprüche. Boxen ist ein ehrlicher Sport. Ich spreche von Unsportlichkeiten. Nicht alle boxen fair, es gibt brutale, hinterhältige, gemeine Schlägerinnen. Manch einer ist jedes Mittel recht, um zu gewinnen.»
«Dafür gibt es den Ringrichter.»
«Ja, im Prinzip schon, da hast du recht, dafür ist die Ringrichterin da. Sie geht dazwischen, sie mahnt, sie zählt aus, notfalls bricht sie ab. Nur: Die beste Ringrichterin sieht nicht alles. Ich weiss, wovon ich rede. Niemand kann rückwärts im Kreis gehen und zwei flinke Boxer ständig im Blickfeld behalten. Einer fiesen Gegnerin beizukommen mit legalen Mitteln, das verlangt nicht nur Taktik, Technik und Talent. Man muss auf unerlaubte, verdeckte Schläge gefasst sein, wie zum Beispiel Ellbogen in die Leber. Da gilt es, auf der Hut zu sein, dauernd, und so einer auf die Schliche zu kommen, bevor es zu spät ist. Im Ring ist Magdalena ganz auf sich gestellt. So ein Treffer setzt einem zu. Eine Runde wird damit verdammt lang. Ich will und muss sie darauf vorbereiten.»
«Das hast du ihr gesagt.»
«Natürlich», sagte er beiläufig und tastete umständlich in der Schublade nach einem Couvert.
Ich hatte genug gehört und glaubte zu wissen, was Hammer-Joe wollte. Eine pubertierende Göre war seiner Einladung ferngeblieben, weil sie befürchtete, ihr hübsches Näschen könnte Schaden erleiden. Er wollte, dass ich sie aufstöberte und gegen ihren Willen zu ihm schleppte. Hatte er deswegen jemanden wie mich kommen lassen? War das ein Fall für einen privaten Ermittler? Hoffte er, ihre Fähigkeiten würden mein Ehrgefühl, meinen Berufsstolz wecken? Vielleicht ganz allgemein meine Begeisterung für den Boxsport neu beleben?
Seine Sorgen berührten mich ehrlich gesagt kein bisschen. Aus welchem Grund sollte sich eine begabte Spürnase wie ich für diesen kindischen Auftrag erwärmen?
Ich war drauf und dran, abzulehnen. Ich stand auf, legte das Foto auf das Pult und sagte: «Von mir aus gesehen ist das ein Fall für die Polizei.»
Als hätte er mit dieser Reaktion gerechnet, entnahm er dem Couvert vier neue Hunderter und zählte sie direkt auf dem Foto ab.
Fürwahr, das machte ihn sympathischer.
Dazu kam, dass in meinen Auftragsbüchern Flaute herrschte. Seit über einer Woche lungerte ich in meiner Agentur herum, kritzelte Strichmännchen auf den Rand von Gratiszeitungen, baute auf dem Schreibtisch meterhohe Kartenhäuser oder stand am Fenster, sah auf den Gemüsemarkt hinunter und beobachtete die Händlerinnen, die ihren Salat besprühten, mit dem Schürzenzipfel Tomaten und Auberginen polierten und dabei telefonierten.
Kurz: Ich hatte Zeit und brauchte Geld.
Ich beschloss, Hammer-Joe den Gefallen zu erweisen. Die vier blauen Scheine waren vier handfeste Argumente, sie verschafften dem Auftrag eine Basis, auf der sich eine Annahme des Falls rechtfertigte.
Es dürfte nicht allzu schwer sein, Magdalena aufzuspüren, dachte ich, und es spielte keine Rolle, aus welchen Gründen sie seiner Aufforderung nicht gefolgt war: Ich würde sie finden und sie bei ihm abliefern.
Er hatte derweil das Laptop ausgegraben.
Ich setzte mich wieder und zog das Foto und das Geld vorsichtshalber in meine Nähe.
Er schaltete das Ding ein, schickte eine Scheibe in den Schlitz, richtete den Bildschirm in einen günstigen Winkel, drückte auf Abspielen und lehnte sich mit verschränkten Armen an den Türrahmen.
Das Video zeigte einen Boxkampf. Zwei blutjunge Frauen traten gegeneinander an. Das Oberteil und die Kniehosen der einen waren marineblau, die Sachen der anderen kirschrot. Die Boxhandschuhe waren gelb. Sie glänzten wie der rohe Dotter eines Hühnereis vom Lande.
Das Mädchen in Rot war breiter und muskulöser. Sie trug einen roten Kopfschutz, aus dem hinten ein schwarzer Haarstummel herausragte.
Das Mädchen in Blau war Magdalena. Wegen des blauen Kopfschutzes erkannte ich sie erst nach dem Ende der ersten Runde. Sie versuchte auf dem kurzen Weg in ihre Ecke, in die Kamera zu lächeln.
Die Ringrichterin in langen schwarzen Hosen, weissem Hemd und mit einer schwarzen Fliege überragte beide um Kopfgrösse.
Zu Beginn der Runde marschierte die Rote forsch in die Mitte und eröffnete den Kampf mit einer gestreckten Geraden.
Magdalena parierte mit Mühe. Sie hielt ihren linken Arm angewinkelt, stemmte den Ellbogen schräg nach aussen und schützte mit den Fäusten in erster Linie ihren Kopf. Sie lauerte hinter ihrer Deckung auf die Gelegenheit zu einem Konter, hoffte auf eine Unachtsamkeit ihrer Gegnerin. Sie lauerte auf eine Gelegenheit, die nie kam.
Die Rote griff fortwährend an. Sie bewegte sich wendig und boxte furchtlos, stocherte mit der Linken in Magdalenas Deckung und schlenzte einen Schwinger von rechts in Richtung Kopf.
Reflexartig stemmte Magdalena ihren Ellbogen dagegen. Die Faust klatschte auf den Oberarm und rutschte über Schulter und Kopf ins Leere, wo die Wirkung verpuffte. Es war ein furchterregender Hieb gewesen.
Ich fand die Klatschgeräusche und vor allem das Ächzen, Japsen und Wimmern unerträglich und bat Hammer-Joe, den Ton leiser zu stellen.
Die Rote fing sich auf und versuchte zur Abwechslung, eine gestreckte Gerade im Gesicht zu landen.
Magdalena krümmte sich nach hinten weg, blitzschnell. Im Wegtauchen war sie äusserst gewieft, trotzdem schien sie mir übers Ganze gesehen weniger aktiv.
Die Rote bedrängte Magdalena hartnäckig, trieb sie vor sich her und gewährte ihr weder Zeit noch Raum für einen Gegenangriff. Beharrlich setzte sie ihre Tupfer mit der Linken und feuerte manch einen Schwinger von rechts ab. Zur Abwechslung versuchte sie es mit einem linken Haken ans Kinn.
Wieder gelang es Magdalena, rechtzeitig auszuweichen. Sie berührte das Ringseil mit ihrem Rücken und tastete sich im Krebsgang in die Ecke. Vor ihr bezog die Rote Position, plusterte sich auf, sah sich als Königin im Ring und Magdalena geschlagen, ausgestreckt auf der Matte. Plötzlich geschah etwas Unerwartetes: Die Rote kassierte einen Schlag. Einen Treffer, der es in sich hatte, direkt aufs Jochbein.
Und da – zack – ein zweiter Streich. An den Kopfschutz im Bereich der Schläfe. Und gleich darauf ein wuchtiger Haken von unten ans Kinn.
Die Rote taumelte zurück. Wankte sie? Gab sie sich geschlagen?
Die Ringrichterin war mit ausgebreiteten Armen dazwischengegangen.
Magdalena hatte in der Deckung der Roten eine Lücke gesehen und sie aufgesprengt. Ihre Arme waren vorgeschnellt, links, links, rechts. Jäh, präzis und mit einer erstaunlichen Wucht. Zwei Stahlfedern unter Hochspannung.
Die Rote atmete aus, sammelte sich, nahm die Fäuste wieder hoch und nickte der Ringrichterin zu. In diesem Moment rettete sie der Pausengong.
Ich schaute zu Hammer-Joe. Er kaute Kaugummi, das hatte ich bisher übersehen.
«Und?», fragte er.
«Hat Magdalena ein Handy?»
«Sicher.»
«Hast du versucht, sie anzurufen?»
«Ihr Handy ist ausgeschaltet.»
«Wo wohnt sie? Bei ihren Eltern?»
«Beim Vater. Die Mutter sitzt im Knast.»
«Ach, das ist die Fellmer!»
«Wer denn sonst?»
«Und der Vater? Was sagt der?»
«Ich rufe nie zu Hause an. Mann, sie ist alt genug.»
Ich brauchte ihn nur fragend anzusehen.
«Also gut, sie hat es mir verboten», brummelte er.
«Sie hat … was hat sie?»
«Sie will nicht, dass ich bei ihr zu Hause anrufe. Ihr Vater hält nichts vom Boxen – und noch weniger von mir.»
«Ist das der Grund, weshalb ich hier bin?»
«Ist das ein Problem für dich?»
«Nein», sagte ich, versuchte, nicht gelangweilt auszusehen, und fragte: «Weiss die Mutter, wo sie ist?»
Er winkte ab.
«Hast du mit ihr gesprochen?»
«Klar. Hab sie angerufen.»
«Du hast sie angerufen, in der Anstalt Hindelbank?»
«Wo denn sonst?»
«Die haben dich tatsächlich mit ihr verbunden?»
«Zuerst nicht. Ich musste fragen, auflegen und eine Stunde später ein zweites Mal anrufen.»
«Am Ende hat sie sich was angetan», sagte ich.
«Wie kommst du darauf? Meinst du, weil sie eine Mutter hat, die im Knast hockt, und einen Vater, der trinkt, schneidet sie sich die Pulsadern auf?»
«Sie wäre nicht die Erste», sagte ich. «Mädchen in ihrem Alter …»
«Blödsinn! Ein schwieriges Zuhause ist kein Nachteil.»
Mir rutschte ein unbedachtes «Was?» über die Lippen.
«Boxen befreit. Warum, meinst du, steigt jemand in den Ring? Stell dir eine Bilderbuchfamilie vor, Alex. Kinder, die in einem schönen Haus aufwachsen, alles haben, alles dürfen und nichts müssen. Solche Kinder bekommen einen Hund geschenkt, gehen in die Musikschule und lernen Klavier, Geige, Schlagzeug, Gitarre spielen. Die Mutter fährt sie ins Ballett, zum Schwimmen, zum Reiten. Oder sie dürfen mit Vati zum Tennis. In einer glücklichen Familie, Alex, hat es niemand nötig zu boxen. Was meinst du, welcher Boxer hat ein schönes, sorgenloses Daheim gehabt? Ist behütet und gehätschelt aufgewachsen? Also ich kenne keinen einzigen, und ich kenne eine Menge Boxer.»
Die Pause war um, es folgte die dritte Runde.
Wieder marschierte die Rote in die Mitte und konnte es kaum erwarten, auf Magdalena einzudreschen.
«Und der Junge da draussen?», fragte ich.
«Vergiss diesen Bubi. Sein Vater bringt ihn her und holt ihn wieder ab. Jeden Sonntag. Es geht ihm nicht ums Boxen. Er will, dass der Kleine lernt, sich zu behaupten. Nein, Alex, richtig boxen, sich wettkampfmässig vorzuwagen, das macht kein Mensch aus freien Stücken. Weisst du, warum? Angst vor den Prügeln? Nein. Weil es primitiv ist, sich zu schlagen? Nein. Boxen ist für die, die nichts zu verlieren haben. Boxen verleiht dir weder Achtung noch Anerkennung. Du erfährst keine Wertschätzung. Wer geachtet ist, kann die Achtung nur verlieren. Und wenn’s schlimm kommt, dazu jede Würde. Ein vernünftiger Mensch steigt nicht in den Ring, wenn ihm das Leben andere Möglichkeiten bietet. Schon gar nicht gegen eine harte Nuss. Klar, wer boxt, wird bekannt – auch wenn er verliert.»
Die beiden auf dem Bildschirm kämpften schneller, härter, wilder, das Rangeln um den Sieg wurde verbissener.
Magdalena war erwacht. Sie sprang vor und zurück, haute rein, musste sich ducken, hüpfte locker weg und wieder heran, schlug zurück, wich aus, tastete sich aufs Neue vor und stach abermals zu. Die Vormacht der Roten bröckelte.
Hammer-Joe redete ununterbrochen weiter: «Respekt verschafft man sich nur mit einem Titel. Das bringt obendrein ein bisschen Ruhm. Geld liegt auch drin, sicher. Um richtig Kasse zu machen, musst du aber einen internationalen Titel holen. Das heisst, wer mit Boxen Kasse machen will, muss hart ran. Sehr, sehr hart.»
Ich sagte bloss: «Ah, ich verstehe.»
Meine Bemerkung kratzte an seiner Würde oder an seinem Stolz oder an sonst einer empfindlichen Stelle seines Gemüts.
Er kam mir zu nahe und fuhr mich an: «Du verstehst? Ja? Du verstehst und weisst, wie sich das anfühlt, in gebrauchten Kleidern aufzuwachsen? Mit zwei Schwestern tagsüber still sein in einer winzigen, verrauchten Wohnung, weil die Mutter schläft? Weil sie nachts in ihrem Taxi Leute nach Hause fährt? Trunkenbolde, die in den Fond kotzen, während sich ihre eigenen Kinder daheim vor Hunger in den Schlaf weinen? Zu dritt in einem Bett? Oder junge Flegel in teuren Klamotten, die sich zu viert ins Taxi quetschen und für ein Trinkgeld um den Block chauffiert werden wollen? Nur so zum Spass? Oder ein Flittchen, das heult und sich die Pelzjacke vollsabbert, weil ihm ein Fingernagel abgebrochen ist? Du verstehst also und weisst, was das für ein Gefühl ist, ja? Wenn kleine Kinder erleben, wie sich ihre Mutter am Morgen zur Tür hereinschleppt? Müde und entnervt? Und das Geld, das sie heimbringt, trotzdem nicht reicht? Ich habe mir vor jedem Kampf, vor jeder neuen Runde dieses Elend in Erinnerung gerufen. Der Geruch, nur schon der widerwärtige, säuerliche Geruch in dieser winzigen Küche … Grahhh!» Er schüttelte sich und hämmerte die Faust unter einem Porträt an die Wand. Das Bild fiel zu Boden. «Ohne den Traum vom besseren Leben, ohne diesen Zwang, da herauszukommen, hätte ich ‹Hardy the Cutter› niemals besiegt! Zwei Mal hat er mich niedergeschlagen, beide Male bin ich wieder aufgestanden. In der letzten Runde habe ich ihn erwischt. Ein Punch an die Schläfe, und er ist gestürzt wie ein getroffener Bär.» Er hob das Bild auf und strich mit dem Handrücken über das Foto. «Vor einem Jahr ist er gestorben.»
Er tippte auf das Foto daneben. «Und den hier, Ferdinand, der Stier. In der zweitletzten Runde hat sein Trainer das Handtuch geworfen. Wir haben beide geblutet, ich hätte niemals aufgegeben. Mann, bin ich fertig gewesen nach dem Kampf.»
Ich hatte genug gesehen. Wer konnte Gefallen finden an einem Faustkampf Mädchen gegen Mädchen? Wer mochte sich ergötzen an kindlichen Gesichtern mit verkniffenen Augen, geschwollenen Lippen, blutenden Nasen? An Schreien, Ächzen und Stöhnen in den höchsten Tönen?
Ich faltete das Geld zusammen, nahm das Foto, steckte beides ein und wollte aufstehen.
Seine Hand lastete auf meiner Schulter, sie zwang mich, sitzen zu bleiben.
«Das Ende», sagte er ruhiger, «du musst dir das Ende ansehen, den Ausgang des Kampfes. Gleich ist es so weit.»
Die Rote näherte sich Magdalena steifbeinig. Ihre Beherztheit war am Zerfallen, und ihre überhöhte Deckung verriet, dass ihre Überzeugung in Zweifel und Kleinmut umgeschlagen war. Die Angriffslust war weg. Etwas wie Furcht hatte sie erfasst. Sie schien nahe am Aufgeben.
Die Kamera hatte sich auf ihr Gesicht eingeschossen: Ihre Augen flackerten müde im Licht der Scheinwerfer, ihre Wangen glichen einer geschälten Tomate.
«Das ist nicht irgendwer, das ist Auri Komlosic. Die rumänische Landesmeisterin», enthüllte er. «Sie ist ein Jahr älter, acht Zentimeter grösser und mindestens zwei Kilogramm schwerer.»
Magdalena, genauso verschwitzt, deutlich weniger gezeichnet, griff an. Sie täuschte, köderte, stichelte und sperrte die Rumänin in die Ecke. Dort trommelte sie kurz auf ihre Deckung ein. Das brachte die Rote zur Explosion.
Blindwütig und mit einem schauderhaften Schrei stürzte sie aus der Blockade und setzte alles daran, den Kampf endlich zu entscheiden.
Vergeblich. Ihre Hiebe kamen in regelmässigen Abständen, links, rechts, links, rechts, und von zu weit aussen. Sie wurden dadurch abschätzbar und in der Folge wirkungslos. Es reichten weder Schwung noch Kraft, um Magdalenas Abwehr zu schwächen, geschweige denn zu knacken. Sie wurde von keinem einzigen Schlag ernsthaft behelligt.
Anscheinend vergass die Rumänin zu atmen, ihr Feuerwerk verglühte, ihre Arme wurden schwer und schwerer.
Magdalena konterte prompt und mit äusserster Härte. Sie vernachlässigte ihre Deckung, wagte sich vor, jagte ihre Rechte einmal mehr auf das Jochbein, rammte blitzschnell einen Haken ans Kinn und knockte die Landesmeisterin mit einem Crosshaken an die Schläfe aus.
Das war es also: Hammer-Joes angekündigtes Ende. Der Kopf der Rumänin schwang herum, der Mundschutz spritzte heraus, ihre Arme schlafften ab, ihre Knie knickten ein. Sie versuchte mit letzter Kraft, auf den Beinen zu bleiben, wie jemand, der bestrebt ist, aus einem sinkenden Ruderboot zwei überschwere Taschen zu bergen.
Die Schiedsrichterin streckte ihren Arm vor, hielt Magdalena auf Distanz und sprach die Rumänin an.
Die gab keine Antwort. Sie drehte sich ab, drohte seitlich wegzukippen und wurde vom hinzugeeilten Trainer im Fallen aufgefangen und in ihre Ecke geleitet.
Hammer-Joe klappte das Laptop zu.
Nach einigem Nachdenken sagte er: «Magdalena will die Nummer eins werden in Europa. Hat sie selbst gesagt. Die hat sich’s nicht anders überlegt. Kann ich mir nicht vorstellen. Nein, Alex. Ich bin sicher, da mischt sich jemand ein. Verstehst du, was ich meine? Jemand hält sie davon ab, weiterzutrainieren. Gegen ihren Willen.»
«Hast du einen Verdacht?»
Er schüttelte den Kopf. «Wenn ich einen hätte, wärst du nicht hier.»
«Hast du ein Verzeichnis mit den Namen, gegen die sie antritt? Können wir uns die mal ansehen?»
«Daran habe ich auch gedacht. Ich kenne nicht jede Boxerin, ich kenne die Teams und die meisten Trainer. Hier, da drin steckt die Liste mit den Auslosungen der Kämpfe.»
Er drückte mir das Couvert, dem er die vier Noten entnommen hatte, in die Hand.
«Für mich kommt keiner in Frage. Das muss jemand anders sein. Es ist nicht die erste Meisterschaft, die in der Schweiz abgehalten wird. Ich kann mich nicht erinnern, dass es so was gegeben hat.»
Er begleitete mich zur Pendeltür, hielt sie für mich auf und sagte zum Abschied: «Je schneller du sie findest, desto besser. Egal, wer sie festhält, ich werde diesem Halunken zeigen, was es heisst, sich mit mir anzulegen.»
ZWEI
Kaum sass ich im Wagen, begann es zu regnen.
An jedem Tag im August und in den ersten beiden Septemberwochen war es ununterbrochen heiss gewesen. Das Gras auf den Kuppen und an den Hängen war dürr und bräunlich geworden, der Waldboden bis tief in die hintersten Gräben knochentrocken und hart. Mit einem Donnerschlag hätte der Wetterwechsel einsetzen können, mit einem Kältesturz, mit Niederschlag, der den Namen verdiente. Stattdessen zogen die Wolken langsam, fast vorsichtig auf, die ersten Tropfen fielen höflich und sanft. Weder Sturm noch Blitz und Donner, bloss ein Wind, der ein leises Zischen erzeugte. Auf der verstaubten Fahrbahn bildeten sich Blasen, die sofort wieder platzten. Am Strassenrand sammelte sich ein Gesülze, das gemächlich den Schächten zuströmte, und über dem heissen Asphalt begann es zu dampfen. Der unverwechselbare Geruch drang bis in meinen Wagen vor.
Ich nahm die Hauptstrasse aus dem Dorf hinaus Richtung Burgdorf. Die Fahrbahn folgte in sanften Kurven dem Lauf der Emme. Mit den Häusern blieben auch die Hügel zurück, das Sichtfeld auf den Horizont weitete sich und hätte ab und an einen Blick auf den Jura erlaubt, auf diese lange Kalksteinfalte im Norden, wäre da kein Regen gewesen.
Fünf Kilometer weiter bog ich links ein, der Weg führte über weites Schwemmland zu einem länglichen Weiler. Die sandig kargen Kiesböden eigneten sich schlecht für die Landwirtschaft. Sie waren durchlässig wie ein Sieb, trockneten daher rasch aus und speicherten so gut wie keine Nährstoffe. Trotzdem bauten die Bauern Kartoffeln an und säten Mais.
Jetzt waren die Äcker durchwühlt, die Felder der Knollen beraubt. Einzig die Stauden lagen herum, die Stängel gebrochen, die Blätter zerquetscht und faulig, und in den Fahrrinnen der Erntemaschine entstanden lange, schmale Pfützen.
Dem Mais stand die Ernte bevor. Die mannshohen Pflanzen warteten in militärischen Reihen, ausgereift, mager, fast traurig.
Ich erreichte den Weiler, der verdeckt hinter einem Erlenhain direkt am Damm lag. Die Gebäude, eine Handvoll Wohnbauten mit den dazugehörenden Ställen, Speichern, Bienenhäusern und Garagen, standen orientierungslos in der Ebene. Miststöcke behaupteten sich neben eingezäunten Gemüsegärten, beigepflanzte Nussbäume oder Winterlinden schützten vor Wind und Sonne. Der Fahrweg führte an einem Gehege für Kälber vorbei. Sechs dieser hochbeinigen Tiere gafften mir nach, Wasser tropfte von ihren Ohrmarken.
Die dunklen Wolken verstärkten jene nach Armut riechende Schwermut, die von den tief herabgezogenen Dächern ausging. Wer auf dieser Ebene sein Auskommen suchte, in der Gefahrenzone der Emme, auf der Schattenseite des Tales, ausserhalb des Gemeinsinns des Dorfes, dem fehlte das Geld und die Musse für eine fachmännisch angelegte und liebevoll gepflegte Gartenanlage. Hier gab es keine Holzterrassen, keine Gartenlauben, weder Ziersträucher noch Rasenflächen, schon gar keinen Schwimmteich, nicht einmal Vogelbäder. Geranien vor den Fenstern, das wohl, doch nirgends eine blühende Rose.
Die Dämmerung setzte ein, kein Mensch war zu sehen.
Fellmers Hof war der hinterste in der Sackgasse. Das zweihundert Jahre alte Bauernhaus klebte förmlich am Damm. Auf diesem Hof, hatte Hammer-Joe gewusst, war Magdalena aufgewachsen.
Ich parkierte meinen Wagen auf dem Kiesplatz zwischen Garten und Brunnen, am Rande des Lichtkegels, der aus dem Schopf fiel.
Ein Schatten tauchte auf, gleich darauf trabte eine Hündin heran, ihr hängendes Gesäuge mit den rosa Zitzen schwang hin und her. Sie stellte sich vor mein seitliches Autofenster, streckte ihre Fahne stramm gegen den Himmel, legte die Ohren an und fletschte die Zähne.
Sie blinzelte und bellte mal den Rückspiegel, mal den Türgriff an, und ich begriff, dass sie mich im Regen und bei dem diffusen Licht im Wagen weder sehen noch riechen konnte. Das stimmte mich zuversichtlich. Ich öffnete die Tür.
Sie schnappte nach meinem Ellbogen, ihr heisser Atem streifte meinen Hals. Sie schien mehr als aufgebracht, und ich weiss nicht, welche Haare sich stärker sträubten, ihre oder meine.
Ich riss die Tür wieder zu, rückte auf den Beifahrersitz und stieg dort aus.
Sie war nicht dumm. Sie hetzte um das Heck herum wie eine hungrige Wölfin. Ich rettete mich mit einem Sprung über den Zaun in den Garten. Sie war mit wenigen Sätzen da, stellte sich auf die Hinterbeine, stützte sich mit ihren Vorderpfoten auf der Querlatte ab und kläffte mir respektlos ins Gesicht.
Gehörte diese Hündin nicht an die Kette? Oder in einen Zwinger? Wäre ich stehen geblieben, sie hätte mir die Zähne in die Wade geschlagen. Oder weit schlimmer: ins Sitzfleisch. Ihr Verhalten liess mich keinen Augenblick daran zweifeln: Sie wollte mich weghaben. Mein Pulsschlag kletterte schätzungsweise auf hundertachtzig, ich bekam heisse Ohren, obwohl sich die Nässe im Nacken und auf den Schultern kalt anfühlte.
Die Gartentür befand sich wenige Meter weiter links. Sie bestand aus einem Metallrahmen und Holzlatten, die senkrecht daran festgeschraubt waren. Die Oberkante reichte mir bis zum Brustbein. Sie liess sich gegen aussen öffnen. Ich drückte sie auf, gerade so weit, dass die Hündin durch die Lücke schlüpfen könnte.
Sie verfolgte meine Bewegungen. Sie verstand den Durchlass als Einladung, nahm ihre Pfoten vom Zaun und jagte auf mich zu. Die Tür war schwer, der Rahmen widerstandsfähig, und ich war bereit und entschlossen: Sobald ihr Kopf durch die Lücke war, würde ich zuziehen, je ungestümer sie heranpreschte, desto übler würde es sie erwischen.
Es klappte nicht. Natürlich klappte es nicht, sie war hier zu Hause und hatte ihre Erfahrungen gesammelt mit den Tücken dieser Gartentür. Eine Hundelänge davor stoppte sie, duckte sich tief, robbte mit gefletschten Zähnen heran, hielt immer wieder inne, bis sich ihre Schnauze gefährlich nah vor meiner Hand befand. Sie hörte auf zu belfern und zu blinzeln und hielt ihren Blick starr zu mir hochgerichtet. Ihre Knopfaugen glühten, dass ich glaubte, der Regen würde darin verdampfen.
Ich war enttäuscht, das muss ich zugeben, und gleichzeitig erleichtert, das kann ich nicht leugnen.
«He, Sie, was tun Sie in unserem Garten?», rief eine Frauenstimme von der Haustür herab.
«Entschuldigen Sie», rief ich zurück, «Ihre Hündin hätte mich fast gefressen.»
Es regnete stärker, das Getöse nahm zu, wir mussten schreien, um uns zu verstehen.
«Haben Sie sie gefoppt?»
«Gefoppt? Nie und nimmer.»
«Tun Sie das nie wieder!»
«Ich werde nass, rufen Sie sie zurück.»
«So machen Sie jeden Hund verrückt.»
«Die gehört eingesperrt.»
«Was?»
«Einsperren. Sperren Sie sie ein!»
«Einsperren? Niemals. Sie tut niemandem was, glauben Sie mir.»
«Das sagen alle.»
«Was?» Die Frau lief die vier Stufen hinunter und rief: «Naxa! Naxa, komm her!»
Die Hündin schüttelte sich die Nässe aus dem Fell, trottete auf die Frau zu und liess sich am Kinn kraulen. Sie leckte der Frau die Hand und folgte ihr wie ein Lamm zum Schopf. Kaum waren die beiden ins Licht eingeschwenkt, vor dem Eintreten in den Schopf, blieben sie stehen und drehten ihre Köpfe. In einer Harmonie. Die Frau machte ein Zeichen mit der Hand und rief mir ein paar Worte zu, die ich nicht verstand. Die Hündin indes, das könnte ich beschwören, die Hündin grinste.
Gleichzeitig prasselte der Regen, von Windböen gebeutelt, wild und roh hernieder. Ich flüchtete mich unter die Traufe und drückte mich an die Wand, die weitesten Spritzer erreichten gerade eben meine Schuhspitzen. Ein Schwall nach dem anderen rauschte heran. Die Scheiben, das Blech, die Lampen, das ganze Auto wurde überspült mit einem Gemenge aus Schaum und Gischt.
Ich war stellenweise nass bis auf die Haut.
Die Frau trat aus dem Schopf, liess das Licht brennen, zog das Tor zu, bis auf einen schmalen Spalt, und kam unter der Traufe langsam näher. Sie blieb zehn Schritte vor mir stehen, hielt die Hände seitlich abgewinkelt und rief: «Was wollen Sie?»
Wir waren ungefähr gleich gross und schätzungsweise im selben Alter. Ihre Haare trug sie aufgesteckt, dazu einen verfilzten roten Pullover und blaue Latzhosen, die nie in Mode gewesen waren. Ihre Füsse steckten in grünen Gummistiefeln. Ihre Augen konnte ich nicht erkennen, sie lagen in dunklen Höhlen.
«Ich möchte zu Herrn Fellmer», brüllte ich zurück.
«Ist nicht da.»
Die Zeit der Dämmerung war vorbei, rundherum herrschte Nacht, wir standen im Schein der Lichter, die aus den Fenstern fielen.
Ich hasste dieses gegenseitige Anschreien und ging auf sie zu. «Ich suche seine Tochter, Magdalena.»
«Ist auch nicht da.»
«Sie hat sich für eine Trainingswoche eingeschrieben. Beim Boxclub Emmental. Wettkampfvorbereitung. Eine Woche Jura. Sieben Tage fort von zu Hause. Haben Sie davon gewusst?»
«Sicher.»
«Sie hat sich angemeldet, ist aber zum Zeitpunkt nicht erschienen.»
«Schickt Sie Hammer-Joe?»
«Ja. Er wartet auf Magdalena. Das heisst, das ganze Team wartet auf sie.»
Wir standen uns gegenüber, so nah, dass ich sie an den Schultern hätte fassen können. Trotzdem war nicht zu erkennen, wohin sie schaute. Dass sie angestrengt überlegte, das war unverkennbar. Ich streckte die Hand aus zum Gruss. «Alexander Bergmann.»
Ihre Hände blieben an ihrer Hosennaht. Schliesslich gab sie sich einen Ruck, huschte durch den Regen zum Brunnen, wusch sich die Hände, wischte sie an den Hosen ab, kam zurück und gab mir die Hand.
«Gloria Egli», sagte sie.
Ihre Finger waren eiskalt.
«Bergmann», wiederholte ich.
«Es ist niemand da. Kommen Sie morgen wieder. Ich werde ihm sagen, dass Sie hier waren. So gegen zehn Uhr wird er hier sein, denke ich.»
Ich lächelte.
Sie bemühte sich, freundlich auszusehen, und sagte: «Auf Wiedersehen, Herr Erdmann.»
Ich sagte: «Sie hat Junge, nicht wahr?»
Endlich drang ein Lächeln durch, begleitet von einem zögerlichen Nicken.
«Wie viele sind es?»
«Fünf.»
«Kann ich sie mal sehen?»
Sie ging rückwärts, zwei, drei Schritte, sagte schliesslich: «Gut, kommen Sie», und stiefelte voraus in den Schopf.
Ich musste mich sputen, um ihr zu folgen.
Die Glühbirne an der Decke blendete, und es roch nach Heu und Hundepisse. Sie wartete, bis ich eingetreten war, und wuchtete das Tor zu, bis der Riegel einrastete. Damit verminderte sie das Tosen und ermöglichte uns eine Unterhaltung in Ruhe.
Im hinteren Bereich hatte sie mit hüfthohen Gitterelementen ein Rechteck abgeriegelt. Die Hündin lag ausgestreckt in Seitenlage auf einem alten Teppich. Am Bauch hingen fünf Winzlinge. Sie hatte uns kommen hören und den Kopf gehoben. Das Licht kam nun von hinten, wir standen am Gitter und warfen lange Schatten in die Welpenstube.
Sie sagte: «Ja, Naxa. Ist ja gut, Naxa. Brave Naxa.»
Naxa legte den Kopf wieder ab, allerdings so, dass sie uns betrachten und unsere Bewegungen verfolgen konnte. Für sie gab es ein Schlupfloch mit einer Schwelle, die für die Welpen einige Zeit unüberwindbar bleiben dürfte.
Es waren fünf wuschelige Zotteltiere mit spitzen Schwänzen, breiten Köpfen und breiten Pfoten. Vier hatten weisse Flecken an Hals und Brust, das fünfte war vollkommen schwarz. Alle saugten an einer Zitze. Wenn wir schwiegen, konnten wir hören, wie sie schmatzten.
Das Schwarze lag zuhinterst. Es fiel ab, winselte, hob den Kopf, versuchte über alle Geschwister nach vorn zu kraxeln, kullerte seitlich weg und fiepte verärgert. Ein Weilchen zeigte es uns seinen dicken Bauch mit der rosa Haut. Wenig später hatte es sich die vorderste Zitze erobert, an der anscheinend mehr Milch zu holen war. Dafür fing das Abgedrängte an zu winseln und zu klagen und suchte sich weiter vorn eine neue Zitze. Fehlanzeige. Es besann sich, tappte um die anderen herum nach hinten, schmiegte sich zwischen die Schenkel an den Bauch der Hundemutter und schlief ein.
«Wie alt sind die? Fünf Wochen?»
«Viereinhalb.»
«Schon alle vergeben?»
«Bis auf den Schwarzen. Ein Rüde. Geben Sie ihm einen Namen, und ich reserviere ihn für Sie. Er wird Sie nie enttäuschen.»
Ich schüttelte den Kopf, lachte und sah zu ihr hinüber. Sie warf mir einen Seitenblick zu, den zu deuten mir misslang.
Dafür konnte ich ihre Augen sehen. Kastanienbraun. Die Farbe passte zu ihrem von Sonne und Landluft gegerbten Antlitz. Ihr Blick, die Stirn, die Wangen, die Lippen; ihr Gesicht wirkte bedeutend jünger und freundlicher als ihre Körperhaltung. Sie litt offensichtlich unter Kummer, vielleicht unter der Bürde der Arbeit, oder, und das hätte mich am wenigsten erstaunt, unter den angehäuften Sorgen mit der Familie.
Ich holte Magdalenas Foto, das am unteren Rand feucht geworden war, hervor und hielt es so, dass wir es beide sehen konnten.
«Mich dünkt», sagte ich, «sie haben die gleichen Augen, nur nicht denselben Blick.»
Sie schaute auf das Bild. «Magdalena! Woher haben Sie das Foto?»
«Sind Sie mit ihr verwandt?»
«Sie ist meine Nichte. Astrid, ihre Mutter, ist meine ältere Schwester.»
«Frau Fellmer sitzt in Hindelbank, nicht wahr?»
Sie senkte den Kopf und drehte sich ab. Ich hatte den Eindruck, es fehlte wenig, und sie hätte geweint. Sie musste zur Decke sehen und sich mit dem Handrücken über Stirn und Wangen wischen, bevor sie meine Karte zu lesen vermochte. Ich hatte gewartet, bis sie sich räusperte, und überreichte ihr die Karte. Mein Taschentuch konnte ich ihr nicht leihen, es war schon feucht.
«Ach: Bergmann. Hab Erdmann verstanden.»
«Alexander, wenn Sie nichts dagegen haben.»
«Gloria.»
«Und nun, Gloria, lebst du hier, bis deine Schwester entlassen wird?»
«Sie hat mich gebeten, täglich herzukommen. Hier einziehen, das kommt nicht in Frage.»
«Verstehe.»
Sie nickte und wusste nicht, wohin mit der Karte. «Vor allem wegen Naxa und den Jungen. Und die Wäsche, der ganze Haushalt, der Garten …» Ihre Handbewegung schloss den halben Hof mit ein.
Ich nahm die Karte wieder an mich, steckte sie zusammen mit dem Foto ein und sagte: «Das Foto hat mir Hammer-Joe geliehen.» Ich wollte wieder auf Magdalena zu sprechen kommen und fragte behutsam: «Eine Ahnung, wo sie sein könnte?»
«Nein», hauchte sie und legte sich die Finger an die Schläfen.
Ich dachte daran, wie kalt ihre Hände gewesen waren.
Sie gab sich einen Ruck, den dritten, seit ich da war, und drehte mir ihr Gesicht zu. «Die Polizei hat ihren Roller gefunden. Beim Bahnhof. Sie stellt ihn immer beim Bahnhof ab, wenn sie in den Club fährt.»