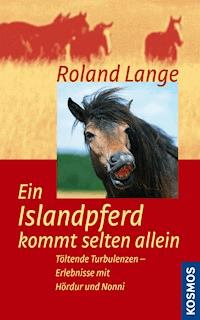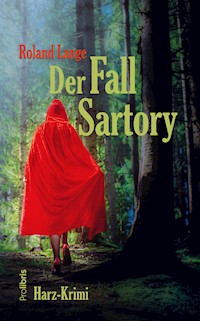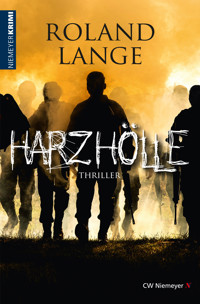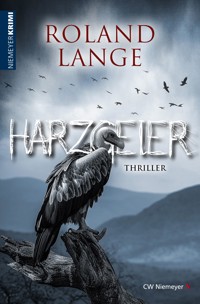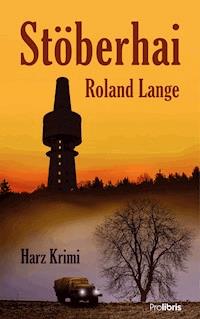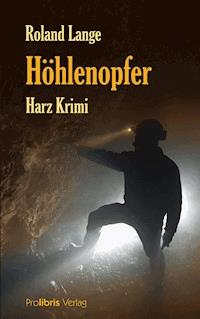
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Wieder ein Toter in der Lichtensteinhöhle! Doch dieser stammt nicht aus vorgeschichtlicher Zeit, sondern aus der Gegenwart. Und er gehörte nicht zu den wenigen heute lebenden Nachfahren der Bronzezeitmenschen vom Lichtenstein. Das hatten die spektakulären DNA-Vergleiche ergeben. Aber warum musste Franz Krüger in 'seiner Höhle' sterben, als deren Entdecker er sich fühlte? Und dann geschieht ein weiterer Mord, diesmal mitten in Osterode. Hauptkommissar Behrends und sein Team jagen einen geheimnisvollen schwarzen Mönch, der immer am Tatort auftaucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roland Lange
Höhlenopfer
Harz Krimi
Prolibris Verlag
Handlung und Figuren sind frei erfunden. Darum sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt.
Für Heidi,
die dem Leben gern mal die Stirn bietet.
Eröffnung
Die Wasserbombe explodierte wenige Zentimeter neben seinem Kopf an der Hauswand. Er hatte keine Chance, ihrer verheerenden Wirkung zu entkommen.
Erschrocken machte er einen Satz zur Seite, blickte fassungslos auf sein völlig durchnässtes Hemd und auf den Fotoapparat in seiner Hand, von dem das Wasser tropfte. Hastig fingerte er ein Taschentuch aus seiner Hose und begann laut fluchend, die wertvolle Spiegelreflexkamera trocken zu tupfen.
Verdammt, warum war er nicht zu Hause geblieben? Warum war er nach Förste gefahren, um dem Schützenfestumzug zuzusehen? Er hätte gewarnt sein müssen. Das Förster Schützenfest war eine Legende. Wenn diese Verrückten in der kleinen Ortschaft am südwestlichen Harzrand alle fünf Jahre ihr Fest feierten, stand das ganze Dorf für zwei Wochenenden Kopf, und die Regeln geordneten Miteinanders waren außer Kraft gesetzt! Mit eigenen Augen hatte er sich von dem Ausnahmezustand überzeugen wollen. Jetzt hatte er die Quittung für seine Neugier bekommen!
Bloß weg, dachte er, nicht eine Minute länger unter diesen Halbwilden bleiben!
Immerhin, etliche farbenfrohe Motive waren ihm im Verlauf des Umzuges schon vor die Linse gekommen, und er hatte sich köstlich über das turbulente Treiben an den verschiedenen Barrikaden amüsiert. Bis zu diesem Augenblick. Plötzlich war er selbst ein Opfer und sah sich dem schadenfrohen Lachen der anderen Passanten ausgesetzt. Was für eine Demütigung!
Er versuchte, sich durch die Menschenwand vor ihm zu drängeln. Es gelang ihm nicht, so sehr er auch seine Ellenbogen einsetzte. Er wurde einfach in Richtung dieser kindischen Biene-Maja-Barrikade geschoben, aus der heraus immer noch Wasserbomben flogen. Plötzlich kam er ins Straucheln und wurde von einem fetten Mann in Grashüpferkostüm aufgefangen. Das Johlen um ihn herum ließ ihn ahnen, welch peinliche Figur er in den wabbeligen Armen des Grashüpfers abgab.
Die Biene Maja rettete ihn aus der unmöglichen Situation. Sie zog ihn von dem Fetten weg und drückte ihn sanft auf einen der Strohballen, die die Barrikade zu den Seiten hin abgrenzten.
»Na, Sie hat es ja übel erwischt. Klatschnass sind Sie!«, summte die Biene.
Er hatte eine bissige Erwiderung auf den Lippen, blieb aber stumm. Stattdessen starrte er auf das dick ausgestopfte gelb-braune Ringelkostüm, aus dem unten zwei dünne Beinchen in gelben Strumpfhosen herausragten. Wie konnte sich ein Mensch nur derart verunstalten?
»Hier – wollen Sie ein Bier?«
Er hob etwas den Kopf und sah die Flasche, die sie ihm entgegenhielt. Langsam griff er danach.
»Danke«, murmelte er und wagte es endlich, ihr ins Gesicht zu blicken.
Die Biene schenkte ihm ein Lächeln. Süß … honigsüß. Er liebte Honig über alles!
»Sind Sie von der Presse?« Sie deutete auf seine immer noch feuchte Kamera.
»Nein, ich …«
Er kam nicht dazu, den Satz zu vollenden. Gierige Hände griffen nach der Biene Maja und zerrten sie von ihm weg. Die Pioniere hatten begonnen, die Barrikade aus dem Weg zu räumen und das Insektenvolk gefangenzunehmen. Wütend sprang er auf. Wollte sich auf die Männer stürzen, die Biene aus ihren brutalen Händen reißen. Sie waren so grob! Sie taten ihr weh! Wie konnten sie es überhaupt wagen, sich dazwischen zu drängen? Dazu hatten sie kein Recht! Das konnte er nicht zulassen! Die Biene gehörte ihm – jedenfalls für den Moment! Solange er sich mit ihr unterhielt!
Er wurde zur Seite gedrängt. Rücksichtslos. Kam nicht an sie heran. Sie ließ sich von den Pionieren wegschleppen. Kreischte und lachte dabei. Es schien ihr zu gefallen. Er ignorierte ihren offensichtlichen Spaß an der Gefangennahme. Wut kochte in ihm hoch. Wie von selbst ballten sich seine Hände zu Fäusten. Er unternahm einen weiteren Versuch, sie zu befreien. Scheiterte erneut.
»Sehen wir uns heute Abend?«, rief sie ihm zu, schon ein paar Meter entfernt. »Beim Tanz? In der Festhalle?«
Ihre Stimme – fast noch süßer als ihr Lächeln. Warum bemerkte er das erst jetzt? Seine Fäuste lösten sich. Er stellte sich auf die Zehenspitzen. Sah nur noch ihren Kopf in der Menge:
»Ich weiß nicht! Möchten …«, sie war verschwunden, ehe seine Worte sie erreichten.
»Möchten Sie denn, dass ich komme?« hatte er fragen wollen. Er würde es wohl nur erfahren, wenn er zum Tanz in die Halle ginge.
Als sie ihm abends in der Festhalle am Schützenplatz aus einer der hinteren Sitzreihen entgegenkam, hielt er die Luft an. Beinahe hätte er sie nicht wieder erkannt. Was für ein Kontrast! Das pummelige Bienchen vom Tag hatte sich in einen Sommernachtstraum verwandelt! Ein luftiges, hellblaues Kleid aus Stoff, so zart wie ein Hauch, umschmeichelte ihre atemberaubende Figur. Die tagsüber noch hochgesteckten Haare fielen ihr jetzt in sanften Wellen bis auf die Schultern.
Um ihren Hals hatte sie einen Seidenschal gelegt, farblich perfekt auf ihr Kleid abgestimmt. Während sie mit federnden Schritten auf ihn zukam, wehten die Schalenden hinter ihr her, sahen aus wie kleine, durchscheinende Flügelchen. Verliehen ihr das anmutige Aussehen einer Fee. Sie war die Fee der Nacht!
»Komm, tanz mit mir!«, sagte sie, als sie ihn erreicht hatte. Mehr sagte sie nicht.
Er befürchtete einen Moment lang, sie sei beschwipst, vielleicht sogar angetrunken, sodass ihre kesse Art, ihn zu erobern, dem Alkohol zuzuschreiben sei und er schon im nächsten Moment wieder Luft für sie war. Aber sie schien ihn wirklich zu wollen und ließ es ihn spüren. Sie ignorierte die gierigen Blicke ihrer Freunde und Verehrer und missachtete das neidische Tuscheln in ihrem Rücken. Sie war an diesem Abend nur für ihn da und er wusste vor Glück nicht, wohin.
Irgendwann verließen sie die Halle, gingen an die frische Luft, über den Sportplatz, setzten sich in das weiche Rasengrün, oben auf dem Damm. In ihrem Rücken, hinter den dichten Sträuchern, plätscherte leise das Wasser der Söse dahin und nur wenige Meter von ihnen entfernt vergnügte sich ein Pärchen im Dunkel der Sträucher. Ihr Flüstern und Kichern drang bis zu ihnen herüber. Die beiden Turtelnden ließen sich nicht stören, obwohl sie bemerkt haben mussten, dass sie nicht allein waren.
Schweigend saßen sie auf dem Damm, er, der Prinz und sie, die Fee. Schauten zum sternklaren Himmel hinauf und hingen eine Weile ihren Gedanken nach. Als ihre Hand seine berührte, durchlief ihn ein wohliger Glücksschauer. Er wandte ihr den Kopf zu und blickte ihr in die Augen, in diese dunklen, unergründlich tiefen Seen, auf deren Oberfläche sich das Sternenlicht spiegelte.
Langsam beugte er sich vor, hielt zögernd inne, traute sich nicht. Wieder war sie es, die die Hürde überwand. Sie nahm seinen Kopf in ihre Hände und ihre Lippen verschmolzen zu einem ersten, leidenschaftlichen Kuss.
Später gingen sie zurück in die Halle. Tanzten noch ein paar Mal miteinander, tranken etwas. Sie Bier, er Mineralwasser. Er war mit dem Auto gekommen. Sie überredete ihn nicht zum Alkohol. Bot ihm auch nicht an, bei ihr zu übernachten. Nur nach Hause bringen durfte er sie. Bis vor die Haustür. Ein letzter, inniger Kuss, dann war sie im Haus verschwunden.
Er war glücklich. Sie wollte es anscheinend auch langsam angehen lassen. Das gefiel ihm. Sie war eine gute Frau – nicht so eine, wie die meisten anderen …
Sie trafen sich wieder, nach dem Schützenfest. Erst nur ab und zu, dann öfter, bis sie sich schließlich fast jeden Tag sahen. Schon ein Jahr später heirateten sie und Fee zog endgültig bei ihm ein.
Seit jenem Abend in der Festhalle hatte er sie nie anders genannt, als Fee. Sie war seine Fee. Für immer.
»Bis dass der Tod euch scheidet«, hatte der Pastor gesagt.
So sollte es sein!
1.
Dort, wo sich der Waldweg am Fuße des Lichtensteins zur Hangseite hin zu einem halbkreisförmigen Platz weitete, hatte man eine herrliche Sicht über die weite Ebene des Sösetals bis hin zum Westerhöfer Wald, dem fichtenbestandenen Höhenzug im Westen.
Soeben war die Sonne hinter dem Höhenzug versunken und hatte das Sösetal zum Abschied in ein warmes, rotgoldenes Abendlicht getaucht. Der Wind war eingeschlafen und eine melancholische Stimmung lag über der Ebene.
Franz Krüger stand mitten auf dem buchenumsäumten Platz und starrte nachdenklich den Hang hinauf. Er hatte weder einen Blick für das einmalige Panorama in seinem Rücken, noch konnte er die Abendstille genießen, die sich um ihn herum ausbreitete. Sein Interesse galt ausschließlich einer Öffnung im Berg, die er von seinem Standort aus nur noch eine kurze Zeit würde erkennen können, ehe das Blätterdach auch den letzten Rest an Helligkeit verschluckt hatte.
Ein paar Meter vor ihm ging der ebene Platz mit einem deutlich sichtbaren Knick in den steilen Hang über. Treppenstufen waren in den abschüssigen Waldboden modelliert, die von Brettern und kurzen, senkrecht bis auf Stufenniveau in den Boden gerammten Pfählen in Form gehalten wurden. Die Stufen waren mittlerweile derart ausgetreten, dass man sie nur noch mit größter Vorsicht hinauf- und hinabsteigen konnte. Wäre da nicht das provisorische Geländer gewesen, schlanke, dünne Fichtenstämme, die man an die wesentlich dickeren Stämme der Buchen unmittelbar neben den Stufen genagelt hatte, kaum jemand wäre unfallfrei auf die kleine Plattform vor der Öffnung im Berg gelangt und hätte in den künstlich angelegten Stollen kriechen können – den seitlichen Zugang zur Lichtensteinhöhle.
Heute Mittag erst waren sie in der Höhle gewesen – er, zusammen mit dem Kreisarchäologen und diesem Studenten, dessen Namen er sich nicht merken konnte. Da hatte er etwas bemerkt. Ein kurzes Aufblitzen nur, als der Schein seiner Helmlampe über eine kleine Nische am Fuße des freigelegten Schlotes gewandert war. Er hatte keine Zeit gehabt nachzuschauen, denn schon hatten die anderen beiden wieder den Rückzug aus der Höhle angetreten und ihn mit nach draußen gedrängt. Er glaubte ein goldenes Kettchen erkannt zu haben, vor allem den Anhänger, einen springenden Delphin.
Er hatte seine Entdeckung für sich behalten und sich vorgenommen, später noch einmal in die Höhle zu kriechen. Ohne Begleitung. Er musste wissen, ob dieses Schmuckstück tatsächlich in der Höhle lag und er endlich etwas in der Hand hatte, woraus er dem Großmaul einen Strick drehen konnte.
»Ich mache das jetzt«, murmelte Krüger gegen sein Unbehagen an, »dafür bin ich schließlich hier. Ich ziehe bestimmt nicht den Schwanz ein. Du Scheißkerl hast mich die längste Zeit lächerlich gemacht.«
Nach all den Jahren, die er nun schon in Höhlen herumgekrochen war, hätte er nicht gedacht, dass er noch ein mulmiges Gefühl bekäme. Das hier war immerhin »seine« Höhle! Er kannte sich aus in der Lichtensteinhöhle. Aber es war sein erster Alleingang tief in das enge, verwinkelte Höhlensystem hinein, er war mit seinen fast sechzig Jahren nicht mehr der Jüngste und er wusste mittlerweile um die Gefahren. Er gab sich einen Ruck und riss seinen Blick vom Stolleneingang los. Was sollte schon passieren?
Langsam ging er auf seinen Passat zu. Im Kofferraum lag seine gesamte Ausrüstung. Er zwängte sich in den blauen Overall. Der Einteiler aus derbem Baumwollstoff war am Hinterteil und an den Knien mittlerweile stark abgenutzt und wies Spuren von Gipsschlamm auf, denen auch intensives Waschen nichts mehr anhaben konnte. Nachdem er sich die Gummistiefel übergestreift und die LED-Lampe an seinem Helm überprüft hatte, blickte er sich suchend nach Joggern oder Mountainbikern um. Auch wenn diese nachtaktiven Freizeitsportler harmlos waren, meist grußlos vorbeihuschten und ihren eigenen Gedanken nachhingen, sahen sie vielleicht doch Dinge, die nicht für ihre Augen bestimmt waren.
Aber er war allein, stieg die Stufen zur Plattform hinauf. Oben angekommen zog er entschlossen die knapp einen Meter hohe eiserne Eingangstür zurück. Sie war nur lose am Rahmen angelehnt, seit man sie letzte Nacht aufgebrochen hatte. Ein kurzer Blick zurück ins Tal, einmal tief durchgeatmet, dann schaltete er die Helmlampe ein, ging in die Hocke und schob sich, die Füße voran, in den Stollen hinein.
Es dauerte einen Moment, bis er die Beklemmung abgeschüttelt hatte, die sich immer wieder wie ein eiserner Ring um seine Brust legte, wenn er in »seine« Höhle einstieg. Er hatte sich nie richtig an diesen abrupten Übergang gewöhnen können, wenn er die scheinbar grenzenlose Bewegungsfreiheit außerhalb des Berges gegen die Enge in den zerklüfteten Gesteinsröhren mit manchmal nicht mehr als gerade mal dreißig Zentimetern Durchmesser tauschte. Er hasste dieses nur ein oder zwei Minuten andauernde Gefühl, lebendig begraben zu sein, umschlossen von Gipsfelsen, die ihn, kaum eine Handbreit von seiner Nasenspitze entfernt, zu erdrücken schienen. Hilflos und winzig kam er sich vor, musste mit ausgestreckten, manchmal auch an den Körper angelegten Armen vorwärts robben mit Bewegungen, die denen eines Wurmes oder einer Schlange ähnelten und die Gelenke und Muskeln in ihm aktivierten, von denen er normalerweise nicht einmal wusste, dass er sie überhaupt besaß.
Dann weitete sich der Gang ein wenig, er drehte sich aus der Rückenlage auf den Bauch und zog Beine und Arme an, damit er in die Hocke kam. Als er den Berndsaal erreichte, konnte er sich endlich etwas aufrichten und noch ein Stück weiter sogar zu voller Größe ausstrecken. Ein kurzer Blick nach oben in den Schlot hinein, dann ging er wieder zurück in die Hocke. Auf allen Vieren kriechend machte er sich auf die Suche nach dem Kettchen.
Er ließ den Lichtkegel seiner Helmlampe einige Male hin und her gleiten, als es plötzlich aus einer der engen Spalten aufblitzte.
»Wusste ich es doch«, brummte Krüger vor sich hin. Ein flüchtiges, triumphierendes Lächeln huschte über sein Gesicht.
Er zog die Lampe von seinem Helm, um sein Fundstück besser auszuleuchten – und schrak zurück. Blinzelte. Schaute noch einmal hin. Er hatte sich nicht geirrt. Dort lag tatsächlich ein Halskettchen mit einem filigranen Anhänger. Doch es war nicht das Kettchen, das er noch vor wenigen Tagen am Hals dieses elenden Mistkerls hatte baumeln sehen. Das Schmuckstück dort im Spalt gehörte ihm! Aber das konnte nicht sein! Seit Jahren trug er es nicht mehr bei sich, sondern verwahrte es zu Hause in einem Versteck, das außer ihm niemand kannte! Plötzlich begannen seine Finger zu zittern.
»Reiß dich zusammen, Mann«, mahnte er sich selbst, »vielleicht ist es gar nicht dein Kettchen.«
Nach mehreren erfolglosen Versuchen gelang es ihm, mit zusammengebissenen Zähnen seine Hand so weit in den schartigen Spalt zu quetschen, dass er das Kettchen zwischen Mittel- und Zeigefinger zu fassen bekam. Der Anhänger hatte ein schwarz-weißes Dekor und war mit einem goldenen Rand eingefasst. Genau wie seiner! Und auf der Rückseite die geschwungenen Linien der winzigen, eingravierten Buchstaben: Ila. Es gab keinen Zweifel mehr!
Ein Berg von Fragen türmte sich jäh in ihm auf. Seine Gedanken rasten, versuchten das Unmögliche mit dem Wahrscheinlichen zur Deckung zu bringen. Eine Gleichung, die nicht aufgehen wollte. Eigentlich hatte er doch nur anhand eines ganz anderen Kettchens den Grabräuber überführen wollen, der es hier vielleicht verloren hatte. Und nun hielt er in seiner aufgeschürften, blutigen Hand ein Schmuckstück, das ihm gehörte, das aber unmöglich hierher gelangt sein konnte, er hatte es seit Jahren nicht mehr getragen. Jemand musste es ihm gestohlen haben. Aber wer und warum?
Er wehrte sich gegen die aufkeimende Angst. Wenn er seinen klaren Verstand bewahrte, würde er das Rätsel lösen. Schnell zog er den Reißverschluss seines Overalls soweit auf, dass er in die Gesäßtasche der Jeans greifen konnte, die er darunter trug. Mit klammen Fingern förderte er sein Portemonnaie zutage, verstaute seinen Fund in dem Geldfach, um die billige, arg strapazierte Geldbörse dann wieder in die enge Tasche zu stecken.
Ein leises Klicken ließ ihn in seiner Bewegung erstarren. Beinahe gleichzeitig war der ganze Höhlenraum, wie ein Festsaal, bis in den letzten Winkel von kaltem Licht erhellt.
Mit einem Ruck fuhr er herum und blinzelte in das grelle Licht einer starken Taschenlampe. Er hob die leere Hand schützend vor seine Augen und taumelte leicht. Mit einer Bewegung seiner Arme versuchte er, sich im Gleichgewicht zu halten, dabei rutschte ihm das Portemonnaie aus der Hand und verlor sich in einem Spalt.
»Dr. Stein? Sind Sie das?«, rief er, einer ersten, spontanen Vermutung nachgebend. Er bekam keine Antwort, alles blieb ruhig.
»Verdammt, was soll das? Ich kann Sie nicht erkennen. Sie blenden mich!« Er legte seinen Kopf ein kleines Stück zur Seite, um dem Lichtkegel auszuweichen. Die Taschenlampe folgte seiner Bewegung.
»Mann, hören Sie auf mit dem Scheiß!«, brüllte er. »Leuchten Sie woanders hin und sagen Sie endlich was! Zum Teufel, wer sind Sie?« Es fiel ihm schwer, seine Stimme unter Kontrolle zu halten.
Die Person hinter dem Licht blieb stumm.
Er wollte nach vorn schnellen, die Lampe zur Seite schlagen. Doch die Befehle, die sein Gehirn aussandte, erreichten weder Muskeln noch Glieder.
Schlaff und ohne Regung hockte er am Boden. Eine schreckliche Beklemmung machte sich in ihm breit, während er fieberhaft versuchte, seine wirbelnden Gedanken einzufangen und zu ordnen: Wer war da in der Höhle, war er schon vor ihm dort gewesen, er hätte ihn doch hören müssen, hatte er auf ihn gewartet, was wollte er von ihm?
»Hören Sie«, stammelte er mit flacher, angsterfüllter Stimme, »lassen Sie mich gehen, und dann machen Sie, was Sie wollen. Ich werde niemandem etwas verraten.«
Er wusste selbst, es war ein mehr als kläglicher Versuch, dem Eindringling ein Friedensangebot zu machen, und der quittierte das auch sofort mit einem verächtlichen Schnauben.
Nach wie vor war er dem grellen Schein der Taschenlampe hilflos ausgeliefert, bot seinem unsichtbaren Feind einen jämmerlichen Anblick. Es war ihm egal, er robbte hektisch Stück für Stück rückwärts über den nassen Boden, bis er den Widerstand der Höhlenwand in seinem Rücken spürte. Sein Gegner ließ es geschehen, regte sich immer noch nicht. Er blieb hinter dem Lichtkegel versteckt und beobachtete ihn. Sog zischend die feuchte Luft ein und gab sie schnaubend wieder frei – atmete Mordlust aus.
Krügers Herz raste. Dröhnte mit unerbittlichem Stakkato in seinen Ohren. Es war kalt in der Höhle. Er fror und schwitzte zugleich. Aus all seinen Poren drang die Angst.
Seine Gedanken wurden zum Wirbelsturm, rissen letzte, verzweifelte Hoffnungen mit sich. Keine Flucht. Weder zur Seite, noch nach hinten oder nach oben. Nur nach vorn. Aber da kniete lauernd sein Gegner und weidete sich wahrscheinlich an seiner Hilflosigkeit und Furcht …
Dann, zu seiner eigenen Überraschung, wähnte er sich im Auge des Taifuns. Plötzlich war ihm nichts mehr wichtig. Uninteressant, wer der Eindringling war, ohne Belang, wie er in die Höhle gelangt war, egal, warum er da hockte und was er wollte. Keine Fragen mehr. Er wusste, es gab nur noch die eine, bittere Antwort: Sein Gegenüber wollte ihn töten. Einzig aus diesem Grund war er hier. Merkwürdig, wie wenig ihn diese Erkenntnis erschütterte und wie klar er auf einmal denken konnte.
Krüger spannte seine Muskeln, stützte sich am Felsen in seinem Rücken ab, zog die Beine unmerklich noch ein Stück näher an seinen Körper, atmete tief ein, hielt die Luft an, wollte vorspringen …
Sein Gegner hatte seine Absicht offensichtlich erahnt, war den entscheidenden Bruchteil einer Sekunde schneller als er. Stürzte sich auf ihn und gewährte ihm dabei einen flüchtigen Blick in sein Gesicht, das umrahmt war von einer übergroßen, schwarzen Kapuze.
Krügers Augen weiteten sich vor Überraschung und Entsetzen. Er hatte mit ihm gerechnet. Irgendwann. Aber nicht jetzt! Nicht hier! Nicht so! Die Vergangenheit hatte ihn eingeholt. Viel früher, als erwartet.
Stöhnend fiel er gegen die Felswand zurück. Schmerz ließ seinen Körper zusammenkrampfen.
2.
Kreisarchäologe Dr. Edgar Stein verbrachte eine ausgesprochen unruhige Nacht. Mehrere Male schreckte er, von wirren Traumfantasien gequält, aus dem Schlaf hoch. Dann drehten sich seine Gedanken um Franz Krüger, den Grabungshelfer.
Er hätte den Mann nicht allein an der Höhle übernachten lassen dürfen. Aber Krüger hatte regelrecht darum gebettelt, diese undankbare Aufgabe zu übernehmen. Hätte er es ihm verbieten sollen? Krüger war ein erwachsener Mann, der sich zu helfen wusste, wenn es Probleme gab.
Andererseits – warum sollte es überhaupt Probleme geben? Es musste schon mit dem Teufel zugehen, wenn sich ausgerechnet in dieser Nacht alles Gesindel der Welt am Lichtenstein herumtrieb. Und die Raubgräber hatten vermutlich die Nase voll. Ihr Einbruch war ein totaler Misserfolg gewesen. Kein Wunder, wenn es nichts gab, das sich zu stehlen lohnte. Sie würden kaum einen zweiten Versuch unternehmen. Dr. Stein wusste nicht, warum er sich trotzdem Sorgen machte.
Gegen halb fünf hielt er es kaum noch aus. Wälzte sich unruhig hin und her. Seine Frau wurde wach.
»Was ist denn los?«, nuschelte sie undeutlich und ließ ein leises Schmatzen folgen.
»Gar nichts«, brummte er, »schlaf weiter.«
Er blieb eine Weile regungslos auf dem Rücken liegen, bis er wieder ihr ruhiges, gleichmäßiges Atmen vernahm. Dann schob er vorsichtig die Bettdecke zur Seite und schwang die Beine aus dem Bett. Er beugte sich zu den ausgetretenen Pantoffeln hinunter, nahm sie in die Hand, um keine unnötigen Geräusche zu verursachen, und huschte barfuß zur Toilette.
Nachdem er sich erleichtert hatte, schlüpfte er in die Pantoffeln und ging in die Küche. Ihn fröstelte. Durch die Schlitze der nicht vollständig heruntergelassenen Jalousie am Küchenfenster zwängte sich das erste Tageslicht. Er schlurfte zum Fenster und zog die Jalousie zur Hälfte hoch. Das reichte, um sich zu orientieren.
Aus dem Kühlschrank holte er die Dose mit dem gemahlenen Bohnenkaffee heraus, fummelte eine Filtertüte in die Kaffeemaschine und gab die üblichen vier gehäuften Teelöffel Kaffeepulver hinein. Danach maß er mit der Glaskanne Wasser für einen Pott Kaffee ab. Mit diesem Ritual des Kaffeekochens startete Dr. Stein gewöhnlich ganz in Ruhe in seinen Tag. Heute jedoch war er überhaupt nicht bei der Sache. Während die Kaffeemaschine vor sich hinröchelte, tigerte er unruhig durch die Küche, kramte den Toaster hervor und durchsuchte die Schränke nach etwas Essbarem. Er fand nichts, worauf er Appetit hatte. Immer wieder huschten seine Augen zur Küchenuhr. Die Zeiger schienen stillzustehen.
Schließlich hielt er es nicht mehr aus und griff nach dem Telefon, das er im Vorbeigehen aus der Ladeschale im Hausflur mit in die Küche genommen hatte.
Er wählte die Nummer von Krügers Handy. Es war fast fünf Uhr. Krüger hatte ihm mal gesagt, er sei kein Langschläfer. Sicher stand der Mann schon vor seinem Auto am Wegrand und genoss das frühe Morgenlicht über dem Sösetal. Er ließ es lange läuten. Fünfmal … siebenmal. Krüger nahm nicht ab. Stattdessen meldete sich seine Mailbox. Dr. Stein legte auf, ohne eine Nachricht auf die Box zu sprechen. Krüger war also noch nicht wach.
Hatte er einen so festen Schlaf? Das konnte er sich beim besten Willen nicht vorstellen. Aber es gab noch andere Möglichkeiten: Er hatte sein Handy lautlos gestellt. Oder er inspizierte gerade die Umgebung und hatte sein Handy im Auto liegen lassen.
Dr. Stein beschloss, erst einmal seinen Kaffee zu trinken, damit er halbwegs klar denken konnte. Dann wollte er es noch einmal versuchen. Aber er konnte weder den Kaffee genießen, noch den Toast mit der Aprikosenkonfitüre darauf, für den er sich schließlich entschieden hatte.
Kaum hatte er den letzten Bissen hinuntergewürgt, griff er wieder zum Telefon. Nach einer kleinen Ewigkeit meldete sich erneut die Mailbox.
»Mann, Krüger, wo sind Sie denn, verdammt noch mal? Rufen Sie mich schnellstens zurück!«, blaffte er und wusste noch im selben Augenblick, dass er keine Antwort bekäme.
Irgendetwas war schiefgegangen. Die ganze Zeit schon hatte er es befürchtet. Das Druckgefühl in seiner Magengegend kam nicht von ungefähr. Er atmete schwer. Es hatte keinen Zweck, länger zu warten. Er musste zur Höhle fahren, musste sehen, was geschehen war. Sofort!
Er schlich ins Schlafzimmer zurück, um sich frische Kleidungsstücke herauszuholen. Nicht leise genug. Seine Frau hatte ihn gehört.
»Wieso stehst du denn schon auf?«, fragte sie schläfrig.
»Ich muss zur Höhle.«
»Jetzt schon? Es ist doch noch so früh. Ich denke, der Krüger hält Wache?« Sie räkelte sich wohlig. »Komm, leg dich noch ein bisschen zu mir«, schnurrte sie.
Unter anderen Umständen hätte er nichts lieber getan, als ihrem Wunsch nachzugeben. Doch heute Morgen drängte es ihn, mit eigenen Augen zu sehen, dass es Krüger gut ging.
»Geht nicht. Krüger wartet auf mich«, sagte er daher nicht ganz wahrheitsgemäß und verließ das Schlafzimmer.
Als er seinen VW-Golf auf der kleinen Wegausbuchtung neben dem alten Passat parkte, wirkte auf den ersten Blick alles friedlich. Ein wenig zu friedlich. In dem Bild morgendlicher Naturidylle fehlte ein entscheidendes Detail – Krüger. Kein Grabungshelfer weit und breit. Dr. Stein hatte gehofft, den Mann zu sehen, wie er herumlief und die frische Morgenluft in sich einsog. Oder wie er am Heck seines Passats auf der Kofferraumkante saß und sein mitgebrachtes deftiges Frühstück genoss. Krüger war ein ausgesprochener Liebhaber eines derben Picknicks in freier Natur. Bestimmt hatte er sich gestern Abend ausreichend Proviant eingepackt.
Dr. Stein stieg aus seinem Golf und umrundete den Passat. Der Wagen war leer. Kein Krüger, der zusammengekauert auf der Rückbank lag und schlief. Auch keine Anzeichen, dass der Grabungshelfer im Wagen gesessen oder gelegen hatte. Kein Schleier aus Kondenswasser innen an den Scheiben oder eine unordentlich zurückgelassene Decke vielleicht, in die er sich in der kühlen Nacht eingewickelt hatte.
»Krüger!«, brüllte Dr. Stein in die Stille hinein. »Krüger, wo sind Sie? Antworten Sie!«
Er lauschte angestrengt, bekam aber keine Antwort. Dafür hörte er seinen eigenen Herzschlag lauter schlagen, als ihm lieb war. Der Mann würde ja wohl keinen Morgenspaziergang machen, er war gewissenhaft, hätte sicher bis zur Ablösung hier ausgeharrt.
»Krüger!«, rief er noch einmal, lauter als zuvor.
Wieder keine Antwort.
Hatte ihn jemand gegen seinen Willen von hier weggetrieben oder mitgeschleppt? Oder war er etwa in die Höhle gestiegen? Allein? Ein Wahnsinniger, wenn er das tatsächlich gewagt hatte. Und vor allen Dingen – aus welchem Grund hätte er das tun sollen? Immerhin, es wäre eine Erklärung dafür, dass er nicht geantwortet hatte. In der Höhle hatte er ihn wahrscheinlich gar nicht gehört. Oder doch? Vielleicht hatte er versucht, sich bemerkbar zu machen, aber ihm fehlte die Kraft, weil er sich ernsthaft verletzt hatte! Der Kreisarchäologe war sich plötzlich ganz sicher, dass Krüger in der Höhle lag und seine Hilfe brauchte.
Er verfluchte sich, dass er so kopflos von Zuhause aufgebrochen war. Weder Overall, Stiefel oder Helm hatte er mitgenommen. Er hatte nicht einmal Licht, um sich in der Höhle zu orientieren! Doch – die kleine Taschenlampe! Ein Werbegeschenk und nicht gerade leuchtstark, aber immerhin. Sie musste reichen.
Kurz entschlossen angelte er sich die Lampe aus dem Handschuhfach und stolperte, so schnell er konnte, zur Plattform hinauf. Keuchend erreichte er das kleine Podest. Sofort sah er, dass jemand in die Höhle gekrochen war. Die eiserne Pforte stand offen. Krüger war tatsächlich da drinnen! Der verdammte Idiot!
Dr. Stein schaltete die Taschenlampe ein und steckte sie sich in den Mund, um sie mit den Zähnen festzuhalten. So hatte er wenigstens beide Hände frei. Die brauchte er unbedingt zum Kriechen. Die profillosen Sohlen seiner Schuhe boten ihm keinen ausreichenden Halt.
Schon nach dem ersten Meter, den er auf dem Hosenboden in den Stollen hineinrutschte, drang die schmierige Nässe durch den Stoff seiner Jeans und verursachte ein unangenehmes Gefühl auf der Haut.
Er musste sich vorsehen, kam nur langsam Zentimeter für Zentimeter voran. Ohne Helm lief er Gefahr, sich den Kopf blutig zu schlagen. Und das spärliche Licht der kleinen Taschenlampe irritierte ihn mehr, als dass es ihm den Weg wies.
Er atmete schwer vor Anspannung. Und vor Angst. Er verfluchte Krüger. Stumm, in ohnmächtiger Wut. Und er verfluchte sich selbst. Dann, endlich hatte er den Zugang zum Berndsaal erreicht und konnte die Lampe aus dem Mund nehmen. Einmal war er mit dem Kopf an einer Felskante entlanggestreift. Kein Problem. Eine kleine Hautabschürfung vielleicht. Mehr nicht.
Er ging in die Hocke und verharrte in gespannter Erwartung: »Krüger?«
Für einen Augenblick hielt er den Atem an und lauschte. Nichts.
»Krüger? Sagen Sie doch was!«
Aber Krüger schwieg. Genau wie die Höhle.
Er kroch die beiden Stufen zum Berndsaal hoch. Spürte sie mehr unter seinen Händen, als dass er sie sah.
Wieder verharrte er. Ließ den kümmerlichen Lichtkegel der Taschenlampe nach vorn gleiten. Im schwachen Lampenschein tauchte das grobstollige, ockergelbe Sohlenprofil von Gummistiefeln auf.
»Mann, Krüger, da sind Sie ja!«
Keine Reaktion.
Der Lichtkegel tastete sich weiter nach vorn, glitt über schwarze Stiefel, über Beine, in blauen, derben Stoff gehüllt, wurde zunehmend zittrig. Blieb einen Moment am Reißverschluss des Overalls hängen, der weit geöffnet war. Bis zum Hosenbund der Jeans, die darunter sichtbar wurden.
Dr. Stein schob sich ein kleines Stück nach vorn, bis auf Höhe der Stiefel.
»Krüger?«
In Brusthöhe wechselte das Blau des Overalls in ein schmutziges Rotbraun. Der Farbwechsel war trotz des allmählich schwächer werdenden Lichtes gut zu erkennen. Dr. Stein schwenkte die Lampe ein wenig nach rechts, dann über den Körper hinweg nach links. Sah die beiden Arme, die schlaff neben dem Körper lagen. Seine Hand sträubte sich, die Lampe auf das Gesicht des Mannes zu richten. Er wollte nicht glauben, dass es Krüger war, der vor ihm lag. Mit aller Kraft kämpfte er gegen seinen inneren Widerstand an, überwand mit einem Ruck die Barriere.
Der Anblick, der sich ihm bot, ließ seine grausamsten Albträume wahr werden. Leere, kalte Augen starrten ihn an, fraßen sich in Sekundenbruchteilen in seine Seele. Über dem weit geöffneten Mund des Toten schien immer noch ein letzter, lautloser Hilfeschrei zu hängen. Deutlich konnte er Krügers längst erstorbene Stimme hören. Sie traf ihn bis ins Mark.
Das bleiche, blutüberströmte Gesicht bereitete ihm unerträgliche Qualen. Trotzdem konnte er sich nicht davon abwenden. Die toten Augen hielten ihn fest. Unerbittlich. Sein Magen begann zu rebellieren. Erst war es ein schwaches, flaues Gefühl. Wenige Sekunden nur. Dann kamen die Krämpfe und das Würgen in der Speiseröhre. Rasend schnell. Im letzten Moment gelang es ihm, seinen Oberkörper ein Stück herumzureißen, ehe er sich mit ungewöhnlicher Heftigkeit auf den Höhlenboden erbrach.
Er japste nach Luft. Stützte sich mit butterweichen Armen am Boden ab. Seine Augen füllten sich mit Tränen und seine Nase tropfte. Kalter Schweiß stand ihm auf der Stirn. Panik überfiel ihn. Schoss ihm durch den Körper und jagte seinen Puls in gefährliche Höhen.
Wie von selbst setzten sich seine Arme und Beine in Bewegung, trieben ihn in blinder Hast aus der Höhle. Er stolperte, schrammte mit dem Kopf an felsigen Kanten vorbei, blieb kurz in Spalten hängen, riss seine Füße aus der schartigen Umklammerung, taumelte weiter, erreichte schließlich den Ausgang.
Die milde Luft des noch jungen Tages umfing ihn. Drang tief in seine Lungen und ließ ihn schreien. Endlich!
Rutschend und stolpernd nahm er die Stufen den Hang hinunter, immer kurz davor, nach vorn überzukippen und sich zu überschlagen. Irgendwie gelang es ihm, die Balance zu halten und unten anzukommen, ohne sich die Knochen zu brechen.
Er taumelte auf seinen Golf zu, sah ihn verschwommen durch den feuchten Schleier vor seinen Augen. Gleichzeitig suchten seine zittrigen Hände in den Hosentaschen nach dem Autoschlüssel, fanden ihn aber nicht sofort.
»Scheiße, Scheiße …«, wimmerte er, als er neben dem Golf stand, immer noch auf der Suche nach dem Schlüssel.
Dann hatte er ihn gefunden, schob ihn nach mehreren Fehlversuchen in das Schloss, öffnete die Fahrertür. Das Handy lag auf dem Beifahrersitz. Es fiel ihm schwer, die richtigen Tasten zu treffen. Sie kamen ihm noch kleiner vor, als sonst.
»Bitte … schnell … kommen Sie! Krüger ist tot … ermordet!«
»Hallo … wer ist denn da?« Eine mürrische Stimme am anderen Ende, in der die Erfahrung mit tausenden, sich ähnlich unpräzise ausdrückenden Anrufern mitschwang. »Wo genau sind Sie? Sagen Sie Ihren Namen und was passiert ist!«
»Stein … Dr. Stein, Archäologe«, röchelte er und schnappte nach Luft, »ich … ich bin … bin an der Lichtenstein … höhle … Krüger liegt in der Höhle … tot …«
Das Handy fiel ihm aus der Hand. Er lehnte sich mit dem Rücken an den Golf und ließ sich langsam zu Boden sacken. Undeutlich drang die Stimme aus dem Handy. Jetzt sehr aufgeregt und laut. Sie erreichte ihn nicht. Zusammengekauert hockte er neben seinem Wagen und starrte einen Moment über das dunstige Sösetal ins Leere. Dann vergrub er unvermittelt sein blutverschmiertes Gesicht zwischen seine Arme und Beine. Seine Kraft war aufgebraucht. Er wurde von Weinkrämpfen geschüttelt.
3.
Die nervtötende Dudelmelodie riss Ingo Behrends aus dem Schlaf. Orientierungslos tastete er mit der rechten Hand zur Seite und zu der Stelle, wo er den Schalter seiner Nachttischlampe vermutete. Bevor er ihn erwischte, fegte er zunächst seinen Eifel-Krimi mit dem bedauernswerten Protagonisten Siggi Baumeister zu Boden, danach das Handy, das munter weiterdudelte. Allerdings drang das Plärren jetzt unter seinem Bett hervor. Er beugte sich mit dem Oberkörper nach vorn über die Kante der Matratze. Mit rechts stützte er sich auf dem Fußboden ab, während seine linke Hand unter dem Bett auf Handysuche ging.
Intuitiv wusste er, wer mit diesem Anruf zu früher Stunde seine Hoffnungen auf einen freien Vormittag grausam zerschlug. Nie wählte sie sein Diensthandy an. Sie nerve ihn lieber auf der Privatschiene, hatte sie einmal zu ihm gesagt. Da sei sie wenigstens sicher, dass sie ihn auch tatsächlich erreiche. Ein dezenter Wink mit dem Zaunpfahl.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!