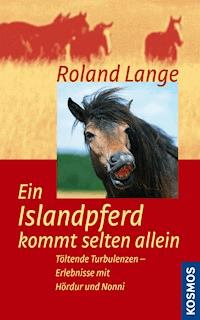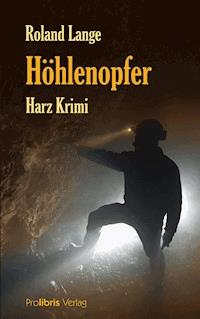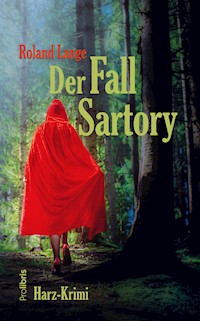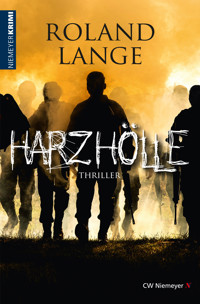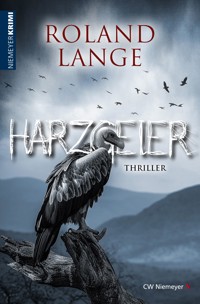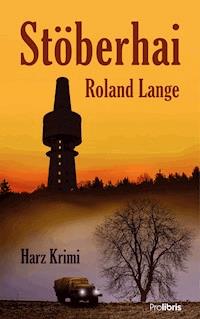
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Hauptkommissar Ingo Behrends kuriert die Folgen einer Schussverletzung aus. Doch die Verbrecher nehmen auf seine Reha keine Rücksicht. Als ein russischer Restaurant-Besitzer in Bad Sachsa ermordet wird, hält es Behrends kaum in der Klinik. Die junge Kommissarin, die ihn in Northeim vertritt, geht die Ermittlungen völlig falsch an, davon ist er überzeugt. Das »Gagarin« soll ein Drogenumschlagplatz gewesen sein? Zusammen mit dem Journalisten Holger Diekmann verfolgt Behrends eine andere Spur. Die führt zurück in die Zeit, als die DDR in Auflösung begriffen war und einige Funktionäre von der unkontrollierbaren Situation profitieren wollten. Zu dumm nur, dass ein Mitarbeiter im NATOAufklärungsturm auf dem Stöberhai eine Nachricht abgefangen hatte, in der ein Offizier der NVA einen illegalen Waffendeal mit russischen Soldaten verabredete …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roland Lange
Stöberhai
Harz Krimi
Prolibris Verlag
Handlung und Figuren sind frei erfunden. Darum sind eventuelle Übereinstimmungen mit lebenden oder verstorbenen Personen zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten,
auch die des auszugsweisen Nachdrucks
und der fotomechanischen Wiedergabe
sowie der Einspeicherung und Verarbeitung
in elektronischen Systemen.
© Prolibris Verlag Rolf Wagner, Kassel, 2016
Tel.: 0561/7 66 44 9 – 0, Fax: 0561/7 66 44 9 – 29
Umschlagfoto:
© dk-fotowelt, Fotolia
E-Book: Prolibris Verlag
ISBN »E-Book«: 978-3-95475-137-2
Dieses Buch ist auch als Printausgabe im Buchhandel erhältlich. ISBN: 978-3-95475-127-3
www.prolibris-verlag.de
www.facebook.de/Prolibris
Prolog
Donnerstag, 16. August 1990, 23 Uhr
Bis zum Sperrgebiet waren es drei Kilometer. Vor knapp einer halben Stunde war der Mann aufgebrochen. Mit seinem Fahrrad und dem kleinen Anhänger war er über Feldwege hierhergefahren. Hatte sich mitsamt seinem Gefährt durch die Sträucher gezwängt, die das Gebiet umgrenzten. Wie letzte Nacht und schon viele Nächte davor.
Es war ein gottverlassenes Fleckchen Erde, das sich vor ihm ausbreitete. Einen Zaun oder andere Absperrmaßnahmen gab es nicht. Der sowjetische Truppenübungsplatz in der Döberitzer Heide umfasste ein riesiges Areal, das an wenigen Stellen halbwegs gut gesichert war. Der Zutritt sollte meist nur mit Schildern am Wegrand verwehrt werden, das war’s.
Hier, in seinem Revier, gab es seit fast zehn Jahren keine militärischen Aktivitäten mehr. Die Natur hatte längst verloren gegangenes Terrain zurückerobert und ein Paradies für Rot- und Rehwild, für Hase, Kaninchen, Fuchs, Dachs und Marder geschaffen. Gut für den Mann, denn der nahezu unerschöpfliche Wildreichtum sicherte ihm einen Nebenverdienst, der ihm half, zusammen mit seiner kargen Frührente einigermaßen über die Runden zu kommen. Seine Abnehmer waren verschwiegen und zahlten recht ordentlich für Pelze und frisches Wildbret.
In Gedanken versunken, aber mit festem Schritt, schob der Mann das Rad mit dem Anhänger neben sich her. Aufsitzen und fahren konnte er in diesem unwegsamen Gelände nicht. Keine zehn Minuten mehr, dann würde er die ersten seiner Fallen erreichen. Zielsicher steuerte er darauf zu. Trotz der Dunkelheit. Er brauchte kein Licht zur Orientierung. Er hätte den Weg auch mit geschlossenen Augen gefunden, so oft war er ihn schon gegangen.
Es würde Regen geben. Schon bald. Er konnte es riechen. Ein Aufblitzen ließ den Mann in der Bewegung innehalten. Er fuhr herum und blickte in die Richtung, in der er den Lichtpunkt wahrgenommen hatte. Das kurze Aufleuchten wiederholte sich. Einmal, zweimal, dreimal, in regelmäßiger, schneller Abfolge. Wie ein … Ein Signal? Klar und deutlich war es dort hinten vor der schwarzen gezackten Baumkulisse unter dem wolkenverhangenen Nachthimmel zu erkennen.
Es war ein Signal!
Er begriff es in dem Moment, als das Blinken gleich darauf rechts, ein gehöriges Stück abseits der ersten Lichtquelle, beantwortet wurde. Erneut leuchtete es viermal schnell hintereinander auf. Dann blieb es dunkel. Dafür nahm er ein Geräusch wahr, das der schwache Wind zu ihm hinübertrug. Ganz leise erst, wurde es von Sekunde zu Sekunde kräftiger, schwoll an und wieder ab, und das anfangs diffuse Brummen wandelte sich allmählich zum Motorengeräusch. Der Dieselmotor eines Lkws, das erkannte der Mann auch über die Entfernung hinweg. Und dieser Lkw rumpelte mit ausgeschalteten Scheinwerfern durch die Finsternis.
Der Mann schob sein Fahrrad hinüber zu einer dürren, windschiefen Birke und lehnte es gegen den Stamm des Baumes. Dann hob er das teure, lichtempfindliche Fernglas, ein Relikt aus besseren Zeiten, das ihm vor der Brust baumelte, an seine Augen und suchte nach der Stelle, wo er das erste Signal wahrgenommen hatte. Kurz darauf kam die Silhouette eines breiten, kastenförmigen Lastwagens in sein Blickfeld. Es war ein Armeelaster, so viel stand für ihn angesichts mehrerer offenkundiger Details sofort fest. Er hatte lange genug mit militärischem Gerät zu tun gehabt, um zu wissen, was er sah. Der Lkw, der sich einige Augenblicke später von links näherte, war ebenfalls kein ziviles Fahrzeug.
Der Mann ahnte, dass diejenigen, die einander dort drüben in der Senke begegneten, etwas Illegales im Sinn haben mussten. Unter normalen Umständen hätte er sich vermutlich nichts dabei gedacht, auf einem Truppenübungsplatz Armeefahrzeuge zu entdecken. Aber das waren keine normalen Umstände. Nicht in dieser Einöde, aus der sich die Sowjets längst zurückgezogen hatten.
Einen Moment zögerte der Mann, dann lief er los. Nahezu lautlos bahnte er sich seinen Weg über den von alten Fahrspuren, Buckeln und kleinen, tückischen Mulden übersäten Untergrund. Seine Schritte wurden vom weichen, grasbedeckten Sandboden gedämpft. Er huschte zwischen Ginstersträuchern, verkrüppelten Stieleichen, Birken und pilzbefallenem Totholz hindurch auf den Treffpunkt der Lkws zu. Im Schutz der Dunkelheit würde er so nahe wie möglich an die Fahrzeuge herankommen und hinter einem Busch oder in einer Bodenwelle in Deckung gehen. Auf keinen Fall wollte er verpassen, was da vorn passieren würde. Er wollte wissen, was die Typen vorhatten. Allein schon um sicherzugehen, dass seine eigenen Geschäfte dadurch nicht beeinträchtigt würden.
Als der Mann die Senke erreichte, stellte er enttäuscht fest, dass er von den Lkws noch mehr als hundert Meter entfernt war, die er nicht unbemerkt überwinden konnte. Eine lang gestreckte baum- und strauchlose Ebene lag vor ihm, an deren Ende die beiden Lastwagen standen, die Ladeflächen einander zugewandt. Direkt dahinter stieg das Gelände sanft an. Aus dicht stehenden Sträuchern ragten die steinernen Ruinen eines alten Schuppens heraus.
Jeder Versuch, sich dem Geschehen weiter zu nähern, musste scheitern. Man würde ihn entdecken. Ernüchtert presste der Mann einen leisen Fluch zwischen den Zähnen hervor. Er fand einen halbwegs geschützten Platz nur wenige Schritte entfernt. Dort konnte er trotz der nächtlichen Stille in diesem gottverlassenen Landstrich vermutlich kaum etwas von dem hören, was gesprochen wurde. Aber er hatte wenigstens einen guten Überblick. Er ging hinter den Ginstersträuchern auf den Bauch, stützte sich mit den Ellenbogen am Boden ab und setzte das Fernglas an die Augen. Dann wartete er.
Es dauerte nur ein paar Sekunden, bis er zwei Uniformierte aus dem Fahrerhaus des rechten Lkws steigen sah. Sie liefen an der ihm zugewandten Seite am Lastwagen entlang nach hinten. Einer der beiden schaltete einen seitlich am Aufbau befestigten Scheinwerfer an. Augenblicklich wurden die Lkw-Rückseiten und die Fläche dazwischen in grelles Licht getaucht. Jetzt erkannte der Mann deutlich, was er bereits vermutet hatte: Die zwei waren russische Soldaten. Der eine ein Hauptmann und der andere ein Major, wenn ihn sein Blick nicht täuschte. Fehlten noch die Insassen des zweiten Lasters, eindeutig ein Fahrzeug aus dem Fuhrpark der Nationalen Volksarmee. Seine ehemaligen Kameraden also! Waren sie etwa hierhergekommen, um Geschäfte mit den ungeliebten Waffenbrüdern zu machen? Einiges deutete darauf hin. Vermutlich hatten die sowjetischen Offiziere diesen Platz für ein gefahrloses Zusammentreffen ausgekundschaftet und darüber hinaus ihren deutschen Geschäftspartnern über die sowjetischen Richtfunkverbindungen auch die Zufahrt mitgeteilt, auf der man unkontrolliert ins sowjetische Sperrgebiet einfahren konnte. Aus eigener Erfahrung wusste der Mann, dass die Kommunikation zwischen NVA-Soldaten und Russen auf diesem Weg möglich war, auch früher schon. Als noch nicht das Chaos regierte, wie in diesen Tagen des Umbruchs.
Er schnaubte verächtlich, und da sich die deutschen Genossen mit dem Aussteigen Zeit ließen, konzentrierte er sich auf die Russen. Die öffneten gerade die Plane ihres Lkws und enthüllten eine fast bis unter das Dach mit Kisten vollgepackte Ladefläche. Die beiden Volksarmisten nahm er erst wahr, als sie im Rücken der Russen auftauchten. Die vier begrüßten einander freundschaftlich. Und so, als kenne man sich. Genau, wie er es vermutet hatte.
Plötzlich machte einer der beiden Deutschen, ein Major, einen kleinen Schritt von den anderen weg. Er wandte sich von ihnen ab und ließ seine Augen forschend über die Ebene wandern. Es schien, als habe er irgendetwas Verdächtiges bemerkt. Als der Offizier in seine Richtung blickte, verschlug es dem Mann in seinem Versteck den Atem. Er kannte das Gesicht – das Gesicht einer Bestie, von der er gehofft hatte, sie niemals wieder sehen zu müssen! Das verlogen freundliche Grinsen, das starr und maskenhaft die Mundpartie dieses Sadisten umrahmte, hatte sich schmerzhaft in seine Seele eingebrannt. Dazu die kalten Augen, durchdringend und ständig lauernd, so wie jetzt, als sie die Senke absuchten. Ausgerechnet hier musste er dem Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit wieder begegnen, dem Wassermann, wie er wegen seiner perfiden Verhör- und Foltermethoden genannt wurde. Er selbst hatte die Spezialbehandlung des Wassermanns erfahren, nachdem er als Grenzsoldat unter Spionageverdacht geraten war. Er hatte damals Tagebuch geführt und darin leichtsinnigerweise dienstliche Details, aber auch seine geheimen Zweifel an Sinn und Rechtmäßigkeit der Grenzsicherung aufgeschrieben. Ein schwerer Fehler, der ihm fünf Jahre Knast in Schwedt eingebracht hatte. Nach seiner Entlassung war er ein gebrochener Mann gewesen. Sein Leben lag in Trümmern. Ohne jede Zukunftsperspektive.
Die Arme des Mannes begannen zu zittern, und sein Brustkorb verengte sich schmerzhaft. Hatte er eben noch ganz ruhig geatmet, so schnappte er jetzt nach Luft, glaubte, jeden Moment ersticken zu müssen. Eine plötzliche Kälte zog durch seine Finger und lähmte sie. Das Fernglas drohte ihm aus den Händen zu gleiten.
»Ruhig! Ganz ruhig«, rief er sich stumm zur Besinnung. »Es ist vorbei. Er kann dir nichts tun! Nicht mehr!«
Es dauerte vielleicht eine Minute, dann hatte er sich wieder in der Gewalt und konnte dem Geschehen auf dem Platz weiter folgen. Er hörte Stimmengemurmel, sah die olivgrünen Kisten, die von einer Ladefläche zur anderen wechselten. Eine wurde gerade von den Russen auf dem Boden abgesetzt und geöffnet. Die beiden NVA-Offiziere beugten sich darüber. Und nahmen je eine Pistole heraus! Dann ein Päckchen, das sie öffneten, um ihm Munition zu entnehmen und die Waffen zu laden und sie auf die Russen zu richten. Die wichen erschrocken zurück. Darauf schallendes Lachen der Volksarmisten, die sich anscheinend einen Spaß mit ihren Geschäftspartnern erlaubt hatten, denn schon im nächsten Moment wandten sie sich von den Russen ab, zielten auf die Mauerreste im Hintergrund und feuerten.
Als seien die Schüsse ein Startaufruf, tauchte wie aus dem Nichts ein Mann in Zivil hinter den Ruinen auf. Er brüllte wie ein Berserker, stürzte auf die Soldaten zu und schoss auf sie. Einer der beiden Russen ging getroffen zu Boden, während der andere seine Waffe zog und auf den Angreifer zielte.
Mit angehaltenem Atem verfolgte der Beobachter im Schutze der Ginstersträucher die Attacke. Er sah den Zivilisten zusammenbrechen und den getroffenen Russen, der Deckung suchend über den Boden robbte. Plötzlich erschienen zwei weitere Personen im Blickfeld seines Fernglases. Ebenfalls Männer in Zivil, die hinter dem Mauerrest verharrt haben mussten und die, so wie es aussah, jetzt ihrem Freund helfen wollten. Sie waren mit ein paar schnellen Sätzen bei ihm, beugten sich hinunter, packten ihn bei den Armen, wollten ihn hinter die Mauer in Sicherheit ziehen.
Wieder fielen Schüsse. Zwei, drei, vier ... Die beiden Männer brachen getroffen zusammen, noch bevor sie mit ihrem Freund die schützende Mauer erreichen konnten.
Der Beobachter brauchte einen Moment, ehe er begriff, dass die beiden NVA-Soldaten die Schüsse abgegeben hatten. Mit den Pistolen, die sie kurz zuvor aus der Kiste genommen hatten. Aber es war noch nicht zu Ende: Die Volksarmisten wagten sich aus der Deckung hinter der Motorhaube ihres Lkws hervor, legten nun auf die beiden Russen an und feuerten die Waffen erneut ab. Der Mann mit dem Fernglas zuckte zusammen, Herzschlag und Atmung beschleunigten sich. Reflexartig schloss er die Augen. Nur für eine Sekunde. Dann starrte er wieder auf die Deutschen, die zu ihren Geschäftspartnern hinübergingen und sich mit leichten Fußtritten gegen ihre leblosen Körper davon überzeugten, dass sie tot waren. Danach richteten sie ihre Aufmerksamkeit auf die Zivilisten.
Der Beobachter wandte sein Fernglas ebenfalls dorthin. Zwei der Männer lagen noch da, wo sie zusammengebrochen waren. Der dritte Zivilist, der auf den Russen geschossen hatte, fehlte. War es ihm gelungen, zwischen den Ruinen und dem undurchdringlichen Gestrüpp zu entwischen? Das Verhalten der NVA-Offiziere deutete darauf hin. Einen Augenblick lang irrten sie suchend umher, dann tauchten sie in das nahe Unterholz ein. Der Beobachter machte sich keine Illusionen. Der Flüchtige hatte kaum eine Chance, auch wenn er nur leicht verletzt sein sollte. Der Major und dessen Kumpan würden ihn fassen und ebenso kaltblütig hinrichten, wie die anderen Beteiligten an dem nächtlichen Stelldichein.
Zehn Minuten mochten vergangen sein, als die Volksarmisten wieder auf der Bildfläche erschienen. Hatten sie den Geflohenen erwischt? Es war kein Schuss gefallen. Aber sie fühlten sich eindeutig nicht mehr bedroht, denn sie drückten den toten Russen die Pistolen in die Hand, mit denen sie noch vor Kurzem das Blutbad angerichtet hatten. Gleich darauf luden sie eilig die restlichen Kisten mit Waffen und Munition auf ihren Lkw und wenig später waren sie mit ihrer Beute in der Dunkelheit verschwunden.
Etliche Minuten blieb der Mann noch wie benommen hinter dem Busch liegen, dann drückte er sich hoch in den Stand. Er wandte sich von der grausamen Kulisse ab und ging langsam den Weg zurück, den er gekommen war. Mit jedem Schritt ließ seine Anspannung etwas nach. Gleichzeitig verfiel er in dumpfes Grübeln. Was sollte er jetzt machen? Einfach so tun, als sei nichts geschehen? Da hinten lagen vier Männer, kaltblütig erschossen von zwei NVA-Offizieren. Einer der Mörder war sein ehemaliger Peiniger, dem er nichts sehnlicher wünschte, als den Tod – einen qualvollen Tod! Sollte er die Täter einfach so davonkommen lassen? Er konnte seine Beobachtungen der Polizei melden. Aber was dann? Er befand sich auf einem russischen Truppenübungsplatz. Im Sperrgebiet! Verbotenes Terrain! Alles andere als gute Voraussetzungen für ihn. Er würde sich Fragen gefallen lassen müssen. Unangenehme Fragen. Schon einmal hatte er für seine Gutgläubigkeit, für seine Naivität bitter bezahlt! Trotzdem, es musste doch eine Möglichkeit geben! Eine anonyme Anzeige vielleicht?
»Stoj!«
Die Stimme riss den Mann aus seinen Gedanken und ließ ihn erschrocken zusammenfahren. Wie erstarrt blieb er stehen. Erst nach einigen Sekunden wagte er es, sich vorsichtig umzublicken. Aus dem Gebüsch zu seiner Rechten schälte sich eine Person, kam mit vorgehaltener Pistole auf ihn zu. Der Zivilist, der den NVA-Offizieren entkommen war! Der Kerl sah erbärmlich aus – verschwitzt, die Haare wirr, die Jacke zerrissen. Seine Hose war voller Blut, und er zog das linke Bein nach. Die Schusswunde!
»Du musst mir helfen«, presste der Verletzte mit kehligem Akzent hervor. Ein Russe!
»Aber ich ...«
»Nicht reden. Nur helfen«, schnitt ihm der Russe mit verzerrter Miene das Wort ab und fuchtelte mit der Pistole. »Du bringst mich zu meinem Auto. Sofort! Hast du kapiert?«
Der Mann nickte. Was sollte er anderes tun? Er legte sich den freien Arm des Russen über die Schulter und umfasste seine Hüfte.
»Wohin?« Wenigstens das musste er wissen.
»Da.« Der Verletzte deutete mit seiner Pistole auf ein unbestimmtes Ziel.
Er setzte sich in Bewegung. Der Russe hing schwer an ihm. Zu schwer. Das würde er nicht lange durchhalten. Plötzlich hatte der Mann eine Idee. Er wechselte die Richtung.
»Halt!«, brüllte der Russe sofort und hielt ihm die Pistole unter die Nase. »Nicht dahin! Was soll das?«
Der Mann schluckte trocken. »Ich ... ich habe ein Fahrrad mit einem Anhänger«, stammelte er nervös. Sein Herz raste. Er zwang sich, sein Hände auszustrecken und beschwichtigend auf und ab zu bewegen, um die Harmlosigkeit seines Vorhabens zu unterstreichen. »Gleich da vorne steht es. Nur ein paar Meter.«
Der Russe musterte ihn scharf. Nach einigen Augenblicken nickte er. »Gut. Aber keine Tricks, hörst du?«
Der Mann atmete erleichtert auf. Er bugsierte den Verletzten zum Hänger und half ihm hinein. Dann ließ er sich von dem Russen zu dessen Auto dirigieren. Über einen Kilometer entfernt. Ein schwarzer Mercedes stand am Wegrand. Mit Automatikgetriebe, wie der Mann erkennen konnte, als er dem Russen die Autotür öffnete. Ohne Frage von Vorteil, wenn man mit so einer Wunde noch fahren wollte. Dennoch hatte er Zweifel, ob der Verletzte sein Ziel je erreichen würde. Wo immer es auch liegen mochte.
Er wollte dem Russen beim Einsteigen helfen, doch der wehrte seine Hand ab und hielt ihm stattdessen die Pistole entgegen. »Umdrehen, Hände auf das Wagendach!«, forderte er schroff.
Der Mann zuckte erschrocken zusammen, zögerte. Als er den Pistolenlauf zwischen seinen Rippen spürte, gehorchte er. Gleich darauf tastete der Russe seinen Oberkörper ab, durchsuchte Hose und Jacke, fischte seinen Ausweis heraus und ließ ihn in der eigenen Hosentasche verschwinden. Danach schien er zufrieden und zog ihn vom Auto weg. Mit schmerzverzerrter Miene ließ er sich auf den Fahrersitz sinken.
»Was du heute gesehen und erlebt hast, ist nie passiert, verstehst du?«, mahnte ihn der Russe zum Abschied eindringlich. »Du wirst niemandem etwas sagen. Wenn doch, werde ich dich finden. Und dann ...«
Der Mann nickte. Er hatte verstanden. Noch während er dem davonfahrenden Mercedes hinterhersah, fielen die ersten Regentropfen und verdichteten sich binnen Sekunden zu einem monotonen Rauschen.
1.
Mehr als 25 Jahre später, Frühling
»Ist das Ihr Vater?«
Die raue Stimme ließ Jana erschrocken zusammenzucken. Sie war so tief in ihre Andacht versunken gewesen, dass sie die Person nicht bemerkt hatte, die hinter sie getreten war. Einen Moment verharrte sie, dann drehte sie sich langsam um. Zwei wache Augen in einem faltigen, unrasierten Männergesicht blickten sie unter buschigen Brauen hinweg neugierig an.
»Was ...?« Sie spürte ein Kratzen im Hals und räusperte sich. »Was haben Sie gesagt?«
»Ich habe gefragt, ob das Ihr Vater ist.« Der Mann deutete mit einem Kopfnicken zu dem kleinen Emailleschild, auf dem ein Männerportrait zu sehen war und das in Augenhöhe mit einer Schraube am Stamm der alten Buche befestigt war.
»Ich wüsste nicht, was Sie das angeht«, erwiderte Jana feindselig.
»Tut mir leid. Sie haben natürlich Recht. War nur so ein Gedanke, als ich Sie vor dem Foto stehen sah. Scheint mir eine Art Gedenkstätte zu sein. Nicht gerade alltäglich, mitten im Wald, das müssen Sie zugeben.«
Der Mann wirkte keineswegs betreten. Ungerührt stand er da, die Hände in den Taschen seiner schlammfarbenen Vintage-Jacke vergraben, und musterte Jana neugierig. Er war schlank und gut einen Meter neunzig groß und machte einen auffallend vitalen Eindruck. Graue Locken kräuselten an den Seiten und im Nacken unter einer schwarzen Strickmütze hervor. Jana schätzte den Mann auf sechzig Jahre, vielleicht auch etwas jünger.
»Schleichen Sie sich immer so an?« Sie verschränkte herausfordernd die Arme vor der Brust. »Wer sind Sie überhaupt?«
Der Mann zog die Hände aus den Taschen und hob sie entschuldigend in die Höhe. »Ich bitte nochmals um Verzeihung! Es war wirklich nicht meine Absicht, Sie zu erschrecken.« Er grinste verlegen. »Mein Name ist Vetter, Ulrich Vetter. Und …« Er wurde von einem schwarzbrauen Fellknäuel unterbrochen, das aus dem Gestrüpp gewuselt kam und auf kurzen, krummen Beinen hechelnd auf Jana zutrippelte. Der Rauhaardackel setzte sich vor sie hin und blickte bettelnd zu ihr hoch. Dann ließ er ein heiseres Kläffen ertönen.
»Hey, wo kommst du denn her?«, rief Jana entzückt aus und beugte sich zu dem kleinen Kerl hinab. Dabei blickte sie Ulrich Vetter fragend an. »Ist das Ihrer?«
Er nickte und zog missbilligend die Stirn kraus. »Aus, Otto! Bei Fuß!«, rief er dem Hund zu, der seinen Befehl ignorierte.
»Otto?«
»Richtig. Mein alter Wegbegleiter Otto. Und wie heißen Sie?«
»Jana Schuchart«, antwortete sie automatisch, während sie dem Dackel sanft über Kopf und Rücken streichelte, was der mit leisem Fiepen und freudigem Schwanzwedeln quittierte. »Und Sie lassen ihn einfach so hier im Wald herumstreunen?«, fragte sie. »Ich meine, er ist doch ein Jagdhund, oder?«
Vetter grinste gequält. »Schon. Aber vor dem braucht kein Karnickel oder Dachs mehr Angst haben. Otto ist in einem Alter, wo er froh ist, dass ihn seine Füße überhaupt noch tragen, das sieht man ja. Ich fürchte, seine Tage sind gezählt.« Er stieß einen herzergreifenden Seufzer aus. »Immerhin hat er seinen guten Geschmack was Frauen betrifft noch nicht verloren. Er mag Sie.«
Jana schaute ihr Gegenüber skeptisch an. »Ach, wirklich?« Dann musste sie unwillkürlich lachen. »Da habe ich wohl richtig Glück gehabt.«
Vetter lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf das Männerportrait am Baumstamm. »Sie haben meine Frage immer noch nicht beantwortet: Ist das Ihr Vater?«
Jana nickte und schenkte dem leicht verblassten Foto, das einen Mann in der Paradeuniform der Roten Armee zeigte, einen sehnsüchtigen Blick.
»Ein russischer Offizier?«
Wieder nickte sie.
»Er ist tot, vermute ich.«
Sie wandte sich von dem Foto ab. Ihre Haltung versteifte sich. Kalt blickte sie Vetter in die Augen. Otto, der Dackel, spürte den plötzlichen Stimmungsumschwung und verzog sich ängstlich hinter die Beine seines Herrchens.
»Sie haben mir meine Frage auch noch nicht beantwortet, Herr Vetter«, sagte sie schneidend. »Was haben Sie hier zu suchen? Was wollen Sie von mir?«
Ulrich Vetter antwortete nicht sofort. Er presste die Lippen zusammen, blickte zu Boden. Nach einem Augenblick hob er wieder den Kopf, sah ihr direkt in die Augen. »Also gut, Frau Schuchart, ich will ehrlich zu Ihnen sein. Ich bin Ihnen hierher gefolgt, nachdem Sie das Haus Ihrer Mutter verlassen haben.«
»Sie sind mir ... Was?« Jana machte erschrocken einen Schritt von ihm weg.
»Sie müssen keine Angst haben.« Er hob beschwichtigend die Hände. »Es ist nicht, was Sie denken.«
»Was dann? Kennen Sie meine Mutter?«
Vetter schüttelte den Kopf. »Nein, ich kenne sie nicht. Nicht persönlich. Ich bin Journalist, verstehen Sie? Und ich wollte mit ihr sprechen. Eine spontane Entscheidung. Ich hatte mich nicht angekündigt. Als ich ankam, sah ich sie gerade in ihr Auto steigen und wegfahren. Ich glaube jedenfalls, dass es Ihre Mutter war. Sie hatte es sehr eilig, wie mir schien. Ich habe gezögert, wusste nicht, ob ich ihr hinterherfahren sollte. Dann sah ich Sie aus dem Häuschen kommen. Ich habe mir gedacht, wenn schon nicht die Mutter, dann kann mir vielleicht die Tochter ein paar Fragen beantworten. Ich habe gehofft, dass Sie die Tochter sind.« Er grinste verlegen. »Deshalb bin ich Ihnen gefolgt. Ohne zu ahnen, wohin Sie mich führen.«
Jana nahm augenblicklich eine Abwehrhaltung ein. »Journalist? Was wollen Sie von mir?« Immerhin, kein Vergewaltiger! Sonst hätte er sich wohl kaum erst vorgestellt und wäre auch nicht mit Hund im Wald unterwegs. Trotzdem eine Unverschämtheit von dem Mann, ihr heimlich nachzustellen!
Vetter ignorierte ihre Frage. »Ihr Vater war Jegor Antonowitsch Andrejew, Offizier der sowjetischen Streitkräfte in der DDR«, entgegnete er gelassen.
Sie riss überrascht die Augen auf. »Woher ... woher wissen Sie das?«, stammelte sie verwirrt. Etwas rieb an ihrem Bein. Sie blickte nach unten. Otto hatte sich wieder aus der Deckung getraut und schmiegte sich an sie. Jana ging in die Hocke, streichelte den Hund. Er fühlte sich warm an. Ihre Anspannung löste sich.
»Erzählen Sie mir von Ihrem Vater?«, fragte Vetter sanft. »Wie ist er gestorben? Warum diese Gedenkstätte? Sein Grab, wo ist es?«
Jana blickte zu ihm hoch, ohne aufzuhören, Otto zu streicheln. »Es gibt kein Grab. Jedenfalls nicht hier in Deutschland.« In ihren Augen lag ein feuchter Schimmer. »Fast immer, wenn ich meine Mutter besuche, mache ich auch einen Abstecher hierher. Ich rede mit ihm, lade meinen Kummer ab. Auch wenn ich nur eine vage Erinnerung an ihn habe, es hilft mir.«
»Sie wohnen nicht bei Ihrer Mutter?«
»Oh Gott, nein!«, stieß sie aus. »Ich bin weggezogen, als ich volljährig war. Ich habe studiert. Architektur. Nebenbei habe ich gejobbt. Um meine Mutter nicht anbetteln zu müssen. Heute wohne ich in Uelzen. Kleine Wohnung, schlecht bezahlte Arbeit im Fitnesscenter.« Sie grinste. »Wenn Sie zufällig jemanden kennen, der ein lukratives Angebot für eine qualifizierte Architektin hat, lassen Sie es mich wissen.«
»Sie verstehen sich nicht sonderlich mit Ihrer Mutter«, vermutete Ulrich Vetter.
Ein wütendes Funkeln lag plötzlich in Janas Augen. »Stimmt. Ich komme nicht mit ihr klar. Mit ihrem trostlosen Leben.«
»Weil sie arm ist?«
Jana lachte bitter auf: »Arm? Nein, Geld hat sie genug. Ihre Witwenrente ist mehr als ausreichend. Trotzdem verschwendet sie ihr Leben. Sie kauft sich ständig unnütze Dinge, geht Beziehungen ein, die kurz darauf wieder in die Brüche gehen ...« Sie unterbrach sich, runzelte die Stirn und fragte sich, was sie eigentlich dazu trieb, mit ihm über all das zu sprechen, was sie seit Jahren allein mit sich herumtrug. Vielleicht war es leichter, mit einem Fremden darüber zu reden, den sie wohl nie wieder sehen würde? Sie warf einen mitleidigen Blick auf Otto, den Dackel, der es sich mittlerweile zwischen ihr und Vetter auf dem Boden gemütlich gemacht hatte und vor sich hindöste.
»Mutter hat Papa vergessen«, begann sie. »Zwei Jahre nach seinem Tod hat sie die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Sie ist Wolgadeutsche, wissen Sie? Und sie kannte damals einen Kerl, der ihr geholfen hat, das bei den Behörden zu regeln. Es ging erstaunlich reibungslos über die Bühne. Jetzt heißen wir beide Schuchart. Das ist Mutters Geburtsname. Nicht einmal sein Name ist mir von Papa geblieben. Bald danach sind wir hier nach Stendal gezogen. In das kleine Haus, in dem sie immer noch wohnt. Acht Jahre alt war ich da. Aber selbst wenn wir nicht umgezogen wären, es gibt kein Grab, an dem ich mich an Vater erinnern könnte. Seinen Leichnam haben sie zu seiner Familie nach Russland überführt. Ganz offiziell. Seine Dienststelle hat sich darum gekümmert. Ich habe das damals alles nicht begriffen, fühlte nur, wie sehr er mir fehlte und habe nach einer Möglichkeit gesucht, mich an ihn zu erinnern.« Sie beugte sich vor und streichelte sanft über das verblasste Foto. »Und dann habe ich eines Tages diesen Platz gefunden und ihn zu meinem Andachtsort gemacht.«
»Was wissen Sie über den Tod Ihres Vaters?«, unterbrach Vetter sie. »Sie waren damals noch sehr klein. Was hat Ihnen Ihre Mutter erzählt?«
»Er hatte einen Unfall. Während eines Diensteinsatzes ist er tödlich verunglückt.« Jana ließ von dem Bild ab und blickte zu Boden. »Soldat ist ein gefährlicher Beruf, hat Mutter mal gesagt. Das klang so, als habe sie damals immer mit seinem Tod gerechnet.«
Vetter nickte. Ihr schien es, als habe er genau diese Antwort erwartet. »Hatten Sie nie das Bedürfnis, das Grab Ihres Vaters zu besuchen?«, fragte er. »Vielleicht sogar ganz nach Russland zu gehen? In seine Heimat?«
»Mutter wollte nicht zurück, sie hat das Land nie gemocht. Das ist bis heute so. Und ich ...« Jana blickte an ihm vorbei auf einen imaginären Punkt irgendwo zwischen den Bäumen und schien zu überlegen. Sekunden später schüttelte sie den Kopf. »Nein, daran habe ich keinen Tag gedacht. Mein Traumland ist Norwegen. Außerdem kenne ich die Heimat meines Vaters nicht. War nie dort. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich trage einen deutschen Namen. So ist das nun mal. Ich habe zwar überlegt, ob ich den Namen meines Vaters wieder annehmen und die Entscheidung meiner Mutter rückgängig machen soll. Aber hätte das was geändert? Meinem Vater wäre ich dadurch nicht näher gewesen. Er ist hier, an meiner Gedenkstätte. Sonst nirgends. Ich finde ihn weder durch einen Namen noch in irgendeinem Grab in einem fremden Land.«
»Wo er vielleicht gar nicht beerdigt ist«, ergänzte Ulrich Vetter. »Wer weiß, ob die sterblichen Überreste Ihres Vaters jemals in seiner Heimat angekommen sind. Einen Sarg hat man wohl an seine Familie geschickt. Die Frage ist nur, was sich darin befand.«
Jana zuckte zurück. »Was? Wie meinen Sie das?«
Er sog vernehmlich die Luft durch die Nase ein. »Ich denke, ich sollte Ihnen jetzt meinen Teil der Geschichte erzählen«, sagte er. »Wie Sie schon wissen, ich bin Journalist. Freier Journalist. Hauptsächlich mache ich Reportagen über brisante Politik- und Wirtschaftsthemen. Für verschiedene Magazine. Auch über Dinge, die ihren Ursprung in der Vergangenheit haben. Ich beschäftige mich schon seit einer Weile mit dem illegalen Waffenhandel in Deutschland. Ein Thema, das mich bis in die Wendezeit zurückgeführt hat. Und in dem Zusammenhang bin ich auf ein Ereignis aufmerksam geworden, bei dem Ihr Vater ins Spiel kommt. Ein Waffengeschäft auf einem sowjetischen Truppenübungsplatz, bei dem er ...«
Weiter kam Vetter nicht. Wie eine Furie stürzte sich Jana plötzlich auf ihn, gab ihm einen Stoß, sodass er stolperte und rücklings zu Boden fiel. Einer Rachegöttin gleich stand sie über ihm, deutete mit dem Finger auf seinen Oberkörper. »Mein Vater war kein Verbrecher«, stieß sie drohend aus. »Er hat nicht mit Waffen gehandelt! Sagen Sie so etwas nie wieder!« Ihr Atem ging schnell und stoßweise. »Wer sind Sie wirklich? Staatsschutz? Irgend so ein mieser Spitzel?«
»Reden Sie keinen Unsinn, verdammt! Und hören Sie mir doch erst mal bis zum Ende zu!« Vetter rappelte sich ächzend hoch, während Otto, der Dackel, laut kläffend um ihn herumscharwenzelte. Jana trat einen Schritt zur Seite, ließ Vetter aufstehen.
»Was ich Ihnen eigentlich mitteilen wollte«, knurrte er und klopfte sich Laub und Waldboden von Jacke und Hose, »ist etwas anderes. Bei diesem Waffen... bei dieser Sache auf dem Truppenübungsplatz muss es einen Zwischenfall gegeben haben. Etwas ist aus dem Ruder gelaufen. Es kam zu einer Schießerei, in deren Verlauf auch Ihr Vater getötet wurde. Ermordet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Ihr Vater war. Wie es scheint, hat es seitens der sowjetischen Militärführung keine Ermittlungen gegeben. Obwohl ich Informationen besitze, denen zufolge die Sowjets durchaus von dem Vorfall wussten. Deshalb wollte ich mit Ihrer Mutter sprechen. Um von ihr zu erfahren, ob sie die Wahrheit kennt oder ob man ihr damals ein Märchen aufgetischt hat.«
»Das ist nicht wahr. Sie lügen.« Jana drohte die Stimme zu versagen. Ihre Augenlider flackerten. Ihr ganzer Körper befand sich in Aufruhr. Gleichzeitig spürte sie sich eingezwängt in ein imaginäres Korsett, dass es ihr unmöglich machte, sich zu bewegen.
Vetter schüttelte traurig den Kopf. »Ich belüge Sie nicht. Leider.« Er zog eine Visitenkarte aus der Tasche. »Hier, meine Adresse. Wenn Sie wirklich am Schicksal Ihres Vaters interessiert sind, sollten Sie mich besuchen. Dann kann ich Ihnen beweisen, dass ich die Wahrheit sage.«
Sie nahm die Karte und starrte sie eine Weile an, ohne wirklich etwas darauf zu erkennen. Schließlich fragte sie tonlos: »Wissen Sie, wer meinen Vater ermordet hat?«
Vetter zögerte, blickte an ihr vorbei ins Leere, schien zu überlegen. »Rufen Sie mich an«, sagte er dann aber nur und wandte sich seinem Dackel zu. »Los, Otto, es wird Zeit, dass wir gehen. Wir haben die Dame schon lange genug belästigt.« An Jana gerichtet sagte er: »Ich hoffe, wir sehen uns, Frau Schuchart. Machen Sie’s gut. Ach übrigens, es wäre besser, wenn Sie niemandem von unserem Gespräch erzählen.«
Jana nickte geistesabwesend, ihre Augen fest auf die Visitenkarte geheftet. Sie registrierte seine Worte, auch dass er sich umdrehte und ging. Wirklich bewusst wurde es ihr jedoch nicht. Ihre Gedanken beschäftigten sich mit einem Unbekannten. Einem Mörder. Dem Mörder ihres Vaters.
2.
Es war so weit. Hauptkommissar Ingo Behrends stand im Schlafzimmer vor seinem Bett und starrte auf die gepackte Reisetasche, die sich tief in die Daunendecke drückte. Für die nächsten Wochen würde er nicht mehr hier schlafen. Daran war seine Frau Katrin nicht ganz unschuldig. Einen flüchtigen Moment lang dachte er, dass sie vielleicht sogar froh war, sein Schnarchen für längere Zeit nicht neben sich ertragen zu müssen, so engagiert, wie sie sich um einen schnellen Operationstermin und die nachfolgende Reha für ihn bemüht hatte.
»Blödsinn!«, rief er sich noch im selben Augenblick leise zur Ordnung. Er wusste sehr gut, wie nötig der Eingriff war, dem er sich in der Uniklinik in Göttingen unterziehen sollte. Die alte Schussverletzung hatte ihm im zurückliegenden Jahr zunehmend Probleme bereitet. Die Schmerzen hatten sich nicht mal mehr mit Tabletten vollständig unterdrücken lassen.
Außerdem hatte auch Maike ihm immer und immer wieder gesagt, dass es so nicht weitergehen könne. Jedes Mal, wenn sie in sein Büro gekommen war und er mit aschfahlem Gesicht gekrümmt hinter seinem Schreibtisch gehockt hatte, war ihre Miene ein wenig sorgenvoller geworden. »Du kannst so nicht mehr arbeiten«, hatte sie ihn ermahnt. »Du wirst zunehmend zum Risiko. Für dich und deine Kollegen.«
»So ein Quatsch«, hatte er wütend abgewehrt und gleichzeitig gewusst, dass es stimmte, was sie sagte. Die Polizei konnte keine kranken Beamten gebrauchen. Schon gar nicht, wenn es bei einem Einsatz hart auf hart kommen sollte.
Schließlich hatte Katrin die Reißleine gezogen und Nägel mit Köpfen gemacht. Erstaunlich, dass seine Frau überhaupt so lange stillgehalten hatte. Als Arzthelferin war sie, wenn es um das Thema Gesundheit ging, diejenige, die in ihrer Beziehung das Sagen hatte – ob es sich um die Therapie einer einfachen Erkältung handelte oder eben darum, auf einer überfälligen Operation zu bestehen.
»Kommst du? Wir müssen los!«, tönte es von unten aus dem Hausflur. Katrin stand bereit, um ihn nach Göttingen zu chauffieren. Er würde sich nicht einmal mehr selbst hinter das Steuer setzen dürfen. Lächerlich! Noch war er Herr seiner Sinne und Gliedmaßen. Aber er wollte darüber nicht diskutieren und ließ ihr den Willen.
»Ja, Moment. Bin gleich da!«, rief er zurück. So recht konnte er sich nicht entschließen, die Tasche zu nehmen und hinunterzugehen. Er hasste das Kranksein. Und Krankenhäuser ganz besonders. Dieser elende Geruch, diese Mischung aus Desinfektionsmitteln, Hilflosigkeit und Schwäche, die in den Zimmern hing. Die blass-grauen Gestalten, die in Bademänteln und Jogging-Anzügen über die Flure schlichen. Damals, als er sich im Harz die Kugel eingefangen hatte, da war alles ganz schnell gegangen. Von seiner Einlieferung ins Krankenhaus hatte er nichts mitbekommen. Dieses Mal war es anders. Ihm war genug Zeit geblieben, über das nachzudenken, was ihm bevorstand. Und das lag ihm wie ein Granitblock im Magen. Da half es auch nicht, mantramäßig zu wiederholen, dass die Operation absolut notwendig war.
Er seufzte, griff endlich die Tasche und verließ das Zimmer. Mit einem sehnsüchtigen Blick zurück auf sein Bett zog er die Tür ins Schloss.
»Eigentlich wäre das mit der Reha doch wirklich nicht nötig gewesen«, maulte Behrends, nachdem er etwa die Hälfte des Weges, tief in den Beifahrersitz gekauert, schweigend vor sich hingebrütet hatte. »Ein, zwei Wochen Erholung zu Hause hätten es nach der Operation auch getan.«
Katrin warf ihm einen ärgerlichen Blick zu. »Ich verstehe nicht, warum du immer und immer wieder davon anfängst. Ich dachte, das hätten wir längst geklärt.«
Längst geklärt ist gut, dachte Behrends. Katrin hatte die Sache mehr oder weniger vorangetrieben, auch wenn es letztlich sein Hausarzt gewesen war, der ihm die Notwendigkeit einer Rehabilitationsmaßnahme erläutert hatte. Dabei war verdächtig oft das Wort Diät gefallen, ein Begriff, der ihm gar nicht zugesagt hatte.
»Außerdem hat Marina dir doch erklärt, dass die Kirchberg-Klinik eher ein Vier-Sterne-Hotel ist als ein Krankenhaus«, fuhrKatrin fort. »Und Bad Lauterberg liegt gleich um die Ecke. An der Nordsee oder in Bayern könnte ich dich nicht so oft besuchen.«
Marina Hegenscheidt, die Chefin des Schwarzen Bären, hatte vor der Übernahme des Gasthauses als Leiterin des Küchen-Teams in der Kirchberg-Klinik gearbeitet und wusste nur das Beste darüber zu berichten. Was hätte er dem entgegensetzen sollen?
»Na ja, ja ...« Behrends rutschte noch etwas tiefer in seinen Sitz. Vier-Sterne-Hotel traf schon irgendwie zu. Davon hatte er sich zusammen mit Katrin vor einer Woche bei einer Stippvisite in der Klinik überzeugen können. Trotzdem wollte keine Begeisterung bei ihm aufkommen. Dem stand eindeutig das Reha-Programm entgegen, das ihn erwartete.
»Wer übernimmt jetzt eigentlich deine Vertretung in der Inspektion?«, lenkte ihn Katrin von seinen dumpfen Gedanken ab.
Noch so ein wunder Punkt, an den sie mit ihrer Frage rührte. Seine Leute, führungslos! Über Wochen! Nicht dass er sich für unersetzlich hielt. Aber er war immerhin der Chef des K1, des Kommissariats für die dicken Brocken, die Kapitaldelikte. Das war keine Frittenbude, in der er arbeitete. Verbrechensaufklärung erforderte andere Fähigkeiten, als Bratwürste auf dem Grill hin und her zu schieben. Durchsetzungsfähigkeit, Organisationstalent, Geduld, darauf kam es an. Und auf Erfahrung! Erfahrung war überhaupt das Wichtigste. Wer aus seinem Team brachte die schon mit? Maike noch am ehesten. Und Tim. Für die zwei sprach auch, dass sie sich schon oft im Außendienst bewährt hatten. Nicht solche Büromenschen waren wie Richard. Er hatte sie dem Chef, Kriminaldirektor Liebig, als seine Vertretung vorgeschlagen. Liebig hatte sich nach einigem Hin und Her für Tim Seidel entschieden. Das war vorgestern gewesen, seinem letzten Tag in der Inspektion.
»Tim vertritt mich«, antwortete Behrends knapp.
»Nicht Maike?«, wunderte sich Katrin. Es klang ein wenig wie Protest. »Sagtest du nicht, Maike würde das machen?« Katrin kannte Maike de Baer. Besser als die anderen aus seinem Team. Die beiden Frauen waren sich sympathisch, das wusste er.
»Der Chef hat sich für Tim entschieden«, gab er knapp zurück. »Konnte ich nichts machen.«
Vielleicht würde es ja gut gehen mit seinem jungen Kollegen. Es war lange Zeit ruhig gewesen in ihrem Revier. Keine komplizierten Fälle, alles eindeutige Geschichten. Vielleicht würde es so bleiben, bis er wieder an Bord war. Er konnte es nur hoffen – für Tim.
Die markanten Gebäude der Göttinger Uniklinik tauchten links vor ihnen auf, nachdem sie in die Robert-Koch-Straße eingebogen waren. Sie hatten ihr Ziel erreicht.
Behrends seufzte leise in sich hinein. Warum ausgerechnet ich, dachte er.
3.
Das verträumte Fachwerkschlösschen mit seinen Erkern und dem Turm als auffälligem Blickfang lag in dem südharzer Städtchen Bad Sachsa beschaulich auf einer kleinen Anhöhe, inmitten dicht an dicht stehender alter Laubbäume. Die Ziegel des steilen, verwinkelten Daches glänzten in der Mittagssonne. Jana fuhr langsam unter den ausladenden Ästen der alten Eichen und Kastanien die Auffahrt hinauf. Hinter der silbergrauen Limousine, die vor einem Nebengebäude parkte, stellte sie ihr Motorrad ab.
Sie ging nicht sofort zur Haustür hinüber, sondern betrachtete einen Moment nachdenklich das Gebäude mit seinen verspielten Holzverzierungen und den bunten, bleiverglasten Fenstern. Der prächtige Jugendstil-Bau faszinierte sie. Gleichzeitig fragte sie sich aber, wozu der Mann eine Villa bewohnte, in der gut und gerne drei Familien untergekommen wären. Oder vier, rechnete man das Nebengebäude dazu. Soweit sie wusste, lebte der Russe allein. Er schien über ausreichend Geld zu verfügen, um sich solch ein Anwesen leisten zu können und dazu die Leute, die Haus undPark in Schuss hielten. Aus den Gewinnen, die sein unscheinbares Lokal abwarf, das ebenfalls in dieser verschlafenen Kleinstadt stand? Schwer vorstellbar, hier mit russischer Hausmannskost ordentlich Kasse zu machen. Zumal das Gagarin, so der Name des Ladens, immer erst um siebzehn Uhr öffnete. An sechs Tagen in der Woche. Mittwochs war Ruhetag. Heute also. Vor einer halben Stunde hatte sie vor der verschlossenen Restauranttür gestanden.
Gestern Abend war Jana im Harz angekommen. Recht spät und ohne sich vorher um eine Unterkunft gekümmert zu haben. Irgendwo in Bad Sachsa würde sie schon etwas finden, hatte sie gehofft. Wenigstens für die erste Nacht. Danach hatte sie weitersehen wollen. Noch bevor sie die Kurstadt erreicht hatte, war ihr am Straßenrand das Schild einer Frühstückspension aufgefallen, das nach Steina wies, einem kleinen Ort, nur wenige Kilometer von Bad Sachsa entfernt. Pension Waldesruh hieß das Haus. In fetten roten Blockbuchstaben hatte »Biker willkommen!« unter dem Pensionsnamen gestanden und für Jana den Ausschlag gegeben, dort nach einem freien Zimmer zu fragen. Mit Erfolg.
Vier Wochen waren mittlerweile vergangen, seit sie Ulrich Vetter, dem Journalisten, das erste Mal begegnet war. Vier Wochen, in denen sie so orientierungslos gewesen war, wie selten zuvor in ihrem Leben. Vetter hatte ein kleines Stück der verklärenden Patina vom Bild ihres Vaters gekratzt. Was da zum Vorschein zu kommen schien, hatte sie erschüttert, und sie war sich lange nicht sicher gewesen, ob sie sein Angebot annehmen sollte, ihr das vollständige Bild darunter zu zeigen.
Warum die Begegnung mit ihm nicht einfach vergessen und alles lassen, wie es war, hatte sie sich gefragt. Es machte ihren Vater nicht wieder lebendig, wenn sie an die Vergangenheit rührte.
Nach und nach war ihr klargeworden, dass es nicht funktionieren würde. Also hatte sie Vetter besucht. Seitdem wusste sie, dass der Journalist sie nicht belogen hatte und ihr Vater zusammen mit drei anderen Männern tatsächlich während eines heimlichen Waffengeschäftes Opfer eines kaltblütigen Mordes geworden war. Und mehr noch: Es gab einen weiteren Beteiligten, der das Massaker überlebt hatte und, so Vetters Vermutung, vielleicht sogar handfeste Beweise für das Verbrechen besaß. Wenn der Mann redete, könnte er helfen, die Täter aufzuspüren und als Zeuge dazu beitragen, dass sie für eine Tat angeklagt und hoffentlich auch verurteilt würden, deren Aufklärung seinerzeit offensichtlich vertuscht worden war. Aus Gründen, über die auch Vetter nur spekulieren konnte. Der Zeuge war Leo Adam, vor dessen Haus sie gerade stand.
Jana stieg die Betonstufen zur Eingangstür hinauf und betätigte die Klingel. Im Hausinneren ertönte ein Dreiklang, der an ein Glockengeläut erinnerte. Noch mit dem letzten Ton wurde die Tür aufgerissen und eine grobschlächtig wirkende Frau trat ihr entgegen. Unter einer Kittelschürze, die sich um ihren Bauch spannte, lugten nackte Beine hervor, die in blassblauen Segeltuchschuhen steckten. Ihr schwarz gefärbtes Haar war streng nach hinten gekämmt und im Nacken zu einem Dutt gebunden. Die Frau hatte ein aufgedunsenes rotes Gesicht. Ein feines Netz lilafarbener Äderchen durchzog ihre Wangen.
»Ja, bitte?«, fragte sie abweisend.
»Ich bin Jana Schuchart und möchte Herrn Adam sprechen«, entgegnete Jana.
»In welcher Angelegenheit?«
»Das möchte ich ihm gern selbst sagen.«
Die Frau schnaubte und blinzelte feindselig. »Warten Sie hier«, sagte sie nach einer kurzen Pause, drehte sich um und verschwand im Hausinneren.
Jana musste sich gut zwei Minuten gedulden, dann kam ein Mann den Flur entlanggeschlurft. »Was wollen Sie?«, fragte er schroff, als er sie erreicht hatte. Ein unangenehmer Alkoholdunst schlug ihr entgegen. »Ich erwarte keinen Besuch.«
Der stämmige Mann hatte ein schwammiges Gesicht, seine Wangen wiesen die gleichen feinen Äderchen und die ungesunde rote Gesichtsfarbe auf wie die der Frau. Er sah heruntergekommen aus. Schüttere aschblonde Haare standen wirr von seinem Kopf ab, ein fadenscheiniger, ausgeleierter beiger Strickpullover schlackerte um seine Hüften und hing ihm bis über den Hintern. Darunter trug er eine verwaschene schwarze Cordhose, seine Füße steckten in Filzpantoffeln von undefinierbarer Farbe.
Sie wiederholte ihren Namen und fragte, nicht sicher, ob sie den Hausherrn vor sich hatte: »Sind Sie Herr Adam?« Sein Aussehen entsprach ganz und gar nicht dem, was sie sich unter einem Restaurant- und Villenbesitzer vorstellte.
Anstatt zu antworten, musterte er sie abschätzig von oben bis unten. Dann blickte er an ihr vorbei nach draußen. Dorthin, wo ihre Maschine stand. »Na ja, von den Zeugen Jehovas scheinen Sie jedenfalls nicht zu sein«, stellte er brummend fest. »Oder ist die Motorradkluft jetzt ihre neue Masche?« Der Mann schien Humor zu haben. Immerhin. »Ja, ich bin Leo Adam«, fügte er etwas versöhnlicher hinzu. »Also, was führt Sie zu mir?«
Jana entschied sich, nicht lange um den heißen Brei herumzureden: »Ich möchte mit Ihnen über etwas sprechen, was sich im August 1990 ereignet hat. In der Döberitzer Heide. Und Sie haben daran teilgenommen. Sie haben ...«
Weiter kam sie nicht. »Hat dieser verfluchte Schmierfink Sie geschickt?«, brüllte der Russe ohne Vorwarnung los. »Glaubt er, ich lasse mich breitschlagen, wenn er seine junge Assistentin vorbeischickt? Sagen Sie ihm, die Masche zieht nicht! Nicht bei mir! Ich habe ihm nichts zu sagen! Und jetzt hauen Sie ab!«
Ehe Jana reagieren konnte, hatte er ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen. Völlig überrumpelt stand sie da und hörte das leise Schlappen seiner Pantoffeln, das sich langsam entfernte. Natürlich! Adam kannte den Journalisten. Vetter hatte ihr von seiner Kontaktaufnahme mit dem Russen erzählt, die ebenfalls in einen Rauswurf gemündet war. Kein Wunder, dass der jetzt die falschen Schlüsse zog. Sie holte tief Luft. So einfach würde sie sich trotzdem nicht abservieren lassen! Wütend hämmerte sie mit der Faust gegen das hölzerne Türblatt. »He! Machen Sie auf, verdammt!«, rief sie. »Es geht um meinen Vater! Er war einer der Toten!«
Plötzlich Stille im Flur. Sekundenlang. Dann kam das Schlappen wieder näher. Adam öffnete die Tür einen Spalt, steckte seinen Kopf heraus. »Ihr Vater?«, fragte er vorsichtig.
»Ja, mein Vater. Major Jegor Antonowitsch Andrejew.«
Er verzog keine Miene, aber Jana glaubte, ein Aufflackern in seinen Augen gesehen zu haben, als sie den Namen genannt hatte.
»Sie sagten, Sie heißen Jana Schuchart«, erinnerte er sie.
»Richtig.« Sie nickte. »Und wenn Sie mich reinlassen, erkläre ich es Ihnen, Herr Adam.«
Der Russe zögerte, musterte sie mit einem Blick, den sie nicht zu deuten wusste. Schließlich trat er zurück und gab die Tür frei.
»Wie kommen Sie darauf, dass ich etwas mit dieser ... dieser Sache zu tun habe?«, fragte er, als er vor Jana her einen düsteren Flur entlangschlurfte.
Jana lachte kurz auf. »Ich weiß ein wenig von dem, was damals passiert ist«, erwiderte sie. »Und aus Ihrer Reaktion schließe ich, dass etwas Wahres daran ist.«
»Der Journalist«, folgerte er missmutig. »Sie kennen ihn, schätze ich. Woher?«
»Wir sind uns zufällig begegnet und ins Gespräch gekommen.« Sie hoffte, Adam würde sich mit der Erklärung zufriedengeben. Ihre kleine Gedenkstätte im Wald ging ihn nichts an.
Der Russe beließ es dabei und führte sie in einen Raum von riesigen Ausmaßen – zumindest für ein Wohnzimmer. Doch trotz seiner Größe und der vier hohen Fenster wirkte es dunkel und erdrückend auf Jana. Die Einrichtung schien alles Licht zu schlucken. Sie war in Brauntönen gehalten, bestand überwiegend aus rustikalen Eichenmöbeln, die ähnlich alt zu sein schienen wie die Villa selbst. Der Dielenfußboden wurde von durchgetretenen, rostroten Teppichen bedeckt, die Decke war holzvertäfelt, ebenso ein Teil der Wände. Den Rest zierten Strukturtapeten mit breiten Bordüren. Zentrum des Zimmers bildete eine Polstergarnitur mit einem gut zwei Meter langen Tisch, in dessen Platte hässliche grüne Fliesen eingelassen waren. Darum herum standen eine schwere Couch und drei dazu passende Sessel, deren schwarzbrauner Lederbezug an manchen Stellen abgewetzt war.
Auf einen der Sessel steuerte Adam zu und ließ sich hineinfallen. Er versank tief in den Polstern. Mit einer jovialen Handbewegung forderte er Jana auf, ebenfalls Platz zu nehmen. Dann widmete er sich der zur Hälfte gefüllten Wodkaflasche und dem Wasserglas neben ihm auf dem Tisch.
»Möchten Sie auch was trinken?«, fragte der Russe und schwenkte die Flasche leicht in Janas Richtung.
Sie lehnte kopfschüttelnd ab. Daraufhin goss er sich das Glas drei viertel voll und nahm einen kräftigen Schluck.
»Medizin«, brummte er, »gegen meine Rückenschmerzen.«
»Verstehe.« Jana nickte. Für wie dumm hielt der Mann sie?
»Also, Frau Schuchart«, sagte er gönnerhaft, »wie kann ich Ihnen denn nun helfen?«
»Sie waren damals auf diesem Truppenübungsplatz dabei, als mein Vater getötet wurde«, konfrontierte Jana ihn sofort mit ihrem Wissen. »Sie sind entkommen. Ich verstehe nicht, warum Sie all die Jahre geschwiegen haben. Sie haben die Täter doch gesehen! Wissen Sie, dass ich mit einer Lüge aufgewachsen bin? Weil das Verbrechen ganz offensichtlich vertuscht wurde! Ist Ihnen klar, wie schlimm es ist, nach mehr als fünfundzwanzig Jahren zu erfahren, dass der Vater, von dem man glaubte, er sei bei einem Unfall ums Leben gekommen, ermordet wurde? Und dann womöglich einfach irgendwo verscharrt? Ohne Beerdigung? Würdelos, wie ein räudiger Hund?«
Adam zeigte keine Regung. Janas Vorwürfe schienen ihn kaltzulassen.
»Ich will, dass die Dinge aufgeklärt werden«, schloss Jana. »Besser spät, als gar nicht. Ich bin nicht hier, um Sie anzuklagen, sondern um Sie um Ihre Hilfe zu bitten.«
Der Russe nahm einen weiteren tiefen Schluck. Er machte keine Anstalten, ihr zu widersprechen oder sich zu rechtfertigen. Stattdessen fragte er: »Wie soll ich wissen, ob ich Ihnen vertrauen kann? Vielleicht arbeiten Sie ja doch für diesen Reporter und graben nur in der Vergangenheit, um eine aufregende Geschichte zu bekommen, die Sie teuer verkaufen können. Sie sollten mir etwas über sich erzählen. Dann sehen wir weiter, Jana Schuchart. Schuchart ... Das ist nicht der Name Ihres Vaters.«
Jana hatte gehofft, schneller ans Ziel zu gelangen. Aber wie es aussah, musste sie wohl diesen Umweg gehen. »Nein, ist er nicht. Schuchart ist der Mädchenname meiner Mutter. Nach dem Tod meines Vaters hat sie ihn wieder angenommen.« Der Russe nickte zustimmend. Fast schien es, als habe er die Antwort erwartet. »Seitdem ist das auch mein Name. Ich war zu klein, um selbst bestimmen zu können, wie ich heißen will.«
»Wenn Sie alt genug gewesen wären, für welchen Namen hätten Sie sich entschieden?«, hakte Adam nach.
»Hm, vermutlich für den Namen meines Vaters«, antwortete sie zögernd.
»Und wie haben Sie es geschafft, in Deutschland zu bleiben, Sie und Ihre Mutter?«
Jana lächelte. »Es gab Wege und Möglichkeiten. Das sollten Sie eigentlich wissen, Herr Adam. Sie sind Russe und leben auch hier. Unter einem Namen, der nicht gerade russisch klingt.«
»Gut gekontert, Tatjana Jegorowna.« Er grinste anerkennend. »Tatjana stimmt doch, oder? Jana ist nur die kurze Form.«
Sie nickte, etwas irritiert über die Anrede. Dann sah sie, wie er sein Glas leerte und es sofort wieder vollschenkte.
»Wenn Sie etwas anderes trinken möchten, können Sie sich ruhig etwas drüben aus der Küche holen. Wasser oder Cola. Irgendwas von dem Zeug muss im Kühlschrank stehen.« Er machte eine Kopfbewegung zur Tür. »Meine Haushälterin kann Sie leider nicht mehr bedienen. Sie ist schon gegangen.«
Die Frau, die ihr vorhin geöffnet hatte, vermutete Jana. Sie sah, dass er keinerlei Anstalten machte, sich aus seinem Sessel zu erheben, um sie persönlich zu bewirten. Ein unhöfliches Benehmen, das sie bewegte, der Aufforderung nicht nachzukommen. »Nein, danke, ich habe keinen Durst.«
Adam gab einen leisen Grunzlaut von sich und trank. »Was treiben Sie so, Tatjana Jegorowna?«, fragte er dann. »Verheiratet scheinen Sie nicht zu sein. Oder doch? Haben Sie Kinder? Wie alt sind Sie? Womit verdienen Sie Ihren Unterhalt?«
Jana fiel auf, dass seine Stimme schleppender wurde. Oder bildetet sie es sich nur ein? »Ganz schön viele Fragen«, entgegnete sie.
»Und auf alle sollten Sie mir eine Antwort geben.«
Sie verstand. Sie wollte etwas von dem Russen, also musste sie ihm etwas dafür geben. Er war nicht bereit, seine Informationen zu verschenken.
»Ich werde dieses Jahr einunddreißig«, begann sie zögernd, »Ende Juli. Sternzeichen Löwe, falls Sie das interessiert. Es heißt, Löwen-Menschen seien loyal, stolz und optimistisch, aber auch egozentrisch, autoritär und eitel.« Sie lächelte. »Ich weiß nicht, vielleicht bin ich all das ja, obwohl ich mich ganz anders sehe. Optimistisch, das stimmt allerdings.«
»Sonst wärst du wohl kaum hier, Tatjana Jegorowna«, bestätigte Adam müde und genehmigte sich einen weiteren großen Schluck Wodka. Wie selbstverständlich war er vom Sie zum Du gewechselt. Er wedelte leicht mit der freien Hand, wie ein Herrscher auf seinem Thron. »Weiter. Erzähl weiter.«
»Ich bin mit achtzehn von zu Hause weg. Direkt nach dem Abitur. Habe Architektur studiert. Mit einem miserablen Abschluss. Na ja, vermutlich habe ich deshalb keine feste Anstellung, sondern schlage mich mit verschiedenen Jobs durchs Leben. Ich wohne allein in einer kleinen Wohnung in Uelzen. Die Witwe in der Wohnung unter mir kümmert sich um meine Goldfische, wenn ich nicht zu Hause bin. Zurzeit arbeite ich in einem Fitnessstudio. Gelegentlich gebe ich Kurse in Selbstverteidigung.«
»Kein Leben, das dir gefällt«, stellte der Russe mit schwerer Zunge fest.
Seine Worte berührten sie unangenehm. War sie so leicht zu durchschauen? »Wenn ich in den Bergen bin, gefällt es mir schon«, entgegnet sie trotzig. »Klettern. Freeclimbing. In Norwegen. Das ist mein Ding. So oft es geht, fahre ich dorthin. Irgendwann vielleicht für immer.«
»Du solltest heiraten.« Adam füllte sein Glas auf. Der Flascheninhalt neigte sich in atemberaubender Geschwindigkeit dem Ende zu.
Jana schüttelte vehement den Kopf. »Niemals! Ich habe mich gerade von meinem Freund getrennt. Es war eine Katastrophe.«
»Aber Familie ist wichtig. Gibt dir Schutz und Sicherheit.«
Jana antwortete nicht sofort. Ein feiner Schmerz durchzog ihren Brustkorb, und eine Wand baute sich in ihr auf. Ein Schutzwall. Wie immer, wenn sie auf dieses Thema angesprochen wurde. »Ich brauche das nicht«, erwiderte sie schroff. »Ich habe das nie wirklich erlebt. Familie, ein Zuhause. Vielleicht, als ich klein war und Vater noch lebte. Ich erinnere mich nur dunkel an die Zeit, als wir noch eine richtige Familie waren. Nein, mir fehlt nichts ...« Sie zögerte einen Atemzug lang. »Doch, mein Vater«, gab sie dann zu, »der hat mir immer gefehlt. Bis heute ist das so. Nach seinem Tod hatte meine Mutter mehrere Beziehungen, die alle nicht gehalten haben. Schutz und Sicherheit? Das können Sie vergessen.«
Sie schnaubte verächtlich. »Über meinen Vater hat Mutter nur selten gesprochen«, fuhr sie fort. »Das meiste, was ich von ihm weiß, beruht auf den Geschichten, die mir seine ehemaligen Kameraden erzählt haben, solange wir noch in der Garnison in Wünsdorf gewohnt haben und bevor sie Deutschland in Richtung Russland wieder verlassen mussten. Wenn die Männer von Jegor Antonowitsch sprachen, dann nur von einem guten und verlässlichen Freund, einem, den sich jedes Mädchen als Vater wünscht. In ihren Geschichten war er ein Held, ein Mann, der immer für seine Familie und seine Tochter da war. Das ist es, was ich von ihm weiß. Und es gefällt mir. Aber dann muss ich hören, dass er bei einem Waffengeschäft ermordet und dieser Mord nie gesühnt worden ist. Ich kann das nicht einfach so hinnehmen!« Zorn kochte in ihr hoch.
»Du siehst ... siehst ihr so ähnlich«, murmelte Adam plötzlich.
»Was haben Sie gesagt?«, fragte Jana, nicht sicher, ob sie ihn richtig verstanden hatte. »Wem sehe ich ähnlich?«
Statt ihr zu antworten, sah er sie nur an. Sie stellte fest, dass seine Augen feucht schimmerten. Gleich darauf löste sich eine Träne und lief ihm über die Wange. Er wischte sie ab und wandte seinen Blick von Jana. Einem tiefen Seufzer ließ er gleich danach einen kaum unterdrückten Rülpser folgen. Es wurde Zeit, dass er ihr endlich etwas über das Geschehen auf dem Truppenübungsplatz verriet, ehe er ganz wegklappte.
»Herr Adam, was ist damals auf dem Truppenübungsplatz geschehen? Bitte sagen Sie es mir! Sie waren doch dabei. Wer hat meinen Vater getötet? War es der mit dem Spitznamen Wassermann?«
Der Russe reagierte nicht. Er starrte vor sich hin und schien dabei immer tiefer in seinem Sessel zu versinken. Jana stand auf, machte einen Schritt zu ihm hin, rüttelte ihn an der Schulter. »Bitte!«, stieß sie energisch aus.
Unendlich langsam und, wie es schien, unter Aufbietung all seiner Kräfte hob er seinen Kopf. »Ja, ich war dabei. Ich habe alles mit angesehen«, sagte er tonlos ins Leere. »Ich ... Es war so schrecklich!« Er zwang sich, Jana anzusehen. »Dein Vater könnte noch leben, wenn ich ... Ich fühle mich so schuldig.«