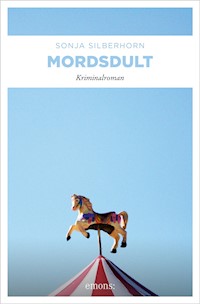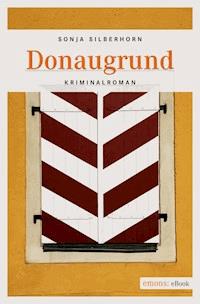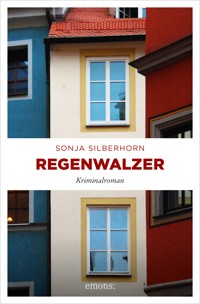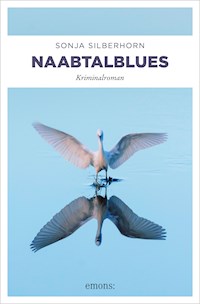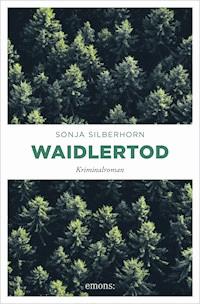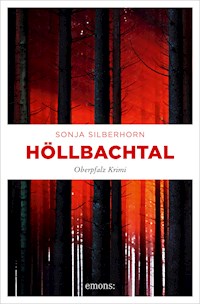
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lene Wagenbach
- Sprache: Deutsch
Ein rätselhafter Mord erschüttert die Idylle der Oberpfalz. Im Höllbachtal, am Rande des Bayerischen Waldes, wird auf einem Einödhof die Leiche einer Frau gefunden. Kommissarin Lene Wagenbach von der Kripo Regensburg schließt zunächst auf Raubmord, doch dann stellt sich heraus, dass die Tote einem brisanten Familiengeheimnis auf der Spur war. Wer könnte ein Interesse daran gehabt haben, es zu vertuschen? Die Ermittlungen führen Lene zu grausamen Verbrechen aus der Vergangenheit, die bis heute ihre Schatten werfen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sonja Silberhorn, Jahrgang 1979, ist in Regensburg geboren und aufgewachsen. Sie arbeitete mehrere Jahre in der Hotellerie, unter anderem auf den Kanaren und in Berlin, doch dann überwog die Liebe zu ihrer Heimatstadt. Heute lebt sie dort mit ihrer Familie und schickt seit 2011 ihre Kriminalkommissare erbarmungslos durchs lokale Verbrecherdickicht.www.sonja-silberhorn.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
©2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Konrad Kleiner/imageBROKER
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Hilla Czinczoll
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-692-0
Oberpfalz Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Aber vergessen bist du nicht.
Max Windhager
* 08.07.1888 Vilshofen an der Donau
† 17.08.
Ach Liebe, wie ich dich vermisse,
das Glück, den Mut, die Zuversicht.
Die Arme, fest um mich geschlungen,
ersehn’ ich, doch ich fühl’ sie nicht.
Ach Kindchen, wie ich dich vermisse,
die Unschuld und dein Gottvertrauen.
Wirst du wohl eines fernen Tages
die liebend’ Mutteraugen schauen?
Ach Heimat, wie ich dich vermisse,
grüne Hügel, lauer Wind,
ob ich im wilden Bachesrauschen
irgendwann mein’ Frieden find?
Ach Freiheit, wie ich dich vermisse,
ungebändigt Fühl’n und Tun,
in diesen uns’ren bösen Tagen,
wo Worte und Gedanken ruh’n.
Ach Leben, wie ich dich vermisse,
seit Wahn und Hass im Gleichschritt zieh’n
gegen Gute, Fremde, Kleine,
weh und zermalmt sind, die nicht flieh’n.
Ach Feinde, wie ich euch verachte,
sogar in meiner bitt’ren Not.
Doch ich ahne, ihr bleibt Sieger,
EINS
»Im Herbst war’s hier aber schöner«, murmelte Kriminalhauptkommissarin Lene Wagenbach mit einem bedauernden Blick dort hinüber, wo das Höllbachtal lag. Sie lenkte den Wagen an dem kleinen, an diesem Tag im März verwaisten Parkplatz im Rettenbacher Ortsteil Postfelden vorbei, den sie vor rund fünf Monaten mit Henning im Schlepptau angesteuert hatte. In der goldenen Oktobersonne waren sie durch das in schillernden Farben leuchtende Naturschutzgebiet Hölle gewandert und geklettert, das doch mit seinen moosigen Felsriesen, durch die sich der wilde Bachlauf schlängelte, und den lichten Lindenbäumen vielmehr einem verwunschenen Paradies glich. Die anschließende Einkehr im Biergarten des »Jagawirt zu Aumbach« hatte den schönen Tag schließlich zu einem perfekten gemacht.
James Hetfield gab wie erwartet keine Antwort, zu beschäftigt war er damit, bei »Seek& Destroy« seinen Aggressionsstau in gewohnt testosteronstrotzender Manier zu entladen. Lene trommelte den Rhythmus auf dem Lenkrad mit und wunderte sich selbst ein wenig darüber, dass sie sich mit Metallica immer wieder motivieren konnte. Wenn die Musik in ihren Ohren dröhnte, egal ob wütend oder melancholisch, fühlte sie sich mit einem Schlag quicklebendig. Was vor allem deshalb erstaunlich war, weil es nicht das Leben war, das sie heute in den westlichsten Ausläufer des Landkreises Cham beorderte, sondern– wieder einmal– der Tod.
Hinter Postfelden hielt Lene sich links, wo sich nach einem Feld der Ortsteil Steinersried anschloss. Zwischen diesen Häusern und Höfen, über die der Turm der kleinen, gelb getünchten Kirche wachte, waren sie damals zum Auto zurückspaziert. Irgendwo in der Nähe musste der Einödhof liegen, den man ihr am Telefon genannt hatte.
Das Navi hatte sich beharrlich geweigert, »Steinerhof« als Zielort zu akzeptieren, dennoch entdeckte Lene schon kurze Zeit später die schlecht geteerte einspurige Zufahrtsstraße, die dorthin führte. Sie parkte direkt hinter den Streifenwagen und dem Kleinbus des Erkennungsdienstes, band sich die braunen Locken zum unordentlichen Dutt, steckte das Smartphone in die Umhängetasche und stieg nach einem letzten anfeuernden Brüllen des guten alten James aus.
Der Kollege von der Streife, der am Gartenzaun stand und den Zugang bewachte, winkte ab, als sie die Dienstmarke zücken wollte. »Hallo, Frau Wagenbach«, sagte er. Anscheinend war sie mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund, wahrscheinlich als die Irre, die jedes Mal in der rollenden Metal-Disco angereist kam. Sie nickte dem Kollegen, den sie unter Garantie noch nie im Leben gesehen hatte, freundlich zu und betrat das Grundstück, nachdem er bereitwillig die Tür im Zaun geöffnet hatte, die unheilvoll knarzte.
Der vor ihr liegende Hof, der inmitten der düsteren Trübheit des nur sehr langsam ausklingenden Winters selbst ganz grau wirkte, war bereits erfüllt von geschäftigem Treiben, aber Lene hatte kaum einen Blick für die vielzähligen Kollegen, als sie auf das offensichtlich recht alte, aber gepflegte Haus zustrebte. Nur die angebaute Scheune hatte schon bessere Tage gesehen, einige Holzlatten hingen schief oder fehlten ganz. Kein Wunder, landwirtschaftlich wurde das Anwesen wohl schon länger nicht mehr genutzt, zumindest war weit und breit weder Tier noch Landmaschine zu entdecken.
Als sie die massive hölzerne Eingangstür des Wohnhauses erreichte, fummelte sie Überzieher über ihre Bikerboots und schlüpfte in die Einmalhandschuhe. Die Kollegen vor Ort hatten die Möglichkeit eines Raubmordes erwähnt. Überall konnten Spuren vorhanden sein, die zum Täter führten.
Lenes erster Blick galt dem unbeschädigten Türschloss, auf dessen Innenseite der Schlüssel steckte, von dem wiederum ein Bund mit einem violetten Miniaturtraumfänger sowie einem türkischen Auge baumelte. Auch die Garderobe sowie der angrenzende Flur ließen vermuten, dass die Bewohnerin eine Vorliebe für fremde Kulturen gehegt hatte: Hölzerne, afrikanisch anmutende Masken zierten die hellgelben Wände, bunt geflochtene Übertöpfe die zahlreichen Grünpflanzen, und beim Nippes auf dem Sideboard und sogar im offenen Schuhregal, wo sich neben unauffälligeren Modellen auch drei Paar bestickter Stoffschuhe im indischen Stil fanden, setzte sich die bunt gemischte Exotik fort. Alles in allem war das Interieur nicht Lenes Geschmack, sie mochte es lieber puristisch, aber der Flur des alten Bauernhauses wirkte liebevoll, warm und freundlich, obwohl er mit sehr wenig Tageslicht auskommen musste.
Zu ihrer Linken führte eine Holztreppe in den ersten Stock, Lene jedoch folgte den Stimmen im Erdgeschoss in den vordersten der drei vom Flur abzweigenden Räume. Trotz des tristen Wetters fiel dieser Raum weit weniger schummrig aus, dafür sorgten neben zwei wohl nachträglich eingebauten gläsernen Terrassentüren auch die Scheinwerfer, die die Kollegen vom Erkennungsdienst in dem kleinen Wohnzimmer aufgebaut hatten. Im ersten Moment fiel die Orientierung schwer, weil die zahlreichen Beamten kaum freien Blick auf eine unverstellte Fläche zuließen.
»Lene.« Michael Bauer, der Leiter des Erkennungsdienstes, wie sein Team von Kopf bis Fuß in weißer Schutzkleidung, löste sich aus der Gruppe und kam auf sie zu. »Eng hier«, stellte er treffend fest. »Ich schick meine Leute gleich raus.« Sie arbeiteten lange genug zusammen, um solche Dinge nicht erst diskutieren zu müssen. »Wir nehmen uns sowieso das ganze Haus vor. Bist du schon im Bilde?«
»Weibliche Leiche, von einer Kollegin aufgefunden, offensichtlich Gewalteinwirkung, Haus durchwühlt und verwüstet, mutmaßlich Raubmord«, fasste Lene ihren bisherigen Wissensstand zusammen.
»Die Frau heißt Amanda Heinz«, begann Michael den erwarteten Lagebericht. »Einundfünfzig Jahre alt, geschieden, hat allein hier gelebt. Eigentlich war sie Lehrerin, allerdings in Frühpension. Ehrenamtlich war sie engagiert in der Flüchtlingshilfe, genau deshalb wurde sie auch gefunden: Die Kollegin von dort war verwundert, weil sie gestern nicht zu ihrem Integrationskurs erschienen ist. Nachdem sie das Opfer heute Vormittag nicht am Handy erreicht hat, ist sie hierhergefahren.« Er wies mit dem Kopf in die Richtung, in der Lene die für sie immer noch unsichtbare Leiche vermutete. »Die Haustür war unverschlossen.«
»Die Frau hat die Tote bewegt?«
Michael nickte. »In der Panik, natürlich. Sie ist fix und fertig. Sitzt mit der einfühlsamsten Kollegin, die wir gefunden haben, nebenan in der Küche.«
»Und sonst?«
»Ich maße mir wie üblich kein Urteil an, aber die Gewalteinwirkung ist offensichtlich, der Gürtel nach wie vor um ihren Hals geschnürt. An der Ecke des Schreibtischs und am Boden sind Blutspuren, es gab wohl einen Sturz. Den Rest überlasse ich Bertl, der ist schon unterwegs.«
Lene hoffte, dass der Rechtsmediziner Dr.Heribert Melchior vom Institut in Erlangen bald eintraf, aber doch spät genug, um ihr selbst noch eine ungestörte erste Bestandsaufnahme am Tatort zu ermöglichen.
»Ansonsten würde ich das Haus im Übrigen nicht unbedingt als verwüstet bezeichnen. Man erkennt, dass es durchsucht wurde, ein paar Schubladen stehen offen, aber allzu großes Chaos hat der Täter nicht angerichtet.«
Lene bedankte sich, und Michael pfiff seine Getreuen wie versprochen in die anderen Räume des Hauses. Erst als auch der letzte Kollege das Wohnzimmer verlassen hatte, wandte Lene sich zu der Leiche um.
Michael hatte nicht übertrieben: Dass das Opfer nicht friedlich gestorben war, stattdessen einen schrecklichen Todeskampf gekämpft hatte, war unübersehbar.
Die Frau war schlimm zugerichtet, der Gürtel mit Ethno-Muster, der ihren Hals abschnürte, hatte zu einem ausgeprägten Stauungssyndrom geführt: Das Gesicht war aufgequollen und stark gerötet, das aus der Nase gesickerte Blut längst geronnen. Die geschlossenen Augenlider, vor allem das linke, waren blau umschattet, Bertl würde später bestimmt von Einblutungen sprechen. Lene musste sich zwingen, den Blick vom verunstalteten Gesicht der Toten loszureißen.
Der wohlproportionierte Körper der Frau steckte in engen blauen Jeans, dazu trug sie eine farbenfrohe Tunika mit weiten Ärmeln. Sie war barfuß, die Fußnägel schimmerten im gleichen Dunkelrot wie die kleine Blutlache, die sich in der Nähe des Hinterkopfs der Toten auf den Holzdielen gesammelt hatte, verwischt und verschmiert von ihrem üppigen, langen Haar, dessen tiefes Schwarz nur von wenigen Silberfäden durchbrochen wurde. Abgesehen von der starken Rötung des Gesichts wies der Teint der Frau der Jahreszeit zum Trotz eine leichte Bräunung auf. Zu Lebzeiten war sie sicher sehr attraktiv gewesen.
Ein Sexualdelikt schien, der intakten Bekleidung nach zu schließen, nicht vorzuliegen. Ein Beziehungsdrama? Oder doch ein Raub, bei dem das Opfer, das vielleicht unerwarteterweise zu Hause gewesen war, sich massiv zur Wehr gesetzt hatte? Das konnte erst festgestellt werden, wenn eventuell fehlende Gegenstände identifiziert waren.
Lene ließ ihren Blick durch das Wohnzimmer schweifen, blieb am Schreibtisch hängen, wo sich lediglich ein Notizblock und ein durchwühltes Ablagefach zu einem gefüllten Stifthalter und einer Kleenex-Box gesellten. Normalerweise hätte man an dieser Stelle ein Notebook erwartet, hier herrschte in der Mitte des Tisches gähnende Leere.
Eventuell war der Laptop andernorts zu finden, vielleicht im Schlafzimmer der Toten? Oder Amanda Heinz war dem Digitalen nicht besonders zugetan gewesen. Die Frau und ihre Wohnung wirkten durchaus etwas esoterisch angehaucht, vielleicht hatte sie darauf beharrt, in dieser eigentlich so fortschrittlichen Welt lieber Rauchzeichen zu geben. Allerdings sahen zumindest die Regale so aus, als hätte jemand den Bestand dort dezimiert. Anders als in der ansonsten recht vollgestopften Wohnung zeigten sich dort viele Lücken.
Lene schüttelte den Kopf. Alles reine Spekulation, solange sie nicht mit den Menschen sprach, die die Tote, ihr Haus und ihr Leben gekannt hatten. Das weibliche Schluchzen aus der nebenan gelegenen Küche war verklungen, hoffentlich war die Kollegin des Opfers in der Lage, erste Auskünfte zu erteilen. Um die Fakten rund um die Leiche und den Tatort kümmerten sich die Kollegen vom Erkennungsdienst und der Rechtsmedizin fürs Erste auch ohne ihr Zutun.
Hinter ihr erklang ein Räuspern, und Lene drehte sich um. Beim Anblick des bärtigen blonden Hünen in Lederkluft und mit den vom Motorradhelm verstrubbelten Haaren entspannte sie sich augenblicklich, so seltsam ihr das an einem Tatort mit einer grausam zugerichteten Leiche auch vorkommen mochte. »Ich hatte schon gehofft, dass mein Lieblingsstaatsanwalt zugeteilt wird«, sagte sie mit einem verhaltenen Lächeln.
»Könnte sein, dass dein Lieblingsstaatsanwalt bei der Zuteilung ein bisschen nachgeholfen hat, um mal wieder mit seiner Lieblingspolizistin zusammenzuarbeiten«, antwortete Henning mit seinem sonoren Bass, trat zu ihr und blickte zwar gefasst, aber doch mit nicht zu leugnender Erschütterung auf die Tote.
»Raubmord?«, fragte er dann zweifelnd. Anscheinend hatten ihn bisher die gleichen Informationen ereilt wie Lene. »Und weshalb trägt sie dann noch diese Ohrringe?«
Die Küche, in der die Kollegin der Toten sichtlich mitgenommen, aber nunmehr gefasst am zerschrammten Massivholztisch saß, bildete das Kontrastprogramm zum multikulturellen Interieur, das Lene bisher zu Gesicht bekommen hatte: Hier schien die Zeit stehen geblieben zu sein– vom bemalten Schrank über den altertümlichen Herd bis hin zum Herrgottswinkel über der Eckbank fühlte sie sich in eine alte bayerische Bauernstube zurückversetzt. Normalerweise sträubte sie sich gegen zu viel zur Schau gestellte Christlichkeit, in dieser authentischen Umgebung aber fand sie das Christuskreuz, das von zwei gerahmten Marienbildern flankiert wurde, sogar charmant.
Auch hier waren Schrank und Schubladen geöffnet, von Chaos konnte jedoch keine Rede sein. Offensichtlich hatte der Täter Geschirr, Besteck und sonstiges Küchenequipment nicht interessant genug gefunden, um es auszuräumen und die Fächer vollständig zu durchwühlen.
Die Beamtin, die der Frau am Tisch Gesellschaft geleistet und den ersten Schock offensichtlich einigermaßen erfolgreich abgefangen hatte, erhob sich und nickte Lene und Henning zu, bevor sie emsigen Schrittes die Küche verließ.
»Lene Wagenbach, Kripo Regensburg«, stellte Lene sich vor und setzte sich der Frau gegenüber. »Und mein Kollege Dr.Adam von der Staatsanwaltschaft. Fühlen Sie sich imstande, uns ein paar Fragen zu beantworten?«
Die Frau am Tisch– Ende fünfzig, Anfang sechzig, schätzte Lene– nickte und fuhr sich, wohl in der vergeblichen Absicht, es zu glätten, durch das wirre graublonde Haar. Dann rückte sie die Brille mit dem leuchtend orangefarbenen Rahmen zurecht, der sich hervorragend mit dem Grün ihres Pullis biss, atmete tief durch und straffte sich. »Ich denke schon. Ich war nur etwas…«
»Schockiert«, vervollständigte Lene den Satz. »Was nur allzu verständlich ist, Frau…?«
»Heilmann. Marion Heilmann.«
»Sie sind eine Kollegin von Frau Heinz?«
»So ähnlich, ja. Ich kümmere mich in Cham um die Koordination der Ehrenamtlichen, die sich in der Betreuung der Flüchtlinge und Asylbewerber engagieren.«
»Und Frau Heinz war eine dieser Ehrenamtlichen?«, fragte Henning und setzte sich neben Lene, nachdem er die Inspektion der Küche beendet hatte.
»Ja. Sie begleitet einige Asylbewerber schon seit Jahren zu Amtsgängen oder Einkäufen, engagiert sich bei der Wohnungssuche und so weiter. Zuletzt hat sie aber auch Deutsch- und Integrationskurse abgehalten, da gibt es zumindest ein kleines Honorar. Sie war ja eine Fachkraft.« Frau Heilmann nahm die Brille ab und rieb sich die Nasenwurzel.
»Zu ihrem letzten Kurs ist sie nicht erschienen?«, fragte Lene.
»Genau.« Ein Schatten des Bedauerns fiel über Marion Heilmanns Gesicht, als wäre ihr der Grund für Amanda Heinz’ Fernbleiben gerade erst wieder eingefallen. »Der wäre gestern Abend gewesen. Ich habe heute Morgen von ihrer Abwesenheit erfahren und deshalb versucht, sie zu erreichen. Aber sie ist nicht ans Telefon gegangen.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen der Erschütterung, sie atmete tief durch. »Dann bin ich hierhergefahren. Irgendwie habe ich schon gedacht, dass etwas passiert sein muss.«
»Normalerweise war Frau Heinz zuverlässig?«, hakte Henning nach.
»Sehr sogar«, bestätigte Marion Heilmann. »Fast schon überengagiert. Das Wohl dieser armen Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, lag ihr am Herzen, mehr als alles andere.«
»Mhm.« Lene versuchte, den seltsamen Unterton zu deuten, der sich in Marion Heilmanns letzten Satz geschlichen hatte. »Wer sonst lag ihr denn am Herzen? Hier lebte sie ja allem Anschein nach allein. Wissen Sie etwas über Familie oder Freunde?«
Marion Heilmann neigte abwägend den Kopf. Anscheinend hatte Lene ins Schwarze getroffen. »Es gibt einen Sohn«, antwortete sie zögerlich. »Tobias. Er lebt in Regensburg, soweit ich weiß. Viel Kontakt bestand da aber wohl nicht. Vom Vater des Jungen ist sie schon lange geschieden, keine Ahnung, wo der lebt. Und ihre Mutter ist vor zwei Jahren gestorben, die hat hier auf dem Steinerhof gewohnt.«
»Zusammen mit dem Opfer?«, fragte Henning.
»Nein, Amanda ist erst nach dem Tod der Mutter von Cham hierhergezogen.«
»Was wissen Sie sonst noch?«, fragte Lene. Einen Sohn ohne nennenswerten Kontakt zum Opfer, einen verschollenen Ex-Mann sowie eine tote Mutter konnte man selbst mit viel Wohlwollen noch nicht als »soziales Umfeld« bezeichnen. »Hatte sie einen Lebenspartner? Freunde?«
Marion Heilmann winkte ab. »Das weiß ich nicht. Wir hatten ein freundliches, aber unverbindliches Verhältnis zueinander. Natürlich hat uns das gemeinsame Engagement verbunden, aber wir waren nicht wirklich eng miteinander, falls Sie das meinen. Ab und an haben wir auch ein paar persönliche Worte gewechselt, aber nur sehr unregelmäßig. In dieser Hinsicht war sie eher zurückhaltend.«
»Und wie war das Verhältnis zu ihren Schützlingen?«, fragte Lene nach.
»Außerordentlich gut, soweit ich das beurteilen kann. Manche der Geflüchteten verehren sie richtiggehend. Für die wird es schwer sein.« Wieder kniff sie sich in die Nasenwurzel, ihre Stirn lag angespannt in Falten.
»Wie war es denn mit den anderen Kollegen? Gab es da jemanden, der ihr nahestand?«
»Auch da gab es meines Wissens wenig Kontakt«, erwiderte Marion Heilmann. »Ich kann mich aber gerne umhören.«
Lene nickte, das konnte zumindest nicht schaden. »Soweit wir wissen, war Frau Heinz als Lehrerin frühpensioniert. Wissen Sie, weshalb?«
»Ja, durchaus, damit hat sie nicht hinter dem Berg gehalten. Burn-out. Ihr Beruf hat sie ausgebrannt, die stetig zunehmenden Verwaltungsarbeiten, aber auch die ausbleibenden Erfolgserlebnisse.«
Einen Augenblick schien Frau Heilmann nachzudenken. »Sie hat sich immer bedingungslos eingesetzt, zumindest habe ich sie so erlebt. Wenn sie als Lehrerin an der Mittelschule auch so war…« Sie zuckte die Achseln. »Nun, mit viel Dankbarkeit seitens der Schüler oder der Eltern ist da wohl eher nicht zu rechnen. Da bekommt man in der Flüchtlingshilfe natürlich etwas mehr zurück.«
Das Problem der fehlenden Dankbarkeit kannte Lene auch, die Burn-out-Gefährdung zum Glück nicht. Dafür hielt sie selbst ihr Tun wohl immer noch für sinnvoll genug.
Hennings Blick war erneut auf die offene Tür des Schranks gefallen. »Waren Sie zuvor schon einmal hier?« Anscheinend trieb ihn die Frage nach fehlenden Gegenständen um.
»Nein, noch nie«, erwiderte Frau Heilmann prompt.
Blieb nach derzeitigem Erkenntnisstand zunächst also nur der Sohn, der ohnehin über den Tod seiner Mutter informiert werden musste. Allzu viele Hoffnungen setzte Lene auf den abtrünnigen Abkömmling allerdings nicht.
»Wenn Bertl den Todeszeitpunkt einigermaßen eingrenzen kann, frage ich als Erstes dort drüben nach«, sagte Lene und wies mit dem Kopf in Richtung Steinersried, wo zumindest von zwei Häusern aus direkter Sichtkontakt zum Steinerhof bestand. »Ist doch der Hund verreckt hier, da steht bestimmt mal ab und an jemand am Fenster und spioniert die alleinstehende Nachbarin aus.«
Wie zur Bestätigung bewegte sich an einem der Fenster die weiße Gardine. Das Polizeiaufgebot auf dem Steinerhof war bestimmt die Attraktion des Tages, wenn nicht gar des Jahrzehnts.
Aufgrund der beengten Verhältnisse im Haus hatten Lene und Henning den Erkennungsdienstlern das Feld überlassen und sich zu einer ersten Lagebesprechung nach draußen verzogen, wo sie an Lenes Audi lehnten und auf das Eintreffen des Rechtsmediziners warteten, der, seinem üblichen Enthusiasmus entsprechend, mutmaßlich bereits mit wehenden Fahnen herbeieilte.
Henning nickte bedächtig und rieb sich mit der freien Hand über den Vollbart.
»Spuken dir immer noch die Ohrringe im Kopf herum?« Lene, die diese Geste als Hennings Denkerpose mittlerweile zur Genüge kannte, konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen.
Manchmal fragte sie sich ohnehin, weshalb er sich auf das spröde Juristen-Dasein überhaupt eingelassen hatte, wo er doch offensichtlich nichts lieber tat, als sich in die aktive Ermittlungsarbeit einzumischen. Andererseits waren sie nicht nur privat gut befreundet, sondern auch beruflich ein ganz gutes Gespann, und nachdem Lene aufgrund des derzeitigen grippebedingten Personalmangels in der Dienststelle ohnehin nicht damit rechnete, mehr als ein paar zuarbeitende Innendienstler an die Seite gestellt zu bekommen, kam ihr Henning als Hilfssheriff gerade recht. »Glaubst du, die sind wertvoll?«
»Vermutlich nicht übermäßig, aber sie sind alt, schön, und Granatschmuck verkauft sich immer noch gut. Ein bisschen was würden die schon bringen.« Er sah auf, als der Wagen des Rechtsmediziners auf die Zufahrtsstraße einbog. »Völlig egal, ob ich einen Raubmord begehe oder ihn bloß vortäusche, ich würde sie auf jeden Fall mitnehmen.«
»Vielleicht hatte der Täter nicht deinen kühlen Kopf«, gab Lene zu bedenken.
»So kühl ist der auch nicht immer, weißt du ja.« Henning setzte den Motorradhelm auf, schwang sich auf die Harley und ignorierte wiederum geflissentlich, dass Lene seinen Kommentar geflissentlich ignorierte. »Du hältst mich auf dem Laufenden?«
Während der Rechtsmediziner neben ihnen den Motor abwürgte, trotz rundlicher Statur hochmotiviert aus dem Auto sprang und den Anwesenden einen schnellen Gruß zuschmetterte, warf Henning seine heiß geliebte Eva an, die mit dem ihr eigenen satten Sound zum Leben erwachte.
Bertl holte eilends seinen Koffer vom Rücksitz und nahm sich nicht die Zeit, ein paar höfliche Eingangsfloskeln an Lene und Henning zu richten. »Husch, husch, schauen wir sie uns an, worauf wartest du noch?«, warf er Lene über die Schulter zu und eilte zum Haus.
»Es ist doch immer wieder schön, Menschen zu sehen, die ihren Beruf auch nach Jahrzehnten noch über alle Maßen lieben«, brüllte Lene gegen das Dröhnen der Harley an.
»Liegt vielleicht an mir, dass ich das bei Rechtsmedizinern und Scharfschützen irgendwie bedenklich finde.« Mit einem schiefen Grinsen gab Henning seiner Eva die Sporen.
***
Oktober 1939
Schlagbauer-Hof, Steinersried
Franziska seufzte, als sie sich im schmalen Bett zurücklehnte und endlich die Füße hochlegte. Dabei war der Tag auf dem Hof nicht härter gewesen als alle zuvor. Und alle zukünftigen sein würden. Natürlich, sie war seit früh um halb fünf auf den Beinen, weil die Bärbel, die sich seit drei Jahren auf dem Schlagbauer-Hof als Magd verdingte, recht überstürzt nach Hause ans Sterbebett ihres Vaters gerufen worden war. Die Kühe mussten pünktlich gemolken werden, ob die Bärbel nun da war oder nicht.
Aber das frühe Aufstehen war es nicht, was ihr zu schaffen machte. Das zusätzliche Gewicht war es, das sich jetzt, gut drei Monate vor der Niederkunft, schon deutlich bemerkbar machte. Sie steckte beide Hände seitlich unter die Hüften und rieb sich die schmerzenden Lenden.
Eigentlich hatte sie darauf gehofft, ihre Jugend würde ihr helfen, die Schwangerschaft zu überstehen, ohne dass die Arbeit zu schwerfiele. Immerhin, sagte sie sich selbst, der Winter stand bevor. Zu tun gab es zwar auch in der kalten Jahreszeit genug, aber doch vor allem im Haus und in der Küche. Und bis es wieder wärmer wurde, war das Mädel längst auf der Welt und Franzi wieder so wendig und belastbar wie vorher.
Mit einem Lächeln fühlte sie der Bewegung nach, die ihren Bauch auf der rechten Seite ausbeulte. Natürlich konnte sie nicht wissen, ob es ein Mädel war, das da in ihr heranwuchs. Aber irgendwie wusste sie es eben doch, und ihre Schwiegermutter Johanna behauptete, dass man sich auf das Gespür der Mutter durchaus verlassen könne.
Überhaupt, die Johanna. Franzi konnte sich nicht entscheiden, wer im Hinblick auf den erwarteten Nachwuchs die größte Aufregung an den Tag legte: Johanna, die nun bald zum ersten Mal Großmutter werden würde, oder Max, der es kaum erwarten konnte, den Säugling endlich auf dem Arm zu halten. Sie selbst war es nicht, so viel stand fest. Seit sie wusste, dass sie ein Kind erwartete, hatte sich ihrer eine große Ruhe bemächtigt. Wenn nur die Rückenschmerzen und die geschwollenen Füße nicht gewesen wären.
Das Gewicht des Babys lastete unangenehm auf ihrer Wirbelsäule, stöhnend drehte sie sich auf die Seite. »Du wirst schon so ein dicker Brummer werden«, sagte sie leise.
Ihr Blick fiel auf die weiß getünchte Mauer direkt neben Max’ Bettseite. Sollten sie Johannas Angebot nicht doch endlich annehmen? Seit Max und Franzi vor anderthalb Jahren geheiratet hatten, drängte ihre Schwiegermutter darauf, dass die beiden ihr endlich Max’ kleine Kammer überließen und selbst in die große Schlafstube umzogen, in der Johanna seit dem Tod ihres Mannes vor zehn Jahren allein schlief. Bisher hatten sie sich nicht dazu durchringen können. Die kleine Kammer war wie ihre Höhle, in die sie sich des Nachts zurückzogen wie die Bären im Winter. Nur die zwei schmalen, aneinandergeschobenen Betten und die kleine Kommode mit dem Spiegel fanden hier Platz. Mit dem Kind würde es eng werden.
Über diesem Gedanken wollte sie das Licht löschen, als sie hörte, wie sich unten im Haus die Tür öffnete. War der Max etwa schon zurück?
Seit sie verheiratet waren, zog es ihn ohnehin nicht mehr oft zum Wirt. Nur noch ab und zu mussten besondere Anlässe in Gesellschaft der anderen Steinersrieder begossen werden, so wie jetzt die ausklingende Ernte, die, als wolle sie den gerade begonnenen Krieg unter einen guten Stern stellen, eine reiche gewesen war. Aber auch diese Feiern uferten selten aus, die Arbeit trieb ihn schließlich frühmorgens schon aus dem Bett. Dass er aber kaum eine Stunde nach seinem Aufbruch schon zurückkehrte, war doch ungewöhnlich.
Die Holzstiegen in den ersten Stock knarzten unter seinem Schritt, vor allem die fünfte, die Franzi immer übersprang. Einen Moment später öffnete sich leise die Tür zur Kammer.
Auf den ersten Blick sah Franzi, dass etwas nicht stimmte: Die steile Zornesfalte, die zwischen Max’ dunklen Brauen entsprang, verriet seinen Ärger, noch bevor er ein Wort sagte. Franzi setzte sich auf und versuchte, die aufsteigende Angst zurückzudrängen. Eine Angst, die, das musste sie sich eingestehen, nur darauf gründete, dass sie ihren Mann recht genau kannte. »Was ist passiert?«
»Der Hitler ist passiert«, sagte Max, ohne das zornige Beben in seiner Stimme zu unterdrücken. »Und diese verblendeten Arschlöcher beim Wirt, die sind auch noch passiert.«
Wie so oft durchfuhr es sie eiskalt. Konnten die Männer die Politik denn nicht ein einziges Mal ausklammern? Dabei wusste sie selbst, wie schwierig das in diesen Tagen war. »Setz dich her«, sagte sie. Max leistete widerspruchslos Folge und ließ sich neben ihr auf dem Bettrand nieder.
»War der Auer auch da?« Es gab sehr wenige Menschen, die Franzi zutiefst zuwider waren. Der schmierige Steinersrieder Blockwart aber gehörte zu ihnen, und Angst machte er, der immer nur darauf zu lauern schien, die ihm von der Partei verliehene Macht auszuspielen, ihr noch dazu. Verabscheuungswürdig von den fettigen Haaren bis zu den platten Füßen, pflegte Johanna zu sagen. Dass ausgerechnet so einer in Steinersried das Sagen hatte, zeigte recht deutlich, in welchen Zeiten sie lebten.
Franzi griff nach Max’ schwieliger Hand.
»Nein, aber die anderen sind genauso verbohrt, oder vielleicht haben sie bloß Angst, was weiß ich.« Max’ Wut war augenscheinlich schon wieder verraucht, fast schon resigniert schüttelte er den Kopf. »Auf jeden Fall haben sie mit all dem lautstarken Propaganda-Geplärre der letzten Jahre anscheinend vergessen, was der Krieg mit den Menschen macht.«
»Und daran hast du sie bloß erinnert?« Vielleicht hatte er sich ja doch nicht allzu sehr hinreißen lassen.
»Das hab ich versucht. Aber alle sagen, der Führer weiß schon, was er tut.«
»Ja«, antwortete Franzi bitter. »Wahrscheinlich uns alle in den Untergang reißen.« Unweigerlich dachte sie, plötzlich voller Mitleid, an das ungeborene Kind in ihrem Leib. »Aber jetzt rück endlich raus mit der Sprach’. War das alles, was du gesagt hast?«
»Na ja.« Max sah sie so treuherzig aus seinen fast schwarzen Augen an, dass sie unweigerlich lachen musste, so wenig ihr auch danach zumute war.
»Vielleicht hab ich noch erwähnt, dass es der glorreiche Führer von vornherein auf diesen Krieg angelegt hat, genau wie ich’s prophezeit hab. Und dass er ihn jetzt hat, seinen Krieg.«
»Und?« Er hatte sich also in Rage geredet, kein Zweifel.
»Könnt sein, dass mir am Schluss noch ›dieses Arschloch‹ rausgerutscht ist.«
Übelkeit ergriff Franzi, stieg langsam von dort empor, wo sich das Kind wieder regte, bis zu ihrem plötzlich so deutlich spürbar klopfenden Herzen. »Dafür sperren sie Leute ins Lager«, sagte sie leise und erinnerte sich an den Brief ihrer Regensburger Cousine vor zwei Wochen, in dem sie berichtet hatte, dass die Gestapo den netten Nachbarn, der sie immer mit frischen Eiern vom Land versorgte, genau wegen einer solchen Geschichte mitgenommen hatte. »Wenn das der Auer erfährt–«
»Wird er nicht, mach dir keine Sorgen. Außerdem ist der Sauhund doch gerade damit beschäftigt, die 175er insKZ zu bringen.« Mit dem Kopf wies er in Richtung Ruderszell, wo neben einem Wäldchen auf knapp halber Strecke die Einöde Steinerhof lag. Erst vergangene Woche hatten sie den Gustl von dort weggeholt, einen fleißigen und tüchtigen Jungbauern, der nur leider auch in zehn Jahren noch keine Frau mit auf den Hof gebracht haben würde. Stramme Männerwaden sagten ihm weit mehr zu als weiche Frauenhaut. Was jetzt aus der kleinen Landwirtschaft werden sollte, die er mit seiner Mutter allein betrieben hatte, stand noch in den Sternen. Was den Auer nicht juckte, Hauptsache, er hatte für Recht, Ordnung und ein linientreues Deutschland gesorgt.
Max entzog ihr unwillig seine Hand. »Da ist der restliche Mann gut in Schuss, und du stürzt dich allerweil auf diesen demolierten Finger.«
Franzi hatte nicht bemerkt, dass sie in ihrer Nervosität ständig mit dem eigenen Daumen über die Stelle strich, an der Max bei einem Unfall mit der Seilwinde vor über zehn Jahren das letzte Glied des linken kleinen Fingers verloren hatte. Sie zwang sich, den Gedanken an den Auer wegzuschieben. Übelkeit half jetzt nicht weiter. »Ich lieb eben alles an dir.«
»Dieses hässliche Trum anscheinend ganz besonders.«
»Der Finger ist nicht hässlich«, widersprach Franzi schmunzelnd. »Bloß–«
»Zu kurz«, vollendete Max den Satz.
»Ich mein’s trotzdem ernst, Max. Reiß dich um Himmels willen zusammen. Es ist nicht die richtige Zeit, um die eigene Meinung an die große Glocke zu hängen.«
»Dass der Hitler ein größenwahnsinniger Kriegstreiber ist, ist keine Meinung. Das ist eine Tatsache.«
Franzi setzte zu einer heftigen Entgegnung an, aber Max hob beschwichtigend die Hände. »Du hast ja recht, und das weiß ich auch. Aber wenn diese gehirngewaschenen Volldeppen nix anderes tun, als den Nazis nach der Gosch’n reden, dann…« Hilflos hob er die Schultern und stand auf.
»Platzt dir der Kragen.« Franzi seufzte. »Und das versteh ich ja auch.«
Max ging zur Kommode, auf der die Waschschüssel stand, und spritzte sich halbherzig Wasser ins Gesicht. Mit noch feuchten Händen fuhr er sich durch das tiefschwarze Haar.
»Aber vielleicht kannst ja einfach ganz schnell heimkommen und deinen Kragen da platzen lassen?«
Wie verquer die Zeit war, in der sie lebten, wie albern dieser Vorschlag und wie groß ihre Angst, dass ihm sein Temperament eines Tages zum Verhängnis werden würde. Dabei war es genau das, was sie schon als junges Mädchen so an ihm gemocht hatte: dass er nichts Verschlagenes, nichts Hinterhältiges an sich hatte.
Für manche mochte seine direkte Art unangenehm sein, und seine Hitzköpfigkeit zuweilen sicher auch, aber es gab nie Zweifel, woran man bei ihm war, und seine Wut wurde er los, indem er laut und deutlich seine Meinung sagte. Nach ein paar Halben natürlich noch lauter und deutlicher. Andere erhoben die Hand in der Wut, gegen ihre Knechte und Mägde, ihre Saufbrüder, gegen ihre eigenen Frauen. Max hatte das nie getan, ja, konnte außer ein paar Raufereien der harmlosen Sorte in der Jugend nichts Derartiges vorweisen. Und ausgerechnet er wurde nun so in seine Schranken verwiesen.
»Bis ich daheim bin, hat’s mich zerrissen«, antwortete er bitter. »In Zukunft geh ich einfach gar nimmer fort.«
Franzi atmete auf. »Daheim kannst du schimpfen, so viel du willst.«
Er zog sich das grobe Hemd über den Kopf und schlüpfte aus der Hose, sodass sein sehniger Körper zum Vorschein kam. »Und im Gegensatz zu den Deppen beim Wirt schimpfst du wenigstens mit.« Behände schlüpfte er neben ihr ins Bett, löschte das Licht und legte seine Hand auf ihren gerundeten Bauch.
»Aber nicht mehr heute.« Franzi schmiegte sich an den warmen Körper ihres Mannes und gähnte.
ZWEI
Lene parkte vor dem modernen Geschäftsgebäude im Regensburger Westen, das der Sohn des Opfers ihr am Telefon genannt hatte, und ließ ihren Blick an der Fassade hinaufwandern. Der siebenundzwanzigjährige Tobias Heinz war ihr sehr gefasst erschienen, fast schon kühl, und auch die Kollegen, von denen er über den Tod seiner Mutter informiert worden war, hatten sich über seine gleichgültige Reaktion gewundert. Das Seelsorgeangebot durch ein Kriseninterventionsteam hatte er rundheraus abgelehnt. Insofern passte das sterile Bauwerk, in dem die Zahnarztpraxis untergebracht war, vielleicht ganz gut zu ihm.
Sie betrat das noch nach Neubau riechende Treppenhaus, ignorierte den Aufzug und folgte den Stufen in den zweiten Stock. Mit ihrem Lauftraining hatte sie in den letzten Wochen öfter mal ausgesetzt, es war einfach zu kalt und matschig gewesen, da konnte ein kleines Plus an Bewegung nicht schaden.
Auch in der Praxis, in der Tobias Heinz als angestellter Zahnarzt arbeitete, setzte sich der hypermoderne und nicht gerade heimelige Stil des Gebäudes fort, die Dame am Empfang aber überschlug sich förmlich vor Freundlichkeit, als sie Lene in ein leeres Büro führte und mit einer Tasse Kaffee versorgte. »Gleich ist er da«, teilte sie noch mit einem verbindlichen Lächeln mit, bevor sie Lene sich selbst überließ.
Zwei Schreibtische standen im Raum, wohl der der Praxisinhaberin und der des Angestellten. Während sich auf dem einen Schreibtisch Unterlagen und gerahmte Familienfotos türmten, herrschte auf dem, vor dem Lene saß, abgesehen von einem Laptop gähnende Leere. Die Deko-Affinität schien er also schon mal nicht von seiner Mutter geerbt zu haben.
Dafür aber das Aussehen, stellte Lene fest, als sich die Tür öffnete und Tobias Heinz, mit angespanntem Gesichtsausdruck, aber um ein Lächeln bemüht, den Raum betrat. Mit einem gehetzten Blick raufte er sich das kräftige schwarze Haar, das er sehr kurz geschnitten trug. »Bitte entschuldigen Sie«, sagte er. »Mir kam noch ein Schmerzpatient dazwischen.« Die Ermordung seiner Mutter schien ihn also nicht daran zu hindern, im völlig normalen Rahmen seiner Arbeit nachzugehen.
»Kein Problem.« Lene winkte ab. Über Wartezeiten unter fünf Minuten regte sie sich schon lange nicht mehr auf.
Tobias Heinz nahm ihr gegenüber am Schreibtisch Platz und schob energisch den Laptop zur Seite, bevor er sich im Drehstuhl zurücklehnte. »Wie kann ich Ihnen helfen?«
»Sie wissen ja bereits, dass Ihre Mutter mutmaßlich am Montag gewaltsam ums Leben kam.« Den Todeszeitpunkt hatte Bertl schon recht genau eingegrenzt, und zwar auf die Zeit zwischen neun und zwölf Uhr abends. Dass es um diese Zeit längst dunkel war und demzufolge keiner der bisher befragten Steinersrieder etwas beobachtet hatte, war aus Mördersicht natürlich günstig gewesen.
Tobias Heinz nickte, ohne eine Miene zu verziehen.
»Um die Geschehnisse einzuordnen und aufzuklären, benötigen wir mehr Informationen über Ihre Mutter und das persönliche Umfeld. Deshalb–«
»Da sind Sie bei mir nicht an der richtigen Adresse«, erwiderte Tobias Heinz, nicht unfreundlich, aber entschlossen. »Ich hatte seit Jahren so gut wie keinen Kontakt zu ihr.«
»Darf ich fragen, warum?« Wenn der eigene Sohn die Mutter so rigoros gemieden hatte, gab vielleicht auch das Aufschluss über das Opfer. Wenn auch wohl nicht so, wie von Lene erhofft.
Für einen kurzen Augenblick sah Tobias Heinz nachdenklich aus dem Fenster, vor dem sich nichts als grauer Himmel abzeichnete. Zum Glück war es immer noch trocken, aber der schneidend kalte Wind dort draußen rückte die Hoffnung auf baldigen Frühling in weite Ferne.
»Es ist so«, begann Tobias Heinz zögerlich und suchte wieder Blickkontakt zu Lene, »dass ich meine Mutter mein Leben lang als große Egoistin empfunden habe.« Er raufte sich die Haare, bevor er mit beiden Händen glättend darüberstrich. »Mittlerweile denke ich eher, wir sind einfach nur zu verschieden gewesen, um einander zu verstehen.«
»Können Sie mir das genauer erklären?« Die Darstellung als Egoistin passte nicht unbedingt zu dem Bild, das Lene sich bislang von der Toten gemacht hatte.
»Nun…«, sagte er und sah auf seine gepflegten, für einen Mann recht feingliedrigen Hände hinab. »Für mich fing das eigentlich schon vor der Trennung meiner Eltern an. Plötzlich hat sich meine Mutter für Yoga interessiert, angefangen, irgendwelche Psycho-Ratgeber zu lesen, ist stundenlang allein durch die Wälder gelaufen… Mein Vater hat das als Egotrip bezeichnet.« Er zuckte die Achseln, als wüsste er nicht mehr so genau, was er davon halten sollte. »Trotzdem wollte er sich nicht scheiden lassen, er hat wirklich um ihre Ehe gekämpft, aber meine Mutter hat ihr Ding eiskalt durchgezogen.«
»Wie alt waren Sie damals?«
»Acht.« Er seufzte leise. »Ich hatte zu meinem Vater ein sehr enges Verhältnis, er war der große Held meiner Kindheit. Und sie hat das alles kaputtgemacht.«
»Aber wenn sie ihn nicht mehr geliebt hat, dann war die Trennung doch vielleicht eine nachvollziehbare Entscheidung?«, wandte Lene ein.
»Mit acht Jahren sieht man das anders. Aus meiner Sicht hat sie damals alles zerstört, ohne Rücksicht auf Verluste. Das hat sich auch nie wirklich geändert, sie war einfach so: Hat einen Entschluss gefasst und ihn durchgezogen, egal, was das für die anderen bedeutet hat. Abgesehen davon, dass sie sich mit ihrem Esoterik-Gespinne auch noch vollkommen lächerlich gemacht hat. Was glauben Sie, was ich für eine Mutter gegeben hätte, die in Cham nicht bekannt wie ein bunter Hund ist, weil sie in Flatterkleidern um die Bäume tanzt und bei jeder Demonstration mit dem größten Transparent vorneweg läuft?«
Für Lene klang das nach wie vor nicht unsympathisch. Dass aber ein kleiner Junge, der sich nach Normalität sehnte, damit so seine Probleme hatte, fand sie zumindest im Ansatz nachvollziehbar. »Wie ging es für Sie nach der Scheidung Ihrer Eltern weiter?«
»Ich bin bei meiner Mutter geblieben, als Lehrerin war es für sie natürlich leichter, ihre Arbeitszeit auf mich abzustimmen. Mein Vater ist nach Regensburg gezogen, bei ihm war ich dann oft an den Wochenenden.« Ein bitterer Zug schlich sich um seine Mundwinkel. »War ihr wohl ganz recht, so konnte sie den nächsten Irrsinn planen oder in Ruhe die Wohnung ausräuchern.«
Ein bisschen selbstgerecht fand Lene schon, was der Sprössling seiner Mutter auch post mortem noch vorwarf. Als müsste ab dem Zeitpunkt der Fortpflanzung jedes Eigeninteresse komplett aufgegeben werden, sofern es dem Kind nicht gefiel.
Anscheinend bemerkte das auch Tobias Heinz, sein schiefes Lächeln wirkte beinahe entschuldigend. »Ich habe ihr sehr lange sehr vieles vorgeworfen, irgendwie ist das tief in mir verankert. Deshalb auch der Kontaktabbruch vor ungefähr fünf Jahren. Ich habe mich einfach nicht mehr bei ihr gemeldet, ihre Anrufe nicht mehr beantwortet und so weiter. Ich musste die Wut, die ich auf sie hatte, endlich loswerden, verstehen Sie? Seither kann ich sie viel besser akzeptieren, wie sie ist. Oder besser gesagt, wie sie war.«
»Wie hat Ihre Mutter auf den Kontaktabbruch reagiert?«
»Nun«, antwortete Tobias Heinz, »am Anfang war es vermutlich schwer für sie. Sie hat immer wieder versucht, mich von meiner Entscheidung abzubringen, so über ein oder zwei Monate hinweg. Dann hat sie aber aufgegeben, auf eine sehr nette Art und Weise. Ich glaube, das hat mich erstmalig ein wenig mit ihr versöhnt.«
Der plötzlich bedauernde Ausdruck auf seinem Gesicht ließ Lene vermuten, dass er sich diese harte Fassade in Bezug auf seine Mutter nur zugelegt hatte, um sich selbst abzuschirmen. Ganz so kalt ließ ihn ihr Schicksal also wohl doch nicht. »Auf welche Art und Weise?«
Einen Moment verbarg er sein Gesicht in den Händen, dann atmete er tief durch und fasste sich wieder. Als wolle er diesen Anflug von Gefühl sofort vergessen, bemühte er sich um einen geschäftsmäßigen Tonfall. »Ihr letzter Brief war sehr kurz, darin stand nur, dass ihr mein Entschluss zwar wehtut, dass sie ihn aber akzeptiert, wenn ich diese Distanz jetzt brauche. Und sie hat geschrieben, dass sie mich liebt und ihre Tür mir immer offen steht.«
Was von Größe zeugte, fand Lene. »Das war der letzte Kontakt, den Sie zu ihr hatten?«
»Nein, zu Weihnachten und zum Geburtstag hat sie mir Karten geschickt, und seit gut drei Jahren habe ich das dann auch getan«, erklärte er.
»Eine vorsichtige Annäherung also?«
Tobias Heinz schüttelte entschieden den Kopf. »So habe ich das nicht gesehen. Eher als ein Mittel, um sie wissen zu lassen, dass ich sie nicht komplett vergessen habe, auch wenn ich die Situation nicht ändern will.«
»Aber gesehen haben Sie Ihre Mutter in all den Jahren nicht?«
»Doch«, antwortete er mit einer Miene, die sehr deutlich machte, dass ihm die Erinnerung daran in etwa so lieb war wie eine schwere Influenza. »Ein einziges Mal, auf der Beerdigung meiner Großmutter vor zwei Jahren. Da hat sie mich aber direkt wieder so aufgebracht, dass ich froh war, als ich wieder heimfahren konnte. Sie war immer so…« Er brach ab, als müsse er sich selbst erst darüber klar werden, was genau es war, das ihn wütend machte.
»Sie hat sich immer in alles furchtbar reingesteigert, nur nie in ihre Aufgabe als Mutter, verstehen Sie? Erst war es das Yoga, dann ihr ganzer Hokuspokus-Kram, die Rettung von irgendwelchen Biotopen, ihre Arbeit als Lehrerin, dann irgendwann die Arbeit mit den Flüchtlingen… Das war alles so extrem, dabei hätte ich mir einfach nur eine stinknormale Mutter gewünscht, die sich in erster Linie für ihr Kind interessiert.«
»Und das hat sie nicht getan?«, fragte Lene skeptisch. Amanda Heinz’ Umgang mit dem Kontaktabbruch des Sohnes sprach eigentlich eine andere Sprache.
»Nicht mit der Ausschließlichkeit, die ich von den Müttern meiner Freunde kannte«, erwiderte Tobias Heinz trotzig.
Lene behielt für sich, dass sie die Mütter dieser Freunde in heutigen Zeiten nicht zwangsläufig für das Nonplusultra hielt. »Und deshalb kam es auch auf der Beerdigung Ihrer Großmutter zum Streit?«
»Es war kein Streit, ich bin nämlich direkt gefahren, um dem zu entgehen. Aber es ging wieder einmal nicht um mich, um unser Verhältnis, sondern nur um den neuesten Schwachsinn, in den sie sich verbissen hat. Sie hat irgendwas davon gefaselt, dass wir nicht die wären, für die wir uns immer gehalten haben, und dass Oma ihr erst kurz vor ihrem Tod die Augen geöffnet hat.«
»Das klingt mysteriös«, erwiderte Lene.
»Das klingt vor allem verrückt«, erwiderte Tobias Heinz rigoros. »Ich habe keine Ahnung, was Oma ihr erzählt hat, aber sie war zum Schluss stark dement. Nichts mehr von dem, was sie gesagt hat, konnte man für bare Münze nehmen. Und abgesehen davon war sie sowieso auch selbst sehr…« Nachdenklich sah er für einen Augenblick aus dem Fenster. »Sehr eigensinnig, könnte man sagen. Wahrscheinlich ist es noch nicht einmal ein Wunder, dass Mama so geworden ist.«
Dass Eigensinn nicht unbedingt etwas war, das Tobias Heinz an seinen Familienmitgliedern besonders schätzte, hatte Lene inzwischen hinreichend zur Kenntnis genommen. »Was ist mit Ihrem Vater, lebt er noch in Regensburg?«
»Im Umland, Etterzhausen, mit seiner neuen Familie. Er hat nach mir noch zwei weitere Kinder bekommen, mit seiner neuen Frau. Die weitaus bodenständiger ist als meine Mutter.«
Dann war ja die Weltordnung zumindest für Papa Heinz doch noch zurechtgerückt worden. »Wissen Sie, ob er noch Kontakt zu Ihrer Mutter hatte?«
»Schon lange nicht mehr«, antwortete Tobias Heinz, ohne zu zögern. »Nach der Scheidung haben sie ohnehin nur noch miteinander gesprochen, wenn es um mich ging. Als ich älter wurde, war das natürlich vorbei.«
Somit war also schon einmal erschöpfend behandelt worden, wer keinen Kontakt zur Toten gehabt hatte. Es war allerhöchste Zeit, endlich das Gegenteil in Erfahrung zu bringen. »Was können Sie mir über das soziale Umfeld Ihrer Mutter sagen? Freunde, eventuell ein Lebenspartner?«
Bis dato waren keine Hinweise auf wichtige Personen in ihrem Leben im Haus der Toten gefunden worden, die gespeicherten Kontakte im Smartphone, das unangetastet auf dem Sideboard im Flur gelegen war, mussten noch abgearbeitet werden. Allerdings hoffte Lene darauf, hier mit Hilfe von Tobias Heinz Prioritäten setzen zu können.
»Das war auch so eine Sache«, antwortete er und trommelte in einer Geste plötzlicher Ungeduld mit den Fingerkuppen auf seinen Laptop. »Allzu viele Freunde hatte sie nicht, was aber bei ihren Spinnereien nicht unbedingt ein Wunder war. Cham ist halt was anderes als Regensburg, Steinersried sowieso, da gibt es nicht für jeden Irren Gleichgesinnte. Meines Wissens hatte sie ein paar Bekannte, aber am liebsten war sie allein. Mit ihrer letzten Beziehung hat sie aber sogar für ihre Verhältnisse den Vogel abgeschossen. Sagt Ihnen der Name Pit Griesbeck was?«
Irgendetwas klingelte bei diesem Namen in Lenes Kopf, einordnen konnte sie ihn aber nicht.
»Der Typ ist Chams bekanntester Motorradrocker, Gründungsmitglied der örtlichen Abteilung des Black VipersMC, verurteilter Schwerverbrecher und, tja«, sagte er mit einer gehörigen Dosis Hohn in der Stimme, »der Ex-Freund meiner Mutter.«
Langsam dämmerte es Lene, vage erinnerte sie sich an einen im großen Stil organisierten Hehler-Ring, dessen Ursprung in einem Motorradclub im beschaulichen Cham zu finden gewesen war. Musste aber schon mindestens fünfzehn Jahre her sein, dass die Kollegen die Täter hochgenommen hatten. Da hatte die Tote ja tatsächlich eine eigenwillige Wahl getroffen. »Ex-Freund, sagen Sie? Was wissen Sie über diese Beziehung?«
»Nicht allzu viel. Obwohl sie bereits zusammen waren, als ich noch Kontakt zu meiner Mutter hatte«, erklärte er. »Dieses Verhältnis war aus meiner Sicht von Beginn an extrem, kam auch ab und an vor, dass sie beide mit Kratzern und blauen Augen durch die Gegend gelaufen sind.«
»Sie haben sich geschlagen? Oder wie meinen Sie das?«
»Vermutlich, vielleicht entsprach das auch gewissen Vorlieben, so genau weiß ich das nicht.« Mit eindeutiger Geste untermalte er, was er vom Geisteszustand beider hielt.
»Der Griesbeck ist gewalttätig, das weiß in der Region jeder, und meine Mutter hat es zumindest lange Zeit nicht gestört. Getrennt hat sie sich erst kurz nach Omas Beerdigung, das heißt, ich musste mit diesem Penner auch noch am Grab stehen. Von der Trennung hat mir aber nur ein Freund erzählt, der noch heute in Cham wohnt. Mehr weiß ich darüber nicht.«
Ein gewalttätiger Ex-Freund war zweifellos interessant, diesem Griesbeck würde Lene so bald wie möglich auf den Zahn fühlen. Fast musste sie sich zwingen, auch noch die restlichen Fragen abzuspulen und ihre plötzliche Ungeduld hintanzustellen. »Hatte Ihre Mutter Ihres Wissens Feinde?«
Tobias Heinz lächelte beinahe überheblich. »Namen kann ich Ihnen nicht nennen«, sagte er. »Aber sie war eine Außenseiterin, ist mit ihrer Meinung ständig irgendwo angeeckt, weil sie sie nie für sich behalten, sondern immer lautstark verkündet hat. Ob das für Feinde reicht, die sie tot sehen wollen, weiß ich nicht. Aber auf die Nerven ist sie bestimmt sehr vielen Menschen gegangen.«
Zwischenzeitlich hatte Lene fast ein wenig Sympathie für Tobias Heinz empfunden, nämlich als die kühle Fassade für einen kurzen Augenblick ein wenig gebröckelt war. Jetzt aber, wo er seine Mutter mit einer Härte aburteilte und fast schon verhöhnte, obwohl sie vielleicht ein etwas unbequemer, aber vermutlich kein schlechter Mensch gewesen war, war er ihr mit seiner zur Schau getragenen glatten Fassade mit einem Mal zutiefst zuwider.
»Ich befürchte, Sie können uns nicht helfen, fehlende Gegenstände in ihrem Haus zu identifizieren?«, legte sie ihm die Antwort entgegen allen Empfehlungen zur Gesprächsführung bereits in den Mund.
»Nein, ich war nie dort.«
»Wie sieht es mit Schmuck aus, haben Sie diesbezüglich Einblick in die Besitztümer Ihrer Mutter? Vielleicht gab es auch Erbstücke von Ihrer Großmutter?«, hakte Lene weiter nach.
Wieder schüttelte er den Kopf. »Für Schmuck interessiere ich mich nicht besonders, auf den meiner Mutter und Oma habe ich ehrlich gesagt nie großartig geachtet.«
»Vielleicht«, sagte Lene und verfluchte sich insgeheim dafür, sich diesen Kommentar nicht verkneifen zu können, »hätten Sie ab und an nicht nur Interesse erwarten, sondern auch welches entgegenbringen sollen.« Mit diesen Worten erhob sie sich und verließ das Büro.
***
»So ganz schlau werde ich aus dir noch nicht.« Lene betrachtete das Foto, das in einem mit bunten Glasscherben beklebten Rahmen neben dem Bücherregal hing. Es zeigte eine noch recht junge Amanda Heinz mit ihrem Sohn, der auf dem Bild vielleicht fünf oder sechs Jahre alt sein mochte. Er saß auf ihrem Schoß, offensichtlich amüsierten sich die beiden köstlich über den Fotografen, dem Lachen auf beiden Gesichtern nach zu urteilen.
Immer noch arbeitete das Gespräch mit Tobias Heinz in ihr, der seiner Mutter Egoismus vorwarf, von seinem eigenen Egoismus aber, so kam es ihr vor, selbst nach ihrem gewaltsamen Tod nicht abrückte.
Die Akte des kriminellen Motorradrockers, der ja vielleicht doch ein ex-krimineller Rocker war– immerhin war er seit seiner Haftentlassung nicht mehr straffällig geworden–, hatte sie in der Dienststelle bereits eingesehen. Eigentlich hatte sie Pit Griesbeck direkt danach aufsuchen wollen, aber Henning bestand darauf, als Geleitschutz zu fungieren. Wahrscheinlich hielt er sich als Eigentümer der dicken, beeindruckenden Eva für den passenderen Gesprächspartner– der allerdings im Moment noch im Gericht festhing. Weshalb Lene die Zeit nutzte, um sich im Haus des Opfers endlich selbst in Ruhe umzusehen. Der Erkennungsdienst war zwar noch im ersten Stock zugange, das Wohnzimmer aber hatte Lene für sich.
Nur noch die Blutlache auf dem Boden war von den schrecklichen Geschehnissen zurückgeblieben, die Leiche von Amanda Heinz lag bereits in Erlangen, wo am kommenden Tag die Obduktion stattfinden sollte.
Lenes Blick fiel auf Amanda Heinz’ Bücherregal, das neben einigen wenigen Romanen, hauptsächlich Klassiker der Weltliteratur, vor allem eine große Fülle an Sachbüchern enthielt– von Selbstfindung bis zu Familientraumata, Esoterisches, Werke über Tarot, Räuchern und Heilkräuter… Im Geiste winkte Lene ab, damit konnte sie nichts anfangen.
»Lene?«, riss Michael Bauer vom Erkennungsdienst sie aus ihren Gedanken. »Hast du Zeit für ein kurzes Update?«
»Nur zu.« Dass ihr das »Regelwerk der weißen Hexen« bei der Aufklärung des Falls half, glaubte sie ohnehin nicht. »Habt ihr schon was?«
»Wir haben einige Proben genommen, das muss alles erst ins Labor«, antwortete Michael. »Aber was den Raubmord angeht: Wo würdest du als Täter nach Schmuck suchen?«
»Im Schlafzimmer vermutlich. Schmuckschatulle, Kommode, Nachttisch, das wären die ersten Anlaufstellen.«
»Genau.« Michael machte eine Art Trump’schen Zeigefinger, als moderiere er eine mittelmäßige Quizshow. »Die Schmuckschatulle auf der Kommode ist leer geräumt und steht demonstrativ offen. Die Wäscheschubladen der Kommode sind zwar aufgerissen, aber nicht durchwühlt. Und den Nachttisch hat der Täter offensichtlich vergessen, zumindest liegen da erstaunlicherweise in ihren Etuis noch zwei Perlenketten nebst einigem anderen Goldschmuck.«
»Habt ihr denn zwischenzeitlich einen Laptop gefunden?«
Michael verneinte. »Dafür aber ihren Geldbeutel in einer Handtasche an der Garderobe. Siebzig Euro in bar sind noch drin.«
»Sie muss auch einen Drucker gehabt haben«, sagte Lene und wies hinüber zum Schreibtisch, wo sich in einem Ablagefach mehrere mit dem Namen des Opfers als Urheberin gekennzeichnete Skripte für ihren Integrationskurs befanden sowie der Ausdruck einer aus dem Internet kopierten Seite, die eine Tabelle mit den Zeichen der altdeutschen Schrift zeigte. Manche Buchstaben– diejenigen, die auch Lene Probleme bereiteten– waren eingekreist. Ein Hinweis darauf, was Amanda Heinz damit vorgehabt hatte, ließ sich jedoch nicht finden.
Michael nickte zustimmend. »Oben sind auch ein paar Ausdrucke, die wichtigsten Wörter und Redewendungen der syrischen Sprache, solche Sachen. Nichts, womit sich viel anfangen lässt.«
»Hast du das hier schon gesehen?« Lene blickte wieder dorthin, wo das Foto von Amanda und Tobias Heinz hing. »Da waren noch mehr Bilder.« Dass es sich um eine komplette Fotowand gehandelt haben musste, war an den verbliebenen Nägeln, sieben Stück an der Zahl, recht klar ersichtlich, auch wenn die Rahmen an der Wand noch keine Spuren hinterlassen hatten.
»Du meinst…«
»Ich meine«, sagte Lene und suchte einen Moment nach den richtigen Worten, »dass mir nach wie vor unklar ist, ob Amanda Heinz sterben sollte oder ob ihr Tod nur ein Kollateralschaden war. Klar ist aber, dass ihr Mörder den Schmuck mitgenommen und alle Schubladen aufgerissen hat, um den Eindruck von materiellen Interessen zu erwecken. Eigentlich, glaube ich, hat er aber etwas ganz anderes gesucht und offensichtlich auch gefunden.«
Ihr Blick wanderte an dem Regal hinab, dessen unterster Boden leer stand. »So räumt kein Mensch seine Regale ein, mit diesen seltsamen Lücken bei den Ordnern und einem freien Fach ganz unten.«
»Man müsste halt wissen, was sich dort befunden hat«, stellte Michael nicht allzu hilfreich fest.
»Eben das wird mir ihr Ex-Gspusi hoffentlich sagen können.« Wenn nur der gnädige Herr Staatsanwalt endlich das Go gab, um dem Clubhaus des Black VipersMC einen Besuch abzustatten.
Nicht zum ersten Mal versuchte Lene, anhand der Staubspuren darauf zu schließen, was vormals im Regal gestanden haben musste. Nichts zu machen, Amanda Heinz war anscheinend eher reinlich gewesen. Da handhabte Lene die eigene Haushaltsführung für den Fall der Fälle weitaus ermittlerfreundlicher.
Ihr Blick fiel auf ein vergilbtes, eckiges Fitzelchen, das sich zwischen Regalboden und -rücken, wo ein schmaler Spalt klaffte, verklemmt hatte. Das war ihr noch gar nicht aufgefallen. Sie beugte sich vor und zog an der Ecke. Zum Vorschein kam ein Schwarz-Weiß-Foto, quadratisch, offensichtlich ziemlich alt, auf dem ein kleines Mädchen von vielleicht sechs oder sieben Jahren zwischen den Eltern stand, einen Zweig Palmkätzchen zwischen den Fingern, während die Mutter einen Korb trug und der Vater recht feist in die Kamera grinste. Lene drehte das Foto um. »Ostern 1946« stand dort geschrieben, in einer alten und ziemlich fitzeligen Schrift, die vielleicht erklärte, weshalb Amanda Heinz sich für diese längst nicht mehr verwendeten Buchstaben interessiert hatte.
»Vielleicht ist da noch mehr dahintergerutscht.« Lene zerrte am Regal. »Hilf mal.«
Gemeinsam gelang es ihnen, das Regal so weit zu bewegen, dass Lene dahinterspähen konnte. Tatsächlich. Sie zog ein weiteres Foto hervor, das vier junge Menschen zeigte. Die beiden Frauen saßen lachend auf einem hoch beladenen Heuwagen, die zwei Männer standen davor und stützten sich, ebenfalls lächelnd, auf ihre Heugabeln. Wieder drehte Lene das Bild um und entzifferte den Vermerk »Heuernte auf dem Schlagbauer-Hof 1938«.
Sie betrachtete die Gesichter genauer und identifizierte eine der Frauen auf dem Heuwagen, nicht zuletzt aufgrund der hellen Haare, die aus dem Kopftuch spitzten, als die Mutter auf dem ersten Foto. Mit etwas gutem Willen konnte man auch einen der beiden jungen Männer für den späteren Vater halten. Man hatte sich gegenseitig ausgeholfen, so war das damals gewesen. Unvorstellbar in den heutigen Zeiten, wo kaum jemand mehr einen Finger für die Belange des anderen krumm machen wollte.
»Hallo miteinander, können wir?«
Lene wandte sich um und stellte fest, dass Henning dem Anlass entsprechend wieder von Kopf bis Fuß in seine Lederkluft gehüllt war. Immerhin, auf einen Fake-Aufnäher der Hells Angels oder Ähnliches hatte er zum Glück verzichtet. Schnell steckte sie die Fotos ein, verabschiedete sich von Michael und folgte Henning nach draußen.
»Kommst du voran?«, fragte er und warf einen skeptischen Blick gen Himmel, der sich nach wie vor grau in grau präsentierte.
Lene zuckte die Achseln. »Im Moment werde ich noch nicht einmal aus dem Opfer schlau, wenn ich ehrlich bin. Rockerbraut oder Umweltaktivistin auf dem Selbstfindungstrip, egoistische Rabenmutter oder aufopferungsvolle Flüchtlingsbetreuerin mit Helfersyndrom, irgendwie passt das alles nicht so richtig zusammen.«
»Vielleicht war sie einfach eine Suchende«, sagte Henning kryptisch, nahm den zweiten Helm vom Lenker der Harley und streckte ihn Lene auffordernd entgegen.
Erschrocken winkte sie ab. »Nix da, ich fahre selbst.«
»Wir wollen ihn doch zum Reden bringen, oder?« Henning wies beharrlich auf seine Harley. »Vertrauen gewinnst du eher, wenn du stilecht vorfährst. Identifikation, guter Cop und so, du weißt doch. Schwing dich rauf, es bleibt trocken heute.«
Mit einem resignierten Seufzen nahm Lene den Helm entgegen.
Als Clubhaus des Black VipersMC diente ein ehemaliges Lagergebäude inmitten eines Industriegebiets im nahe gelegenen Roding. Früher hatte der Club direkt in Cham residiert, Zeitungsberichten zufolge waren die Anwohner dort aber gegen die ungeliebte, weil lautstarke und zwielichtige Nachbarschaft immer wieder Sturm gelaufen.
Lene hatte die ungefähr zwanzigminütige Tour trotz des eisigen Fahrtwinds, den zum Glück Henning in weiten Teilen abgefangen hatte, genossen. Dabei gab sie eigentlich ungern das Steuer aus der Hand, als Beifahrerin in Pkws wurde sie grundsätzlich nervös. Dass es ihr nichts ausmachte, von Henning durch die Prärie kutschiert zu werden, und das sogar ohne schützende Knautschzone, verwunderte sie selbst.
Sie stieg von der Harley und sah sich um. Hier störten die Biker wenigstens niemanden, abends war das Gewerbegebiet vermutlich verlassen, und sogar jetzt wirkten die umliegenden Firmengelände nicht allzu belebt. Der hohe Schlot eines in Sichtweite gelegenen, etwas altertümlich anmutenden Industriebetriebs erweckte jedenfalls den Eindruck, als hätte er schon längere Zeit nicht mehr gequalmt.
Nur drei Maschinen parkten am Straßenrand vor dem Clubhaus. Neben der stählernen Eingangstür prangte auf einem mannshohen Metallschild in Rautenform das Club-Logo: eine schwarze Schlange mit leuchtend roten Augen, die sich um einen Totenkopf wand.
»Soll ich noch mal den Motor aufheulen lassen, um uns anzukündigen?«, fragte Henning mit einem Schmunzeln, stieg dann aber ebenfalls ab und folgte Lene zum Eingang.