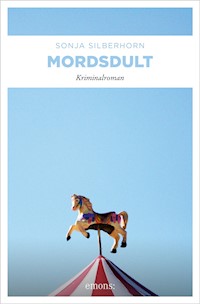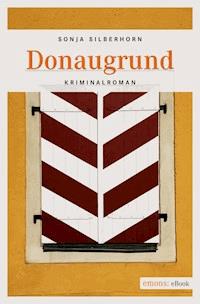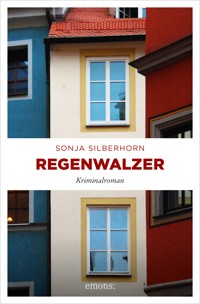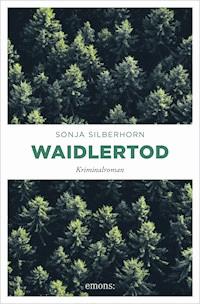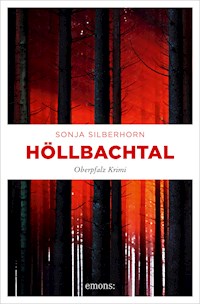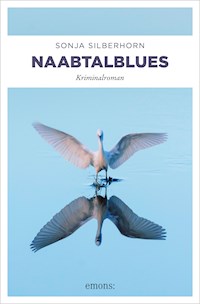
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Lene Wagenbach
- Sprache: Deutsch
In der Nähe der Burgruine Kallmünz im Herzen des Naabtals wird die Leiche eines Galeristen gefunden. Zunächst deutet alles auf einen Unfall hin, doch dann stellt sich heraus, dass der Tote erstochen wurde. Kommissarin Lene Wagenbach von der Regensburger Kripo ermittelt gegen Widerstände, denn der kleine Ort ist tief gespalten: Tradition steht gegen Gentrifizierung, die Liebe zur Kunst gegen die Gier nach Geld. Als ein zweiter Mord geschieht, beginnt für Lene ein blutigerWettlauf gegen die Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sonja Silberhorn, Jahrgang 1979, ist in Regensburg geboren und aufgewachsen. Sie arbeitete mehrere Jahre in der Hotellerie, unter anderem auf den Kanaren und in Berlin, doch dann überwog die Liebe zu ihrer Heimatstadt. Heute lebt sie dort mit ihrer Familie und schickt seit 2011 ihre Kriminalkommissare erbarmungslos durchs lokale Verbrecherdickicht.
Dieses Buch ist ein Roman. Personen sind – mit Ausnahme der Familie Luber – frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Die genannten Lokale existieren tatsächlich, dienen aber nur als Kulisse. Alle Handlungen sind fiktiv.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/age fotostock/Juan Carlos Muñoz
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Hilla Czinczoll
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-482-7
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Ich stehe bloß und ohne Hautund schutzlos in der Nacht.
Ich bin verlor’n, nur halb noch da,verdrängt von deiner Macht.
Ein falscher Blick, ein fester Griff,Berührungen, die stechen.
Ich bleibe ruhig und halte still,aus Angst vor dem Zerbrechen.
Mein Herz liegt frei, ist roh, voll Blutund ganz nah am Verderben.
Und irgendwann zerspringt es mirin tausend schwarze Scherben.
EINS
Mit wild klopfendem Herzen schloss Miriam die Tür des Ateliers hinter sich und lehnte sich aufatmend dagegen. Warum bloß konnte man sie nicht einfach in Ruhe lassen? Sie störten doch niemanden.
Erst jetzt fiel ihr Blick auf Tabea, die an der Werkbank saß, wie immer, wenn sie sich konzentrierte, die Zungenspitze zwischen die vollen Lippen geklemmt, und den Draht für die Skulptur bog, an der sie gerade arbeitete. Offensichtlich widerwillig riss sie sich von ihrer Arbeit los und sah auf. Das tiefschwarz gefärbte Vogelnest auf ihrem Kopf, stilistisch irgendwo zwischen Amy Winehouse und Robert Smith von The Cure gelegen, wackelte, in ihr makellos schönes Gesicht malte sich bei Miriams Anblick aufrichtiges Mitleid.
»Ach herrje«, seufzte sie. »Schon wieder?«
Miriam nickte und atmete tief durch. »Der Schweiger. Er scheint uns wirklich aus tiefstem Herzen zu hassen.«
»Du hast aber auch ein Händchen dafür, diesem Holzkopf ständig zu begegnen.«
»Kunststück«, erwiderte Miriam. »Im Gegensatz zu dir muss ich ein paar Meter gehen, um hierherzukommen.« Mit dem Kopf wies sie auf die Tür zum Nebenzimmer, in dem Tabea für die Dauer des Sommeraufenthalts in Kallmünz wohnte. Sie selbst hingegen spazierte notgedrungen jeden Morgen von ihrem Pensionszimmer auf der anderen Uferseite der Naab zu dem zusammen mit Tabea genutzten Atelier in der Vilsgasse.
»Du brauchst bloß hier miteinzuziehen.«
Miriam winkte ab. Im Gegensatz zu Tabea, die nach eigenen Angaben nichts dagegen hatte, sich mit ihr »zusammenzukuscheln«, brauchte Miriam Platz für sich. Und Ruhe für ihre Gedanken.
»Was hat er dieses Mal gesagt?« Tabea wirkte nur milde interessiert. Eher so, als geböte es die Höflichkeit, nachzufragen.
»Gebrüllt, meinst du wohl.« Miriam zog sich einen bunt bemalten Holzstuhl an die Werkbank und ließ sich erschöpft darauf nieder. »Ich zitiere: ›Schleichts eich alle miteinander, hundsverrecktes Künstlerg’sindel, oder es boußt!‹«
»Und auf Deutsch?« Angesichts von Miriams Bayerisch-Imitation kräuselten sich Tabeas tiefrot geschminkte Lippen zu einem feinen Lächeln.
»Möget ihr euch allesamt verdünnisieren, verehrte Künstlergemeinde. Andernfalls werde ich für eure Eliminierung sorgen«, übersetzte Miriam mit einem Augenzwinkern. Tabeas gewohnt lockerer Umgang mit den Bedrohungen, denen sie während ihres Aufenthalts hier ausgesetzt waren, hatte auch sie beinahe wieder fröhlich gestimmt.
Wie sehr sie sich wünschte, den Hass, der ihnen von Schweiger und Konsorten entgegenschlug, ebenso locker abschütteln zu können wie ihre Kollegin. Denn an und für sich gefiel es Miriam hier in Kallmünz, dem kleinen malerischen Marktflecken am nördlichen Rand des Landkreises Regensburg. Der Ort mit seiner bewegten künstlerischen Vergangenheit verfügte über eine Vielzahl von Galerien und bunten Häusern in mittelalterlichen Gassen, aber besonders die imposante schroffe Felswand, die sein Erscheinungsbild maßgeblich prägte, hatte es ihr angetan. Über der »Perle des Naabtals«, wie der Ort liebevoll genannt wurde, thronte die Burgruine. Kallmünz atmete Geschichte, mit jeder Stiege, jeder Brücke, jedem Winkel, und das trotz aller Ruhe und Beschaulichkeit. Nahezu perfekt für einen sommerlichen Arbeitsaufenthalt eigentlich, wenn nicht –
»Hunde, die bellen, beißen nicht.« Tabea betrachtete ihre Skulptur, die schon in dieser frühen Phase der Entstehung an einen Frauentorso erinnerte, ausnehmend kritisch.
Mit welcher Leichtigkeit sie daran arbeitete! Die altbekannte Eifersucht schnürte Miriam die Kehle zu, als sie bedachte, wie mühselig sich im Gegensatz dazu ihre eigene Arbeit gestaltete.
»Außerdem solltest du eines nicht vergessen.« Das Funkeln in ihren Augen ließ Miriam erahnen, worauf Tabea abzielte. »Wenn Nero erst mit dem Wahlenberg gesprochen hat, können wir dieses provinzielle Pupskaff sowieso hinter uns lassen.«
»Ist Wahlenberg schon da?« Nur nicht zu viel erwarten. Trotzdem beschleunigte die Vorstellung, vielleicht bald bei einem international angesehenen Galeristen unter Vertrag zu stehen, unweigerlich Miriams Herzschlag.
»Seit gestern. Nero will heute Abend oder morgen mit ihm reden. Bisher ging es wohl nur um Neros nächste Ausstellung.«
Beim Gedanken an ihren Mentor Nero Geiger, der sie beide eingeladen hatte, den Sommer mit ihm in Kallmünz zu verbringen, beschlich Miriam leiser Widerwille. Wahrscheinlich weil sie wusste, dass es ihm im Grunde nur um Tabeas Förderung ging, während sie selbst diese Einladung einzig und allein Tabeas Fürsprache zu verdanken hatte. Vielleicht aber auch, weil sie die Hierarchien in dieser Branche jetzt schon satthatte: Während der Großmeister Nero ein paar Meter weiter, ebenfalls in der Vilsgasse, in einem komfortabel ausgestatteten, lichtdurchfluteten Atelier arbeitete, sollte sie für einen Arbeitsplatz in dieser heruntergekommenen und finsteren Bruchbude dankbar sein. Gerade deshalb hoffte sie darauf, dass Neros Galerist sie als das vielversprechende Talent erkannte. Sie und nicht Tabea.
»Du hast Wahlenberg aber noch nicht kennengelernt?« Wie so oft stieg in Miriam die Angst auf, auf den letzten Metern ausgebootet oder übervorteilt zu werden.
Tabea verneinte. »Soll Nero uns erst mal den Weg bahnen.« Sie gluckste übermütig. »Wird er auch. Und dann nimmt uns der Wahlenberg unter Vertrag, und wir gönnen uns ein Atelier in Paris. Oder New York. Oder wo auch immer du möchtest.«
Sie stand auf, dehnte sich genüsslich und sah dann aus dem Fenster. Während der Blick aus Tabeas Wohnraum auf die schmale Vilsgasse mit der dahinter aufragenden Kirche und der übermächtigen Felswand fiel, offenbarte sich hier, vom Atelierfenster aus, der wildromantische Verlauf der Naab, die zu ihrer Rechten eine elegante Kurve um das weitläufige Festgelände des Ortes beschrieb. »Scheiß auf Kallmünz.«
***
»Der war aber heute flott.« Kriminalhauptkommissarin Lene Wagenbach bedachte den bereits anwesenden, völlig vertieft über die Leiche gebeugten Rechtsmediziner aus der Distanz mit einem anerkennenden Blick, bevor sie unter dem Absperrband hindurchkletterte und es für ihre Kollegin Julia Stern nach oben hielt.
Julia wagte sich vorsichtig darunter hindurch und schnaubte angesichts des direkt vor ihr liegenden Abhangs. »Das ist ja lebensgefährlich.« Was sie bereits zum zweiten Mal behauptete, seit sie das Ende des nur in Sonderfällen befahrbaren, normalerweise mit einem Absperrpoller gesicherten Schotterwegs erreicht und die auf einem Bergsporn thronende Kallmünzer Burgruine umrundet hatten.
»Sei froh, dass die Polizei überhaupt mit dem Auto raufkonnte.« Lene sah auf die steilen, unregelmäßigen Stiegen, die von dieser Seite der Burg in südöstlicher Richtung nach unten in den Ort führten. Wenn sie sich richtig erinnerte, endete der Treppenweg direkt neben der hoch aufragenden Kirche, die das Ortszentrum beherrschte.
Es wäre ihr lieber gewesen, die Gegend um die mittelalterliche Ruine mit ihren eindrucksvollen Mauerresten und dem mächtigen Bergfried bei einem Sonntagsausflug zu erkunden. Stattdessen hatte sie – wieder einmal – der Fund einer Leiche in die Natur geführt. »Sei vorsichtig und halt dich an den Sträuchern fest«, riet sie Julia. »Dann klappt das schon.«
Mit offensichtlicher Skepsis ließ Julia sich auf den Abstieg durch das wild wuchernde Gestrüpp ein.
Kurze Zeit später war Lene dort angekommen, wo sich die Kollegen von der Streife, Spurensicherung und Rechtsmedizin so gut wie in dieser Hanglage eben möglich um den Toten scharten, während Julias schwarzseidener Pferdeschwanz noch auf halber Höhe wippte und sie, dem Berg zugewandt, so vorsichtig einen Fuß unter den anderen setzte, als würde eine abrupte Bewegung die sofortige Sprengung des gesamten Burgbergs auslösen. Vielleicht war es aber auch nur die Sorge um ihre Seidenbluse, die sie zu solch übermäßiger Vorsicht bewog. Lenes ausgebeultes Ringelshirt hingegen wäre auch durch ein Erdbeben inklusive Tsunami kaum mehr zu versauen gewesen.
Sie gab einem der Kollegen von der Streife einen Wink. Pflichtschuldig kletterte der junge Beamte Julia entgegen.
»Morgen, allerseits«, sagte Lene, schob den Spusi-Mann im weißen Overall, der ihr die Sicht auf die Leiche versperrte, zur Seite und nickte den Kollegen zu. Erst dann fiel ihr Blick auf den Toten, der von blutigen Schrammen verunziert und mit verdrehten Gliedmaßen mit dem Gesicht voraus in einem Busch hing, der ihn offensichtlich gebremst hatte. Seinem Zustand nach zu urteilen, hatte er ganz im Gegensatz zu Julia, die immer noch an einem mannshohen Strauch festklebte, den Weg hierher mit etwas mehr Schwung hinter sich gebracht.
Abgesehen von den Verletzungen ließ der Anblick der Leiche jedoch darauf schließen, dass der Mann zu Lebzeiten durchaus gepflegt gewesen sein musste: Davon zeugte das grau melierte, perfekt geschnittene Haar ebenso wie die für einen Mann außergewöhnlich makellos manikürten Hände. Seine helle, durch den Sturz verschmutzte Leinenhose, die bordeauxfarbenen Lederschuhe und das in schillernden Rottönen gemusterte, nunmehr mit einem tiefen Riss versehene Hemd schienen von hervorragender Qualität zu sein.
»Guten Morgen, Lene.« Endlich sah Rechtsmediziner Dr. Heribert Melchior mit einem Lächeln im runden Gesicht auf.
Da Regensburg über kein eigenes rechtsmedizinisches Institut verfügte, wurden im Bedarfsfall die Kollegen aus Erlangen hierher in die Oberpfalz bemüht. Somit kam es nur selten vor, dass Bertl vor ihr an Ort und Stelle eintraf. An diesem Morgen musste er wie mit fliegenden Fahnen herbeigeeilt sein. Wahrscheinlich hatte ihn die Sehnsucht nach der nächsten Leiche schon mitten in der Nacht aus dem Bett getrieben.
Inzwischen hatte auch Julia die Gruppe erreicht und sich in vorderste Reihe durchgekämpft. Mit einer Mischung aus Bedauern und Grauen betrachtete sie den Toten. »Was wissen wir?«
»Noch nicht viel«, räumte eines der Streifenhörnchen ein. »Eine Spaziergängerin hat die Leiche entdeckt. Die Personalien der Frau kann ich Ihnen dann geben.« Mit einer raschen Kopfbewegung deutete er auf die Tasche, die er ein Stück entfernt abgestellt hatte.
»Wer ist der Mann?«, fragte Lene.
Der Kollege zuckte die Achseln. »Er führt keine Dokumente mit sich, und von uns kennt ihn auch keiner. Aber wir haben neben einer Schachtel Zigaretten und seinem Handy das hier gefunden.« Er streckte Lene eine Geldklammer entgegen, die ein kleines Bündel größerer Scheine enthielt.
Mit der Auswertung der auf dem Handy vorhandenen Daten war eine Identifizierung der Leiche ohnehin in den meisten Fällen gesichert. Doch vor allem die Gravur auf der Geldklammer war es, die Lene Anlass zur Hoffnung auf schnelle Klärung gab. »Das müssen seine Initialen sein«, sagte sie und beäugte die ineinander verschlungenen Buchstaben interessiert. »WJF … FJW … Wie auch immer, damit wird sich schon was anfangen lassen.«
»Ausgeraubt wurde er also schon mal nicht«, folgerte Julia.
»Einen Hotelschlüssel hatte er auch dabei«, fuhr das Streifenhörnchen fort und demonstrierte das gute Stück. Er hing an einem Anhänger in schwerer Goldoptik und mit eingeprägter Zimmernummer, wie er in vereinzelten Hotels noch üblich war.
»Aus welchem Hotel stammt der?«, fragte Lene.
Der Kollege hob die Schultern.
»Na, dann finden wir’s eben raus!« Julia hangelte sich einen Meter weiter, zückte das Handy und wählte. Lene hörte, wie sie einem Kollegen aus der Dienststelle die Eckdaten durchgab und ihn bat, die Kallmünzer Hotels und Pensionen durchzutelefonieren. Zur Bekräftigung versendete sie noch ein Foto der Leiche, dann gesellte sie sich wieder zu Lene und Bertl.
»Allein das Hemd müsste zur Identifizierung ja schon ausreichen«, murmelte Lene mehr zu sich selbst als zu Julia. »Was kannst du uns verraten, Bertl?«
»Offensichtlich männlich, um die fünfzig Jahre alt, schätze ich.« Bertl hob den rechten, frei zugänglichen Arm des Toten leicht an. Das Ellbogengelenk beugte sich keinen Millimeter. »Die Totenstarre ist vollständig ausgeprägt und schwer zu brechen. Nach dem Brechen setzt sie aber nicht wieder ein.« Zum Beweis knickte er schwungvoll den rechten Unterschenkel des Toten, das Knie beugte sich.
»Aufgrund der sommerlichen Temperaturen geht das alles natürlich etwas schneller als sonst«, erklärte er. »Wir können aber davon ausgehen, dass er auf jeden Fall schon seit sieben Stunden tot ist. Darauf deutet auch die starke Ausprägung der Totenflecke hin.« Er tätschelte den durch das hochgeschobene Hemd seitlich sichtbaren Bauch der Leiche, der besagte rotviolette Flecken aufwies, und erhob sich aus der Hocke.
Julia prüfte ihre goldene Armbanduhr. »Und wann frühestens?«
Bertl seufzte, wie immer, wenn er nach Erkenntnissen gefragt wurde und dabei mit seinem Wissensstand noch nicht zufrieden war. »Die Totenflecke lassen sich noch wegdrücken, wenn auch nicht mehr ganz leicht. Bedeutet: Länger als achtzehn Stunden liegt er sicher noch nicht hier, wahrscheinlich kürzer«, erklärte er mit gerunzelter Stirn. »Einen konkreten Zeitraum kann ich allerdings erst nach der Obduktion liefern.«
»Also zwischen fünfzehn Uhr nachmittags und zwei Uhr nachts.« Julia wandte sich um und nahm den Abhang in Augenschein.
»Danke, Bertl«, antwortete Lene an Julias Stelle. »Was ist deiner Meinung nach passiert?«
Er deutete nach oben zum Eingang in die Ruine, wo sich der Weg am Ende der Stiegen in einen schmalen Trampelpfad verwandelte. »Er ist mutmaßlich von dort gestürzt.« Mit dem Zeigefinger zeichnete er eine Linie den Abhang herunter.
Einer der Erkennungsdienstler nickte. »Wir haben entsprechende Abdrücke im hohen Gras gefunden.«
»Dann«, Bertls Finger verharrte bei einem kleinen Felsvorsprung, den Lene zwischen dem wilden Bewuchs erst jetzt wahrnahm, »ist er dort aufgeprallt, daher stammt wohl die Verletzung am Kopf.«
Wieder schaltete sich der Erkennungsdienstler ein. »Dafür sprechen auch die Blutspuren am Felsen.«
Aus Lenes Perspektive heraus ließ sich die blutige Schramme an der Stirn des Toten nur erahnen.
»Können aber auch noch ein paar weitere potenziell tödliche Verletzungen sein, die ich jetzt noch nicht erkenne«, fuhr Bertl fort. »Er ist weitergerollt und wurde schließlich von diesem Strauch hier gestoppt.«
»Siehst du derzeit schon irgendwelche Kampfspuren oder Abwehrverletzungen?«
»Leider nein. Dazu muss ich ihn gründlicher untersuchen.« Er schloss seine Tasche und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Es wäre von Vorteil, wenn er möglichst bald auf meinem Tisch liegen würde.«
Lene nickte. Je frischer die Leiche, desto besser die Ergebnisse. »Organisierst du die Feuerwehr für die Bergung, Julia?«
Julia griff nach dem vibrierenden Smartphone und meldete sich knapp. »Ja«, sagte sie schließlich. »Aha … Moment.« Sie ließ das Handy ein Stück sinken und wandte sich an Lene. »Er hier«, Julia deutete auf die Leiche, »hat ein Zimmer im Schloss Raitenbuch angemietet.«
»Und wer ist er hier?«, fragte Lene.
»Anscheinend ein bekannter Galerist aus Düsseldorf. Johann F. Wahlenberg.«
***
Lene trieb sich umso mehr zur Eile an, als sie merkte, wie der Weg durch die Gassen von Kallmünz ihren Schritt automatisch verlangsamte. Spazieren. Genießen. Auf sich wirken lassen. Das tat sie viel zu selten, fiel ihr auf. Immer nur im Stechschritt durch Regensburg, zum Dönerstand, zum Bioladen, zu einem der viel zu raren Bewohnerparkplätze und wieder zurück. So wie die meisten anderen Regensburger werktags auch.
Dieser Ort hingegen, am Zusammenfluss von Vils und Naab gelegen, war ein Kleinod, das zum Innehalten geradezu aufforderte. Hatte hier in Kallmünz nicht sogar der bekannte Maler Wassily Kandinsky zu Beginn des 20. Jahrhunderts seine Sommerfrische verbracht? Mit seiner Flamme, der Künstlerin Gabriele Münter, fiel Lene ein, als sie die »Münter Stuben« erblickte.
Direkt neben diesem Café wartete schon das nächste auf, das Galeriecafé »Blaue Lilie«. Zu gern hätte Lene sich jetzt bei einem feinen Stück Kuchen und einer großen Tasse Milchkaffee auf der Felsenterrasse niedergelassen und die laue Sommerluft genossen. Um ehrlich zu sein, war das auch der Grund gewesen, weshalb sie den Wagen am diesseitigen Ortsrand abgestellt hatte. Vielleicht blieb nach getaner Arbeit noch Zeit für eine schnelle Einkehr. Sie sah sehnsüchtig auf das Fenster des Cafés, hinter dem ihr einige der zum Kauf angebotenen Skulpturen höhnisch entgegengrinsten, strich sich das wild gelockte braune Haar wenigstens am Scheitel glatt und trabte weiter.
Lenes künstlerische Ader war nicht allzu ausgeprägt, dennoch erschien es ihr selbstverständlich, dass dieser Ort schon damals Künstler angezogen hatte wie das sprichwörtliche Licht die Motten. Idyllisch und schmuck mit seinen mittelalterlich schmalen Gassen, den bunten Häusern, der Lage am Fluss, offenbarte ihr Kallmünz sogar im gleißenden Sonnenschein eine weitere Facette, oder wenigstens empfand Lene es so: Eine gewisse Enge, die durch den mitten im Ortskern so mächtig aufragenden Felsen nur noch betont wurde, verlieh dem Ort Dramatik und Eigenwilligkeit, und die vereinzelten ärmlichen Häuser mit windschiefen Fenstern und bröckelndem Putz, die sich zwischen den gepflegten, herausgeputzten immer wieder finden ließen, wirkten beinahe morbid. Womit sie bedauerlicherweise wieder beim Grund ihres Aufenthalts angelangt war.
Lene hatte Julia zwischen den hektisch herumwuselnden Erkennungsdienstlern auf dem Burgberg zurückgelassen, denn in Kürze wurde ein Einsatztrupp der örtlichen Feuerwehr erwartet, um bei der Bergung der Leiche zu helfen. Bis dahin sollten sämtliche vordergründige Spuren aufgenommen sein. Bisher hatten die Kollegen allerdings außer einem Zigarettenstummel derselben Marke, die man auch in Wahlenbergs Hosentasche gefunden hatte, keine nennenswerten Funde zu verzeichnen gehabt.
Zu ihrer Linken fiel ihr die Skulptur eines kleinen Pinguins auf, der auf einer stählernen Säule stand und arrogant über sie hinwegsah. Es gab so vieles zu entdecken, stattdessen würde sie gleich das stickige Hotelzimmer eines mausetoten Galeristen durchwühlen, um auf irgendetwas zu stoßen, das ihr verriet, was mit dem Mann geschehen war.
Sie würde das irgendwann nachholen, beschloss sie für sich, und beschleunigte ein weiteres Mal ihre Schritte.
»Lene!«, rief eine wohlbekannte Stimme in ihrem Rücken.
Sie drehte sich um. Trotz der spätsommerlichen Temperaturen und seiner altbewährten ledernen Bikerkluft schien Dr. Henning Adam, seines Zeichens Staatsanwalt mit Hang zu Zigarren, südafrikanischen Weinen und einer Harley-Davidson mit dem bezeichnenden Namen Eva, nicht ins Schwitzen zu geraten, als er lässig auf sie zutrabte. Die Sonne hatte sein ohnehin blondes Haar kräftig ausgebleicht, auch der gepflegte kurze Vollbart schien noch heller als sonst, stellte Lene fest. Vielleicht erweckte aber auch nur der Kontrast zu seiner tiefbraunen Haut diesen Eindruck.
»Du siehst aber erholt aus«, rief sie ihm entgegen.
»Erstaunlich.« Henning legte die letzten Meter zurück und nahm die Sonnenbrille ab. »Besonders erholsam fand ich die Woche Ibiza mit meiner allmählich ganz schön pubertären Tochter nämlich nicht.« Er beugte sich zu Lene herab und beglückte sie mit einer Umarmung, aus der sie sich rasch herauswand.
»Du Armer«, erwiderte sie. »Und danach musste in der Toskana auch noch deine bedauernswerte Leber leiden?« Es sprach ja nichts dagegen, den Staatsanwalt als guten Bekannten zu behandeln. Oder vielmehr als Freund, gestand Lene sich ein. Auf Nahkampf im Vollkontakt hatte sie aber wahrlich keine Lust, auch wenn Hennings allzu überschwängliche Begrüßung wohl seiner zweiwöchigen Abwesenheit geschuldet war.
Er lächelte. »Du hättest wirklich mitkommen sollen. Keine Spur von dem Kaffeefahrtflair, das du befürchtet hast. Tolle Weingüter, tolles Essen, lauter knackige Weinkenner und Feinschmecker, und ich meine mit ›knackig‹ nicht ihre Knochen. Mit meinen vierundvierzig Jahren war ich einer der Ältesten.«
»Trotzdem.« Lene schüttelte entschieden den Kopf. Ehrlicherweise musste sie sich eingestehen, dass das befürchtete Seniorenodeur nicht der einzige Grund gewesen war, weshalb sie Hennings Angebot, ihn auf der fünftägigen Weinreise in die Toskana zu begleiten, abgelehnt hatte. Aber das brauchte er nicht zu wissen. »Ich bin einfach kein Typ für Gruppenreisen.«
»Ich normalerweise auch nicht. Aber es hätte dir gefallen, wirklich«, gab er stur zurück. »Und ich dachte, nachdem ich jetzt den Kurztrip erprobt und für gut befunden habe, kommst du vielleicht nächstes Jahr auf die lange Reise mit.«
Fragend hob Lene die Augenbrauen.
»Drei Wochen Südafrika. Im Januar hat es dort dreißig Grad.«
»Klingt wirklich verlockend. Aber ich beschränke mich auf die Verkostung der Weine, die du nach Hause mitbringst.«
Er schien diese Antwort erwartet zu haben, wenigstens zuckte er nur lapidar die Achseln. »Dann also back to business. Erzählst du mir bei einer Tasse Kaffee, weshalb ich überhaupt hier bin? Da vorne ist ein netter Italiener mit Terrasse am Fluss.«
Fast bedauerte Lene, ihm schon wieder einen Strich durch die Rechnung machen zu müssen. Sie setzte zu einer Antwort an, aber er hob bereits ergeben die Hände.
»Ich seh schon, du bist heute ziemlich ungemütlich. Darf ich neben dir herlaufen, während du mich informierst? Oder ist dir das zu intim und du möchtest mir lieber später eine Mail schreiben?«
Lene lachte leise. »Neben mir herlaufen geht klar. Solange du dich nicht unterhakst.«
Mit übertriebener Erleichterung atmete Henning auf. »Also, meine unnahbare Lieblingskollegin: Wer ist tot, und vor allem: Warum?«
***
»Papa?«
Nur schemenhaft sah Quirin Eisenreich, wie seine Tochter den Kopf ins Schlafzimmer steckte. Sonnenlicht fiel durch die Ritzen des Rollos, im Flur draußen war es taghell. Aber bis seine eigene Sicht aufklarte, würde es wohl noch eine Weile dauern.
»Ich geh jetzt, Papa. Soll ich Licht machen?«
Quirin stöhnte und winkte ab. Alles, bloß das nicht. Die kleinste Bewegung fühlte sich an, als jagte jemand ein glühendes Schwert mitten durch sein Gehirn. »Wie spät ist es?«, fragte er mit schwacher Stimme und hoffte, dass Luna ihn trotzdem hörte.
»Zehn. Es ist so schön draußen, ich geh ein bisschen spazieren.«
Er hob matt die Hand und schloss die Augen, als Luna die Tür zumachte und ihre leichten Schritte sich auf dem Flur entfernten.
Er versuchte sich zu entspannen, aber dann kroch die Übelkeit in ihm hoch. Er wusste, dass sie nur zum Teil mit dem gestrigen Alkoholkonsum zu tun hatte. Entspann dich und zwing die Säure wieder nach unten. Ganz ruhig. Ganz –
Er hängte den Kopf über die Bettkante und erbrach sich auf den Holzboden. Ein zweites Würgen erstickte ihn beinahe, der Geruch des Erbrochenen stach in seiner Nase, bis der nächste Schwall auf den Boden klatschte. Er würgte ein weiteres Mal, spuckte aus, was sich in seinem Mund gesammelt hatte. Als er den bitteren Geschmack registrierte, wusste er, dass es vorbei war.
Ächzend ließ er seinen Kopf auf das Kissen zurücksinken. Es war nicht nur der Alkohol. Es war … alles. Lunas traurige Augen. Die leere Betthälfte neben ihm. Das selbst gemalte Ölbild über dem Bett: eine tief stehende Sonne kurz vor dem Untergang.
Dabei war seine eigene Sonne schon längst untergegangen. Vor sechs Jahren, um genau zu sein.
Manchmal, wenn er auf Saskias leere Betthälfte hinüberblickte, sah er sie wieder vor sich. Nicht so, wie er sie sehen wollte und wie sie die längste Zeit gewesen war, mit Luna tobend, lachend, am Klavier sitzend, während er malte, voller Temperament, sondern so, wie sie am Schluss ausgesehen hatte: abgemagert, apathisch, fremd, mit riesigen Augen, in die die Furcht vor dem Tod geschrieben stand, unruhig, voller Schmerzen, die auch die hoch dosierten Medikamente nicht beseitigen konnten. Nur dämpfen, so wie auch die Krankheit Saskia von Beginn an gedämpft hatte. Bis sie schließlich einfach erlosch.
Wieder kehrte die Übelkeit zurück. An diesem Tag hatte Luna nicht nur ihre Mutter an den Tod, sondern auch ihren Vater an den Alkohol verloren. Und es tat ihm weh, schmerzte bis auf die Knochen, zerfraß ihn, was er seinem eigenen Kind antat. Doch er kam nicht dagegen an.
Wo war er gestern eigentlich gewesen? Ach ja, im »Goldenen Löwen«. Er hatte mit dem Schweiger und seinen Kumpels ein paar Kurze getrunken. Na gut, nicht nur ein paar. Die anderen hatten abwechselnd ausgesetzt, nur er konnte einfach keine Pause machen, trank weiter und weiter, bis sich gnädiges Vergessen eingestellt hatte.
Wie war er eigentlich nach Hause gekommen? Sosehr er sich zu erinnern versuchte, in seinem Kopf herrschte Leere. Kein einziges Bild formte sich, kein noch so kleines Stückchen Erinnerung. Stöhnend richtete er sich auf, achtete darauf, nicht in sein Erbrochenes zu treten, und schleppte sich zu dem Stuhl hinüber, über dem sein Jackett hing. Seine Hand zitterte leicht, als er in die Innentasche griff und den silbernen Flachmann herauszog.
Er schraubte ihn auf, stellte auf Mundatmung um, um einen neuerlichen Anflug von Übelkeit zu verhindern, setzte das Fläschchen an und nahm einen großen Schluck.
Bald, dachte er und ging schwerfällig zum Bett zurück, die Hand fest um den Flachmann geklammert. Bald würde es ihm besser gehen.
***
»Und das ausgerechnet jetzt, wo die Chefin im Urlaub ist!« Mit schnellen Schritten eilte die junge Frau, die sich als Annalena Gleixner vorgestellt hatte, die breiten dunklen Holztreppen des Schlosses nach oben. Lene folgte ihr, nahm sich aber dennoch die Zeit, das stilvolle Interieur zu bewundern. Kunstwerke in knalligen Farben hingen an den hellen Wänden und bildeten einen perfekten Kontrast zu der geschichtsträchtigen Ruhe, die das historische Gemäuer ausstrahlte.
»Richtig schön«, murmelte Henning hinter ihr, und sie pflichtete ihm bei. Offensichtlich hatte sich der Herr Galerist mit dem »Hotel Schloss Raitenbuch« das beste Haus im Ort ausgesucht.
Im ersten Stock wandte Frau Gleixner sich nach rechts, trabte auf dem roten Teppich den Flur entlang bis zum Zimmer Nummer drei und schloss die Tür auf. »Bitte schön, sehen Sie sich ruhig um.«
Auch das Zimmer passte hervorragend zum stilvollen Ambiente des Hauses. Der dunkle Holzboden knarzte unter Lenes Füßen, als sie sich einen ersten Eindruck verschaffte. Hell, lichtdurchflutet und mit der obligatorischen Auswahl zeitgenössischer Kunst an den Wänden, bot Wahlenbergs Kallmünzer Bleibe neben einer Sitzgruppe und einem in einer Nische platzierten Doppelbett mit Himmel sogar Platz für einen raumbeherrschenden schwarz glänzenden Flügel, der dem Galeristen anscheinend als Ablage gedient hatte: Sein lederner Geldbeutel lag dort neben einem Schlüsselbund mit einem reichlich protzigen Jaguar-Autoschlüssel, Visitenkartenetui und Laptop.
Lene griff nach dem Portemonnaie, registrierte ein weiteres Bündel großer Scheine sowie diverse goldene Kreditkarten, die sich darin tummelten, und fand den Personalausweis, der die bereits vermutete Identität des Toten bestätigte. Johann Florian Wahlenberg war gerade erst zweiundfünfzig Jahre alt geworden.
»Wir haben das Zimmer unberührt gelassen«, sagte Frau Gleixner, zupfte nervös an ihrem blonden Pferdeschwanz und wies dann auf das gemachte Bett. »Er hat heute Nacht nicht hier geschlafen.«
Lene behielt für sich, dass das bei einem eingetretenen Tod vor zwei Uhr nachts nicht weiter ungewöhnlich war. »Wie haben Sie seine Abwesenheit bemerkt?«
»Er war heute Morgen nicht beim Frühstück, obwohl er gestern noch gesagt hat, dass ich für acht Uhr herrichten soll«, erklärte die junge Frau. »Nach dem Anruf Ihres Kollegen und der Personenbeschreibung habe ich natürlich nachgeschaut, ob er hier ist. Und nur das verwaiste Zimmer gefunden.«
»Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?«, fragte Henning und inspizierte den offenen Kleiderschrank, in dem einige Leinenhosen und eine Vielzahl quietschbunter Hemden hingen. Sein Blick blieb am Etikett eines Hemdes hängen, das ihn mit seinem wilden Muster in Lila und Rosa gerade noch dazu veranlasst hatte, schmerzlich das Gesicht zu verziehen. Jetzt pfiff er anerkennend durch die Zähne und schickte sich an, die Brusttaschen der Hemden zu durchsuchen, wobei er schon in die lederne Reisetasche spähte, die Wahlenberg auf der Holzvorrichtung neben dem Schrank abgestellt hatte.
»Gestern Vormittag«, erwiderte Frau Gleixner. »Nach dem Frühstück ist er wieder auf sein Zimmer gegangen, dann hat er das Hotel verlassen. So gegen elf, schätze ich. Er muss später noch einmal hier gewesen sein: Das Zimmer habe ich um halb zwölf gereinigt, die Badewanne hat er danach aber noch einmal benutzt.«
Lene sah in den Nebenraum. Am Boden der frei stehenden Wanne hatte sich eine kleine Wasserpfütze gebildet. Nachdem der Hahn nicht tropfte, schien Frau Gleixners Theorie zutreffend zu sein. Dazu passte auch das zusammengeknüllte Badetuch neben einem offen stehenden Kulturbeutel aus schwarzem Leder auf dem Fensterbrett. Über dem Waschbecken fanden sich eine Handvoll exklusiver Pflegeutensilien.
»Aber wann genau er wieder hier war …« Sie hob die Schultern. »Wir sind ein kleines Haus mit nur sechs Zimmern. Wenn jemand anreist, dann vereinbaren wir vorab eine Uhrzeit, oder die Gäste rufen mich einfach an, wenn sie angekommen sind. Ich bin also nicht immer vor Ort, aber das macht Frau Luber, die Chefin, auch so, wenn sie nicht gerade im Urlaub ist.«
»Luber?« Die Kallmünzer Gastronomenfamilie, die früher auch das Gasthaus »Zum Goldenen Löwen« betrieben hatte, war über Kallmünz hinaus in der Region bekannt. Selbstverständlich auch bei Lene, denn gutes Essen und exquisite Weine waren schließlich die einzigen Laster, die sie sich zugestand. Na ja, fast die einzigen.
Frau Gleixner nickte. »Eine Tochter der Familie. Hat das Hotel übernommen und das Yoga-Studio im Erdgeschoss ausgebaut. Deshalb auch die vielen Yoga-Angebote.«
Die Werbeschilder waren Lene bereits aufgefallen.
»Aber irgendwann muss sie ja auch mal Urlaub machen.« Frau Gleixner zögerte den Bruchteil einer Sekunde, dann schlug sie sich mit der flachen Hand vor die Stirn. »Jetzt fällt mir was ein: Ich hab dem Herrn Wahlenberg gestern für neunzehn Uhr einen Tisch im ›Goldenen Löwen‹ reserviert, für zwei Personen. Soll ich nachfragen, ob er dort war?« Ohne die Antwort abzuwarten, hatte sie sich bereits umgedreht und trabte aus dem Zimmer.
»Danke!«, rief Lene ihr nach und klappte den Ausstellungskatalog auf, der ebenfalls auf dem Flügel lag. Ein paar der abgebildeten Werke waren mittels Eselsohr auf der jeweiligen Seite markiert, ansonsten wirkte der Katalog druckfrisch und unberührt. »Am besten, wir nehmen den Geldbeutel und den Laptop direkt mit. Den Rest sollen sich die Erkennungsdienstler vornehmen.«
»Wo sie doch Hotelzimmer mit ihren wenigen Spuren immer ganz besonders gern mögen«, antwortete Henning und widmete sich mit Hingabe den Hosentaschen, bis ein lang gezogener Schreckensschrei ertönte und seine Bemühungen unterbrach.
Die beruhigende Stimme der Hotelmitarbeiterin erklang, aber Lene verstand nicht, was sie sagte. Vielleicht auch, weil eine tiefe Männerstimme zu jaulen anfing wie ein verletzter Bernhardiner. Lene gab Henning einen Wink, packte Laptop und Portemonnaie und machte sich auf den Weg zur Quelle dieser Lärmbelästigung.
Ein dramatisches, von Aufheulen durchbrochenes »Sagen Sie mir, dass das nicht wahr ist!« wies ihr den Weg hinunter ins Erdgeschoss und verschluckte beinahe das Geräusch von Hennings Schritten hinter ihr.
Als sie in der kleinen Halle anlangte, bot sich Lene ein skurriles Bild. Ein hochgewachsener, überaus stattlicher Mann mit grauschwarzer Löwenmähne drehte ihr den Rücken zu. In seinem weiten weißen Kittel, der ihm das Aussehen eines verrückten Professors verlieh, lehnte er in desolatem Zustand an der weißen Säule. Für den Moment hatte er das Jaulen eingestellt, stattdessen wedelte er mit der linken Hand, in der er ein Lorgnon hielt, durch die Luft. »Was ist geschehen? Sagen Sie mir, was geschehen ist, verdammt noch mal!«
Frau Gleixner warf Lene an seiner massigen Gestalt vorbei einen hilfesuchenden Blick zu. »Ich weiß es nicht, Herr Geiger. Aber ich kann Sie leider nicht in sein Zimmer lassen.« Sie legte ihre Hand beschwichtigend auf den Oberarm des Mannes, er jedoch schüttelte sie unwirsch ab. »Die Dame von der Polizei kann Ihnen bestimmt mehr sagen«, fuhr sie ungerührt fort und wies auf Lene.
Als der verrückte Professor sich zu ihr umdrehte, stellte Lene fest, dass er auch von vorne imposant aussah. Außerdem kam er ihr vage bekannt vor. Passend zu seiner Mähne auf dem Kopf trug er einen zauseligen Kinnbart von bestimmt zwanzig Zentimetern Länge, der unter dem verstörten Mahlen seines Kiefers zitterte und bebte. Aus tiefschwarzen schmerzverzerrten Augen starrte er sie an, dann besann er sich auf das Lorgnon in seiner Hand und klappte es mit Schwung vor seine Augen.
»Genau. Wagenbach von der Regensburger Kripo«, sagte Lene und deutete ihm mit einer Geste des Bedauerns an, dass sie aufgrund der Utensilien, die sie mitschleppte, auf den Handschlag verzichten musste. »Das ist mein Kollege Dr. Adam von der Staatsanwaltschaft. Und Sie sind?«
Beim Wort »Kripo« hatte der Mann aufgeschluchzt, jetzt barg er sein Gesicht in einer seiner riesigen Pranken.
»Nero Geiger«, übernahm Frau Gleixner die Vorstellung. »Herr Geiger arbeitet derzeit in Kallmünz an Werken für seine nächste Ausstellung. Herr Wahlenberg war –«
»War? War!«, schluchzte Geiger theatralisch auf und rang in einer Geste der Verzweiflung die Hände. »Er ist ein langjähriger Weggefährte!«, rief er. »Mein Freund, mein Galerist, mein Seelenpartner, mein …« Der Rest seiner Worte ging in einem erstickten Japsen unter.
»Bitte beruhigen Sie sich und nehmen Sie Platz«, sagte Lene und wies auf die Sitzgruppe, die hinter der Säule stand.
»Beruhigen? Wie soll ich mich beruhigen, wenn ich nicht weiß, was –« Mit einem schnellen Schritt war er bei ihr und rüttelte sie an der Schulter.
Kaum hatte Geiger Lene angefasst, kam Henning auf ihn zugestürzt, aber Lene hielt ihn mit einer beschwichtigenden Geste zurück. Sie würde Geiger selbst in seine Schranken weisen. »Ebendeshalb«, sagte sie kühl. »Wenn Sie sich nicht endlich beruhigen, kann ich Sie kaum darüber informieren, was Ihrem Seelenpartner zugestoßen ist, Herr Geiger.«
Das Argument schien zu wirken, wenigstens ließ sich der aufgebrachte Künstler mit einem resignierten Seufzen auf dem senfgelben Sofa nieder.
In aller Seelenruhe stellte Lene den Laptop auf dem Tisch ab und setzte sich auf den Sessel gegenüber. Endlich fiel ihr ein, woher sie den Mann kannte. Im letzten »Monopol«-Magazin, das sie in einem Café durchgeblättert hatte, hatte es einen Artikel über ihn und seine sehnsüchtig erwarteten neuen Werke gegeben. Wenn Lene sich nicht täuschte, saß sie soeben vor einem von Deutschlands namhaftesten – und teuersten – zeitgenössischen Künstlern.
In Ermangelung weiterer Sitzgelegenheiten lehnte Henning sich an die Säule, anscheinend wollte er sich nicht zu Geiger auf die Couch kuscheln, obwohl dieser plötzlich recht lethargisch wirkte.
»Ich höre«, sagte Geiger, lehnte sich zurück und legte stöhnend eine Hand über die Augen.
»Herr Wahlenberg ist heute früh in der Nähe der Burgruine tot aufgefunden worden.«
Geiger schnappte nach Luft.
»Offensichtlich ist er einen Abhang hinuntergestürzt«, fuhr Lene fort und registrierte die einsame Träne, die unter Geigers Hand hervorkullerte. »Können Sie mir sagen, was er in Kallmünz wollte?«
»Ich muss mich ausruhen.«
»Das können Sie, sobald Sie uns erste Informationen gegeben haben«, erwiderte Lene resolut. »Also, was hat er hier gemacht?«
»Mich besucht«, antwortete Geiger schlapp, nahm endlich die Hand von den Augen und starrte auf einen Punkt irgendwo zwischen Lene und Henning. »Wir arbeiten an der nächsten Ausstellung. Er wollte meine Werke sehen und …« Sein Blick schwenkte zu Lene, wich dem ihren aber sofort wieder aus. »Und mich wohl auch«, fügte er hinzu.
»Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen?«
»Gestern Abend.« Mit einem Seufzen schloss Geiger die Augen. »Wir waren miteinander im ›Goldenen Löwen‹. Danach bin ich in mein Atelier gegangen, das liegt auch in der Vilsgasse, ein Stück weiter.« Mit einer vagen Handbewegung deutete er in die relevante Richtung, ohne die Augen zu öffnen. »Jojo wollte ins Hotel zurück.«
»Um wie viel Uhr war das?«
Geiger zögerte einen Moment. »Im Atelier habe ich auf die Uhr gesehen, da war es elf.«
Volltreffer. Eine Festlegung des Todeszeitpunkts auf die Zeit zwischen dreiundzwanzig und zwei Uhr war für die Kürze der bisherigen Ermittlungen ein erfreulich konkretes Ergebnis.
»Hat er Ihnen gegenüber erwähnt, dass er noch zur Burg hinaufsteigen wollte?«
»Nein, ich sagte doch: Er ist zurück ins Hotel gegangen!«, brauste Geiger auf.
»Haben Sie das gesehen?«
»Wir haben uns unten auf der Vilsgasse voneinander getrennt«, sagte er matt.
Das Hotel war von der Gasse aus über einen kurzen Aufgang zu erreichen, der Haupteingang lag auf der rückwärtigen Gebäudeseite. »Sie haben also nicht gesehen, wie er das Hotel betreten hat?«, vergewisserte sich Lene.
Geiger schüttelte stumm den Kopf.
»Arbeiten Sie öfter so spät abends?«, fragte Henning.
»Meine Muse kommt meist mit dem Nachtvogel hereingeflattert«, gab er zurück, und zum ersten Mal war Lene dankbar für seine geschlossenen Augen. Schließlich konnte sie so unverfroren einen Blick mit Henning tauschen, der den Verdacht nahelegte, dass auch er Geigers kryptisches Gebaren halb nervtötend, halb amüsant fand.
»Hatten Sie gestern Abend Streit mit Herrn Wahlenberg? Oder hatte er Ihres Wissens noch Kontakt zu anderen Leuten hier in Kallmünz?«, fragte Henning.
»Sie glauben doch nicht …«, setzte Geiger an und riss seine Augen sperrangelweit auf.
Lene winkte ab. »Wir können im Moment noch keine Aussage treffen. Aber je früher –«
»Jaja, bla, bla.« Geiger schloss die Augen wieder. »Ich glaube nicht, dass er hier noch irgendjemanden kennt. Und wir, Jojo und ich, waren zwei Seelen im Gleichklang, wie üblich. Wir streiten nicht.« Er schnaubte feindselig. »Aber wie Sie sicher sehen: Mir geht es nicht gut. Ich ruhe mich jetzt aus.«
»Hier?«, fragte Lene.
Die Hotelmitarbeiterin, die an der Säule vorbeieilte, nickte schicksalsergeben. Ihrem resignierten Gesichtsausdruck nach zu schließen, nutzte Geiger dieses Sofa nicht zum ersten Mal für ein Päuschen. »Ich muss in die ›Orangerie‹ rüber, Frühstück abräumen«, sagte sie. »Falls Sie noch was brauchen …«
»Wir kommen mit«, verkündete Lene und sah wieder zu Geiger.
Er atmete tief und langsam ein, dann ein zweites Mal, schneller. Der dritte und vierte Atemzug ähnelten eher einem gehetzten Hecheln. Nummer fünf fiel wieder tief und langsam aus.
»Brauchen Sie einen Arzt?« Schließlich sollte niemand Lene nachsagen, sie würde ihre Ermittlungen über die Gesundheit potenzieller Zeugen stellen.
Geiger machte eine abwehrende Geste, ohne sie anzusehen.
»Er macht seine Atemübungen«, erklärte Frau Gleixner resigniert und öffnete die schwere Tür des Haupteingangs. »Die hat er jedes Mal gemacht, wenn er hier auf Herrn Wahlenberg gewartet hat«, fuhr sie fort, während sie den mit Tischen und Stühlen ausgestatteten Hof überquerten, ein paar Steinstufen hinabstiegen, einen weiteren kleinen Freisitz passierten und schließlich das in einem Nebengebäude untergebrachte Café betraten. »Oder auf irgendeinen anderen seiner Künstlerfreunde. Er bleibt ja jedes Jahr ein paar Monate hier, bis in den Herbst.«
Gemütlich war es hier, mit nur drei Holztischen, auf denen zum Teil noch Reste des verzehrten Frühstücks standen, einem kurzen Tresen und einem orange leuchtenden »Orangerie«-Schriftzug, der den Stil des Hauses – Altes, Traditionelles durch ein paar ausgewählte knallige Stücke mit der Gegenwart zu verbinden – fortsetzte.
»Und nach den Atemübungen«, fuhr Frau Gleixner mit gedämpfter Stimme und gerunzelter Stirn fort, »will er dann einen Schnaps.«
Lene wies auf den wohlsortierten Barbestand im Hintergrund. »Alles für Herrn Geiger?«
»Wir haben hier im Sommer ab und an Barbetrieb.« Sie schickte sich an, den ersten Tisch abzuräumen, überlegte es sich dann jedoch anders und huschte hinter den Tresen.
»Wenn Herr Geiger mit dem Hecheln fertig ist, sagen Sie ihm doch bitte, dass er sich für weitere Fragen in den nächsten Tagen bereithalten soll«, bat Lene. »Das gilt auch für Sie, Frau Gleixner. Und wir müssen Wahlenbergs Jaguar erkennungsdienstlich behandeln. Außerdem …« Die Hotelmitarbeiterin war so kooperativ gewesen, dass Lene nun direkt ein schlechtes Gewissen verspürte, ihr das Geschäft versauen zu müssen. »Das Hotelzimmer müssen wir versiegeln, bis sämtliche Spuren gesichert sind.«
Die junge Frau nickte. »Ich geb der Chefin Bescheid. Herr Wahlenberg wäre ohnehin erst in drei Tagen wieder abgereist. Und er hat im Voraus bezahlt.« Mit einem Seufzen holte sie eine Spirituosenflasche und drei Schnapsstamperl aus dem Regal und schenkte das erste Glas voll. »Das ist eigentlich der Marillengeist für den Geiger«, sagte sie und setzte die Flasche ab. »Aber wenn’s besonders arg wird … Für Sie beide auch?«
Henning machte eine abwehrende Geste.
»Nein, danke«, antwortete Lene. »Ich bin an Leichen gewöhnt.«
»Und an exzentrische Künstler?«, fragte Frau Gleixner.
»Wir hoffen, dass wir unsere Ermittlungen schnell abschließen können«, gab Henning diplomatisch zurück.
***
Verbissen trug Miriam die mit körniger Strukturpaste vermischte schwarzgraue Farbe auf die Leinwand auf, wie ihr Professor an der Kunsthochschule es ihr gezeigt hatte. Die Arbeit mit der Spachtel ging ihr immer noch nicht leicht von der Hand. Schon jetzt zweifelte sie daran, dass sie damit den beabsichtigten Effekt erzielen würde.
Es war ihr egal, ob sie von Kollegen und Kunstkritikern für ihre rohe, direkte Kunst gelobt und geachtet wurde. Auch die beiden Förderpreise, die sie seit Beginn ihrer Künstlerlaufbahn erhalten hatte, waren ihr egal. Abgesehen davon, dass sie jegliche Anerkennung ohnehin für geheuchelt hielt, wollte sie einfach selbst nicht, dass ihre Kunst so aussah, wie sie aussah: trampelig und brachial. Was hätte sie dafür gegeben, luftigere, elegantere Werke zu erschaffen? Aber das vermochte sie nicht.
Wieder einmal befiel sie die Angst, irgendwann enttarnt zu werden, als Nichtskönnerin, Nichtkünstlerin, mit profaner Seele und noch profanerer Pinselführung, denn es kostete sie von Tag zu Tag mehr Energie, zu verschleiern, dass ihre Bilder nicht dem entsprachen, was ihr im eigenen Kopf vorschwebte. Es war ganz einfach: Sie hatte kein Talent. Oder wenigstens nicht genug.
Sie ließ die Spachtel sinken und sah zu Tabea hinüber, die den Torso aus Draht in diesem Moment an den Brüsten auseinanderzog, bis in der Skulptur ein sich nach unten bis ungefähr zum Nabel hin verschmälernder Spalt klaffte. Wie hatte sie es geschafft, den Draht so perfekt zu modellieren? Das Werk zeigte jetzt, lange vor der Vollendung, schon all das, was Miriam vergeblich zu erreichen suchte: Leichtigkeit. Eleganz. Aber trotzdem – oder gerade deswegen – eine ungeheuerliche Intensität.
Auf der Werkbank brummte Tabeas Smartphone, und sofort ließ sie von der gespaltenen Drahtfrau ab und nahm den Anruf entgegen. »Ja? … Was ist – Ja, natürlich. Ich komme.« Tabea legte auf und streifte ihr schwarzes, eng am Oberkörper anliegendes Kleid glatt. »Nero braucht mich.«
»Was ist passiert?«, fragte Miriam.
Tabea zuckte die Achseln. »Das hat er nicht gesagt. Aber er ist furchtbar aufgeregt.« Sie griff nach ihrem Schlüssel, der wie immer auf der hölzernen Kommode lag, steckte das Smartphone in ihre dunkelrote Samttasche und verließ mit einem schnellen Winken das Atelier.
Nero braucht mich. Mich. Mich. Mich.
Nur um sicherzugehen, zog Miriam ihr eigenes Smartphone aus ihrer Handtasche. Kein Anruf, keine Nachricht. Natürlich nicht. Offenbar brauchte Nero sie nicht. Offenbar duldete er sie nur, weil Tabea es so wollte. Dass sie, Miriam, von Tabeas Gnade abhing, machte sie nur noch wütender.
Viel zu heftig zog Miriam die Spachtel über die Leinwand, befand das Ergebnis für roh und direkt und stellte fest: Dieses Mal war es ihr recht.
***
Bisher hatte die Spurensicherung keinerlei Hinweise auf die Anwesenheit einer weiteren Person am Fundort der Leiche entdeckt.
Die Bergung des toten Galeristen hatte sich zunächst nicht ganz einfach gestaltet, war aber dank beherzter Unterstützung des THW doch halbwegs schnell über die Bühne gegangen, und die Obduktion Wahlenbergs war bereits für den folgenden Vormittag angesetzt. Auch Bertl wollte den Fall, im wahrsten Sinne des Wortes, schnell vom Tisch bekommen.
Lene sah von ihrem Schreibtisch aus auf den Parkplatz der Dienststelle hinaus, wo Henning die lautstark blubbernde Eva abstellte und sich elegant vom Sattel schwang. Erstaunlicherweise hatten ihm drei Stunden ausgereicht, um das nach zwei Wochen Abwesenheit angeblich überbordende Chaos in seinem eigenen Büro zu lichten.
»Schau dir das mal an!« Julia drehte ihren Monitor, sodass Lene den mit dem Logo einer bekannten Boulevardzeitung geschmückten Artikel einsehen konnte.
»Respekt«, sagte Lene und beäugte mit zusammengekniffenen Augen Wahlenbergs Porträt in Großaufnahme. »Der war ja richtig prominent.«
»Ist nur in einer Regionalausgabe erschienen.« Julia drehte den Monitor wieder zurück. »Aber das meine ich nicht.«
Während Lene sich gerade mit der Sichtung von Wahlenbergs Smartphone befasste und David, der nach dem Beginn seiner Laufbahn als Informatiker über Umwege bei der Polizei gelandet war, versuchte, das Laptop-Passwort des toten Galeristen zu knacken, beschäftigte sich Julia mit der Recherche zum Opfer. Wahlenberg war bei der Polizei nicht aktenkundig, aber dass es keinerlei Angehörige zu benachrichtigen gab, hatte man in der Zwischenzeit immerhin schon herausgefunden. Umso schwieriger gestaltete es sich, an Informationen über den Toten zu kommen, zumal auch Wahlenbergs WhatsApp-Korrespondenz bisher wenig Brauchbares ergab: Hier hatte er in den letzten Tagen vornehmlich mit Nero Geiger kommuniziert, auf eine knappe Art, die angesichts Geigers Exaltiertheit beinahe seltsam wirkte. Aber vielleicht brauchte es bei Seelenpartnern dieses ganze exzentrische Blabla auch nicht.
»Hör zu«, sagte Julia und fokussierte wieder den Zeitungsartikel vor sich. »Eigentlich geht es in dem Artikel darum, dass Wahlenberg eine Kooperation mit einer anscheinend bekannten Londoner Galerie eingegangen ist. Aber hier, dieser Absatz: ›Längst hat sich der Düsseldorfer Galerist in der Szene einen Namen gemacht, und das nicht nur aufgrund seines kunsthändlerischen Geschicks. Exquisite Kleidung, ausgefallenes Schuhwerk, teure Zigarren und das Glas Champagner in der Hand kennzeichnen ihn ebenso wie Gerüchte über sexuelle Ausschweifungen, die nach Informationen eines Branchenkenners selbst vor Minderjährigen nicht haltmachen.‹«
»Ist das die charmante Umschreibung für einen Kinderschänder?«, fragte Lene. »Oder was bedeutet das?«
Julia zuckte unschlüssig die Achseln.
»Auf jeden Fall interessant«, stellte Lene fest.
»Finde ich auch«, sagte Henning, der in diesem Augenblick das Büro betrat, in die Runde grüßte und sich auf den Besucherstuhl fläzte. »Das wäre ein starkes Stück.«
»Der Artikel ist allerdings von 2006«, stellte Julia fest und quittierte Hennings erneutes Auftauchen mit einem erstaunten Blick. »Ich seh mal zu, ob ich noch mehr darüber finde.«
»Vielleicht hat er sich aus Gram über seine früheren Untaten den Abhang hinuntergestürzt.« Lene legte den Ausdruck der Textnachrichten auf Wahlenbergs Handy beiseite und hoffte darauf, dass die noch ausstehende Auswertung der Telefonanrufe aufschlussreicher ausfallen würde.
»Was machen die Ermittlungen?«, fragte Henning.
»Wir sichten Wahlenbergs Kram, sehen uns die Obduktion morgen an, warten auf die Ergebnisse der Spusi, interviewen nochmals den Geiger, die Leute vom ›Goldenen Löwen‹ und vom Raitenbucher Schloss, und wenn es dann keine Ungereimtheiten gibt –«
»… wurde Wahlenberg bei seinem Mondscheinspaziergang Opfer eines tragischen selbst verschuldeten Unfalls«, beendete Julia den Satz. »Schön wär’s. Also, wenigstens für uns. Für das Opfer natürlich nicht.«
»Das klingt nicht allzu stressig«, stellte Henning fest.
Julia sah auf. »Ich hab momentan mit der Hochzeit ohnehin genug am Hals.«
Lene unterdrückte das genervte Schnauben, das sie sich nur gestattete, wenn Julia es nicht hörte. Die in einem Monat anstehende Hochzeit mit ihrem Matze war derzeit Julias alles beherrschender Lebensinhalt, und Lene bluteten von dem ganzen Gedöns, das seltsamerweise meistens weniger romantisch als geschäftsmäßig klang, schon längst die Ohren. Fast wünschte sie sich Moritz Lochbihler, der derzeit mit Kollegin Sarah einem nebulösen Prostituiertenmord nachging, als Co-Ermittler für diesen Fall zurück.
Allzu stressig versprachen die anstehenden Ermittlungen allerdings tatsächlich nicht zu werden, damit hatte Julia ganz recht. Umso mehr freute Lene sich auf einen lauschigen Abend auf ihrem hoch gelegenen Balkon, Prunkstück und – wenigstens im Sommer – heimliches Herz ihrer schmucken Wohnung mitten in der noch schmuckeren Regensburger Altstadt. Ein Glas Wein, den schnurrenden flauschigen Kater Marek auf dem Schoß und einfach die Seele baumeln lassen, wie sie es schon vorhin in Kallmünz nur zu gern getan hätte.
»Hast du Lust, heute Abend meine Rückkehr mit einem Glas Wein zu feiern?«, wandte Henning sich an sie. »Ich habe einen tollen Vernaccia mitgebracht.«
Nur einen kurzen Moment dachte Lene darüber nach, ob sie sich von ihrer Balkonvision verabschieden wollte. »Irgendwann demnächst, ja? Bei mir kommt die Müdigkeit heute bestimmt mit dem Abendvogel hereingeflattert.«
»Häh?« Julia sah Lene ähnlich entgeistert an, wie sie selbst am Vormittag wohl Geiger angesehen hatte.
»Musst du nicht verstehen«, antwortete Lene grinsend und schickte sich an, ihren PC herunterzufahren.
***
Der Barkeeper warf Miriam über den Tresen hinweg ein Lächeln zu, wandte sich aber schon wieder ab, bevor sie reagieren konnte. In Ermangelung unterhaltsamer Gäste begann er, die ohnehin chromglänzende Kaffeemaschine zu polieren.
Wenigstens hatte Tabea Miriam für wichtig genug erachtet, um sie telefonisch über den Grund für Neros Zusammenbruch zu informieren. Seither allerdings machten sich in Miriam zunehmend Frust und Enttäuschung breit. Frust darüber, dass sie, im Gegensatz zu Tabea, nicht gebraucht wurde. Dass Nero sich von Tabea umsorgen und hätscheln ließ, während sich ihre eigenen Hoffnungen wieder einmal erledigt hatten. Enttäuschung angesichts des Pechs, das sie verfolgte. Sie war so nah dran gewesen, verdammt!
Wenn sie nur wahrgenommen würde, nicht als mindertalentierte Provinzkünstlerin, sondern als nationale Hoffnungsträgerin, dann, das wusste sie, würde sie über sich selbst hinauswachsen! Was ihre Kunst und ihre Persönlichkeit anging, denn wenn sie ehrlich war, fühlte sich die ständige Missgunst an wie eine klebrige Haut, die sie nicht abstreifen konnte. Aber wenn sie endlich Erfolg hätte, würde sie sich schälen und die echte, die glückliche, die großzügige Miriam zum Vorschein kommen.
Sie nippte an ihrem Moscow Mule, der ihr heute nicht schmecken wollte, obwohl sie die beflügelnde Wirkung mehr denn je ersehnte, und ließ ihren Blick durch das kleine Lokal schweifen. Die »Orangerie« im Raitenbucher Schloss war gemütlich, hätte aber mit ihrem speziellen Charme genauso gut nach Regensburg oder vielleicht sogar München gepasst. Umso erstaunlicher, dass Miriam heute der einzige Gast war.
Sie verzog das Gesicht zu einer Grimasse und nippte ein weiteres Mal, worauf der Barkeeper sie fragend ansah. »Nicht gut?«
»Doch, alles okay«, winkte sie ab.
»Kommt Tabea heute gar nicht?«, fragte er auffällig unauffällig.
Schon wieder. »Die ist anderweitig verabredet«, sagte Miriam kühl.
Das Telefonat mit Tabea schlich sich zurück in ihre Gedanken. Aus ihren Worten hatte nur die Sorge um Nero geklungen. Keine Spur von Enttäuschung über das unerwartete Ableben ihres gemeinsamen Hoffnungsträgers! Kein Wort darüber, dass sie auch persönlich von diesem Schicksalsschlag betroffen war! Warum bloß musste Tabea zu allem Überfluss auch noch frei von Bösartigkeit und Egoismus sein? Genau das machte es so unmöglich, sie uneingeschränkt zu hassen. Obwohl Miriam doch genau das am liebsten tun wollte.
Sie schreckte auf, als sich die Tür öffnete und Andreas Puntus eintrat. Allein. Ohne seinen Schatten Daniel, genannt Danny, der Andreas nicht das Wasser reichen konnte und ihm dennoch auf Schritt und Tritt folgte. Aber, fragte sich Miriam bitter, verhielt es sich bei ihr und Tabea eigentlich anders?
Andreas Puntus fuhr sich mit der Hand durch das dichte braune Haar und scannte die »Orangerie« mit einem schnellen Rundumblick. Sein kariertes Hemd war schmal geschnitten, steckte in engen Jeans und betonte seine lange, schlanke Statur. Für einen CSU-Marktrat sah er erstaunlich cool aus, stellte Miriam nicht zum ersten Mal fest.
Als er sie am Tisch neben dem Eingang entdeckte, hellte sich sein Gesicht schlagartig auf. Mit einem feinen Lächeln um die Lippen trat er auf sie zu. »War also doch eine gute Idee, noch auf einen Drink herzukommen. Darf ich?« Er deutete auf den freien Platz neben ihr.
»Bitte«, sagte sie schwach und versuchte, ihr plötzlich schneller klopfendes Herz zur Ruhe zu zwingen. Vergeblich.
»Was trinkst du?«, fragte er. »Moscow Mule? Nehm ich auch.« Er gab dem Barkeeper ein Zeichen und wandte sich dann mit einem breiten Lächeln wieder Miriam zu. »Wartest du auf jemanden?«
Sie schüttelte wortlos den Kopf und hoffte, dass er ihr die Enttäuschung nicht ansah. Schon wieder jemand, der sich nur deshalb über ihre Anwesenheit freute, weil er auf das baldige Erscheinen von Tabea hoffte.
»Gut«, antwortete Puntus. »Ich find’s schön, dir mal allein zu begegnen. Ohne Anhang.«
Meinte er das ernst? Noch nie hatte jemand Tabea als ihren Anhang bezeichnet.
»Doch, wirklich«, bekräftigte er. »Darauf warte ich schon seit ein paar Wochen.« Er nahm den Moscow Mule aus den Händen des Barkeepers entgegen und hielt ihn auffordernd in Miriams Richtung. »Trinken wir darauf, dass sich meine Hoffnung erfüllt hat.«
Es fiel Miriam schwer, ihm zu glauben. Dennoch rang sie sich zu einem Lächeln durch und stieß mit ihm an. Der unverwandte Blick, den er ihr über den Rand seines Glases zuwarf, machte sie nervös, als sie trank und ihr Glas mit bemüht ruhiger Hand zurück auf den Tresen stellte.
»Ist alles okay?«, fragte er.
Miriam streifte sich das dunkelblonde Haar glatt, das sicher so aussah, als hätte sie es sich den ganzen Tag gerauft. Was genau genommen auch zutraf. »Na ja …«, antwortete sie zögerlich. »Ich hatte einen beschissenen Tag, um ehrlich zu sein.«
Puntus sah sie fragend an, aber sie hob abwiegelnd die Hand. Er brauchte nicht zu wissen, wie sehr sie auf Wahlenberg gehofft hatte.
»Den hatte ich auch«, antwortete er und legte beiläufig seine gepflegte Hand mit den langen, schlanken Fingern auf ihre. »Aber es sieht so aus, als würde mich der Abend dafür entschädigen.«
ZWEI
Als Lene am nächsten Morgen in der Dienststelle ankam, herrschte an ihrem eigenen Schreibtisch zu ihrem Erstaunen schon rege Betriebsamkeit. David hatte Wahlenbergs Laptop aufgebaut, darum scharten sich nun zwei weitere Kollegen vom Erkennungsdienst und eine sichtlich interessierte Julia.
»Gut, dass du da bist!«, rief sie Lene entgegen, kaum dass diese die Türschwelle überschritten hatte. »David ist drin. Und er hat auch schon ein paar … ähm … bemerkenswerte Dokumente gefunden, sagt er.«
»Bemerkenswert also.« Lene gesellte sich zu den Kollegen. »Habt ihr Jungs die Nacht durchgearbeitet, oder wie?«
»Es kränkt mich in meiner Ehre, wenn ich nicht an Daten komme«, erwiderte David. »Also hab ich heute ziemlich früh angefangen, und dann konnte ich mich nicht mehr losreißen.«
»Die Spannung ist kaum auszuhalten«, stellte Lene spröde fest.
»Wir haben uns natürlich zuerst auf Wahlenbergs Mailprogramm gestürzt«, sagte er und wies mit dem Kopf auf seine beiden Kollegen vom Erkennungsdienst, die eifrig nickten. »Das war aber eher langweilig. Nur Geschäftliches aus unserer Sicht, solltet ihr beide vielleicht nochmals überprüfen. Und auch den Terminplaner haben wir für euch aufgehoben. Aber damit«, fuhr er fort, beugte sich vor und öffnete mittels Mausklick einen der zahlreichen Ordner auf dem grellpinken Desktop, »haben wir uns direkt beschäftigt.«
Unzählige Fotos im Kleinformat kamen innerhalb des Ordners zum Vorschein. So klein, dass Lene nichts erkennen konnte. »Kann man die mal ansehen?«
David johlte, doppelklickte aber folgsam das erste Foto. Ein nackter, sehr schlanker Frauenkörper war abgebildet, mit nur einem zarten Ansatz von Brüsten und knabenhaft schmalen Hüften. Die Person, der zumindest fotografisch der Kopf abgeschnitten worden war, rekelte sich mit gespreizten Beinen auf einem breiten Holzbett mit zartgrauen Satinlaken.
Und das vor der ersten Tasse Kaffee. »Danke schön, jetzt bin ich wach«, sagte Lene. »Sind die alle so?«
»Im Prinzip schon«, antwortete David und klickte munter weiter. Die vermutlich selbe Person, erneut kopflos, lag mit dem Oberkörper auf einem Glastisch und reckte ihren Po in die Linse des Fotografen. »Allerdings in unterschiedlichen Posen und auch mit unterschiedlichen … äh … Models. Ich habe ungefähr siebzig verschiedene Personen gezählt.«
Wie zur Bestätigung zeigte das nächste Foto einen kopflosen Mann, stark behaart und mit erigiertem Penis, an den er gerade selbst Hand anlegte.
»Männer und Frauen also?«, fragte Lene, nur um sicherzugehen.
»Ja, wild gemischt. Wobei von den Frauen keine einzige besonders … äh …« Mit den Händen deutete David einen Vorbau in Lolo-Ferrari-Größenordnung an.
»Also eher androgyn«, kam Lene ihm zu Hilfe.
»Das war das Wort, das mir nicht eingefallen ist.« David grinste. »Die Männer hingegen sind alle sehr bullig. Und haarig. Wie Tom Selleck oder so.«
»Dann war der Zeitungsartikel über seinen ausschweifenden Lebenswandel also doch nicht aus der Luft gegriffen. Könnten Minderjährige dabei sein?«
»Schwer zu sagen.« David klickte weiter und blieb schließlich an einem weiteren knabenhaften Frauenkörper hängen. »Ohne Kopf kann ich persönlich nicht beurteilen, ob diese Frau siebzehn oder dreißig ist. Aber um Kinder handelt es sich eindeutig nicht.« Er klickte weiter zu einer Nahaufnahme eines Penis, bei dem sich jede Ader, die sich zur Spitze schlängelte, abzeichnete.
Angewidert verzog Julia das Gesicht. »Wie unästhetisch. Warum macht man so was?«
David zuckte gleichgültig die Achseln. »Er hat halt Wichsvorlagen gesammelt.«
»Oder Trophäen«, mutmaßte Lene. »Jede erfolgreiche Eroberung wurde fotografisch festgehalten. Besteht irgendwie die Möglichkeit, diese Personen zu identifizieren?«
»Du meinst, mit Google-Bildersuche?« David gluckste. »Er hat fein säuberlich darauf verzichtet, die Gesichter zu fotografieren, insofern sind wir da aus meiner Sicht chancenlos. Es sei denn, du willst einen öffentlichen Aufruf starten.« Gestisch malte er ein Fahndungsplakat an die Wand. »Wer kennt diese Titten?«
»Schlechte Idee«, räumte Lene ein.
»Interessant ist aber vielleicht«, fuhr David fort, »dass eine bestimmte Person sehr häufig festgehalten wurde.« Er scrollte innerhalb des Ordners ein Stückchen nach unten und öffnete ein weiteres Foto. »Er hier.«
Das Bild zeigte einen mächtigen Männerkörper, ebenfalls stark behaart, bei dem das grauschwarze zauselige Haupthaar bis auf die Schultern hing. Auch hier fehlte der Kopf, aber der ziemlich wilde Bart klebte der Person an der verschwitzten Brust. Es gab keine Zweifel.
»Das ist der Geiger«, stellte Lene fest. »Die beiden waren also nicht nur Seelenpartner. Die hatten auch was miteinander.«
»Ist mir unbegreiflich. Von diesem verhutzelten Altmännerpenis wird sogar mir schlecht«, stellte David fest. »Und ich halte echt was aus«, fügte er im Brustton der Überzeugung hinzu.
»Das sieht bei großen Männern immer so aus«, erklärte Julia völlig überzeugt. »Je größer der Mann, desto kleiner wirkt der Penis. Oder wie ist das beim Adam, Lene?«
»Woher soll ich das wissen?« Lene versuchte die Erinnerung an den gerade in die Badewanne steigenden Henning auszublenden. »Der Geiger taucht also immer wieder auf, sagst du? Das erklärt auch seinen gestrigen Zusammenbruch. Dazu müssen wir ihn auf jeden Fall noch befragen. Nach der Obduktion.«
Sie gab Julia einen Wink. »Wenn wir pünktlich in Erlangen sein wollen, müssen wir …« Der schnelle Blick auf die Armbanduhr war ernüchternd. »Seit rund zwanzig Minuten unterwegs sein.«
»Der nächste verhutzelte Schniedel«, seufzte Julia und erhob sich. »Das wird heute wohl nicht mehr besser.«
»Na, wo bleibt ihr denn? Es ist allerhöchste Zeit, der Mann wird ja nicht frischer«, sagte Bertl, als er Julia und Lene, immerhin mit nur geringer Verspätung, in Empfang nahm. »Ich hab schon überlegt, ob ich dich anrufe«, fuhr er an Lene gewandt fort. »Wir haben beim Entkleiden nämlich etwas entdeckt. Aber dann wollte ich uns allen die Überraschung nicht verderben.«
Julia drehte die Augen genervt gen Himmel, Lene hingegen konnte sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Bertls Überraschungen waren zwar selten amüsant, seine überbordende Begeisterung für seine Leichen dafür umso mehr.
»Kommt her und seht euch das an«, sagte er mit gespanntem Vibrato in der Stimme und trat an den Sektionstisch, auf dem der entkleidete Wahlenberg lag, noch mit pietätvoll zugedecktem Kopf, und geduldig der unschönen Dinge harrte, die da kommen sollten. Bertl zog den über dem Tisch hängenden Strahler näher herab, sah Lene und Julia bedeutungsschwanger an und deutete dann, genüsslich langsam, auf einen kleinen blutigen Fleck auf Wahlenbergs Oberkörper. Genauer gesagt, auf Höhe seines Herzens.
»Was ist das?«, fragte Julia und trat einen Schritt näher.