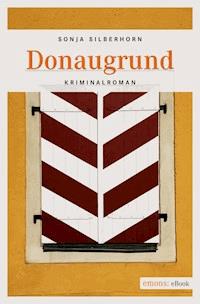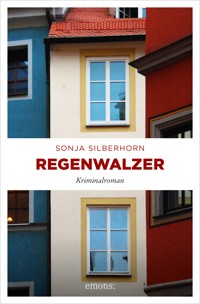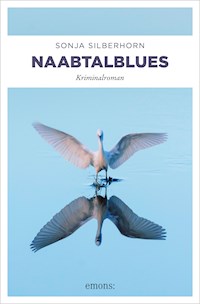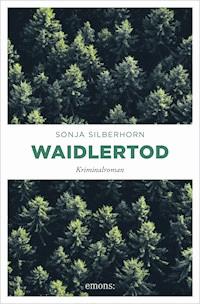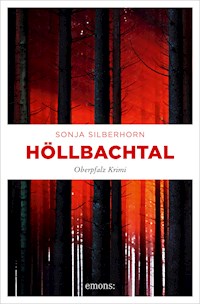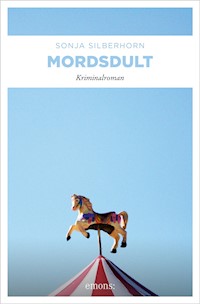
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lene Wagenbach
- Sprache: Deutsch
Ein Bombenanschlag auf der Dult versetzt die Regensburger in Angst und Schrecken. Sarah Sonnenberg und Raphael Jordan übernehmen die Ermittlungen. Doch noch während sie nach ersten Anhaltspunkten suchen, detoniert der nächste Sprengsatz. Wer will dem Volksfest und seinen Besuchern schaden? Als ein Schausteller ermordet wird, müssen die Ermittler tief eintauchen in ein Geflecht aus zerstörten Freundschaften, Familiendramen und Hass.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sonja Silberhorn, Jahrgang 1979, ist in Regensburg geboren und aufgewachsen. Sie arbeitete mehrere Jahre in der Hotellerie, unter anderem auf den Kanaren und in Berlin, doch dann überwog die Liebe zu ihrer Heimatstadt. Heute lebt sie dort mit ihrem Mann und ist im kaufmännischen Bereich tätig. Im Emons Verlag erschienen »Herzstich«, »Regenwalzer« und »Donaugrund«.www.sonja-silberhorn.de
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/diekleene21 Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Hilla Czinczoll eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-627-0 Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
EINS
»Jetzt mach schon, du Trampel! Vom Blöd-Rumstehen werden wir hier nicht fertig!« Mit einer rüden Bewegung wies Georg Stein auf die Werkzeugkiste, die neben dem Kassenhaus auf den Metallplanken stand. »Zurück in den Lieferwagen damit.«
Nina beugte sich schnell zu der Kiste hinab, damit ihr Vater ihren Gesichtsausdruck nicht sah, aber das wäre gar nicht nötig gewesen. Er hatte sich schon umgedreht, um nach dem nächsten Opfer Ausschau zu halten, das er im Befehlston daran erinnern konnte, wer beim Hell Tower als Einziger das Sagen hatte.
Lodernder Hass machte sich in Nina breit.
»Das können Roman und Lew doch machen«, wandte ihre Mutter mit zaghafter Stimme ein. »Die Kiste ist viel zu schwer für die Nina.«
»Halt’s Maul«, fuhr ihr Vater sie an, und Nina zuckte zusammen. Immer noch. Dabei hätte sie sich in den vergangenen zweiundzwanzig Jahren doch an den Ton gewöhnen können, den Georg Stein anschlug. »Wer den Laden irgendwann übernehmen will, der darf sich auch für die Drecksarbeit nicht zu fein sein. Die Kiste ist genau richtig für die Nina.« Eine fein dosierte Prise Heimtücke mischte sich in seine Stimme.
Nina warf ihrer Mutter einen gleichermaßen dankbaren wie warnenden Blick zu. Sei still, sollte dieser Blick bedeuten. Das ist es nicht wert, dass er dir wieder die Fresse poliert!
Gisela Stein nickte, wandte sich mit Tränen in den Augen ab und wischte weiter die Scheibe des Kassenhauses.
Die Männer waren mit dem Aufbau des Hell Tower fertig, alle Bolzen waren versenkt, alle Schrauben und Muttern festgedreht, und das Fahrgeschäft überstrahlte in seiner grellbunten Größe und Penetranz wieder einmal die gesamte Regensburger Herbstdult. Im Geiste sah Nina das selbstzufriedene, feiste Grinsen ihres Vaters. Ein weiteres Mal hatte er allen die Show gestohlen.
Der Wetterbericht sagte für die nächsten beiden Wochen noch einmal hochsommerliche Temperaturen an, für morgen Vormittag war die Abnahme des Hell Tower durch das Regensburger Bauamt geplant, und um achtzehn Uhr würde das Fest wie in jedem Jahr mit dem Fassanstich im Glöckl-Zelt eröffnet. Und Nina hasste es.
Mühsam versuchte sie, die Kiste anzuheben. Nur unter größter Anstrengung konnte sie sie ein paar Zentimeter vom Boden lösen. Und das auch nur auf einer Seite. Sie sah auf. Zum Glück war ihr Vater gerade damit beschäftigt, Lew zusammenzustauchen, der es gewagt hatte, sich nach getaner Arbeit eine Zigarette anzuzünden. »Blöde Kanaken«, dröhnte es zu ihr herüber. »Den Lohn sollte ich euch kürzen.« Als gäbe es da noch recht viel zu kürzen.
Auf der Suche nach der Sackkarre sah Nina sich um – und begegnete dabei dem besorgten Blick Romans, der zwischen den knallgelben Sitzpolstern herumturnte und Geschäftigkeit vortäuschte. »Schon okay«, formte sie mit den Lippen, aber er schüttelte den Kopf, sprang behände zwischen den Sitzreihen von der Plattform, verschwand hinter der Kulisse des Hell Tower und stand nach ein paar Sekunden wieder vor ihr, die zusammengeklappte Sackkarre in der Hand.
Hastig nahm Nina sie entgegen. »Schnell, zurück! Mach schon!« Sie stupste Roman in Richtung der Sitzreihen, wehrte die Geste ab, mit der er versuchte, für einen Moment ihre Hand festzuhalten, atmete erleichtert auf, als sie sah, dass ihr Vater immer noch mit Lew beschäftigt war, und klappte die Sackkarre auf, ohne jemanden anzusehen.
Mit einiger Anstrengung lud sie auf und ließ mit ihrer Fracht den Hell Tower hinter sich, doch erst als sie die gesamte Länge des Hahn-Zelts passiert hatte und rechts abbog, um die Werkzeugkiste unter der Oberpfalzbrücke hindurch zur Warendult und zu den dahinterliegenden Wohnwägen zu karren, wagte sie es, wieder aufzuatmen.
Überall legten die Leute letzte Hand an ihre Buden und Fahrgeschäfte. Der Hitzinger fluchte, weil die Beleuchtung in seiner Losbude noch nicht funktionierte, seine Tochter, die Lisi, schraubte die letzten Verblendungen fest. Als Nina vorüberging, senkte Lisi den Blick, um nur ja nicht grüßen zu müssen. Dabei war sie früher einer der Gründe gewesen, warum die zweimal jährlich stattfindende Regensburger Dult von allen Volksfesten, die die Familie Stein jahrein, jahraus besuchte, Ninas liebstes gewesen war. Auf der Maidult hatte sie hier immer begeistert und übermütig mit der Lisi die neue Volksfestsaison begrüßt, nur um dann den ganzen Sommer lang auf die letzte Augustwoche hinzufiebern, wo die zweiwöchige Herbstdult begann und sie wieder mit ihrer Freundin das weitläufige Gelände unsicher machen konnte. Wie lang das schon her war!
Auch der alte Auer strawanzte schon wieder herum und gab der Maria vom Süßigkeitenkarussell schlaue Ratschläge. Was der noch hier wollte? Sollte doch endlich seine Rente genießen. Aber anscheinend hielt er es ohne seine heiß geliebte Dult einfach nicht aus.
Am Trachtenhut vom alten Auer vorbei sah die Maria zu ihr herüber und nickte grüßend, aber ohne den geringsten Anflug eines Lächelns. Und natürlich folgte der Auer ihrem Blick, runzelte einen Augenblick nachdenklich die Stirn, als wüsste er nicht recht, wer die Frau war, die da mit der quietschenden Sackkarre vorüberzog, aber gerade als Nina die Hand heben wollte, spuckte er aus und sah weg. Als hätte sich die Abneigung gegen ihren Vater automatisch auf sie übertragen, als sie das Erwachsenenalter erreicht hatte. Vor gut zehn Jahren hatte ihr der Onkel Wiggerl, wie sie ihn damals nannte, noch jeden Tag drei Freifahrten in seinem Kettenkarussell spendiert.
Auf der Höhe von Bauer’s Weinstadl wandte Nina sich nach rechts, zwischen den Toiletten und dem Süßigkeitenladen von den Hörmandingers hindurch, wo die Wohnwägen hinter den Ständen der Warendult dicht an dicht standen. Der Familie Stein gehörten die beiden Wägen und der Sprinter ganz am Ende der langen Reihe. Sogar hier waren sie Außenseiter.
Irgendwie gelang es Nina, die Werkzeugkiste in den Laderaum des Lieferwagens zu wuchten, dann sperrte sie die Tür zum Wohnwagen auf, den sie sich mit ihren Eltern teilte. Immer noch. Mit zweiundzwanzig Jahren lebte sie immer noch den Großteil des Jahres mit zwei anderen Menschen auf gut fünfundzwanzig Quadratmetern, schlief auf der ausklappbaren Esszimmerbank und hörte die Schreie aus dem Elternschlafzimmer durch die abgeschlossene Holztür. Nicht mehr jede Nacht, aber immer noch oft genug. Und fühlte dabei jedes Mal den schmerzhaften Stich des schlechten Gewissens angesichts ihrer vorsichtigen Erleichterung, dass nicht wieder sie selbst es war, die die »verdiente Abreibung« kassierte.
Nina schaltete das kleine Licht auf dem Esstisch an und machte sich nicht die Mühe, die Bank auszuklappen. Nur eine Minute hinlegen. Verschnaufen. Vergessen, wo sie war.
Sie hoffte, dass Lew nach Feierabend losziehen würde, um die Stadt unsicher zu machen. Dass Roman sich entschied, ihn nicht zu begleiten. Dass ihre Eltern angesichts des morgigen Dultauftakts früh zu Bett gingen, schnell einschliefen und somit nicht hörten, wie Nina sich aus dem Wagen schlich, nur um leise an die Tür des benachbarten Mannschaftswagens zu klopfen. Erst wenn Roman die Tür öffnete, würde sie wieder glücklich sein.
Schützend legte sie die Hand auf ihren Bauch.
* * *
Im Stechschritt marschierten wir durch die Warendult, sodass die bunten Stände mit ihren Angeboten verschiedenster Couleur beinahe verschwommen an mir vorbeizogen: Nach dem »Socken Sepp« zu meiner Linken der »Garten Peter«, stilecht in saftigem Grün, auf der rechten Seite. Ihm folgte sein anscheinend weitaus heimatverbundenerer Namensvetter »Tracht’n Bäda« in einem im Stil einer Almhütte gehaltenen Verkaufshaus. Wenn man den Auslagen des Trachtendealers glauben durfte, dann war in dieser Dultsaison ohne von knallpinkem Stoff gestützte, bis zum Kinn upgepushte Brüste und passenden Hut mit Glitzerfeder dirndlmäßig wirklich gar kein Staat zu machen. Die Kombination mit dem türkis-pink karierten Trachtenhemd direkt daneben, wohl als passendes Oberkleid für das männliche Accessoire der Dirndlträgerin gedacht, sorgte bestimmt nicht nur bei mir für Übelkeit. Immerhin, nach ein paar Maß Bier in einem der Festzelte würde man den Brechreiz wohl nicht mehr auf die absurden Auswüchse des aktuellen Trachtenbooms zurückführen.
Zum Glück hatte mein ganz persönliches männliches Accessoire heute die traditionelle und somit augenfreundlichere Variante gewählt und trug zur kurzen dunkelbraunen Lederhose ein vergleichsweise dezentes Karohemd in Blau-Weiß. Allerdings jagte er aus unerfindlichen Gründen immer noch mit unverminderter Geschwindigkeit durch die Reihe der Verkaufsstände und zog entschlossen rechts und links an den Bummlern vorbei, bis ich schließlich japsend stehen blieb.
»Was rennst du denn so? Wollen wir uns nicht ein bisschen umsehen?«
»Warum?« Raphael bremste abrupt ab und sah mich verblüfft an. »Brauchst du Bürsten?«
Zu meinem Leidwesen waren wir tatsächlich ausgerechnet vor »Stefans Bürstenstadl« zum Stehen gekommen. »Das nicht. Aber da drüben gibt es Schmuck. Und dort Gewürze! Und überhaupt, wozu geht man auf die Dult, wenn man kein einziges Mal nach rechts oder links schaut?«
»Hm … Aber Hannes und die Ladys warten doch schon im Bierzelt, oder?«
Ach so. Das brachte Klarheit in die Sache. »Kommt dein plötzlicher Eifer vielleicht daher, dass neben ›Hannes und den Ladys‹ auch noch eine frische Maß Bier auf dich wartet?«
»Könnte sein«, räumte Raphael mit einem Grinsen ein und zog mich an sich. »Aber die Dult dauert ja noch zwei Wochen … Beim nächsten Besuch kannst du dir so lange Bürsten, Wunderputzmittel und Pfefferkörner angucken, wie du willst, okay?«
Da musste noch ein bisschen mehr herauszuholen sein, fand ich. »Und du fährst mit mir einmal im Hell Tower. Abgemacht?«
Wie unter Schmerzen verzog er das Gesicht, aber der lockende Ruf zünftiger Bierzeltkultur bewog ihn wohl schließlich doch zu einem Nicken. »Für dich nehme ich sogar das auf mich.«
Insgeheim schmunzelnd ließ ich mich von ihm weiterziehen – durch die Warendult, wo man neben allerlei Krimskrams vor allem eines kaufen konnte, und zwar noch mehr Krimskrams, sowie die direkt anschließende Vergnügungsdult, Heimat der Fressstände, Fahrgeschäfte und natürlich, wichtigster Punkt für Raphael, der beiden Bierzelte. Und so eilten wir durch die Ströme abendlicher Besucher am Hahn-Zelt vorbei zum entgegengesetzten Ende des Dultplatzes, wo das Glöckl-Zelt lag.
Männer und Bierzelte! Oder muss ich das einschränken: bayerische Männer und Bierzelte?
Obwohl ich den Großteil meines Lebens (inklusive der Geburt) im bayerischen Regensburg verbracht habe, ist es mir nach wie vor ein Rätsel, worin der Reiz besteht, auf unbequemen Bänken inmitten schwitzender Leiber zu sitzen und zu ohrenbetäubender Musik, die sogar für die Beerdigung des schlimmsten Feindes zu schlecht wäre, Bier aus sperrigen Ein-Liter-Humpen zu saufen und fettige Hendl zu futtern, beides natürlich zuvor von einer grantigen Bedienung zu völlig überteuerten Preisen lieblos auf den dreckigen Tisch geschmissen.
Irgendwas muss dran sein, irgendwas muss diese Begeisterung doch erklären! Aber trotz (selten freiwilliger) intensiver Nachforschungen in meinen bisher dreißig Lebensjahren ist es mir noch nicht gelungen, das Rätsel zu lösen.
Falls Sie sich nun fragen, wer sich hinter dieser umfassenden Schimpftirade auf die bayerische Volksfestkultur verbirgt: Na, ich bin es mal wieder. Sarah »Miesmacherin« Sonnenberg. Die – abseits der leicht getrübten Dultlaune – meistens gar nicht so übellaunig ist. Aber Sie müssen verstehen: Die Umstellung ist im Moment wirklich hart, denn vor vierundzwanzig Stunden lag ich im Beisein von Raphael noch cocktailschlürfend am Strand einer schnuckligen kleinen Seychelleninsel, im Hintergrund nichts als gedämpfte Reggae-Klänge und das Rauschen des Meeres. Das aus dem Glöckl-Zelt dröhnende Humpfdada kommt also einem kleinen Kulturschock gleich.
Tatsächlich warteten Hannes, Nicole und Linda schon auf uns und machten sich durch wildes Winken bemerkbar, kaum dass wir das als Biergarten gestaltete Vorzelt betreten hatten. Zum Glück saßen die drei heraußen – es würde also nicht erforderlich sein, sich wie innen im Zelt zu Kommunikationszwecken gegenseitig bis zum gellenden Tinnitus in die Ohren zu schreien, sondern ausreichen, sich über den Tisch hinweg ganz locker ins Gesicht zu brüllen. Durch den Zelteingang erhaschte ich einen Blick auf die Bühne, an deren Rückwand mir ein Transparent kundtat, dass sich gerade »Die Urviecher« die Ehre gaben. Klang auch so.
Endlich am Tisch angekommen, sprangen Nicole und Linda auf und fielen mir um den Hals, als hätte ich nicht schnöde drei Wochen, sondern mindestens ein halbes Jahr auf den Seychellen verbracht. Hannes hingegen pfiff anerkennend an mir vorbei. »Es geht doch nix über einen schönen Mann in Lederhosen«, sagte er und ließ seinen Blick über Raphaels gleichermaßen schlanke, hochgewachsene und durchtrainierte Statur und die wohlgeformten Waden schweifen. Dieser wiederum ertrug Hannes’ bewundernden Blick mit stoischer Gelassenheit. Er war schließlich daran gewöhnt.
»Einspruch.« Schnell löste ich mich von der in ein giftgrünes Dirndl gewandeten Nicole, bevor sie mich noch mit ihren normalerweise eher unauffälligen, heute aber aufs Erstaunlichste hochgewuppten Brüsten erstickte.
Zwar konnte man angesichts von Raphaels markant geschnittenem Gesicht mit den strahlend grünen Augen, die einen tollen Kontrast zu seiner seychellenbraunen Haut und den von der Sonne ausgebleichten blonden Haaren bildeten, durchaus von einem schönen Mann sprechen, aber ohne Trachtenhemd und Haferlschuhe gefiel er mir eindeutig besser. Die erotische Anziehungskraft von haarigen Männerbeinen und Hosen, die man niemals waschen konnte, erschloss sich mir leider immer noch nicht.
»Mir persönlich sind Frauen im Dirndl durchaus lieber als Männer in Lederhosen«, trug Raphael bei. Wohl nur, um das gegenüber Hannes vorsichtshalber noch einmal klarzustellen.
»Ja, eine Sünde.« Hannes drückte mir einen Kuss auf die Wange und zupfte missbilligend an meinem Sommerkleid. »Wie oft soll ich dir eigentlich noch sagen, dass du die perfekte Dirndlfigur hast, Schätzchen?«
»Und was hab ich?«, fragte Nicole und warf sich in Pose.
»Offensichtlich einen guten BH«, antwortete Hannes mitleidlos und zog mich neben sich auf die Bank.
Eine geschlagene halbe Stunde später, nachdem die fast freundliche Bedienung endlich aufgehört hatte, uns zu ignorieren, standen auch vor Raphael und mir zwei volle Maßkrüge, und als hätten es die Urviecher geahnt, stimmten sie sofort das längst überfällige »Prosit der Gemütlichkeit« an. Ihre Musik klang wirklich zum Steinerweichen, aber das Timing war immerhin perfekt.
Raphael strahlte wie ein kleines Kind unterm Christbaum, Linda hingegen hob mit schlecht verhohlenem Neid ihre Spezimaß, streifte Nicoles gertenschlanke Taille mit einem resignierten Blick und legte dann die Hand auf ihr mittlerweile schon wohlgerundetes Bäuchlein. Himmel, das hatte ich ja fast vergessen. »Wie geht’s dir?«, fragte ich und deutete auf ihre Mitte.
»Abgesehen davon, dass mich die Lust auf einen Schluck Bier im Moment halb umbringt und der kleine Mann jetzt ab und an tritt wie ein Kickboxer, eigentlich ganz gut.« Sie versuchte, ein wenig genervt zu klingen, aber trotzdem strafte ihr seliges Lächeln ihre Aussagen Lügen. »Jetzt schon wieder. Fühl mal.« Rasch griff sie nach meiner Hand und legte sie auf ihren Bauch.
Tatsächlich. Eine kleine Beule stupste sachte gegen meine Handfläche. »Das ist sein Protest gegen die Urviecher«, kommentierte ich flapsig, um zu überspielen, dass mir mit einem Mal ganz komisch zumute wurde. Richtig komisch. Mir wurde ein bisschen schwummrig, aber es half nichts, ich musste den Tatsachen wohl ins Auge sehen: Anscheinend waren wir jetzt also erwachsen. Oder wenigstens Linda war es. So richtig, mit Kinderkriegen und Immobilienkaufen und allem Drum und Dran. Ich musste mir noch darüber klar werden, ob mir diese Erkenntnis gefiel.
Hannes, der sich längst dagegen entschieden hatte und auch dieser Baby-Thematik nicht besonders viel abgewinnen konnte, verzog das Gesicht. »Und morgen müsst ihr schon wieder arbeiten?«, wechselte er nur halbwegs elegant das Thema.
Ich wäre eindeutig lieber bei Lindas Baby geblieben. Allein die Vorstellung, schon am nächsten Tag im K1 der Regensburger Kripo anzutanzen und mich nach drei Wochen Auszeit wieder Dramen, Mord und Totschlag zu stellen, war beängstigend. Warum nur wurde der Gedanke an den Arbeitsalltag mit jedem Tag, den man fernab der Arbeit verbrachte, um ein so Vielfaches bedrückender? Als könne man sich gar nicht mehr aufraffen, sobald man dem süßen Leben erst einmal nachgegeben hatte.
Auch Raphael sah alles andere als begeistert aus. »Sofern Sarah nicht doch auf meinen Vorschlag eingeht, einfach durchzubrennen und auf den Seychellen eine Strandbar zu eröffnen, wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben.«
Vielleicht sollte ich darüber noch einmal nachdenken. Natürlich, eigentlich mochte ich meinen Job, unser Team, den Kontakt zu den vielen unterschiedlichen Menschen, das Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen und wenigstens ab und an etwas wirklich Sinnvolles zu tun. Trotzdem war in diesem Augenblick nicht einmal die Tatsache, dass ich auch in der Arbeit Raphael an meiner Seite hatte, ein wirklicher Lichtblick. Na gut, vielleicht ein kleiner.
Als wäre sie meinen Gedanken gefolgt, sah Nicole uns kopfschüttelnd an. »Ich finde es wirklich unglaublich, wie das bei euch funktioniert. Ihr seid seit einem Dreivierteljahr beinahe ständig zusammen, in der Arbeit, abends, nachts, am Wochenende, im Urlaub, und dabei immer noch so ekelhaft …« Mit dem Neid der Besitzlosen suchte sie verzweifelt nach dem richtigen Wort.
»Verliebt«, beendete Hannes den Satz grinsend.
»Rasend verliebt sogar.« Raphael lächelte mich an, und wie üblich schmolz ich dahin. Immer noch. Manchmal wunderte ich mich selbst darüber.
Erst als ich mich wieder von seinem Anblick losriss, sah ich die Horde uniformierter Kollegen, die sich vor dem Zelt zusammengerottet hatte.
* * *
Raphaels Blick war Sarahs ganz automatisch gefolgt. Mit Befremden bemerkte er die leise Erschütterung auf den Gesichtern einiger Kollegen, dann sagte derjenige, der anscheinend gerade über Funk Informationen hereinbekam, irgendetwas zu den anderen, und die ganze Gruppe setzte sich im Laufschritt in Bewegung Richtung Dulteingang.
»Bestimmt eine Schlägerei im Hahn-Zelt«, kommentierte Hannes. »Wegen einer Alkoholleiche würden die doch nicht gleich alle losspurten.«
Raphael unterdrückte den Impuls, aufzustehen, den Kollegen zu folgen und nachzusehen, ob er helfen konnte. Noch war Sonntag, noch hatte er Urlaub. Der nächste Morgen kam ohnehin früh genug.
Drei weitere Uniformierte trabten aus dem Zelt, eilten über den Platz vor dem Riesenrad und aus seinem Blickfeld, und Sarah wibbelte nervös mit dem Bein. Als kurz darauf noch einmal vier Kollegen aus dem Zelt sprinteten und den gleichen Weg antraten – und somit wohl die ganze Mannschaft rund um das Glöckl-Zelt abgezogen worden war –, fing er Sarahs alarmierten Blick auf. »Da stimmt irgendwas nicht«, sagte sie.
»Genau das befürchte ich auch.«
Zeitgleich standen sie auf, Sarah warf ihren Freunden einen bedauernden Blick zu, Raphael seinem Bier.
»Nicht ernsthaft jetzt, oder?«, fragte Hannes prompt. »Ihr seid doch Beamte. Wo ist eure viel gerühmte Gleichgültigkeit, wenn man sie mal braucht?«
»Frag uns das in zwanzig Jahren noch einmal. Vielleicht haben wir sie dann gefunden.« Mit einem Achselzucken stieg Raphael über die Bank hinweg, wartete, bis Sarah ihre Handtasche vom Boden aufgeklaubt hatte, und griff dann nach ihrer Hand.
Sie schafften es beide nicht, ein gemäßigtes Tempo an den Tag zu legen, als sie am Riesenrad, an der Crêpes-Bude, der Fischbraterei und dem kuriosen Standbetreiber, der anbot, Namen auf ein Reiskorn zu schreiben, vorbeizogen. Wie üblich stellte Raphael sich die Frage, was er denn bitte schön mit seinem Namen auf einem Reiskorn anfangen sollte. Und wie der Standbetreiber wohl reagieren würde, wenn eines schönen Tages Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ihren Namen auf einem Reiskorn verlangte. Heute fand er diesen Gedanken aber ausnahmsweise nicht besonders lustig.
Am Ende des langen Ganges vor ihm zeichnete sich links der pinkfarbene Hell Tower vor dem nächtlichen Himmel ab, und eine blinkende Leuchtschrift machte darauf aufmerksam, dass die Fahrgäste ein spektakulärer freier Fall aus sechzig Metern erwartete. Auf der rechten Seite jedoch, wo der Dultplatz in den Ausgang zum Pfaffensteiner Weg mündete, bemerkte Raphael jetzt zwei Sanitätswagen mit Blaulicht und Martinshorn, die versuchten, sich den Weg durch einen Pulk Leute zu bahnen. Sowohl Polizisten als auch Sanitäter liefen neben den Fahrzeugen her und hatten alle Hände voll zu tun, die Passanten zu vertreiben. Ein weiterer Rettungswagen schloss sich lautstark den beiden vorhergehenden an, so gut das eben möglich war.
»Scheiße.« Sarah lief im selben Moment wie er los, beide schlängelten sich durch die Leute, die, wie üblich von Blaulicht und Katastrophen magisch angezogen, ebenfalls in immer größerer Zahl dem offensichtlichen Ort des Geschehens (welchen Geschehens auch immer) zustrebten, und erreichten schließlich den völlig überfüllten Platz zwischen Autoscooter und Hell Tower.
»Siehst du was?« Sarah hatte sich neben ihn gekämpft und stand auf den Zehenspitzen, aber die Menschenmasse versperrte ihr wohl die Sicht.
Es dauerte einen Moment, bis Raphael, der zum Glück die meisten Leute vor sich überragte, das Terrain sondiert hatte. Zu groß war das Gewirr aus Rettungsfahrzeugen, umherwuselnden Helfern und Unbeteiligten, die rege schnatternd oder mit großen Augen das chaotische Geschehen verfolgten. Doch dann sah er jemanden in einer Blutlache liegen, direkt vor den metallenen Bodenplanken des Hell Tower. Die Sanitäter waren bereits bei der verletzten Person angekommen und versorgten sie so ruhig und zielstrebig, wie es inmitten einer aufgebrachten Menschenmenge eben möglich war. Direkt daneben stand eine Frau mit kreidebleichem Gesicht und einem Baby im Tragetuch am Bauch. Eine junge Kollegin stützte sie und sprach beruhigend auf sie ein. Raphaels Blick scannte die nach wie vor besetzten Sitzreihen des Hell Tower, der natürlich bereits zum Stillstand gekommen war. Hatte es die verletzte Person aus dem Fahrgeschäft geschleudert? Nein, alle Sitze waren belegt, alle Sicherungsriegel geschlossen, die Gesichter der Fahrgäste, die auf der dem Geschehen zugewandten Seite so etwas wie Logenplätze hatten, schwankten zwischen Ungeduld, Entsetzen und Neugier.
Erst jetzt bemerkte Raphael die beiden Mädchen, die auf den Metallplanken ein paar Meter weiter saßen. Eine Sanitäterin versorgte die blutende Kopfwunde der einen, die andere saß kopfschüttelnd daneben und hielt sich das Bein. Neben den beiden stützte sich ein älterer Mann schwer atmend auf eine Mülltonne, auch er schien verletzt zu sein – zwischen seinen auf den Oberarm gepressten Fingern quoll Blut hervor.
»Hast du deinen Dienstausweis dabei?«, fragte er Sarah und kramte in der Tasche der Lederhose nach seinem eigenen.
»Schon griffbereit.«
»Dann los.« Er bahnte sich einen Weg durch die Menschen, ignorierte ihre irritierten Blicke, die wohl zum Ausdruck bringen sollten, dass die Aussage »Polizei, bitte lassen Sie uns durch« eher weniger zu seinem Outfit passte, und steuerte auf Ernst Wagmüller zu, einen dienstälteren Kollegen, den er flüchtig kannte und der gerade auf einige junge Beamte einsprach. Niemand versperrte ihnen den Weg.
Wagmüller atmete tief durch, als er Raphael sah. »Herr Jordan«, sagte er erleichtert. »Und Frau Sonnenberg. Gut, dass Sie da sind. Wir können jede helfende Hand gebrauchen.«
»Was ist passiert?«
»Angeblich eine Explosion, direkt da vor dem Hell Tower auf der Metallplattform. Keine Ahnung, was da so aus heiterem Himmel explodieren kann. Ist erst zehn Minuten her, aber das reicht natürlich aus, um die ganzen Gaffer auf den Plan zu rufen.«
»Was ist mit ihm?«, fragte Raphael und deutete auf den noch immer reglosen Verletzten, offensichtlich ein Mann, der gerade in das Rettungsfahrzeug verfrachtet wurde.
»Nicht bei Bewusstsein. Sieht schlimm aus. Aber mehr weiß ich nicht.«
Wagmüller wandte sich wieder der Gruppe junger Kollegen zu, die sich zwischenzeitlich noch vergrößert hatte. »Also, absperren, weiträumig. Alle unverletzten Passanten raus aus dem Sperrgebiet, und zwar möglichst schnell. Sonst noch was?«, fragte er mehr sich selbst als die Anwesenden.
Aus dem Augenwinkel sah Raphael einen weiteren Einsatztrupp der Polizei auf den Unglücksort zusteuern. Er wechselte einen schnellen Blick mit Sarah. Sie nickte.
Also gut. »Sie beide«, sagte Raphael und wandte sich an zwei Kollegen, »nehmen bitte die Personalien aller ansprechbaren Verletzten auf. Auch und gerade derjenigen, die nur einen Kratzer haben und dieses Chaos schnellstmöglich hinter sich lassen wollen. Sie«, sagte er zu einem beherzt dreinblickenden Kollegen mittleren Alters, »machen bitte eine Durchsage, dass alle Passanten, die etwas zum Unfallhergang aussagen können, ihre Personalien bei einem der Dienstwägen hinterlassen sollen. Und sorgen Sie bitte dafür, dass mindestens zwei besetzte Fahrzeuge gut sichtbar dort drüben geparkt werden.«
Der Angesprochene nickte und machte sich unverzüglich auf den Weg.
»Ist der Erkennungsdienst schon verständigt?«, fragte Sarah.
Wagmüller zuckte die Achseln.
»Ich ruf vorsichtshalber die Einsatzzentrale an. Verstärkung kann so oder so nicht schaden.« Sie entfernte sich ein paar Schritte, das Handy ans Ohr gepresst.
»Was machen wir mit denen?«, fragte Wagmüller und deutete auf die Hell-Tower-Kunden, die immer noch in ihren Sitzen festsaßen.
»Die haben sich gerade ihr Schleudertrauma abgeholt, als das Unglück passiert ist?«
»Ja«, antwortete Wagmüller. »Der Betreiber hat dann natürlich sofort die Fahrt gestoppt.«
»Unbedingt sofort abchecken, ob nicht doch jemand von den Fahrgästen verletzt ist, schließlich waren die ja verhältnismäßig nah dran. Dann die Freiheitsberaubung beenden, aber lassen Sie zwei Leute die Personalien aufnehmen und die Herrschaften direkt befragen, ob sie etwas gesehen haben.« Raphael sah sich um. Zwischenzeitlich hatte es die eingetroffene Verstärkung geschafft, wenigstens die Zufahrt und einen Teil des Unglücksortes zu räumen.
Wagmüller nickte und wirkte endlich einigermaßen beruhigt. »Bringt mal noch zwei Jacken mit Aufschrift für die Kollegen von der Kripo hier«, sagte er geistesgegenwärtig. »Der Rest sperrt ab.« Mit einem weiteren Nicken setzte er den vorläufigen Schlusspunkt.
Raphael fröstelte, obwohl es nicht kalt war, weder draußen noch hier in seinem Schlafzimmer. Aber aus irgendeinem Grund schaffte er es nicht, aufzustehen und sich ein T-Shirt aus dem Schrank zu holen. Das Einzige, was er jetzt zustande gebracht hätte, wäre, eine Zigarette zu rauchen. Fuck, das war doch einfach nicht fair! Kaum hatte ihn die Grausamkeit des Alltags wieder, schon flammte die alte Sucht auf. Dabei hatte er beim Heimflug nach drei völlig rauchfreien Wochen auf den Seychellen verkündet, endlich über den Berg zu sein. Und dann reichte ein Bombenanschlag, um alles wieder ins Wanken zu bringen. Nein, dieses Mal würde er standhaft bleiben. Es fehlte ihm ohnehin die Energie, noch einmal raus- und zum nächsten Automaten zu gehen.
Vor allem nach diesem Abend, dessen Bilanz ernüchternd war. Ein Schwerstverletzter, der mit zerfetztem Gesicht und nur noch einem verbliebenen Ohr im Koma lag. Ob sein Augenlicht gerettet werden konnte, war zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Vier Schwerverletzte mit zum Teil massiven Fleischwunden, weitere neun Leichtverletzte, mehrere Knalltraumata. Die Frau des Schwerstverletzten hatte einen Schock erlitten und würde die Nacht zusammen mit ihrem Baby in ärztlicher Betreuung verbringen, und auch einigen anderen hatte der Anblick der Vorfälle so zugesetzt, dass sie behandelt werden mussten. In Anbetracht der Tatsache, dass die Dult bei gutem Wetter sonntagabends durchaus stark frequentiert war, musste man aber traurigerweise sogar von Glück sprechen, dass es nicht noch mehr Opfer gegeben hatte.
So hatte Raphael sich seinen letzten Urlaubsabend wirklich nicht vorgestellt. Ein sanftes »Willkommen zurück im Alltag« sah definitiv anders aus.
Sarah lag reglos neben ihm im Bett und starrte an die Decke. Ihre hellbraunen Augen schimmerten feucht, das Buch, das sie auf dem Heimflug zu lesen begonnen hatte, hatte sie schon längst wieder beiseitegelegt. »Wer macht so etwas?« Sie drehte sich zur Seite, stützte ihren Kopf auf die Hand und sah ihn ratlos an. »Wer kommt auf so eine abartige Idee? Terroristen? Wahnsinnige?«
Raphael zuckte ratlos die Achseln, zog Sarah an sich und schloss die Augen. Es tat gut, die Wärme ihres Körpers an seinem zu fühlen.
Diejenigen Augenzeugen, die mit glaubwürdigen Informationen aufwarten konnten, waren sich einig gewesen, dass es tatsächlich eine Explosion gegeben hatte, und zwar direkt auf der zum Hell Tower gehörenden Metallplattform. Dort hatte der mittlerweile im Koma liegende Andreas Kellermann gestanden und auf seine Frau gewartet, die mit dem Baby noch einmal zurück zum Süßigkeitenstand gegangen war, um sich gebrannte Mandeln zu holen. So viel hatte man immerhin noch aus Frau Kellermann, die unentwegt auf die Tüte Mandeln in ihrer Hand gestarrt hatte, herausgebracht.
Die Explosion, auch da waren sich mehrere Stimmen einig gewesen, war von einer Einkaufstüte ausgegangen, die direkt an der Sicherheitsabsperrung zum Fahrgeschäft selbst gelehnt hatte.
Der ältere Herr mit den tiefen Wunden am Oberarm glaubte, sich erinnern zu können, dass Kellermann erst auf sein Handy eingetippt, dann die Tüte bemerkt und einen interessierten Blick hinein gewagt hatte. Exakt in diesem Moment war die Tüte – oder besser: die darin deponierte Bombe – mit beträchtlicher Wucht detoniert.
Die ersten Erkenntnisse der Spurensicherung stützten diese Aussagen. Man hatte, nachdem der Ort des Geschehens endlich geräumt worden war, verkohlte Papierreste gefunden, mutmaßliche Relikte der Tüte, sowie Reste eines aufgeplatzten Rohrs. Genaueres würden erst die Untersuchungen der nächsten Tage ergeben, aber Michi Bauer, der Leiter des Regensburger Erkennungsdienstes, hatte sich bereits jetzt zu der Aussage hinreißen lassen, dass so eine Rohrbombe, selbst von einem noch so dilettantischen Trottel zusammengebaut, in den allermeisten Fällen eine verheerende Wirkung hatte.
»Hast du eigentlich die Verletzungen von diesem Kellermann gesehen?«, fragte Sarah.
Raphael nickte stumm. Es war nicht viel übrig gewesen, was noch an ein Gesicht erinnerte. Wobei die Chirurgie da ja bestimmt so einiges machen konnte. Erst mal wichtiger war wohl, dass Andreas Kellermanns Zustand stabil blieb und man seine Augen retten konnte. Schnell schob Raphael die Erinnerung an die blutigen, verbrannten Fleischlappen, die einmal ein Gesicht gewesen waren, wieder beiseite.
»Ich hab nicht hingeguckt«, sagte Sarah mit belegter Stimme und kringelte zärtlich sein Brusthaar um ihren Zeigefinger.
»War nicht die schlechteste Entscheidung.«
Sie sah wieder auf, betrachtete ihn prüfend und legte dann ihre hübsche Stirn in Falten. »Und wie sich dieser Typ vom Hell Tower aufgeführt hat, weil wir ihm sein Höllengefährt für heute gesperrt haben … Hast du das mitbekommen?«
Dankbar schüttelte Raphael den Kopf. Er hatte wirklich keine Lust mehr, über Gesichter zu sprechen, die zufällig Bekanntschaft mit Rohrbomben gemacht hatten.
»Ich glaube, da hast du gerade mit Michi geredet. Kommt dieser unsympathische Kerl, Stein heißt er, glaube ich, also aus seinem Kabuff raus, plustert sich auf und macht den Wagmüller zur Schnecke, was er sich einbildet, dass er ihm mit der Absperraktion das Geschäft des ganzen Sonntagabends versaut.« Sie schnaubte entrüstet, und Raphael musste unweigerlich lächeln. Er fand es herzerwärmend, wie sie sich regelmäßig über die Vollidioten der Nation aufregen konnte.
»Der Wagmüller stottert nur irgendwie rum – der kam mir heute sowieso ein bisschen überfordert vor –, also habe ich mich eingeschaltet und gefragt, ob er nicht vielleicht erst mal die Blutspritzer von den Sitzen seines Killer-Tower wischen will, bevor er wieder ans Geschäft denkt. Hat er natürlich nicht verstanden, der Vollpfosten.«
»Und dann?«
»Habe ich ihm freundlich, aber bestimmt mitgeteilt, dass er sich schon mal überlegen soll, was er Sinnvolles zu den Ermittlungen beitragen kann. Muss ja nicht unbedingt Zufall sein, dass die Rohrbombe ausgerechnet vor seinem Gefährt abgestellt war. Und ich habe gemutmaßt, wie sehr es die mit den Ermittlungen betrauten Kollegen interessieren wird, von mir zu hören, dass ihm sein Sonntagabendumsatz wichtiger ist als die Aufklärung dieses schrecklichen Anschlags.« Ihre Stirn glättete sich, die vollen Lippen verzogen sich zu einem triumphierenden Lächeln. »Das hat er dann kapiert.«
»Gut gemacht, Frau Kriminaloberkommissarin.« Er konnte nicht widerstehen und drückte ihr einen schnellen Kuss auf die Lippen, bevor sie sich wieder an ihn schmiegte.
»Alles von dir gelernt, Herr Kriminaloberkommissar.« Er hörte das Lächeln durch ihre Worte. Bestimmt dachte auch sie daran, dass gerade der rabiate Ton, den er bei störrischen Zeugen gern mal anschlug, zu Beginn ihrer Zusammenarbeit vor über einem Jahr der häufigste Streitpunkt zwischen ihnen gewesen war.
»Ach, echt? Bin ich jetzt etwa so was wie dein Vorbild?«
»So weit kommt’s noch.«
Okay, also doch kein Vorbild. Schade.
Sie sah auf, plötzlich ernst. »Aber ich mein’s ernst. Ich hab so einiges von dir gelernt, nicht nur im Job. Und ich glaube, so insgesamt besehen ist das eine ziemlich gute Sache.«
Endlich war ihm wieder einigermaßen warm.
Selbst als Sarah schon längst eingeschlafen war, streichelte er noch ihr seidiges dunkles Haar.
ZWEI
Zwar steckte uns die vergangene Nacht noch in den Knochen, trotzdem hatten Raphael und ich es geschafft, uns frühzeitig aus dem Bett zu quälen.
Der Besprechungsraum unserer Dienststelle in der Bajuwarenstraße war erst spärlich besetzt, als wir, bewaffnet mit zwei randvoll gefüllten Kaffeehumpen, zum neuerdings obligatorischen Montagmorgenmeeting antraten.
Raphaels größter Bewunderer Moritz, mittlerweile offiziell ein Mitarbeiter des K1 und somit endlich den langatmigen Betrugsdelikten im K3 entkommen, winkte uns enthusiastisch zu, kaum dass wir den Raum betreten und in die Runde gegrüßt hatten.
»Wie kann der bloß schon wieder so motiviert sein?«, raunte Raphael mir zu. »Ist doch auch gerade erst aus dem Urlaub zurück.«
»Der hat halt noch jugendlichen Elan«, antwortete ich beiläufig.
»Im Gegensatz zu mir, meinst du?«
»Zu uns. Ab dreißig geht’s ja bekanntermaßen dahin …« Wenigstens war ich im Moment weit davon entfernt, mich besonders dynamisch zu fühlen. Und nachdem ich zwischenzeitlich, vor gut zwei Wochen, die magische Dreißigerschwelle ebenfalls überschritten hatte, bot es sich natürlich an, fehlenden Enthusiasmus einfach darauf zu schieben.
»Hätte ich dir zum Geburtstag lieber einen Rollator schenken sollen? Oder Kukident?« Raphael ließ mit einem Grinsen seine blendend weißen Zähne blitzen, die zum Glück nächtens nicht in aufgelöste Zwei-Phasen-Tabs eingelegt ein von ihrem Besitzer getrenntes Dasein fristeten, und steuerte zielstrebig die leeren Plätze neben Moritz an.
»Oh Mann«, murrte Moritz, kaum dass wir in kommoder Hörweite waren. »Ist ja grauenvoll, wie braun gebrannt und erholt ihr ausseht.«
»Und du?« Raphael fläzte sich in den Stuhl und gab sich sofort noch ein bisschen tiefenentspannter. »Statt auf Sri Lanka versehentlich am Nordpol gelandet?«
Besonders viel Farbe hatte Moritz tatsächlich nicht bekommen. Im Gegensatz zu Raphael leuchtete er in hellem Cremeweiß.
»Die Regenzeit hat voll zugeschlagen. Drei Wochen lang Witterungsverhältnisse wie in Castrop-Rauxel.« Er seufzte, als trüge er das Leid der ganzen Welt auf seinen Schultern. »Ich bin echt froh, wieder hier zu sein.«
»Aber da kann man doch immerhin richtig viel angucken, oder?«, versuchte ich mich an einem ermunternden Einwurf.
»Wenn die Straßen befahrbar sind, bestimmt«, grummelte Moritz. »Und bei euch war’s gut?«
Mit einem verträumten Lächeln rutschte Raphael noch ein Stück tiefer. »Lass mich überlegen: strahlender Sonnenschein, türkisblaues Meer, ein weißer Postkartenstrand, ein luxuriös ausgestatteter Bungalow mit Außenjacuzzi, perfekter Service, exzellente Küche –«
»Hör schon auf, das ist ja deprimierend«, fiel Moritz ihm ins Wort. »Obwohl«, fügte er nach einer Sekunde des Nachdenkens hinzu, »wird das nicht ziemlich schnell irre langweilig auf so einer kleinen Insel? Was macht man denn da den ganzen Tag?«
»Ich kann dich beruhigen«, antwortete Raphael, wobei sein schwelgerisches Lächeln zu einem reichlich anzüglichen mutierte. »Uns ist so einiges eingefallen.«
»So genau wollt ich’s nicht wissen«, brummte Moritz.
»Und tauchen und surfen kann man dort natürlich auch«, warf ich in Rekordgeschwindigkeit ein. Ich wollte sein Kopfkino schließlich nicht überstrapazieren.
»Ihr surft?« Moritz’ Gesichtsausdruck wandelte sich von Irritation zu grenzenloser Bewunderung.
War ja mal wieder klar, dass er Raphaels Hobby weitaus toller fand als meinen Tauchschein. »Er schon. Ich paddele eine halbe Stunde auf dem Bauch, gebe dann auf und genieße lieber die Aussicht.«
»Cool«, sagte Moritz und bedachte Raphael mit einem Blick der Marke Wenn-ich-mal-groß-bin-will-ich-so-sein-wie-du.
Zum Glück erstickte das Erscheinen des Chefs weitere Ausführungen im Keim, bevor Moritz noch auf die Idee kam, den längst überfälligen Raphael-Fanclub zu gründen.
»Das ist also der Stand der Dinge«, schloss Kommissariatsleiter Schneckmayr, nicht nur aufgrund seines Namens von seinen Mitarbeitern gern auch »Schneck« genannt, den Bericht über den Anschlag am Vorabend. »Der Zustand des Opfers ist so weit stabil, aber es ist noch nicht abzusehen, wann Herr Kellermann aus dem Koma geholt wird. Bis dahin werden wir also wohl keine genaueren Informationen zum Hergang bekommen. Und selbst dann ist natürlich fraglich, ob er sich überhaupt noch erinnert.«
Schneckmayrs Schilderungen hatten für allgemeine Erschütterung gesorgt. Zwar war der Großteil der Kollegen bereits im Bilde gewesen, einen Rohrbombenanschlag gab es schließlich nicht alle Tage, aber die Willkür, mit der hier wahllos Menschen in friedlicher, sogar fröhlicher Atmosphäre geschadet worden war, bedrückte alle.
»Frau Sonnenberg und Herr Jordan waren gestern Abend aufgrund eines privaten Dultbesuchs vor Ort«, fuhr Schneck fort, »und haben die Kollegen sofort tatkräftig unterstützt. Vielen Dank Ihnen beiden dafür.«
Raphael und ich nickten vage. Es war schließlich klar, dass Dank überflüssig war und es keinerlei Handlungsalternative für uns gegeben hatte.
»Deshalb würde ich auch gern Ihnen beiden diesen Fall übertragen, Sie konnten sich ja bereits gestern ein erstes Bild vom Geschehen machen.«
Damit hatten wir natürlich gerechnet. Meine Begeisterung darüber, ausgerechnet auf der Dult ermitteln zu müssen, hielt sich allerdings in Grenzen. Blieb zu hoffen, dass wir schnell eine Spur fanden, die uns möglichst weit weg von Bierzelt und Blasmusik führte.
»Herr Lochbihler wird Sie unterstützen«, fügte er an Moritz gewandt hinzu. »Und natürlich Herr Hoffmann, sollte er jemals wieder in Erscheinung treten.«
Als hätte er sein Stichwort gehört, öffnete sich die Tür, und Herbert rumpelte herein, mit hochroter Birne und beschämtem Gesichtsausdruck. »’tschuldigung«, sagte er gehetzt und ließ seinen Blick über die zwischenzeitlich voll besetzten Reihen schweifen. »Mir ist gerade beim Bäcker so ein Hanswurscht ans Auto gefahren.« Wie zur Bekräftigung biss er in die Butterbreze in seiner Hand. Sein finsterer Blick hellte sich jedoch auf, als er Raphael und mich entdeckte.
»Na, Hauptsache, es schmeckt noch«, erwiderte Schneckmayr resigniert, entließ die versammelte Bagage mit einem Nicken und eilte selbst aus dem Besprechungsraum.
Wenige Minuten später war endlich auch Herbert auf den neuesten Stand gebracht. »Fassen wir also zusammen«, nuschelte er hinter Breze Nummer zwei hervor und spuckte ein paar feuchte Brösel auf den Tisch, was von Moritz mit einem angewiderten Blick quittiert wurde. »Dieser Kellermann scheint, ebenso wie alle anderen Verletzten, ein Zufallsopfer zu sein. Der einzige Anhaltspunkt bisher ist diese ominöse Tüte, in der der Sprengsatz deponiert war, sofern sich nicht doch noch ein Zeuge meldet, der mehr beobachtet hat. Und es ist in keiner Weise ersichtlich, wer hinter diesem Anschlag steckt, oder auch nur, was damit bezweckt wurde.«
»Korrekt.« Raphael stand auf und streckte sich, nur um sich ein paar Meter weiter ans Fensterbrett zu lehnen. Wahrscheinlich trieb ihn die Angst vor einer weiteren Bröselattacke um.
»Und was gedenkt ihr jetzt zu tun?« Mit einem lauten Schnaufen machte Herbert der Breze endgültig den Garaus.
»Wir, Herbert«, sagte Raphael mit Nachdruck, »nicht ›ihr‹.« Wie üblich war Raphael nicht gewillt, Herberts Lethargie ohne Widerworte hinzunehmen. Seit sich Herbert vor gut einem Jahr aus gesundheitlichen Gründen in den Innendienst zurückgezogen und Raphael seine Nachfolge überlassen hatte, war er zunehmend teilnahmslos geworden. Ab und an blitzte noch etwas von der früheren Energie und Motivation durch, aber auch für meinen Geschmack waren diese Momente mittlerweile ziemlich selten. Zu selten. Als bestünde Herberts einziges Interesse darin, die verbleibende kurze Zeit bis zur Pensionierung möglichst nervenschonend zu überstehen. Nervenschonend für ihn, wohlgemerkt. Für uns weniger.
»Also gut. Was gedenken wir jetzt zu tun?« Zufrieden kraulte Herbert sich den umfangreichen Bauch, der von einem rot-grün karierten, leider zwischen den Knöpfen klaffenden Hemd mehr schlecht als recht verhüllt wurde. Dann lehnte er sich satt und zufrieden zurück. Fehlte nur noch das Bäuerchen.
Raphael winkte ab, als hätte es keinen Sinn, überhaupt noch zu antworten, worauf ich ihm einen strafenden Blick zuwarf. Das war einer unserer wenigen Streitpunkte: Ich fand, wir mussten versuchen, Herbert wenigstens noch ein bisschen zu motivieren. Raphael hingegen beschränkte sich regelmäßig auf grantige Kommentare, gefolgt von stiller Ignoranz.
Moritz starrte betreten auf die Brezenspuckebrösel.
»Ich denke, wir sollten zuerst mit den Leuten vom Hell Tower reden«, brach ich schließlich das Schweigen. »Schließlich hatten die die besten Beobachtungsposten. Außerdem hat mir das Verhalten von diesem Herrn Stein gestern überhaupt nicht gefallen – schon allein deshalb will ich dem mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Oder hast du andere Vorschläge?«, wandte ich mich pädagogisch wertvoll an Herbert.
»Nein, mir ist das komplett wurscht. Aber sagt mal, habt ihr eigentlich eine Ahnung, wer den Käsekuchen mitgebracht hat, der in der Teeküche steht?«
Raphael war anständig genug, sich einen triumphierenden Blick in meine Richtung zu verkneifen, stattdessen starrte er mit fest aufeinandergepressten Lippen aus dem Fenster. Moritz sah mich mitleidig an. Und ich schluckte die Wut auf Herbert und die Traurigkeit darüber, wie sehr sich seine Arbeitshaltung im letzten Jahr verändert hatte, mühsam hinunter.
»Nein. Aber find das doch einfach selbst raus in der Zwischenzeit. Moritz, du nimmst dir bitte noch einmal die Aussagen aller Zeugen von gestern Abend vor, vielleicht gibt es ja irgendwo noch einen Hinweis oder eine Ungereimtheit, der wir nachgehen können. Falls wir von jemandem nur die Personalien und noch keine Aussage haben, hängst du dich bitte an die Strippe. Und Raphael und ich fahren auf die Dult und statten dem netten Herrn Stein einen kleinen Besuch ab.«
»Wann genau öffnen eigentlich die Süßigkeitenbuden auf der Dult?«, fragte Herbert interessiert.
»Keine Ahnung.« Ich unterdrückte ein Seufzen. »Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass gebrannte Mandeln nicht auf deinem Diätplan stehen.«
* * *
»Es wird immer schlimmer«, sagte Sarah nach einer schweigsamen Fahrt völlig zusammenhanglos, als Raphael den Wagen schließlich auf dem noch beinahe autofreien Parkplatz am Protzenweiher, direkt neben dem Dultplatz und einige Meter von der dortigen Polizeidienststelle entfernt, zum Stehen brachte. Trotzdem wusste er sofort, wovon die Rede war.
»Es wäre leichter, wenn du akzeptieren würdest, dass Herbert die restliche Zeit eben nur noch absitzt, meinst du nicht? Weißt du, mich ärgert’s ja auch oft genug … Aber das ändert nichts, Sarah. Es interessiert ihn einfach nicht mehr.«
»Aber wie kann das sein?« Sie schniefte, und Raphael sah die ersten Tränen kullern. Sofort kochte die Wut auf Herbert wieder in ihm hoch.
»Weißt du, er war jahrelang ein richtiger Fels in der Brandung. Immer gemütlich, aber trotzdem interessiert daran, Leuten wie dem Kellermann zu Gerechtigkeit zu verhelfen. Wie Balu, der Bär …« Sie versuchte sich an einem Grinsen und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht, aber sofort folgten neue.
Raphael löste den Gurt und nahm sie in die Arme. Auch wenn er sich darüber wunderte, dass sie dieser Sachverhalt plötzlich zum Weinen brachte. Schließlich war Herberts Null-Bock-Stimmung beileibe nichts Neues.
»Und jetzt?« Sarah schüttelte sachte den Kopf. »Käsekuchen. Gebrannte Mandeln. Butterbrezen. Mir doch vollkommen wurscht, ob hier jemand Unschuldige in die Luft jagt, Hauptsache, es gibt was zu futtern … Das kann doch nicht wahr sein, oder?«
»Tja, ich fürchte …« Raphael zuckte hilflos die Achseln. »Er ist über sechzig, macht den Job somit seit mehr als vierzig Jahren. Und hat die Pension vor Augen. Vielleicht ist er einfach ausgebrannt? Nicht im Sinne eines richtigen Burn-outs, dafür ist er definitiv zu gut gelaunt. Aber eben aus beruflicher Sicht, verstehst du? Wahrscheinlich hat er genug gesehen in den letzten Jahrzehnten. Und will davon einfach nichts mehr hören.«
»Ja, du hast ja recht.« Sie schniefte ein letztes Mal, prüfte mit skeptischer Miene, ob sie auf Raphaels T-Shirt Make-up-Flecken hinterlassen hatte, fand offensichtlich nichts oder gab zumindest vor, nichts zu finden, und lächelte halbherzig zu ihm nach oben. »Weiß ich ja eigentlich. Aber es fällt mir trotzdem schwer, das ständig vor Augen geführt zu bekommen.«
»Hauptsache, du weinst nicht mehr deshalb.« Mit weinenden Frauen hatte er schon immer so seine Probleme gehabt. Auch wenn man ihm oft genug versichert hatte, dass es ab und an einfach guttat, zu weinen. Weil der Film so traurig war. Oder so schön. Oder beides gleichzeitig. Weil man so gerührt war oder sich so freute. Manchmal, selten, tatsächlich auch, weil man sehr traurig war, aber oft reichte es auch aus, nur ein bisschen traurig zu sein – dann hatte man nämlich an diesem Tag nah am Wasser gebaut. Was nichts daran änderte, dass Raphael den Anblick schlecht ertrug und immer das Gefühl hatte, den Grund für die Tränen sofort eliminieren zu müssen. Was wiederum in den meisten Fällen aber gar nicht im Interesse der Damen lag. Kompliziert, kompliziert.
»Sorry«, sagte Sarah. »Ich hab heute wohl einfach nah am Wasser gebaut.«
Danke für die Info, somit war alles klar, und er konnte getrost davon absehen, Herbert zu eliminieren.
»Und jetzt auf zum Hell Tower.« Unfassbar, mit welcher Geschwindigkeit Sarah es schaffte, vom Heul-Modus auf den Tatendrang-Modus umzuschalten. »Vielleicht schmeißen sie das Ding ja extra für uns beide an.« Und auf den Sadismus-Modus.
Ob er vielleicht auch einmal versuchen sollte, mit Tränen Sarahs hartes Herz zu erweichen? Nur aus Gründen der Männlichkeit entschied er sich dann doch dagegen.
Die Vergnügungsdult mit den Fahrgeschäften öffnete erst am Mittag, aber auch auf der Warendult war man gerade erst damit beschäftigt, in gemächlichem Tempo die Stände verkaufsbereit zu machen. Es war ein seltsames, fast beklemmendes Gefühl, über die menschenleere Dult zu laufen, die Raphael sonst nur voll wogender Menschenmassen, kreischender Kinder und lautem Gedröhne kannte. Aber vielleicht war es auch nur die Erinnerung an den Vorabend, die die Beklemmung auslöste.
Das Hahn-Zelt hatte noch geschlossen, ebenso der Autoscooter. Gegenüber, vor dem Hell Tower, herrschte jedoch schon rege Betriebsamkeit: Hinter dem Absperrband war noch immer eine Horde Erkennungsdienstler in weißen Overalls zugange, dazwischen der eine oder andere Uniformierte, um dafür Sorge zu tragen, dass die Arbeit der Spurensicherung nicht gestört und keine einzige Spur verwischt wurde. Eine blasse junge Frau mit rundlichem Gesicht und langen braunen Haaren saß hinter der Kasse und beäugte missmutig das Geschehen.
»Da seid ihr ja!« Michi Bauer, bereits wieder im Einsatz, streifte die weiße Kapuze vom Kopf und kam auf sie zu. Er sah müde aus, was aber kein Wunder war. Als Sarah und Raphael sich am Vorabend vollkommen erledigt nach Hause geschleppt hatten, war Michi noch immer in Aktion gewesen und hatte seine vielköpfige Hui-Buh-Mannschaft energisch durch die Gegend gescheucht.
»Gibt’s neue Erkenntnisse?« Sarah inspizierte das Geschehen, als gäbe bereits das Aufschluss über das Schwein, das diese Scheiße hier zu verantworten hatte.
Michi Bauer zuckte die Achseln. »Wir haben geschmolzene Teile von etwas gefunden, was eine Zeitschaltuhr gewesen sein könnte. Sieht also aus, als hätte hier jemand einen elektronischen Zeitzünder gebastelt – provisorisch, aber wirkungsvoll.«
»Dann müsste man doch eigentlich herausfinden können, woher das Teil stammt?«
Michi musterte Raphael kritisch. »Okay, Bomben scheinen nicht unbedingt dein Spezialgebiet zu sein. Schon mal im Baumarkt gewesen?«
»Verkaufen die da Bomben?«, fragte Sarah geistesabwesend – und rettete mit dieser wenig intelligenten Nachfrage wenigstens einen kleinen Teil von Raphaels Ehre, indem sie brav den Part des totalen Techniktrottels übernahm.
»Wollt ihr den Fall nicht doch lieber abgeben?«, fragte Michi grinsend. »Wie auch immer: Im Baumarkt findest du die Einzelteile. Du programmierst eine Zeitschaltuhr, baust einen kleinen Schaltkreis, kaufst ein Rohr –«
»Und den Sprengstoff?«, hakte Raphael ein.
»Bravo«, sagte Michi und klopfte ihm mit übertriebener Begeisterung auf die Schulter. »Das hätte ich dir jetzt gar nicht mehr zugetraut! Den Sprengstoff gibt’s nicht im Baumarkt. Aber es gibt reichlich Mittel und Wege, auch den zu organisieren. Das ist ein unüberschaubarer Schwarzmarkt. Und in Zeiten des Internets ist sowieso alles möglich. Ich schicke auf jeden Fall alles, was wir hier finden, ans LKA zur Auswertung und mach denen ein wenig Dampf unterm Allerwertesten.«
Raphael nickte dankbar. »Im Internet gibt’s dann wohl auch Bauanleitungen für Sprengwillige in Hülle und Fülle?«
»Klar«, antwortete Michi. »Damit würdest sogar du so ein Ding hinbekommen.« Sein Blick schwenkte zu Sarah, die immer noch gedankenverloren die Szenerie inspizierte. »Sarah vielleicht eher weniger«, fügte er leise hinzu und zwinkerte.
»Was ist los?« Aufgeschreckt riss sie ihren Blick von den Arbeiten los. Besonders konzentriert wirkte sie heute nicht unbedingt.
»Nichts von Bedeutung«, winkte Raphael ab. »Und wir sollten uns jetzt die junge Dame dort drüben vornehmen, wenn uns an weiteren Zeugenaussagen gelegen ist.«
Sie verabschiedeten sich von Michi Bauer und näherten sich dem Kassenhaus, dessen Insassin mit jedem Schritt, den sie auf sie zumachten, widerwilliger dreinschaute. Nachdem sie keinerlei Anstalten machte, die in schreienden Farben lackierte Tür zu öffnen, klopfte Raphael an die geschlossene Scheibe. Endlich bequemte sie sich aus ihrem Stuhl und öffnete die Tür – einen Spaltbreit.
»Raphael Jordan und Sarah Sonnenberg, Kripo Regensburg. Wir ermitteln hinsichtlich des gestrigen Bombenanschlags. Können wir Ihnen ein paar Fragen stellen?«
Sie verzog das Gesicht, nickte aber ergeben und ließ sich sogar dazu herab, die Tür vollständig zu öffnen. Dann sank sie zurück in ihren kleinen Drehstuhl, einen von zweien, die gerade so hinter die beiden Kassentische passten.
»Was machen Sie hier beim Hell Tower?«, fragte Sarah.
»Ich bin Nina Stein. Meinem Vater gehört das Geschäft.« Sie presste die Lippen aufeinander, als hätte sie damit schon zu viel gesagt. Das Töchterchen des umsatzbewussten Herrn Stein also. Das erklärte das Missfallen, mit dem sie die Arbeit des Erkennungsdienstes beobachtet hatte.
»Und Sie sind beim Hell Tower beschäftigt?«
Sie schnaubte. »So kann man es auch nennen.«
Sarah hatte ihren bohrenden Blick aufgesetzt, und so knickte Nina Stein doch noch ein. »Ja, ich arbeite hier«, sagte sie schließlich und klang mächtig genervt. »Gegen Kost, Logis, ein kleines Taschengeld und die Aussicht, das Geschäft irgendwann zu übernehmen.«
»Sie scheinen davon enorm begeistert zu sein«, stellte Raphael fest.
Mit einem kleinen Lächeln, das ihr rundliches Gesicht gleich viel hübscher machte, zuckte Nina Stein die Achseln.
»Waren Sie gestern Abend auch hier, als der Anschlag passierte?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich bin eine halbe Stunde vorher in den Wohnwagen gegangen. Mir war nicht gut, ich musste mich ausruhen.«
»Und ist Ihnen zuvor etwas aufgefallen? Zum Beispiel die Tüte, die nach dem bisherigen Ermittlungsstand den Sprengsatz enthielt?«
Sie zögerte einen Moment, dann schüttelte sie wieder den Kopf. »Nein, tut mir leid. Ich habe von alldem nichts mitbekommen. Erst nachdem es passiert war, habe ich die Rettungswägen gehört und bin wieder hierhergekommen – aber da war die Polizei schon längst vor Ort.«
»Wer hat dann gestern hier gearbeitet, als der Anschlag stattgefunden hat?« Sarah fixierte sie, als wolle sie sie röntgen.
Nina Stein senkte den Blick. »Meine Eltern. Und …« Sie sah wieder auf, plötzlich lächelnd. »Roman. Roman Zielinski. Einer unserer Angestellten.«
»Nun gut«, schloss Sarah das Gespräch und legte die Stirn nachdenklich in Falten. »Wo finden wir Ihre Eltern und Herrn Zielinski?«
»Unsere Wohnwägen stehen hinter der Warendult, die letzten beiden in der Reihe. Ich weiß aber nicht, ob –«
»Gibt’s Probleme?«, unterbrach eine tiefe, barsche Männerstimme Nina Steins Erläuterungen.
Raphael drehte sich um und wusste den Mann, der vor ihm stand, mit einem Blick einzuschätzen. Groß, wenn auch ein paar Zentimeter kleiner als er selbst, dafür aber fast doppelt so breit. Nicht dick im eigentlichen Sinn, aber sehr stämmig, das Gesicht ebenso wuchtig wie der Körper und beinahe quadratisch, die braunen Haare und die Augenbrauen voll und struppig. Altersmäßig um die fünfzig, verströmte dieser Kerl aus jeder Pore Selbstbewusstsein – aber eines von der ungesunden Sorte. Eines, das andere unterdrückte und einschüchterte. Oder unterdrücken und einschüchtern wollte.
Es war kein Wunder, dass Raphael die Frau neben ihm erst auf den zweiten Blick bemerkte. Sie war klein, ihre Züge ähnelten denen Nina Steins, wenngleich sie bestimmt zwanzig Jahre älter war und das Haar kurz trug. Und mausgrau. Der verkniffene Zug um ihre Mundwinkel wirkte mehr traurig als trotzig.
»Ach, Herr Stein, gut, dass Sie da sind.« Sarah bedachte ihn mit einem warnenden Blick, als sie Raphael und sich vorstellte und ihren Dienstausweis zückte. »Wir haben uns ja gestern schon kurz kennengelernt.«
Stolz durchspülte Raphael. Sarah war noch nie ein Mäuschen gewesen, dennoch: Im vergangenen Jahr, seit sie beide Seite an Seite ermittelten, hatte sie ein gutes Stück an natürlicher Autorität hinzugewonnen. Kuschlig war sie nur noch bei ihm.
»Es gibt noch einige Fragen zum gestrigen Abend«, fuhr sie fort. »Zunächst: Wo waren Sie zum Zeitpunkt des Anschlags?«
»Ich war im Fahrerstand«, antwortete Herr Stein und deutete auf eine kleine, beinahe versteckt liegende Kabine in der quietschbunten Kulisse des Hell Tower, links vom namensgebenden pinken Turm, um den sich wiederum die knallgelbe Gondel schloss, die die Passagiere zunächst sechzig Meter in die Höhe beförderte, um sie dann eiskalt fallen zu lassen. Aus Gründen der Farbharmonie waren die Sitze für die bedauernswerten Fahrgäste in der Gondel wieder in Pink, die Schulter- und Zwischenbeinbügel in Gelb gehalten. Solange Raphael aber immerhin nicht in dieses Höllengefährt einsteigen musste, wollte er sich nicht über die augenschmerzende Farbkombination beklagen. Er verdrängte mühsam das Versprechen, das er Sarah gegeben hatte. Schließlich war ein Bayer mit Bierdurst nicht wirklich geschäftsfähig.
»Ich hab aber nichts bemerkt, falls Sie das meinen. Nur den Knall gehört und dann die Riesensauerei hier gesehen.« Er wies auf die Metallplanken, die noch nicht vom Blut der Opfer gesäubert worden waren. Ob er mit ›Sauerei‹ den Anschlag verurteilte oder aber nur die Flecken auf seinem Höllengefährt meinte, war nicht ersichtlich.
»Können Sie den Hampelmännern dort gefälligst mal ein wenig einheizen?«, fragte er. Der Unterton in seiner Stimme war drohend. »Mir fehlt nämlich schon der Umsatz von gestern Abend. Auf einen weiteren Tag mit Einbußen kann ich gut verzichten, werte Herrschaften.«
»Davon bin ich überzeugt«, antwortete Raphael und merkte selbst, dass er die Wut in seiner Stimme nur schlecht unterdrückte, »aber wie Sie gestern schon gehört haben, hat Ihr Umsatz derzeit keine Priorität.«
Stein schnaubte. Anscheinend war er aber noch anständig genug, seine Wut nicht an der Obrigkeit auszulassen. »Glotz nicht so blöd«, blaffte er stattdessen seine Tochter Nina an, die sich hinter Sarah und Raphael im Kassenhaus verschanzt hatte. »Geh lieber zum Wohnwagen und putz den mal wieder. Himmelherrgott noch mal, dass man den jungen Leuten aber auch alles sagen muss.« Beifallheischend sah er seine Frau an, doch die verzog keine Miene. Und auch Raphael und Sarah waren nicht gewillt, ihm zuzustimmen.
Nina Stein stand auf, trat mit gesenktem Kopf aus dem Kassenhaus und schlug dann den Weg zu den Wohnwägen ein. Mit jedem Schritt, den sie sich entfernte, hob sich ihr Kopf wieder ein wenig. In dieser Familie schien ja so einiges im Argen zu liegen. Was für ein Tyrann. Raphael biss die Zähne zusammen und schluckte seinen Groll hinunter, was ihm wie üblich schwerfiel. Nicht dein Bier, Jordan. Kümmer dich lieber um deine Arbeit.
»Und Sie … Frau Stein, nehme ich an?«
Sie nickte, ein vorsichtiges Lächeln erhellte ihre Züge.
»Wo waren Sie zum Zeitpunkt der Explosion?«
»Sie hat kassiert«, kam ihr Mann ihr zuvor. »So ein Betrieb läuft ja schließlich nicht von allein.«
Raphael sah Sarah schlucken. Bestimmt verkniff sie sich jetzt reichlich angestrengt den nächsten spitzen Kommentar.
Raphael hingegen spähte zur Metallplattform. Der Blick war gut. Und von der Scheibe des Kassenhauses aus sicher noch besser. »Haben Sie etwas gesehen, Frau Stein? Anscheinend war die Bombe in einer Tüte deponiert, die dort drüben stand. Die müsste Ihnen doch aufgefallen sein?«
»Sie hat kassiert, Herrgott noch mal. Da bleibt keine Zeit, Löcher in die Luft zu starren.«
Raphael warf Herrn Stein einen vernichtenden Blick zu. Was für ein Riesenarschloch.
»Ist es für einen Job an der Kasse nicht notwendig, sich verständigen zu können?« Sarahs Unterlippe bebte vor Wut.
»Natürlich«, antwortete Stein arglos.