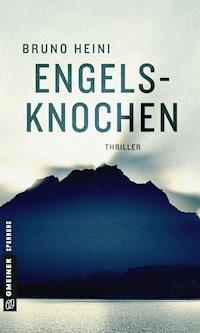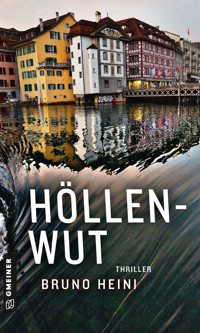
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Detektivin Palmer
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau verschwindet spurlos in Luzern. Ihre Wohnung ist stark verwüstet. Das Blut an den Wänden zeugt von eindeutigen Kampfspuren und kann ihr zweifelsfrei zugeordnet werden. Offensichtlich ist sie entführt oder sogar ermordet worden. Der Verdacht fällt umgehend auf ihren ehemaligen Chef, einen milliardenschweren Rohstoffhändler. Die Polizei befragt und überwacht ihn, doch alle Spuren führen ins Nichts. Lebt sie noch - oder ist es für sie längst zu spät?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bruno Heini
Höllenwut
Thriller
Zum Buch
Unbändiger Hass Elisa ist eine blasse Frau mit großen, traurigen Augen. Sie verschwindet – von einem Tag auf den anderen. Ihre Wohnung ist stark verwüstet. Das Blut an den Wänden zeugt von eindeutigen Kampfspuren und kann zweifelsfrei Elisa zugeordnet werden. Offensichtlich ist sie entführt oder sogar ermordet worden. Der Verdacht fällt umgehend auf Elisas ehemaligen Chef, den milliardenschweren Rohstoffhändler Rjabow. Die Polizei befragt und überwacht ihn, doch alle Spuren führen ins Nichts. Elisas Bruder ist von ihrem Tod überzeugt und bittet die Detektivin Palmer die Leiche seiner Schwester aufzuspüren. Deren Vergangenheit scheint sich auf fürchterliche Weise zu wiederholen. Fieberhaft versucht Palmer in Luzern herauszufinden, was wirklich mit Elisa geschah. Dabei gerät sie immer tiefer in einen wahren Albtraum. Dann hat sie einen furchtbaren Verdacht.
Bruno Heini lebt mit seiner Frau, mehreren Katzen und umgeben von Büchern über den Dächern von Luzern. Er arbeitete erfolgreich als Unternehmer und im Marketing, bevor er beschloss, sich auf das Schreiben von Krimis und Thrillern zu verlegen. Nach seinen Thrillern »Teufelssaat«, der auf Anhieb in der Schweizer Taschenbuch-Hitparade landete, und »Engelsknochen« legt Bruno Heini mit »Höllenwut« einen weiteren Luzern-Thriller nach.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Engelsknochen (2018)
Teufelssaat (2016)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © santosha57 / stock.adobe.com
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6354-9
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1
Elisa wollte nun sterben.
Lange hatte sie sich gesträubt, die unabwendbare Tatsache zu akzeptieren, denn sie hatte geglaubt, kein normaler Mensch setzte sich bereits mit neununddreißig Jahren ernsthaft auseinander mit seiner allerletzten Reise. Aber dann waren die Schmerzen allzu grässlich angeschwollen, und sie hatte nun auch ihren letzten Traum begraben. Zudem warteten kein Ehemann oder Begleiter und nicht eine einzige Freundin.
Elisa war bereit.
Vor wenigen Minuten noch war sie im Delirium gelegen und für einige Zeit nicht mehr bei Bewusstsein, ihre sowieso schon verminderte Atmung hatte ganz ausgesetzt. Aber dann japste sie plötzlich nach Luft und kam keuchend wieder zu sich.
Ihre abgemagerten Finger tasteten im Dunkeln nach der Glocke und sie drückte den Knopf.
Es verging weniger als eine Minute, bis in ihrer makellos weißen Uniform die Nachtschwester herbeieilte, deren Namensschild an der Brusttasche sie als Franziska Arnold auswies. Als hochgewachsene Frau mit auffallend heller Haut gab sie eine beeindruckende Erscheinung ab, die auf die fünfzig zuging und ihr rotblondes Haar im Nacken mit einem Gummiband zu einem straffen Pferdeschwanz gebunden trug. Ihr Gesicht kam ohne Schminke aus, und die Augen hatten einen wissenden, aber traurigen Blick, als habe die Frau in mehr dunkle Abgründe geblickt als die meisten Menschen. Einige ihrer Kolleginnen hatten sich für die regelmäßige nächtliche Arbeit entschieden, um den Tag mit der Familie zu verbringen. Schwester Arnold jedoch arbeitete nachts, um jedem einzelnen Tag ohne ihren mürrischen Ehemann mehr abzugewinnen. Es half, sich möglichst wenig zu begegnen …
Schwester Arnold eilte zum Zimmer.
Damit, dass die Patientin wieder zu sich kommen würde, hatte sie nicht mehr gerechnet, deshalb stand ihr die Überraschung ins Gesicht geschrieben, als sie auf leisen Sohlen in Elisas Krankenzimmer huschte. Sie quittierte den Alarm, rückte ihre Brille mit dem altmodischen Drahtgestell zurecht, um dann etwas Desinfektionsflüssigkeit zwischen den Händen zu verreiben. Nun knipste sie die gedämpfte Nachtbeleuchtung an, denn das spärliche Licht vom Flur reichte nicht aus, um dieses mit nur einem Bett belegte Doppelzimmer genügend zu erhellen.
Noch bevor sie fragte, womit sie helfen könne, murmelte Elisa schwach: »Ist es jetzt so weit?«
All die Schmerzmittel und Krebsmedikamente, die sie seit Wochen verabreicht bekam, vernebelten Elisas Gedanken. Hinuntergewürgt hatte sie schon lange keinen Bissen mehr; was auch immer man ihr vorsetzte, seit zwei Tagen rührte sie nicht mal das Glas Wasser auf dem Nachttisch an. Tief im Innern wusste Elisa, bald würde alles vorbei sein.
Stumm, aber teilnehmend, blickte ihr Nachtschwester Arnold für einige Sekunden tief in die erschöpften Augen, schürzte die Lippen und nickte sanft.
»Aber wir wollen doch nicht aufgeben«, schob sie mit gütigem Lächeln hinten nach. »Erst heute Morgen hat Dr. Ritter die Dosis der neuen Chemo weiter erhöht. Wir fügen uns weiß Gott nicht widerstandslos dem Schicksal. In meinen unzähligen Jahren in der Pflege habe ich schon die eine oder andere Heilung in einer solch aussichtslosen Situation … erlebt.« Sie biss sich auf die Unterlippe, senkte beschämt ihren Blick auf die Schuhe und hielt in ihrer Erklärung inne, als sie die ungeschickte Wahl ihrer Worte erkannte.
Elisa winkelte langsam den dünnen Arm an, hob das Kinn fast unmerklich und deutete in einer ermatteten Bewegung mit der gebrechlichen Hand auf ihren Hals.
»Reichen Sie mir bitte meinen Schmuck … aus der Schublade«, hauchte Elisa. Sie wollte sich schön machen, um mit Würde das Ende ihres Lebenswegs zu beschreiten.
Behutsam legte ihr Nachtschwester Arnold das schlichte, aber anmutige Collier um den Hals. Nichts Extravagantes, die Diamanten waren klein und auch nicht lupenrein. Für Elisa waren sie dennoch von besonderem Wert, denn völlig unerwartet hatte sie diese vor vielen Jahren von Cecilia Hoffmann geerbt, ihrer einzigen Freundin. Cecilia war beim Schwimmen ertrunken. Kennen und schätzen gelernt hatte Elisa Cecilia bei den regelmäßigen Versammlungen des Quartiervereins der Luzerner Altstadt. Bis auf dieses Schmuckstück hatte die alte Dame ihr gesamtes Vermögen der Vogelwarte Sempach vermacht. Für Elisa stellten die Edelsteine eine teure Kostbarkeit dar, auch wenn diese im Umfeld des Krankenzimmers völlig fehl am Platz schien, als lieferte sie am Hals einen stillen Kampf um Aufmerksamkeit gegen das durchsichtige Schläuchlein, das sich hinter den Ohren durchschlängelte und leise zischend Sauerstoff in die Nase leitete.
Kraftlos, aber mit einem Lächeln, faltete Elisa die schmalen, bleichen Hände, ließ sie auf der Decke ruhen und schloss die Augen. So harrte sie ihrem Schicksal.
Vorsichtig zupfte Nachtschwester Arnold ihr zuerst das Kissen unter dem Kopf zurecht, dann prüfte sie das regelmäßige Tropfen der Salzlösung und der neuen Medikamente, welche in Kunststoffbeuteln an einem fahrbaren Metallständer baumelten und deren flüssigen Inhalt über ein biegsames Röhrchen Elisas Vene zuführte. Schließlich drückte Schwester Arnold sanft Elisas Unterarm, knipste das Nachtlicht aus, verrieb sich beim Hinausgehen erneut Desinfektionslösung zwischen den Händen, schloss mit einem leisen Klicken von außen die Tür und tauchte damit das Zimmer in vollkommene Dunkelheit und Stille.
Elisas Atem flachte noch weiter ab.
Nach wenigen Minuten setzte er ganz aus.
Mit Eisenplättchen beschlagene Absätze klackten rhythmisch auf den harten Kunststoffboden, der sich über die ganze Länge des Korridors hinzog. Das gehetzte Stakkato schwoll an, bis es vor Elisas Zimmer urplötzlich verstummte. Ohne anzuklopfen riss eine Hand die Tür auf und klickte die Deckenbeleuchtung an, die den Schatten des Betts scharf auf den Kunststoffboden zeichnete. Nicht im Geringsten darauf bedacht, Lärm zu vermeiden, stapfte der Mann zu Elisas Krankenbett. Dort hantierte er wenige Sekunden, ehe er sich abwandte und entschlossen aus dem Zimmer marschierte, ohne sich noch einmal nach der Patientin umzublicken. Die Türe ließ er offen stehen, als er sich schnurstracks den Gang hinunter aus dem Staub machte.
Für wenige Minuten harrte die ganze Abteilung in völliger Ruhe, bis die Nachtglocke mit unerbittlichem Piepen wiederum nach der Schwester schrie.
Wo bleibt denn nur die Nachtschwester, sonst kommt sie ständig hereingerannt, auch wenn ich nicht nach ihr gerufen habe, fragte sich Elisa und presste noch einmal den Daumen auf die Alarmglocke.
Als Schwester Arnold zum Zimmer hastete, wunderte sie sich erst über die offen stehende Tür und wechselte sogleich das gleißende Hell der Deckenlampe in schummriges Nachtlicht, als sie eintrat.
»Wer war das eben … bei mir im Zimmer?«, stammelte Elisa, rang nach Atem, hustete und fixierte Nachtschwester Arnold, schloss jedoch ermattet die Augen, noch bevor sie eine Antwort erhielt.
»Gerade eben habe ich einem anderen Patienten eine Schlaftablette gebracht«, antwortete die Schwester, die vor lauter Verwunderung über das neuerliche Alarmsignal aus diesem Zimmer vergaß, beim Eintreten die Hände zu desinfizieren. Denn diese Patientin hatte sie im Koma gewähnt. »Ihren Besucher habe ich nur ganz kurz durch die offen stehende Tür vorbeihetzen sehen. Er hat sich mir nicht vorgestellt.«
»Wie hat er ausgesehen? Etwa vierzig, braungebranntes Gesicht, teure Kleider?«
Nachtschwester Arnold nickte zögerlich, dann senkte sie den Blick. »Sie müssen wissen, das Morphin lässt Sie immer länger wegtreten. Ich kenne diese Symptome. Als Sie bei meiner letzten Visite vor einigen Stunden noch flacher geatmet haben, gefolgt von völligem Atemstillstand, habe ich mir erlaubt, diesen Herrn anzurufen. Erwähnt haben sie zwar nie jemanden, aber in den ärztlichen Unterlagen bin ich auf ihn gestoßen. Da er ihr einziger Verwandter zu sein scheint, habe ich mir gedacht, sie wünschten sicherlich, ihn noch ein letztes Mal zu sehen, sollten sie nochmals zu sich kommen. Aber ich habe nur diesen einen Anruf getätigt. Ganz ehrlich.«
»Oh, Gott, nein!«, entfuhr es Elisa in einem abgerissenen Keuchen, als sie ungelenk mit ihrer Handfläche das baumwollene Nachthemd über ihrer Brust abtastete. »Es fühlt sich an, als sei … Mein Collier liegt nicht mehr um meinen Hals.«
»Vielleicht ist es bloß runtergerutscht«, beschwichtigte die Nachtschwester und beugte sich über Elisa. Mit den Augen suchte sie das Bett ab, schüttelte aber bald den Kopf. »Ich kann’s nirgendwo entdecken.« Sie machte das Deckenlicht an und führte ihre Hand den Falten des weißen Bettzeugs entlang. Anschließend tastete sie erst unter dem Kissen, dann unter der dünnen Decke das fix gespannte Laken ab. Schließlich ging sie in die Knie und neigte den Kopf. »Auch nicht unter dem Bett.«
»Das wird ihm noch leidtun«, hauchte Elisa mit gepresster Stimme, während ihr Mund verbitterte Züge annahm. »Bitte suchen Sie … die Telefonnummer … von Rechtsanwalt Hartmann heraus … Man hat mir gesagt … er sei ein richtig … scharfer Hund.« Sie schnappte nach Luft. »Er soll herkommen … bitte … trotz dieser Uhrzeit … sofort. Ich habe etwas zu erledigen … bevor ich sterbe.«
2
Siebzehn Monate später:
Nie hätte sich Palmer auf diese Diskussion mit ihrem Chef einlassen dürfen, nun kriegte sie seine Worte nicht mehr aus dem Kopf. Niemand, auch nicht der Herr Direktor, hatte sie zu erinnern an ihre Aufgaben als Warenhausdetektivin, aber anders als er legte sie ihre Pflichten nicht ganz so eng aus. Immerhin bescheinigten ihr mehrere sorgsam aufbewahrte Dankesschreiben ihres Arbeitgebers überdurchschnittlichen Erfolg im Bestreben, Diebe zu überführen und der Polizei zu überstellen. In der Tat bewies Palmer ein unglaublich gutes Auge für Langfinger.
Allerdings hatte sie ihr Pflichtenheft aus freien Stücken um vorbeugende Maßnahmen erweitert, und genau dies war jetzt der strittige Punkt.
Der Vierzehnjährige hatte schon beinahe den rettenden Ausgang erreicht gehabt, blass im Gesicht, mit unsicherem Gang, den angewinkelten rechten Arm angepresst, als schmerze ihn dort der Oberkörper. Solche Zeichen eines Unwohlseins erkannte Palmer viel eher als die eines schlechten Gewissens.
Freundlich hatte sie ihn zur Seite geführt und eine coole Handy-Hülle zusammen mit »Beats-Pro«-Kopfhörern unter seiner Jacke hervorgezaubert, beides originalverpackt. Zusätzlich war da noch sein reichlich verwaschener Gesamteindruck, der so gar nicht passte zu seinen glänzend neuen, knallroten Nike-Schuhenan den Füssen. Palmer wusste, seine eigenen Latschen würde sie im Regal finden, fein säuberlich eingereiht inmitten der Neuheiten. Und als sie noch weiterbohrte, stieß sie auf zwei fabrikneue T-Shirts einer angesagten Marke, die er unter seinem Sweater nach draußen zu schmuggeln versucht hatte.
Hohe Regale, ausladende Dekorationen, raumgreifende Rolltreppen und massive Stützpfeiler minderten die Übersicht auf den Etagen des Warenhauses und erleichterten Dieben ihr Vorhaben. Wo sich Kunden in Gängen drängten, Produkte betasteten und mit den Fingern prüften, wanderte schnell mal das eine oder andere passende Stück in die Tasche oder unter die Jacke. Palmers gutes Auge für Ausbuchtungen, wo keine sein sollten, umständlich langes Herumlungern, um vermeintlichen Hausdetektiven auszuweichen, oder deren typische Leidenshaltung erleichterten ihr die Arbeit.
Aber genau hier lag der juristische Stolperstein, nämlich in der Art und Weise, wie sie einem Dieb gegenübertrat. War sie zu rau oder drohte womöglich, erfüllte sie schnell den Tatbestand der Nötigung oder gar der Erpressung und stand dann selbst in Konflikt mit dem Gesetz. Außerdem durfte sie zwar einen Dieb anhalten, jedoch den Verdächtigen nur so lange festhalten, bis die Polizei eintraf, wobei sie diese sofort zu verständigen hatte, andernfalls machte sie sich der Freiheitsberaubung strafbar.
Und exakt an diesem Punkt hakte der Direktor heute ein. Palmer hatte den Schüler auf frischer Tat ertappt, hatte ihn zur Seite genommen und ihm ins Gewissen geredet, ihm bildlich vor Augen geführt, was mit ihm geschieht, falls er vor dem Richter landet.
»Palmer, ich kenne dein großes Herz für Jugendliche«, sagte der Warenhausdirektor und schüttelte den Kopf. »Dennoch musst du die Spielregeln einhalten«, flehte er. »Überführen, die Polizei rufen, fertig. Den Jungen ins Gewissen zu reden interessiert hier niemanden.«
Er hatte Palmer auf ihrem Weg in den Feierabend gerade noch im Flur hinter den Kulissen eingeholt. Sogleich hatte er sie zur Rede gestellt in diesem stickig heißen Gang, der so grell beleuchtet war, dass sich die Leuchtstoffröhre auf seiner Stirn spiegelte.
»Erwachsene können von mir keine Nachsicht erwarten«, verteidigte sich Palmer. »Du weißt aber, wie gut meine Standpauken bei Jugendlichen wirken. Okay, die Polizei lasse ich dann außen vor und rede ihnen ins Gewissen. Das angedrohte Polizeiverhör sitzt ebenso tief wie das zu erwartende zermürbende Gerichtsverfahren, die saftige Buße und erst recht die peinlichen Diskussionen mit Vater und Mutter, denen sie entgegenblicken, falls ich sie beim nächsten Mal der Polizei melde. Es gibt Eltern, die mir für meine eindringlichen Warnungen danken. Erst vergangene Woche hat mich ein Vater aufgesucht und bestätigt, wie gut sich ihr Sprössling nach meiner Moralpredigt entwickelt hat, auch sei er nicht rückfällig geworden. Er hat sich bedankt für meine Nachsicht und dafür, dass ich den Jungen nicht der Polizei überstellt habe.«
»Ich will von dir keine Charakterstudien. Ein Warum hat in deinem Job niemanden zu interessieren. Hörst du? Was ich von dir erwarte ist eine Überführung mit einem einfachen Bericht – wer, wie, wo, wann und was. Abgeholt durch die Polizei. Punkt. Mit deinen Predigten tanzt du auf der ganz dünnen Linie zur Illegalität, wenn du diese Jungen zwar in den Hinterraum führst und sie beschwörst, aber nicht unmittelbar die Polizei benachrichtigst.«
Palmer verschränkte die Arme und sah ihrem Chef mit strengem Blick in die Augen.
Als ein Kollege aus Palmers Abteilung in den Flur trat und erfasste, wie der Direktor hier ein ernsthaftes Gespräch führte, verfinsterten sich dessen Gesichtszüge, während der Direktor innehielt und stumm zu Boden blickte. Auch der Kollege wich Palmers Augenkontakt aus und hüstelte, während er sich an beiden vorbeizwängte. Erst als die Türe hinter ihm auf der anderen Seite des Flurs wieder ins Schloss einklickte, fuhr der Direktor fort.
»Stell dir vor, einer dieser Diebe verpetzt dich bei seinen Eltern, obwohl du ihn bei der Polizei nicht gemeldet hast, und diese fühlen sich in ihrer Ehre verletzt im Sinne von: Aber mein Kinddoch nicht.« Dabei hielt er die Arme hoch, wackelte mit Händen und Kopf und verdrehte die Augen. »Für dich sieht es gar nicht gut aus, sollten Vater oder Mutter Gefallen finden, in einen juristischen Kampf zu steigen. Und als dein Chef würde alles zurückfallen auf mich.« Sein Gesicht rötete sich. »Ich lass mir meine Karriere nicht versauen. Nicht von dir.« Bei jeder einzelnen Silbe stach er mit dem Zeigefinger nach Palmer: »Ich hab deine Extravaganzen satt. Erst vor zwei Tagen hat sich einer deiner Mitarbeiter beschwert, du hättest ihn ›Arschgutzi‹ genannt. Ich frage mich, ob dies nicht vielleicht sogar eine sexuelle Belästigung war.«
»Wenn du dich erst fragen musst, war es keine.«
Sein Blick huschte gehetzt durch den engen Gang, als suchte er nach einem Tisch, um die flache Hand draufzuknallen. Nun wurden seine Augen zu Schlitzen. »Schluss jetzt mit deiner Milde Dieben gegenüber, sonst schmeiß ich dich raus.«
Endlich draußen hätte Palmer viel darum gegeben, sich an einem lauschigen Plätzchen ein kühles Bier zu gönnen. Aber als die Drohung des Chefs ihr wieder durch den Kopf schoss, breitete sich Gänsehaut über ihren Körper aus. Auf gar keinen Fall durfte sie ihren Job verlieren, das hätte ihr gesamtes Leben auf den Kopf gestellt. Auf weitere Nachsicht ihres Vermieters durfte sie nicht bauen, hatte er ihr doch klipp und klar kundgetan, keine einzige Beschwerde mehr wegen zu viel Lärm von einem Nachbarn würde er akzeptieren. Damit meinte er ihre E-Gitarre. Und auch die Miete habe ab sofort rechtzeitig auf seinem Konto zu landen, Ausnahmen werde er keine mehr dulden. Sie ärgerte sich, denn deren Fälligkeit verpasste sie aus reiner Nachlässigkeit. Aber Palmer würde jetzt alles daransetzen, die gemütliche Wohnung im Obergeschoss des hölzernen Ruderhauses zu behalten, direkt am See in der Grünzone. Klar meinte Alex, es sei nun an der Zeit, sie solle endlich bei ihm einziehen, aber sie hatte den klaren Willen, ihre eigene Wohnung und damit ihre Freiheit zu behalten.
Eigentlich hatte sie sich lange nicht mehr so gut gefühlt wie in diesen Tagen. Seit sie mit Alex zusammen war, hatte sich ihr Privatleben merklich beruhigt, auch ihre Finanzen standen kurz davor, sich erstmals im grünen Bereich zu bewegen. Dieses für sie neue, entspannte Gefühl wollte sie auf keinen Fall aufs Spiel setzen, indem sie ihren Job verlor. Denn über zu wenig Geld zu verfügen war eine der spärlichen Konstanten in ihrem Leben.
Auch hatte sie sich fest vorgenommen, sich aus den Problemen anderer rauszuhalten. Damals nach ihrer vermissten Freundin Juli zu suchen, später auch nach Niki, war ihre persönliche Sache gewesen. Als dann die Medien ihre Erfolge in großen Headlines aufmachten, traten mehrmals Unbekannte an sie heran und baten um Hilfe. Eine Dame bettelte, sie solle einen Fahrzeuglenker ermitteln, der sich ohne Angabe seiner Personalien aus dem Staub gemacht und sie mit dem Blechschaden zurückgelassen habe. Ein anderer bekniete sie, seinen erwachsenen Sohn nach Hause zu bringen, vermutlich aus Italien, wohin er nach einem Streit abgehauen sei, da der Vater sich weigerte, weiter für ihn und seinen Drogenkonsum aufzukommen. Als sie mit Alex darüber sprach, ermutigte er sie, sich selbstständig zu machen. Doch Palmer zögerte, denn sie fürchtete, nicht genügend viele Auftraggeber zu finden, und wenn, mussten diese ja auch bereit sein, einen genügend hohen Preis für ihre Leistung zu zahlen.
Aber allem voran war ihr persönlicher Einsatz für Juli und Niki folgenschwer gewesen und hatte sie beide Male fast das Leben gekostet. Damit war Schluss. In solch eine Situation wollte sie sich nie mehr begeben.
So hatte sie das zumindest bis zum Vortag gesehen. An dessen Abend allerdings hatte sie am Arbeitsplatz der Anruf einer Frau erreicht, die verzweifelt geklungen hatte, wodurch sie sich hatte erweichen lassen, sie heute um siebzehn Uhr zu Hause zu besuchen. Kein Mensch interessiere sich für ihr Problem, hatte die Frau ihr Leid geklagt. Palmer hatte sich vorgenommen, ihr zumindest mal ein offenes Ohr zu schenken. Aber ihre Entscheidung, keinen Auftrag anzunehmen, war bereits gefallen.
Wäre sie nicht in die unerwartete Moralpredigt ihres pingeligen Chefs geraten, hätte sich Palmer jetzt nicht verspätet, als sie sich eiligst vom Warenhaus auf den Weg zu dieser verzweifelten Frau machte. Das Feierabendbier musste warten.
Von oben brannte die Sonne, gleichzeitig aber verspürte Palmer angenehme Kühle und roch den moosigen Geruch der seelenruhig unten dahinströmenden Reuss, als sie über den Rathaussteg eilte und anschließend jeweils zwei Stufen im Sprung die Rathaustreppe hinauf nahm. Auf dem Kornmarkt bahnte sie sich ihren Weg durch eine Gruppe chinesischer Touristen, von denen einige mit ihrem Handy das Rathaus im Stile eines italienischen Renaissance-Palazzos filmten, dem man jedoch vor einigen hundert Jahren nach heftigem Streit ein riesiges Satteldach statt einer diskreten, nahezu flachen Bedeckung verpasst hatte. Guckt sich diese Videos tatsächlich irgendwann jemand an von Anfang bis Ende?, fragte sie sich. Nun legten die Reisenden wie auf Kommando den Kopf in den Nacken und blickten zur Spitze des Rathausturms hoch, der die Ziegeldächer dieser gegen tausend Jahre alten Stadt weit überragte.
Auf der anderen Seite des Platzes bog Palmer links ab, überquerte erst den Weinmarkt, durchschritt den Mühleplatz, bog rechts in die ansteigende Brüggligasse ein, um endlich auf der menschenleeren Museggstrasse noch steiler hochzuhasten, zu welcher nur Bewohnern oder Besuchern die Zufahrt gestattet war. Bald drosselte sie ihr Tempo, damit ihr nicht die Puste ausging. Erleichtert stieß sie einen Seufzer aus, als sie endlich ganz oben die Hausnummer 31 erreichte.
Das mächtige Anwesen im neoklassizistischen Stil lag gerade noch innerhalb der mittelalterlichen Befestigungsmauern mit ihren Türmen, die sich vom Musegghügel über die Altstadt erhoben. Offensichtlich erst kürzlich neu angestrichen, erstrahlte das Bauwerk in erhabener Eleganz. Ein ausladendes Doppelhaus mit zehn Wohnungen, inmitten einer kleinen, aber gut gepflegten Parkanlage.
Da das Gartentürchen offen stand, stolperte Palmer die paar Treppenstufen hinunter und stellte sich vor die Klingeln von Nummer 31, Tür an Tür mit Nummer 29. Mit den Händen auf die Knie gestützt atmete sie tief durch, wobei sie spürte, wie das Shirt ihr am Rücken klebte.
Während sie verschnaufte und sich umblickte, wunderte sie sich über den weißen Lamborghini in der blauen Zone vor dem Haus, der so gar nicht in diese ruhige Umgebung passte, da zu erwarten war, dass dessen Motor jeden aus dem Schlaf riss, wenn er beim Starten losbrüllte.
Wieder zu Atem gekommen, richtete sich Palmer auf, hob die linke Schulter an und legte den Kopf schräg, um sich mit dem kurzen Ärmel die Stirne trockenzuwischen. Jetzt war sie bereit. Sie drückte den Zeigefinger auf die zweitoberste Klingel bei »Wirtz«, und fast gleichzeitig summte der Türöffner. Offensichtlich wurde sie erwartet.
Was für eine Wohltat, als sie die Tür aufdrückte. Ein Hauch kühler Luft schwappte aus dem Treppenhaus und erfrischte ihr Gesicht. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn als sie sich umblickte, fanden ihre Augen keinen Aufzug, und ihr blieb nichts anderes übrig, als zu Fuß die drei Stockwerke zu bezwingen.
Bedächtig stapfte sie nach oben, während sich allmählich ein Wohlgefühl in der Brust ausbreitete, hervorgerufen durch die kunstvollen Grafiken und modernen Ölgemälde, welche die Wände des Treppenhauses säumten.
Es roch frisch gebohnert, und bei fast jeder Stufe knarzte das Holz. Auf einer der Zwischenetagen machte sie kurz Halt, um zärtlich mit der Hand über die kühlende Oberfläche der Bronzebüste einer ihr unbekannten männlichen Persönlichkeit zu streichen. Zu diesem Haus gewährte man wohl nur ausgewählten Gästen Zutritt, dachte Palmer, ansonsten hätte längst jemand die Kunstwerke von den Wänden geklaut.
In der dritten Etage erwartete sie, halb verdeckt in der offenen Tür, eine blasse Frau mit traurigen Augen. Sie war Ende dreißig und nicht unattraktiv, auf eine eher nüchtern strenge Art. In ihren kurzen braunen Haaren zeigte sich das erste Grau, wobei sich die ungleichmäßige Länge womöglich dadurch erklärte, dass sie es sich selber schnitt. Sie hatte auf jegliches Make-up und auch auf Schmuck verzichtet, abgesehen von einer uralten, unscheinbaren Armbanduhr. Mit ihrer hageren Figur wirkte sie ziemlich schwächlich und trug etwa so wenig Fleisch auf den Knochen, wie die aktuelle Mode vorschrieb, nur dass sie offensichtlich nichts auf diese gab. Das formlos beigefarbene T-Shirt mit Schmetterlingsdruck und die graue Leinenhose, die nur bis knapp unter das Knie reichte, waren schon lange nicht mehr angesagt, passten aber zu den geflochtenen Ledersandalen, durch deren weite Maschen ihre nackten, leicht einwärtsgerichteten Füße schimmerten.
»Ganz lieb, sind Sie trotz Ihrer Vorbehalte … ich meine, schön, dass Sie gekommen sind«, sagte Elisa Wirtz mit leiser Stimme und strich sich die Hose glatt. »Bitte, Frau Palmer, treten Sie ein.«
Da Frau Wirtz zurücktrat, sogleich aber zu Boden blickte und keine Anstalten machte, ihr die Hand zu reichen, schritt Palmer an ihr vorüber und betrat den Wohnungsflur. Hinter sich hörte sie, wie Frau Wirtz das Türschloss verriegelte, und zwar doppelt.
Vom gut acht Meter langen und fast drei Meter breiten Fischgrat-Parkett des Korridors gingen massive Holztüren ab zu insgesamt sieben Zimmern, während man in jene von Bad und Küche seinerzeit in guter Handwerksarbeit ein Riffelglas eingesetzt hatte. In der Luft mischten sich die Gerüche von reifen Äpfeln und Möbelpolitur.
Palmer war beeindruckt. Allerdings stellte sie sofort fest, sie hatte nicht das Heim einer Kunstliebhaberin betreten. Einzig ein viel zu großer Werbekalender mit einem Schnappschuss aus der Natur über Notizfeldern für jeden Tag bemühte sich, den Gang mit den sonst kahlen Wänden zu schmücken.
Palmer entging nicht, dass Elisa Wirtz’ Blick auf ihren ungepflegten Turnschuhen haftete. Sie räusperte sich. »Ist es okay, wenn ich meine Converse ausziehe?« Ohne eine Antwort abzuwarten, hakte Palmer die Ferse des einen Turnschuhs unter die große Zehe des andern und streifte sich beide von den Füßen, ließ sie auf dem Parkett wie hingeworfen liegen und zog sich die Socken hoch.
Erst kräuselte Elisa Wirtz die Lippen, dann bückte sie sich, stellte die Schuhe bei der Wohnungstür auf der kleinen Matte exakt nebeneinander und streifte mit einer fließenden Handbewegung die Bändel in die Öffnung.
Auf dem Weg ins Wohnzimmer entdeckte Palmer durch eine offen stehende Tür eine Modelleisenbahn, welche sich über die Fläche des ganzen Zimmerbodens ausbreitete. Der Transformator stand vor einem zusammengefalteten Deckchen inmitten der Geleise, daneben ruhten die rote Mütze des Stationsvorstehers, eine Trillerpfeife und eine Signalkelle.
Frau Wirtz kam hinzu und meinte, während sie die Tür schloss: »Mein kleines Hobby«, wobei sie Palmer einen betretenen Blick zuwarf wie ein schuldbewusstes Kind.
Palmer lächelte. Auch wenn sie als kleines Mädchen Puppen vorgezogen hatte, eine solche Bahn hätte sie sich auch gewünscht in der Hoffnung, ihr Vater hätte zumindest dann und wann mit ihr gespielt, statt sich irgendwo rumzutreiben. Schließlich hatte er die kleine Familie endgültig verlassen, weshalb Palmer nach dem Tod ihrer Mutter alleine in der Welt stand, ganz so wie Heidi, die Heldin ihrer Kindheit, deren Geschichte ihr die Mutter ungezählte Male hatte vorlesen müssen, wieder und wieder. Genau wie Heidi hatte auch Palmer eine Welt zu ertragen, die nicht heil war. Wie hatte sie sich an alle diese idealen Bilder geklammert, von der Schweiz und der Familie, die sie selbst nie erlebt, aber sich erträumt hatte.
Als Palmer ins Wohnzimmer trat, vernahm sie durch die offen stehende Balkontür übermütiges Vogelgezwitscher. Sie trat zum Fenster, blickte nach unten zum Apfelbaum im Garten, von dem das Pfeifen und Tirilieren heraufdrang und wo Frau Wirtz sicher auch die roten Äpfel gepflückt hatte, die sie dekorativ in der flachen Schüssel auf der Kommode angeordnet hatte.
Drei rahmenlose Plakate von fast gleicher Größe mit Zeichen in kalligrafischer Schönschrift schmückten in ungleichen Abständen nebeneinander gehängt die Wand. Da hatte jemand tiefschwarze Farbe mit einem Riesenpinsel auf schneeweiße Papierbögen in Übergröße gemalt und ließ die einzelnen Buchstaben filigran zu einem stilvollen und formvollendeten Ganzen verschmelzen. Auf dem ersten Plakat las Palmer »Carpe diem«, das Arschgeweih unter den Lebensweisheiten, aber gleich daneben wurde es besser. »Träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume« war da aufgepinselt und »In allen Dingen ist hoffen besser als verzweifeln«. Nun wurde Palmer nachdenklich, und sie fragte sich, in welcher Lebenslage jemand sein musste, um sich mit solchen Allerweltsprüchen aufzubauen.
Noch während sie die ästhetische Ausgewogenheit der Pinselstriche bewunderte, fragte Frau Wirtz: »Setzen wir uns auf den Balkon?« Mit einer Handbewegung bat sie Palmer hinaus.
Eigentlich war es Palmer zuwider, jemanden zu siezen. Allerdings hatte sie es längst aufgegeben, ihre Gesprächspartner auf du zu trimmen, denn das hatte regelmäßig zur Folge, dass diese sie mit ihrem amtlichen Vornamen ansprachen, falls sie ihn kannten, und das wollte sie unbedingt vermeiden. Christabel. Palmer hasste diesen Namen. Über Jahre hatte sie bei allen darauf beharrt, bloß mit Chris angesprochen zu werden. Allerdings beschwor dieser Vorname nur weitere Erklärungen herauf, weil die Leute wissen wollten, weshalb sie einen Jungennamen trug.
»Du nennst mich Palmer. Und ich werde dich mit Elisa ansprechen«, stellte Palmer frei heraus klar.
Auf dem Balkon zog Palmer einen Gartenstuhl vom Tisch, setzte sich und genoss den prächtigen Ausblick über Luzerns rote Giebeldächer bis hinauf zu den Spitzen des Pilatus. Links davon schloss die Alpenkette an, davor glänzte in silbernem Blau der Vierwaldstättersee, während die frühe Abendsonne die Szenerie in sanft goldenes Licht tauchte. Sie konnte jeden verstehen, der von weither anreiste, um Luzern einmal im Leben mit eigenen Augen zu sehen. Wer heute eine Wohnung mit solcher Aussicht kaufen wollte, müsste locker zwei Millionen hinblättern, dachte Palmer tief beeindruckt.
Elisa setzte sich ihr gegenüber an den Tisch, auf welchem bereits zwei Gläser mit der Öffnung nach unten auf einem mit Werbung bedruckten Bierdeckel standen, exakt eingemittet auf zwei sich schneidende Linien des grüngestreiften Tischtuchs. Vor beiden Plätzen hatte Elisa je ein Set mit Teller, Gabel und Messer zurechtgelegt mit je einer beigen Stoffserviette. In der Mitte ruhte stilles Wasser in einer Glaskaraffe, von der kondensierte Tropfen auf das Tischtuch rannen und bereits einen kreisförmigen dunklen Fleck bildeten.
Gekrönt wurde die Tafel durch eine runde Kunststoffschale, auf der Elisa vier sorgsam mit Frischkäse bestrichene und mit Schnittlauch bestreute Vollkornbrotscheiben hergerichtet hatte, die Palmer an ihre Kindheit erinnerten. Ähnliche Schnittchen hatte ihre Mutter serviert, aber nicht als Zwischenmahlzeit, sondern als Nachtessen. Für mehr war kein Geld da gewesen.
Palmers Blick musste wohl einige Sekunden zu gierig auf dieser Stärkung verweilt haben, jedenfalls schob Elisa die Käsebrote in ihre Richtung. Dankbar hob Palmer eines davon mit Daumen und Zeigefinger direkt an den Mund und biss herzhaft zu. Den Rest legte sie auf ihren Teller, noch bevor sich Elisa ihre Serviette zu einem tadellosen Dreieck auseinanderfaltete, sich in den Schoß legte, mit Messer und Gabel eines der Schnittchen auf der Schale teilte und bloß die eine Hälfte auf ihren Teller schob. Aber ehe sie sich eine Miniportion zum Mund hob, achtete sie darauf, ihre halbe Ration in genau gleich große Portionen zurechtzuschneiden. Anschließend legte sie die Spitzen von Gabel und Messer auf den Teller und richtete sie parallel zur Tischkante aus, bevor sie bedächtig kaute. Als sie endlich runterschluckte, sah es aus, als ob sie dies schmerzte.
»Darf ich?«, fragte Palmer, wobei sie bereits mit den Händen beide Gläser umdrehte und sofort zur Wasserkaraffe griff. Ohne eine Antwort abzuwarten, füllte sie Wasser ein, genehmigte sich sogleich einige Schlucke und gab einen tief entspannten Seufzer von sich. Als sie das leere Glas zügig auf den Tisch stellte, schreckte Elisa zurück ob des dumpfen Aufschlags.
»So, und nun erkläre mir bitte, weshalb du mich so eindringlich beschwört hast herzukommen. Wir sind uns noch nie begegnet. Meine Bedenken habe ich dir bereits am Telefon mitgeteilt. Also, was ist es, das keinen Aufschub duldet?«, fragte Palmer.
Elisa nickte bloß, und Palmer hörte, wie ihr Stuhl selbst bei kleinsten Bewegungen krächzende Geräusche von sich gab. Elisa machte einen tiefen Atemzug, stieß die Luft geräuschvoll aus und brachte ein trauriges Lächeln zustande. »Die Zeitungen haben alles völlig verzerrt dargestellt. Am Allerschlimmsten war …«
»Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Am Telefon hast du erwähnt, dir sei Unrecht widerfahren. Wo, wie und wann hat alles begonnen? Was ist passiert?«
Elisa senkte den Kopf und starrte auf das Muster des Tischtuchs.
»Die Ärzte haben mit dem Schlimmsten … sie haben mir nie Hoffnung gemacht wegen meines bösartigen Gehirntumors«, begann Elisa leise. »Das erste Mal diagnostiziert haben sie die Krankheit vor vier Jahren. Anfangs habe ich gut auf die Bestrahlung und Medikamente angesprochen, aber dann war der Tumor doch stärker. Schließlich habe ich mich im Krankenhaus wiedergefunden, aber dort ging es mit mir … ich meine, ich bin in den letzten Zügen gelegen. Inoperabel, meinten die Ärzte, ich hätte nur noch kurz zu leben.«
Palmer spürte, wie ihr alle Farbe aus dem Gesicht wich. Krebs. Unweigerlich erinnerte sie sich an das Elend ihrer Mutter. Obwohl sie nicht mal geraucht hatte, hatte Lungenkrebs sie hinweggerafft. Palmer schluckte leer und atmete tief ein.
Elisa fuhr fort: »Trotzdem haben sie die Infusionen mit Heilmitteln nicht gestoppt, wofür ich ihnen dankbar bin. Sie haben sogar neue Kombinationen ausprobiert, zu verlieren hatte ich nichts. Jedenfalls, als niemand mehr dran glaubte, hat sich der Tumor tatsächlich innert Wochen zurückgebildet und die Durchblutung der betroffenen Hirnregionen nicht mehr beeinträchtigt. Mein Verstand arbeitet jetzt wieder ohne Einschränkungen.« Kaum wahrnehmbar zuckte sie mit den Schultern und schniefte wie jemand mit chronisch entzündeten Nebenhöhlen. Ein Häufchen Elend.
Als Elisa nicht weitererzählte und Palmer die Stille nicht mehr ertrug, fragte sie:
»Die kalligrafischen Plakate mit den Sinnsprüchen im Wohnzimmer, hast du diese gemalt?« Sie hatte es sich zusammengereimt, Elisa spreche sich mit den Lebensweisheiten selber Mut zu, ihre knappe Lebenszeit heute noch zu genießen und nichts auf den nächsten Tag zu verschieben.
Elisa nickte.
Palmer stellte sich vor, wie Elisa über einem riesigen Papierbogen stand und mit einem langstieligen Pinsel konzentriert arbeitete, in Meditation versunken, Zeit und Raum und alle Probleme für Momente wie weggewischt.
»Ich bin froh, ist es mir möglich, wieder zu Hause zu leben«, fuhr Elisa fort. »Die Langeweile im Krankenhaus habe ich nicht länger ausgehalten, die dauernden Visiten der Krankenschwestern rund um die Uhr, die bitterernsten Gespräche mit den Ärzten, die Enge der vier Wände, die stetig näher zu rücken schienen, die eintönige Trostlosigkeit, die sich durch nichts unterbrechen ließ, weil man vor Schwäche bewegungslos im Bett liegt. Und wer diesen kranken Mist im Fernsehen schaut, fühlt sich gleich noch mieser.« Sie atmete tief durch. »Immerhin bin ich jetzt zu Hause und verlasse die Wohnung nur, um Essen zu besorgen. Ist zum Glück nur die Straße runter.« Scheu blickte sie in Palmers Gesicht. »Es geht mir mittelmäßig, solange ich die Medikamente nehme, sie stabilisieren meinen Zustand und halten den Krebs in Schach. Immerhin. Allerdings hat die letzte Untersuchung leider bestätigt: Geheilt bin ich nicht. Meine Überlebenschance ist klein. Dafür ist meine Hoffnung umso größer.« Sie lächelte traurig. »Täglich bete ich darum, mein Zustand möge wenigstens so bleiben wie heute.«
Elisa drückte sich mit Daumen und Zeigefinger den Nasenrücken.
»Nach den vielen Wochen Krankenhaus habe ich mich einige Tage erholt, habe nach und nach sogar wieder etwas an Gewicht zugelegt. Dann habe ich Sergey Rjabow besucht, um mich zu bedanken.«
Dieser Name traf Palmer wie ein Hammerschlag. Mit einem Mal erinnerte sie sich.
»Moment. Die Headlines in den Zeitungen haben doch verkündet, er habe dich vergewaltigt.«
3
In einer ungelenken Bewegung versuchte Elisa eine nicht vorhandene Strähne hinter ihr rechtes Ohr zu streichen. Vermutlich eine Bewegung, die sie sich angewöhnt hatte, als sie noch längere Haare trug. Sie lächelte traurig, bevor sie Palmer antwortete.
»Bis ich den Job habe aufgeben müssen wegen des Tumors, habe ich als Buchhalterin gearbeitet. Bei Sergey Rjabow. Meine Krankheit war allen ziemlich … kein Mensch hat sich nach mir erkundigt, als ich im Krankenhaus gelegen bin. Rjabow war der Einzige, der von sich hat hören lassen, als ich im Sterben lag. Zwar wäre mir jeglicher Besuch von irgendjemand in der Onkologie zu viel gewesen, allerdings ist gar niemand auch nur auf diese Idee gekommen. Aber Rjabow hat mir einen riesigen bunten Blumenstrauß gesandt mit aufmunternden Worten auf einer Karte. Das hat mich gerührt. Und irgendwie hat es mir auch geschmeichelt, ich meine, er, der milliardenschwere Rohstoffhändler. Die Blumen mit der Karte waren wie ein Lichtstrahl in der düsteren Zeit.« Sie hob das Wasserglas an die Lippen, nahm jedoch keinen Schluck. »Als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wollte ich mich für seine Anteilnahme persönlich bei ihm bedanken. Aber da hat er sich auf mich … da hat er mich vergewaltigt.« Sie starrte auf das Wasserglas.
Palmer hatte das Gefühl, die tiefe Traurigkeit in Elisas Augen nicht mehr länger auszuhalten. Sie setzte sich aufrecht, drehte sich den Alpen zu und fragte sich, ob es denn überhaupt möglich sei, noch mehr zu erfahren, ohne Elisa zu verletzen. Währenddessen zwitscherten die Vögel im Garten fröhlich, als sei nichts gewesen.
Schließlich wandte sie sich wieder Elisa zu, vermied jedoch den Blickkontakt. Erst jetzt entdeckte Palmer die frische Wunde auf Elisas Handrücken und ahnte, Elisa kratzte sich selbst, bis es blutete, so als wollte sie sich zwingen aufzuwachen aus ihrem bösen Traum, in welchem ihr immer und immer wieder Leid angetan wurde, an Körper und Seele. Als Elisa Palmers Blick bemerkte, versuchte sie ihre Wunde unter dem Tischblatt zu verbergen, als sei die Verletzung ein Nachweis für ein Vergehen, das sie begangen hatte.
Dann erst fuhr Elisa fort.
»Zunächst habe ich gezögert, Klage gegen Rjabow zu erheben. Aber der Weinstein-Skandal in Hollywood … diese #MeToo-Bewegung hat mich ermutigt, ihn anzuzeigen. Aber nachher kam ich mir vor wie im falschen Film. Ich wollte Gerechtigkeit, habe Schutz gesucht, stattdessen habe ich öffentliche Zurschaustellung gefunden.« Noch immer hielt sie das Wasserglas in der Hand, aber ihre Finger umklammerten es so stark, als wollte sie es erwürgen.
»Man hat dich zur Schau gestellt?« Fragend hob Palmer die Augenbrauen.