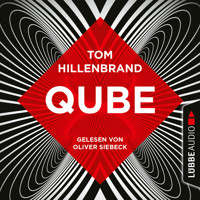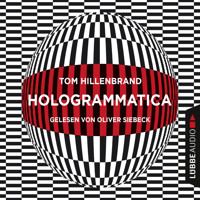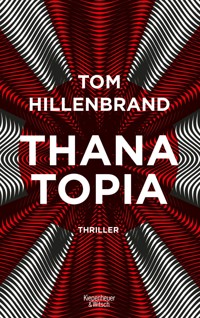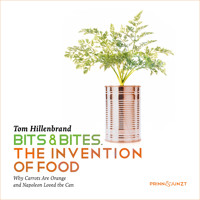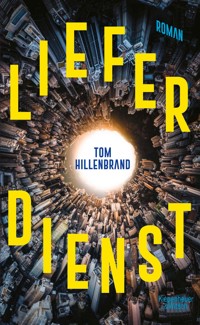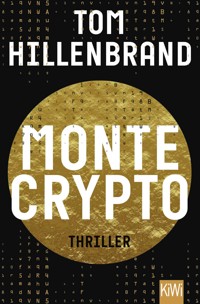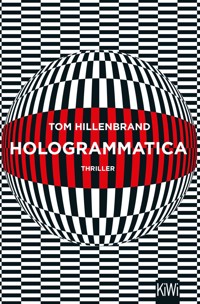
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Aus der Welt der Hologrammatica
- Sprache: Deutsch
Ungeheuer spannend – Bestsellerautor Tom Hillenbrand entwirft in seinem neuen Thriller ein spektakuläres Bild unserer Gesellschaft am Ende des 21. Jahrhunderts. Wenn künstliche Intelligenz die Probleme der Welt lösen kann – sind wir dazu bereit, die Kontrolle abzugeben? Ende des 21. Jahrhunderts arbeitet der Londoner Galahad Singh als Quästor. Sein Job ist es, verschwundene Personen wiederzufinden. Davon gibt es viele, denn der Klimawandel hat eine Völkerwanderung ausgelöst, neuartige Techniken wie Holonet und Mind Uploading ermöglichen es, die eigene Identität zu wechseln wie ein paar Schuhe. Singh wird beauftragt, die Computerexpertin Juliette Perotte aufzuspüren, die Verschlüsselungen für sogenannte Cogits entwickelte – digitale Gehirne, mithilfe derer man sich in andere Körper hochladen kann. Bald stellt sich heraus, dass Perotte Kontakt zu einem brillanten Programmierer hatte. Gemeinsam waren sie einem großen Geheimnis auf der Spur. Der Programmierer scheint Perotte gekidnappt zu haben. Je tiefer Singh in die Geschichte eintaucht, umso mehr zweifelt er daran, dass sein Gegenspieler ein Mensch ist ... Tom Hillenbrand, dessen Sachbücher und Romane sich bereits hunderttausende Male verkauft haben, in mehrere Sprachen übersetzt sind und auf der SPIEGEL-Bestseller- sowie der Zeit-Bestenliste standen, setzt mit seinem Science Fiction-Thriller »Hologrammatica« neue Maßstäbe und zieht den Leser mit spektakulärem Sog in die Zukunft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 716
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Tom Hillenbrand
Hologrammatica
Thriller
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Tom Hillenbrand
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Tom Hillenbrand
Tom Hillenbrand, geboren 1972, studierte Europapolitik, volontierte an der Holtzbrinck-Journalistenschule und war Ressortleiter bei SPIEGEL ONLINE. Seine Sachbücher und Romane sind in viele Sprachen übersetzt und mit Preisen ausgezeichnet. Für »Hologrammatica« erhielt er den Krimipreis von Radio Bremen.
www.tomhillenbrand.de
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ende des 21. Jahrhunderts arbeitet der Londoner Galahad Singh als Quästor. Sein Job ist es, verschwundene Personen wiederzufinden. Davon gibt es viele, denn der Klimawandel hat eine Völkerwanderung ausgelöst, neuartige Techniken wie Holonet und Mind Uploading ermöglichen es, die eigene Identität zu wechseln wie ein paar Schuhe. Singh wird beauftragt, die Computerexpertin Juliette Perrotte aufzuspüren, die Verschlüsselungen für sogenannte Cogits entwickelte – digitale Gehirne, mithilfe derer man sich in andere Körper hochladen kann. Bald stellt sich heraus, dass Perrotte Kontakt zu einem brillanten Programmierer hatte. Gemeinsam sind sie einem großen Geheimnis auf der Spur. Der Programmierer scheint Perrotte gekidnappt zu haben. Je tiefer Singh in die Geschichte eintaucht, umso mehr zweifelt er daran, dass sein Gegenspieler ein Mensch ist …
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Hinweis zum Buch
Hologrammatica
Coda
Hologrammlexikon
Dank
Leseprobe »Thanatopia«
Für Jan, der mir das lustigste Raumschiff des Universums zeigte.
Gern träume ich
Von einer kybernetischen Lichtung
In der Säugetier und Computer
Zusammenleben in einträchtig
Programmierter Harmonie
Richard Brautigan, »Behütet von Maschinen der liebevollen Gnade«
Do you think we’re robot clean
Does this face look almost mean
Is it time to be an android, not a man?
The Misfits, »We are 138«
Ein kleines Hologrammlexikon finden Sie am Ende des Buches
Ich hatte es fast. In der Mitte gibt es diese Stelle, wo das Tenorsaxofon wie ein betrunkener Gigolo um die Trompete herumscharwenzelt, sich entfernend, sich heranpirschend. Wenn Trane die Passage spielt, hört man die blaue Lok förmlich durch die Nacht stampfen. Mein »Blue Train« klingt, als ob der Heizer vor dem Ofen eingeschlafen wäre. Aber diesmal war ich ganz gut, auf jeden Fall näher dran als je zuvor. Das Sax tat, was es wollte. Was es sollte. Das Tao des Bebop. Ich hatte es fast.
Aber dann haute mich die Türklingel raus. Womit der Zug für heute wohl abgefahren ist.
Es klingelt schon wieder. Seufzend setze ich das Instrument ab. John Coltrane schaut mich fragend an.
»Das war besser«, sagt er. »Versuch es gleich noch mal.«
Ich ignoriere den holographischen Musiklehrer, stelle das Instrument auf den Ständer und sage dem Haus, es möge eine Verbindung zur Gegensprechanlage herstellen. Vor mir erscheint ein Fenster, in dem eine Frau mit asiatischen Gesichtszügen zu sehen ist. Ich tippe auf Japanerin.
»Ja, bitte?«, sage ich.
»Guten Abend. Darf ich hochkommen?«, fragt sie auf Englisch, mit leichtem französischen Akzent.
Es ist schon nach zehn. Nicht, dass ich Öffnungszeiten hätte, aber die meisten Klienten tauchen zwischen acht Uhr morgens und fünf Uhr abends auf. Was keineswegs bedeutet, dass mich nicht schon welche um Mitternacht aus dem Bett geklingelt hätten. Aber dass jemand in Fleisch und Blut so spät vorbeikommt? Eher ungewöhnlich.
»Abend. Geht es um einen Auftrag?«, frage ich.
»Ja.« Kurze Pause. »Es geht um Ihr Spezialgebiet.«
Mein Saxspiel meint sie bestimmt nicht. Ich bitte sie hoch, vierter Stock links, die Tür mit dem Milchglas und der Aufschrift: »G.K. Singh. Quästor«.
Einen Fahrstuhl gibt es nicht. Das verschafft mir ausreichend Zeit, von meiner Wohnung in mein Büro im selben Stockwerk gegenüber zu wechseln und mich hinter dem Schreibtisch zu verschanzen. Im Vorbeigehen werfe ich einen Blick in den Garderobenspiegel. Ich trage ein graues Kapuzenshirt mit einem prominenten gelben Fleck in der Bauchgegend (es gab Vindaloo). Außerdem könnte ich eine Rasur gebrauchen. Ich kann eigentlich immer eine Rasur gebrauchen, verdammte Bengalen-Gene. Kurz erwäge ich, einen Anzug über mein Freizeitoutfit zu projizieren, entscheide mich jedoch dagegen. Wer zu dieser späten Stunde kommt, muss den Froschprinz nehmen, wie er ist.
Ich lausche dem Knarzen der Treppenstufen. Kurz darauf höre ich, wie sie die nur angelehnte Vordertür öffnet und eintritt. Sekunden später steht sie vor meinem Schreibtisch. Sie ist um die sechzig und in etwa so kurvenreich wie ein Röntgenbild. Ihr schwarzer Businesszweiteiler ist angesichts der späten Stunde entschieden zu knitterfrei – Holopolish, vermutlich. Ob sie ihr Gesicht ebenfalls digital glatt gebügelt hat? Ich stehe auf und reiche ihr die Hand. Sie greift danach. Meine ist schön warm. Ihre ist eisig.
»Guten Abend, Mrs. …?«
»Pierrette Mumeishi.« Sie lässt meine Hand los. »Mister Singh? Mister Galahad Singh?«
»Derselbe.«
Wir setzen uns. Sie lehnt mein Getränkeangebot ab. Stattdessen holt sie eine Mappe aus ihrer Aktentasche.
»Ich möchte Sie beauftragen, eine Person zu finden.«
Ich nicke. Sie wischt in der Luft herum, das Eins-zu-Drei-Holo einer Frau erscheint auf meinem Schreibtisch. Sie ist schlank, ganz in schlichtes Schwarz gekleidet. Die dunkelblonden Haare sind zurückgebunden – insgesamt eher der praktische Typ. Sie dürfte Ende dreißig sein. Ihre dunklen Augen verraten mir, dass sie intelligent ist und außerdem unglücklich. Könnte zusammenhängen.
»Juliette Perrotte, siebenunddreißig, wohnhaft in Paris. Sie ist Softwareentwicklerin und arbeitet bei Cryptocarbon.«
»Sagt mir nichts«, erwidere ich.
Sie mustert mich einen Moment lang und beschließt dann, dass ich nicht die verlorene Tochter meine, sondern die Firma.
»Klein, aber fein. Cryptocarbon entwickelt Verschlüsselungsverfahren für Uploads.«
Ich tippe mit einem Finger gegen meine Schläfe und schaue Mumeishi dabei fragend an. Sie nickt.
»Genau solche Uploads, ja. Juliette ist am 14. April nicht zu einem Geschäftstermin erschienen, persönliches Meeting mit ihrem Chef, morgens um elf, unweit des Trocadéro. Zumindest ist das bisher mein bester Anhaltspunkt. Vielleicht ist sie auch schon vorher verschwunden – die zwei Tage davor hat sie von zu Hause gearbeitet. Wie ihr Privatleben war, mit wem sie abends ausgegangen ist, das wissen wir nicht genau. Insofern lässt sich auch nicht mit Bestimmtheit ermitteln …«
»Entschuldigen Sie, wenn ich Sie hier kurz unterbreche, Mrs. Mumeishi. Aber könnten wir noch mal einen Schritt zurückgehen?«
Sie guckt etwas unwirsch, ärgert sich offenbar, dass ich sie unterbrochen habe, wo sie gerade so schön in Schwung war. Ich denke an mein entgleistes Saxsolo. Ausgleichende Gerechtigkeit ist das, mehr nicht.
»Zurück?«, fragt sie.
Ich lächele einen Tick zu breit. Ist eine meiner Maschen. Der dunkle Teint lässt mein Lächeln besonders strahlend wirken. Dazu mache ich meine tiefbraunen Augen weit auf. Das verfehlt selten seine Wirkung. Mumeishi scheint für mein Geklimper jedoch nicht empfänglich zu sein.
»Könnten Sie mir zunächst sagen, in welchem Verhältnis Sie zu Miss Perrotte stehen?«
»Ich bin Anwältin, Mister Singh.«
Das wusste ich natürlich schon. Mumeishi redet schnell und sie redet viel, immer ein Hinweis auf Jurisprudenz. Mein Vater sagt gerne: Wenn du einen Anwalt erschießen willst, ziel einfach auf seinen Mund. Den zu verfehlen, ist unmöglich.
Was ich eigentlich wissen will: Wer hat Mumeishi mandatiert? Sie tut mir den Gefallen.
»Ich arbeite für Chenelle Perrotte, die Mutter von Juliette«, sagt sie. Sie schnippt mit den Fingern. In ihrer Hand erscheint eine blütenweiße Visitenkarte. Sie wirft sie. Das Ding dreht sich vor mir in der Luft und verharrt dort. »P. Mumeishi. Avocat. 45 r. Érard, 75012 Paris«.
Ich sage dem System, es möge die Karte archivieren, woraufhin diese auf die Schreibtischplatte hinabsegelt und allmählich transparent wird. Albern, so was. Anwälte eben.
Als Nächstes erzählt mir Mumeishi die Geschichte. Sie ähnelt jener, die ich meist zu hören bekomme, eigentlich immer. Nachdem sich die kleine Juliette in Luft aufgelöst hat, bekommen es ihre nahen Verwandten, in diesem Fall die Mama, mit der Angst zu tun. Sie ruft Juliettes Ex-Freund an, ihren Ex-Ex-Freund und ihre beste Schulfreundin. Keiner von denen hat die Vermisste gesehen, seit Jahren. Spätestens in diesem Moment dämmert der Mutter, dass sie erschreckend wenig über das Leben ihrer Tochter weiß und niemanden aus deren sozialem Umfeld kennt. Als Nächstes läuft Chenelle Perrotte zur Polizei, um eine Vermisstenmeldung aufzugeben. Die Beamten erklären ihr, dass es jedermanns gutes Recht sei, spontan zwei Wochen in die Berge oder ans Meer zu fahren, ohne Mutti Bescheid zu sagen.
»Madame Perrotte ist äußerst wohlhabend«, fährt Mumeishi fort. »Sie hat mithilfe ihres Amanuensis eine immense Menge an Datenquellen angezapft. Doch es ist rein gar nichts dabei rausgekommen. Deshalb ist sie davon überzeugt, dass Juliette das Opfer eines Verbrechens geworden sein muss.«
»Voreilige Schlussfolgerung«, erwidere ich.
»Inwiefern?«
»So ein Amanuensis ist nicht sehr clever.«
»Mister Singh, Sie können mir glauben, dass meine Klientin den Besten besitzt, den man kaufen kann.«
»Bestimmt. Wenn die Vermisste trotz mehrtägiger Beobachtung nicht auftaucht, ist sie möglicherweise gekidnappt worden. Oder aber«, ich zeige auf Mumeishis perfekt sitzenden Hosenanzug, »sie hat einfach ihr Aussehen verändert. Weil sie nicht gefunden werden will.«
»Eine Holomasque ist natürlich denkbar. Meine Klientin hält diese Erklärung allerdings für unwahrscheinlich. Sie kennt ihre Tochter sehr gut. Juliette würde so etwas nie tun.«
Auch den Satz habe ich schon oft gehört.
»Also. Übernehmen Sie den Fall?«
»Gerne«, lüge ich.
»Ihr Preis?«
»Tausend Eurodollar am Tag, für die ersten zehn Tage. Plus Spesen. Fünftausend Vorschuss.«
Mumeishi macht ein empörtes Gesicht. »Das ist eine stattliche Summe.«
»Ja. Aber dafür gehe ich der Angelegenheit auch persönlich nach. Keine automatisierten Suchroutinen. Hand- und Fußarbeit vor Ort.«
»Und wenn Sie sie nicht finden?«
»Haben Sie die Wahl. Entweder entziehen Sie mir das Quästorat. Oder ich lasse die Sache niederschwellig weiterlaufen. Kostet dann nur noch tausend die Woche.«
Mumeishi zieht die Brauen hoch. »Also doch automatisierte Suchroutinen.«
»Suchroutinen basierend auf Daten aus zehn Tagen persönlichen Ermittlungen. Ich werde ihre Wohnung auf den Kopf stellen, ihre Bekannten interviewen, ihr ganzes Leben inspizieren. Das erhöht die Treffsicherheit erheblich. Aber wenn sie in den ersten zehn Tagen nicht wieder auftaucht, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt noch gefunden wird, statistisch betrachtet bei unter einem Prozent. Das ist dann wirklich eher ein Fall für einen Amanuensis.«
Sie legt eine Hand auf die Mappe. »Es gibt noch eine Sonderbedingung.«
»Und zwar?«
»Sie können mit jedem sprechen, aber nicht mit der Mutter.«
Meine Stirn legt sich in Falten. »Warum nicht?«
»Sie ist sehr angegriffen, gesundheitlich. Die Sache mit Juliette hat Madame Perrotte stark mitgenommen – sie ist ihr einziges Kind. Wenn Sie Fragen an sie haben, müssen Sie das über mich machen.«
»Meinetwegen. Noch was?«
»Bitte, Mister Singh.«
»Warum ich? Warum kein Quästor aus Paris?«
»Aus Gründen der Diskretion. In Paris kennt jeder jeden. Außerdem habe ich Gutes über Sie gehört.«
»Hm. Dann haben wir einen Deal«, erwidere ich.
Sie schiebt mir die Mappe rüber. »Das sind alle relevanten Unterlagen, die meine Mandantin und ich besitzen. Außerdem ist eine Schlüsselkarte drin, für Juliettes Apartment.«
»Gut. Ich melde mich, sobald ich etwas habe, Mrs. Mumeishi.«
Wir erheben uns. Ohne sie anzuschauen, sage ich: »Menschen tun manchmal seltsame Dinge. Deshalb ist jedes Detail wichtig. Falls Ihnen also noch etwas einfallen sollte, rufen Sie mich an, jederzeit.«
Dann wende ich mich Mumeishi zu und halte ihr meine Hand hin. Sie greift danach und schaut mir in die Augen, so kurz wie irgend möglich. Anschließend macht sie auf dem Absatz kehrt und verlässt mein Büro. Ich bleibe neben dem Schreibtisch stehen, bis das Geräusch ihrer Stilettos verhallt ist.
Ich kehre in mein Apartment zurück. Es besteht aus einem Schlafraum, einer kleinen Küche, einem großen Gym und einem loftmäßigen Wohnzimmer, durch dessen Panoramascheiben man einen spektakulären, genauer gesagt spektakulär hässlichen Blick auf den Eisenbahnknoten nördlich von King’s Cross hat. Mein Ex wollte immer, dass wir stattdessen eine Panoramasicht des Regent’s Park hineinholographieren, oder vielleicht das Themseufer nahe der Tower Bridge. Nicht mit mir. Ich will das echte Camden sehen.
In einer Ecke sind neben dem Sofa meine beiden Saxofone aufgebaut, ein Tenor und ein Alto. Dahinter erstreckt sich eine gut sechs Meter lange weiße Wand, meine Milchtütenwand. Ihr wende ich mich nun zu. Das mit den Milchtüten ist ein etwas makabrer Scherz, den heutzutage keiner mehr versteht. Vor über hundert Jahren war es üblich, die Gesichter von vermissten Kindern auf Getränkekartons zu drucken. Warum man das tat, erschließt sich mir nicht. Die Polizei war offenbar der Meinung, es würde zu sachdienlichen Hinweisen führen, wenn sich schlaftrunkene Menschen morgens beim Müsliessen von einem verschwundenen Kind anstarren lassen. Klingt bekloppt, aber so war’s. Deshalb nennen wir unsere Vermissten ebenfalls Milchtüten. Ist nicht übermäßig witzig, zugegeben. Es sei denn, man hat so einen verkorksten Humor wie ich.
Die Milchtütenwand ist nicht wirklich weiß. Sie ist voller Notizen, die man aber nicht sieht, weil Holotextur darüberliegt. Auch wenn es mein Job ist, möchte ich beim Frühstück nämlich nicht von Vermissten angestarrt werden. Nun aber bitte ich das Haussystem, die Holocamouflage auszublenden. An der Wand erscheinen drei Fotos, zwei Männer, eine Frau. Das Mädchen ist vorletzte Woche reingekommen. Einer der Männer hängt seit Monaten dort. Seine Verwandten zahlen dennoch brav weiter, sie geben die Hoffnung nicht auf. Niemand versteht das besser als ich. Die andere männliche Milchtüte ist ein Spezialfall, lange Geschichte.
Ich nehme mir Mumeishis Mappe vor. Die darin liegenden Blätter sind natürlich holographiert. Als Erstes clippe ich Perrottes Foto und klebe es an die Wand, und zwar so, dass darunter reichlich Platz für Notizen bleibt. Danach lasse ich mich aufs Sofa fallen und lese. Ich erfahre im Wesentlichen, was mir Mumeishi bereits berichtet hat, angereichert mit weiteren Details. Juliette Perrotte scheint eine sehr talentierte Programmiererin gewesen zu sein. Statt allerdings bei einem Supernational anzuheuern, arbeitete sie bei Cryptocarbon, als Chefentwicklerin. Ihre Wohnung liegt im Marais. Perrottes Mutter macht nichts, sie ist einfach nur vermögend. Einen Vater scheint es nicht zu geben.
Zwischendurch stehe ich immer wieder auf und schreibe mit einem Holopen an die Wand. Ich lege außerdem ein paar leere Karten an: »Wohnung«, »Masques (?)«, »Freunde« und »Arbeit«. Dies sind die Punkte, die ich baldmöglichst abarbeiten muss. Man tut das besser heute als morgen, bevor die Spur erkaltet. Bei der Polizei gilt die Regel, dass die ersten achtundvierzig Stunden entscheidend sind. Danach ist den Erinnerungen der Zeugen nicht mehr zu trauen, Fußabdrücke sind verwischt, DNA-Partikel verweht.
Bei Verschwundenen ist die Sache nicht ganz so dramatisch. Wenn sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen sind, gilt selbstverständlich auch für Quästorate die Achtundvierzig-Stunden-Regel. Falls die Milchtüte sich aber schlichtweg aus dem Staub gemacht hat, produziert sie weiter Daten. Niemand kann sich ewig in einem abgelegenen Motel verstecken. Irgendwann muss er oder sie essen, sich die Beine vertreten, dunkle Begierden befriedigen, was auch immer. All dies spielt dem Quästor in die Hände. Vor allem dann, wenn er den Vermissten kennt, mit all seinen Macken. Eine Wohnungsbegehung ist folglich das Erste, was ich absolvieren muss. Danach will ich mit Juliettes Arbeitgeber sprechen. Ich suche mir die Adresse von Cryptocarbon heraus und diktiere eine Mail. Als Nächstes bitte ich meine Amanuensis-Software, mir die Verbindungen nach Paris anzuzeigen. Der letzte Flug von London-Britannia geht in einer halben Stunde, der nächste morgen um sechs Uhr fünfzehn. Ich frage nach Alternativen. Mit einem Nightcar wäre ich schon um vier Uhr morgens dort. In diesen rollenden Särgen schlafe ich immer wahnsinnig schlecht. Doch irgendein Gefühl sagt mir, dass es ein Fehler wäre, bis morgen früh zu warten.
Seufzend sage ich dem Amanuensis, dass er mir eines rufen soll. Bevor ich zum Packen ins Schlafzimmer gehe, werfe ich einen wehmütigen Blick auf das Tenorsax. Ich war so nah dran. Ich hatte es fast.
Ein gemeiner Ton dringt an mein Ohr. Kurz nach der Ausfahrt aus dem Tunnel muss ich weggedämmert sein. Nun liege ich in dem nach hinten geklappten Sessel des Nightcars und reibe mir den Schlafsand aus den Augen.
»Wo sind wir?«, frage ich.
»Sie haben Ihr Ziel erreicht«, schnarrt das Nightcar. Ich setze mich auf und schaue aus dem Fenster – zweifelsohne Paris, zweifelsohne Perrottes Adresse – 75, rue Vieille du Temple. Das Display zeigt halb vier Uhr morgens an. Welcher Teufel hat mich da bloß geritten? Egal, ich ziehe das jetzt durch. Nachdem ich ausgiebig gegähnt habe, fahre ich den Sessel in eine aufrechte Position, greife nach meiner Tasche und steige aus. Lautlos zischt das Nightcar davon. Nach der Fahrt in dem leicht überheizten Auto empfinde ich die kühle frische Luft als sehr angenehm. Ich schaue die Rue Vieille du Temple auf und ab. Eine hübsche Straße, mit alter Bausubstanz, Cafés und kleinen Boutiquen. Im Erdgeschoss von Perrottes Haus befindet sich eine Patisserie, die ich später vielleicht aufsuchen werde. Darüber thront ein Gebäude aus dem siebzehnten oder vielleicht sogar sechzehnten Jahrhundert, vier Stockwerke. Juliette Perrotte gehört eine der Dachgeschosswohnungen. Früher einmal wäre eine Immobilie dieser Art für Normalsterbliche unbezahlbar gewesen. Aber in Zeiten der Unterbevölkerung muss man nicht mehr obszön reich sein, um so zu wohnen. Da können sich das mitunter auch Angestellte leisten. Ich gebe den Digicode aus dem Dossier ein und drücke die Haustür auf. Es gibt einen Fahrstuhl. Ich nehme die Treppe, in der Hoffnung, dass dies meinen Kreislauf in Gang bringt. Oben angekommen, ziehe ich Mumeishis Schlüsselkarte aus der Jackentasche und halte sie gegen die Tür. Mit einem Schnappen springt das Schloss auf.
Der Flur ist lang und mit Parkett ausgelegt, an den Wänden hängen einige Gemälde. Sie zeigen düstere Gestalten, unter anderem einen Riesen, der gerade einen Menschen auffrisst. Ich halte meinen Fingerring darauf und frage die Amanuensis-Software. Goya, sagt sie. Es handelt sich nicht um Drucke, die Bilder sehen echt aus. Aber was heißt das schon, heutzutage.
Bevor ich weitermache, hole ich meine Strippergoggles hervor. Die Wohnung ist eher unordentlich, die Flächen sehen aber alle aus wie geleckt. Es mag daran liegen, dass Juliette Perrotte einen Putzfimmel hat. Wahrscheinlicher ist, dass sie Holopolish auf Wände und Böden gekleistert hat. Macht fast jeder. Wir leben eben in einer oberflächlichen Welt.
Meine Stripper sind nur Level III, aber das sollte reichen. Mit der Brille kann ich die oberen Schichten des Holonets verschwinden lassen. Nun, da ich sie aufhabe, bemerke ich kleinere Abweichungen. Der Parkettboden ist etwas stärker abgewetzt, als man zuvor sah. Die hübsche Kommode zu meiner Rechten wird nun durch einen unschönen Kratzer verunziert. Es sind Kleinigkeiten, aber vielleicht ist eine davon wichtig.
Vom Flur gehen vier Türen ab: Bad, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer. Ich schaue mich in allen Räumen kurz um. Dabei wechsle ich immer wieder zwischen der kompletten Hologrammatica und der abgespeckten Stripper-Ansicht. Als ich fertig bin, mache ich mir in der Küche einen Kaffee und setze mich damit auf Perrottes Designersofa.
Mademoiselle haben es nicht nötig, etwas in ihre Fenster zu projizieren. Das echte Panorama ist spektakulär genug. Ich öffne die Glastür und trete hinaus auf den schmalen Balkon. Wie es sich für einen echten Touristen gehört, suche ich zunächst nach dem Eiffelturm. Meine geografischen Kenntnisse der Stadt sind eher rudimentär, aber eigentlich müsste man ihn von hier aus bewundern können. Doch er ist nirgends zu sehen.
Ach, natürlich. Der eine Kaffee hat augenscheinlich nicht gereicht. Der Eiffelturm, also der ursprüngliche aus Stahl, ist vor fünfzig Jahren gesprengt worden, von Terroristen. Was für Terroristen? Habe ich vergessen. Auf jeden Fall ist der neue Eiffelturm eine Holographie, doppelt so hoch wie der alte, damit man ihn besser sehen kann.
Dass ich nichts sehe, liegt an den Goggles, die sich noch immer auf meiner Nase befinden. Öffentliche Gebäude sind Level IV, weswegen meine Strippergoggles sie herausrechnen. Ich nehme die Brille ab. Gegenüber erscheinen Geranien in einem Balkonkasten, an den Häuserfronten flackert Werbung auf. Und über den Dächern von Paris taucht der Eiffelturm auf. Er ist wirklich wunderschön.
Okay, genug Sightseeing. Zeit, ein wenig zu arbeiten. Ich fange im Wohnzimmer an. Perrotte mag offenbar Ledergarnituren – Ledersofa, Ledersessel, lederner Sitzsack. An den Wänden hängen noch mehr Bilder. Diesmal sind es alte Fotografien. Sie zeigen Männer in Helmen und Schutzbrillen, außerdem Fahrzeuge. Es scheint sich um irgendwelche archaischen Rennszenen zu handeln. In einem Regal stehen ein paar Bücher und Zeitschriften. Ich sehe viele französische Klassiker, aber auch eine Menge russisches Zeug im Original. Goya, Tschechow und Camus bestärken mich in meinem ersten Eindruck, dass diese Milchtüte eher der grüblerische, schwermütige Typ ist. Außerdem ist sie unordentlich. Überall liegt Zeug herum.
Während ich die Schubladen und den kleinen Sekretär in der Ecke flöhe, mache ich mir ein bisschen Musik.
»Die zehn zuletzt gespielten Songs nochmals spielen«, befehle ich dem Haussystem. Es kommt meiner Order umgehend nach. Perrotte hört Klassik. Auch meinen alten Jazz bezeichnen Banausen inzwischen als Klassik, aber dies hier ist das richtige Zeug. Tschaikowsky, glaube ich. Nach dem ersten Stück kommt dann allerdings Sib Stuk, wummernde, von Computern generierte Musik, nicht unbedingt mein Fall.
In Perrottes Schreibtisch finde ich nicht viel Interessantes, außer einem Kuvert mit einer Einladung – Büttenpapier, gedruckt, nicht holographiert. ›Aubrie lädt ein‹ steht da. Es scheint sich um eine Geburtstagsfeier zu handeln. Die Party findet heute Abend statt, in einem Laden namens ›La Marmotte‹. Auch der Dresscode ist auf der Einladung vermerkt: »Crazy Funky India«. Ein Lächeln schleicht sich auf mein Gesicht. Da kann ich ja gehen, wie ich bin, als lustiger Camden-Town-Maharadscha. Ich rufe mir eine Karte von Paris auf und lasse mir den Ort zeigen. Dann stecke ich die Einladung in die Innentasche meiner Jacke.
Als Nächstes knöpfe ich mir die Küche vor. Sie erzählt mir, dass Juliette so gut wie nie zu Hause isst. Sie hat eigentlich nur Kosmostars-Frühstücksflocken da und, wie ich bestätigen kann, ziemlich guten Kaffee. Es gibt auch ein paar Kochbücher, aber die sehen nicht gerade zerlesen aus. Ich will die Küche schon wieder verlassen, als mir ein dickes, in grünen Stoff gebundenes Buch auffällt, das zwischen »Die neue sibirische Küche« und »99 Brasserie-Klassiker« steht. Es sieht aus wie ein altmodisches Fotoalbum. Ich schlage es auf. Es ist tatsächlich eins. Abzüge auf weißen Papierbögen, darunter befinden sich handschriftliche Bildbeschreibungen. Ich schalte die Stripper ein, aber die Bilder verschwinden nicht. Sie sind allen Ernstes auf das Papier aufgeklebt.
Ich hocke mich an den Küchentisch und fange an zu blättern. Es gibt Bilder, die Juliette als Kind zeigen, an einem Strand, mit vielleicht fünf oder sechs Jahren. Darunter steht in akkuraten Druckbuchstaben: »Korsika, Winter 2060«. Dann sind da welche, auf denen sie um die zehn sein muss. Juliette trägt blaue Shorts und ein T-Shirt, neben ihr kniet eine Frau, die vermutlich ihre Mutter ist. Sie hat Wanderklamotten an – Kakishorts, Karohemd, klobige Stiefel. Dennoch erkennt man, dass sie eine Schönheit ist. Auch ein Mann ist im Bild, ebenfalls in Trekkingausrüstung. Aber er steht am Rand – ein Arm, ein Bein, sonst nichts. Im Hintergrund erkennt man einen Torbogen, wie von einer mittelalterlichen Befestigungsanlage. Die Bildunterschrift lautet: »Wandern mit der Familie«. Mit meiner Ringkamera fotografiere ich das Bild ab. Vielleicht kann der Amanuensis den Ort später identifizieren.
Je weiter ich blättere, desto älter wird das Mädchen auf dem Bild. Es bestehen keine Zweifel mehr, dass es sich um Juliette handelt. Als ich beinahe am Ende angekommen bin, ist da eine Seite ohne Foto. Man sieht noch Reste des Klebers, mit dem das fehlende Bild befestigt war. Darunter steht: »Unverkennbar Vater und Tochter«. Ich blättere zurück, suche nach weiteren Fotos des Vaters. Es gibt das bereits erwähnte angeschnittene Bild, auf dem nur Arm und Bein eines Mannes zu sehen sind. Ist das ihr Vater? Oder nur irgendwer, der durchs Bild lief?
Nachdem ich das Album zurückgestellt habe, gehe ich ins Schlafzimmer. Perrotte besitzt ein großes Futonbett. Daneben steht ein Nachttisch. Darauf befinden sich ein halb volles Wasserglas, ein altmodischer Notizblock und ein paar Stifte. Ich greife mir den Block und blättere mit dem Daumen durch die Seiten. Sie sind allesamt unbeschriftet. An der Decke über dem Bett hängt ein großer Holospiegel. Von dort schaut ein Kerl auf mich herab. Er hat Augen wie Kohlestücke und einen Fünf-Tage-Bart, der in Wahrheit ein Zwei-Tage-Bart ist. Seine Haare sind kaum länger als die Stoppeln an seinem Kinn. Er trägt eine grüne Lederjacke zu einem engen schwarzen Rolli und noch engeren schwarzen Chinos. Seine Züge wirken indisch, sein Teint erinnert an Milchkaffee. Apropos, er könnte noch einen gebrauchen, denn er sieht müde aus. Außerdem schaut er schon viel zu lange in den Spiegel, der eitle Fatzke.
Ich wende mich dem Kleiderschrank zu, der nach amerikanischer Fasson in eine Wandnische gebaut ist. Hinter den Schiebetüren verbergen sich einige säuberlich auf Bügel gehängte Blankoanzüge, mattweiß, in verschiedenen Schnitten. Das Gros der Garderobe ist jedoch leger und in frischem Schwarz gehalten. Gerade will ich den Schrank wieder schließen, als ich ein kaum wahrnehmbares Summen vernehme. Ich benötige ein, zwei Sekunden, um zu kapieren, dass es von dem Fahrstuhl herrührt, der sich irgendwo hinter der Wand befinden muss. Wir haben vier Uhr morgens, weswegen ich lieber auf Nummer sicher gehe. Ich sage dem Haussystem, es möge die Musik abstellen und außerdem die Beleuchtung löschen. Rasch verschwinde ich im Wandschrank. Damit ich nicht an die Anzüge komme, schiebe ich sie etwas von mir weg und hocke mich auf den Boden, bevor ich die Schiebetür zuziehe.
Es dauert nicht lange, bis jemand zur Vordertür hereinkommt. Eine Stimme undefinierbaren Geschlechts sagt etwas, woraufhin das Licht im Schlafzimmer angeht. Der Kleiderschrank hat Lamellen. Ich kann nach draußen schauen. Zunächst sehe ich nur die Beine des Neuankömmlings. Die Gestalt misst etwa eins siebzig und ist mit ziemlicher Sicherheit eine Frau. Ich kann erkennen, wie sie vor dem Nachttisch niederkniet. Ich atme flach, bringe meine Augen so nah wie möglich an den Spalt zwischen zwei Lamellen. Sie hat mir den Rücken zugewandt und begutachtet den Notizblock. Die Frau trägt Jeans und Lederjacke. Braune Haare, kaukasische Züge – aber nein, das habe ich wohl nicht richtig gesehen. Ihre Haare sind eher blond, und ihre Hautfarbe ist weniger hell als gedacht, ähnelt eher meiner. Und sie trägt einen Samtblazer.
Moment mal.
Die Frau hält den Notizblock in der Linken, in ihrer anderen Hand hat sie einen Bleistift. Ich kann nun ihr Gesicht erkennen. Sie besitzt asiatische Züge, ihre schwarzen Haare sind zu Zöpfen geflochten. Ich muss mich beherrschen. Beinahe entfährt mir ein Laut des Erstaunens. Sie – wenn es denn wirklich eine Sie ist – trägt offenbar einen Jedermann-Anzug, auch Dickie genannt. Ich weiß um die Existenz dieser Dinger, aber ich hätte nie gedacht, jemals einen zu Gesicht zu bekommen. Nein, ich muss das anders formulieren. Es ist durchaus möglich, dass schon einmal jemand in einem Jedermann-Anzug an mir vorbeigelaufen ist. Aber es wäre mir entgangen, denn das ist schließlich der Sinn des Ganzen. Die Idee dieses Tarnanzugs ist schon über hundertfünfzig Jahre alt. Aber zu Zeiten des Pharmazeuten Kindred P. Dick, von dem das Konzept stammt, fehlten die technischen Voraussetzungen, ihn herzustellen. Der Dickie ist ein holographischer Anzug, jenen mattweißen Dingern, die in diesem Schrank über meinem Kopf baumeln, nicht unähnlich. Statt jedoch eine im Wesentlichen statische Holotextur zu projizieren – das Schwarz eines Smokings, ein Hahnentrittmuster –, ändert sich das gezeigte Bild ständig. Nicht nur die Kleidung, auch Gesichtszüge und Frisur changieren unaufhörlich. Dies geschieht langsam und fließend, damit es dem flüchtigen Betrachter nicht auffällt. Die Projektionen stammen aus einer Datenbank, welche die Holos von Millionen Personen enthält – daher der Name Jedermann-Anzug. Die Software des Dickie berücksichtigt dabei die Demografie der lokalen Bevölkerung. Wer den Anzug in Peking trägt, wird zu fünfundneunzig Prozent asiatische Gesichtszüge aufweisen. Wer darin durch Moskau spaziert, wirkt meistenteils kaukasisch.
In Städten ist der Jedermann die perfekte Tarnung. Er macht seinen Träger zum Mann in der Menge, zu einer Erscheinung, an die sich niemand richtig erinnern kann. Jedermann-Anzüge sind ziemlich rar – sie sind quasi militärische Ausrüstung. Es dürfte einfacher sein, ein Sturmgewehr zu kaufen, als einen Dickie. Spezialeinheiten des EURUS-Innenministeriums benutzen so etwas, Profispione und vielleicht die Tunichtgute von der Solntsevskaya Bratva.
Ich betrachte die Umrisse der Frau. Zu wem gehörst du wohl? Sie ist immer noch mit dem Block zugange, schreibt etwas. Was macht sie da bloß? Als ich verstehe, was sie tut, spüre ich eine Mischung aus Scham und Ärger. Dass mir das nicht selbst eingefallen ist. Miss Dickie wendet einen der ältesten Schnüfflertricks an. Er funktioniert heutzutage nur noch selten, weil die meisten Menschen holographisches Papier verwenden. Aber neben diesem Block lagen Stifte. Und Stifte hinterlassen beim Schreiben Druckstellen auf der Seite darunter. Sie schraffiert deshalb mit einem Bleistift das leere Papier, um zu sehen, was auf dem darüber stand.
Es scheint, dass sie fündig geworden ist. Sie reißt das oberste Blatt ab und lässt es in einer Tasche verschwinden. Danach steht sie auf und geht. Ich höre die Vordertür zuschlagen. Das Licht erlischt.
Ich bleibe noch einige Minuten in meinem Schrankversteck, bevor ich herauskrieche. Sobald ich wieder im Schlafzimmer stehe, nehme ich mir ebenfalls den Block vor, in der schwachen Hoffnung, dass der Schraffiertrick auch beim nächsten Blatt noch funktioniert. Viel kommt dabei nicht heraus:
A me d a
Andromeda? Achmed am irgendwas? Es könnte vieles bedeuten.
Das Schlafzimmer enthält ansonsten nichts Interessantes – ich hatte auf Sexspielzeuge oder Pornos gehofft, um etwas über Perrottes Präferenzen zu erfahren, aber leider Fehlanzeige. Vermutlich ist sie hetero, so zumindest ist mein Eindruck. Das ist eine etwas dürftige Erkenntnis. Sexuelle Vorlieben sind einer der besten Datenpunkte, vor allem, wenn sie ausgefallen sind. Ich muss mehr über ihre Sozialkontakte herausfinden. Ein weiterer Grund, heute Abend auf diese Party zu gehen.
Es wird hell. Die Patisserie im Erdgeschoss hat allerdings noch nicht offen. Bedauerlich, denn mein Magen knurrt vernehmlich. Ich rufe mir die Adresse des Hotels auf, das der Amanuensis gebucht hat. Es liegt nicht allzu weit entfernt, irgendwo in der Nähe des Place des Vosges. Kann man laufen. Vielleicht macht mich das wacher. Ich spaziere verlassene Straßen entlang. In London wären um diese Zeit schon relativ viele Menschen unterwegs, aber hier nicht. Wie die meisten europäischen Großstädte hat Paris in den letzten Jahrzehnten massiv Einwohner verloren – nicht nur wegen der Seuche. Alles strebt nach Osten, ins Gelobte Land. Die Leute wollen nach Sibirien, ihr Glück machen oder zumindest keinen Hitzeschlag kriegen. Ich war vergangenes Jahr in ein paar mittelgroßen Städten im Süden und in der Zentralregion von EURUS. Auf den Straßen nur Alte und Asoziale, aber die Fassaden und Trottoirs durchweg proper, Holopolish sei Dank. Paris hat den Vorteil, dass es auch als begehbares Museum einen Wert besitzt. In ein paar Stunden wird die Stadt voller Chinesen und Sibs sein, die gaffend durch dieses Disneyland europäischer Kultur stapfen.
Ich stapfe auch, nehme mir aber heraus, mich nicht zu den Touristen zu zählen. Ich passiere eine Kirche namens Saint Paul sowie irgendein Museum. Alles ist tadellos in Schuss. In den vergangenen Jahren hat hier ein Rückbau stattgefunden. Etliche der modernen Scheußlichkeiten wurden herausretuschiert, darunter auch der entsetzliche Tour Montparnasse und die Neue Oper.
Nach einer Viertelstunde erreiche ich mein Domizil, ein Businesshotel mit zu viel Marmor in der Lobby. Ich bin natürlich zu früh, aber der Concierge verspricht mir, das Zimmer eiligst herrichten zu lassen. Währenddessen frühstücke ich. Nach einer großen Portion Rührei und zwei Croissants fühle ich mich deutlich besser. Mit einem Becher Kaffee hocke ich mich in die Lounge und vertreibe mir die Zeit mit den Nachrichten. Im Tal des Todes haben sie eine neue Rekordtemperatur gemessen, einundsiebzig Grad Celsius. Ein Streik droht, den Spacelift in New Albion lahmzulegen. In der Nähe von Jakutsk sind zwei neue Siedlungen eingeweiht worden, die zunächst vier Millionen aufnehmen können, später aber die fünffache Zahl beherbergen sollen. Außerdem haben die London Lions gegen Moskau verloren und liegen in den Lacrosse-Playoffs nun hinten. Da mir völlig schleierhaft ist, wie es zu diesem Desaster kommen konnte, rufe ich mir ein paar Spielszenen auf. Bevor ich sie anschauen kann, winkt mir der Concierge.
Ich schalte das Fenster ab und fahre hoch. Das Zimmer sieht okay aus. Man merkt, dass der Amanuensis dem Hotel meine Vorlieben übermittelt hat. Über dem Bett hängt eine Fotografie von Ryan Pfluger, im Flur eine von Robert Mapplethorpe. Es gibt viel helles Holz, große Fenster, gedeckte Farben. Über dem kleinen Schreibtisch ist reichlich Platz für meine Milchtüten.
Nachdem ich mir mit der Zimmermaschine einen weiteren Kaffee gemacht habe, beginne ich, meine Inbox durchzusehen. Da ist eine Erinnerungsmail für den Cocktailempfang der INTERQUEST-Konferenz. Ich klicke sie weg. Viel wichtiger ist, dass ich eine Antwort von Juliette Perrottes Arbeitgeber erhalten habe. Ihr Vorgesetzter, ein Mann mit dem interessanten Namen 77C Faucheux, wird mich empfangen, gegen elf.
Mir bleibt also ausreichend Zeit, noch ein paar Sachen zu recherchieren und ein kleines Nickerchen zu machen. Zunächst überspiele ich der Amanuensis-Software die Fotos aus Perrottes Album, mit der Bitte, die Aufnahmeorte zu recherchieren. Außerdem übermittle ich ihr den Namen der Dame, deren Party ich heute Abend crashen werde. Und ich bestelle mir ein Kostüm. Diese Feier scheint schick zu sein, weswegen ich da nicht in einem billigen Holofummel auftauchen kann.
Vor meiner Abreise hatte ich außerdem ein paar Streams eingekauft. Es gibt Millionen von Menschen, die auf ihren Häusern oder an ihrer Kleidung Kameras angebracht haben und ständig den öffentlichen Raum filmen. Die auf diese Weise generierten Videos sind in der Regel uninteressant und folglich ziemlich wertlos. Man kann sie kaufen, ein paar Tausend Stunden Material kosten nur wenige Cents. Mein Amanuensis, der ja im Wesentlichen eine Suchmaschine auf Steroiden ist, gleicht die Streams kontinuierlich mit Bildern von Perrotte ab. Die vage Hoffnung ist, dass meine Milchtüte an irgendeinem Flughafen oder sonst wo gesichtet wird. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie eine Holomasque verwendet.
So muss es auch in diesem Fall sein. Dem Amanuensis ist nichts ins Netz gegangen. Ich reibe mir die Augen. Eine letzte Sache noch, dann haue ich mich hin. Ich gehe ins EURUS-Personenregister, für das ich über einen Strohmann einen halblegalen Account besitze. Ich rufe mir Juliette Perrottes Stammdatensatz auf. Die Infos stimmen mit denen von Mumeishi überein. Als Vater ist ein Jacques Perrotte eingetragen. Ich gehe zu seinem Datensatz. Dieser wurde außer Kraft gesetzt, da Jacques Perrotte seit zwanzig Jahren verschwunden ist.
Noch einer, der sich in Luft aufgelöst hat.
Verwunderlich ist es nicht. Vor zwanzig Jahren war der Sibtrek voll im Gange. Eine enorme Zahl von Westeuropäern machte sich aus dem Staub. Viele von ihnen ließen ihr altes Leben ganz bewusst zurück.
Ich verzichte darauf, für den alten Jacques ebenfalls eine Suchroutine einzurichten. Erstens ist es zu lange her. Zweitens jage ich bereits genug Geistern nach. Ich muss lächeln. Anfang des einundzwanzigsten Jahrhunderts soll es fast unmöglich gewesen sein, zu verschwinden. Es gab Überwachungstechnologien, die jeden binnen Sekunden aufspüren konnten. Nach dem Turing-Zwischenfall hat man diese ganze Spitzelsoftware abgeklemmt. Das ist gut so. Andernfalls wäre ich arbeitslos.
Mehr aus Gewohnheit denn aus Hoffnung schaue ich noch kurz nach, ob es irgendwas von Percy gibt. Aber natürlich ist mir auch zu dieser Milchtüte nichts ins Netz gegangen.
»Weckruf um zehn«, sage ich dem Zimmer.
Dann lege ich mich aufs Bett. An der Decke über mir ziehen blaue Schäfchenwolken vorbei. Kurz darauf bin ich eingeschlafen.
Als der Wecker klingelt, fühle ich mich, als sei ich gerade erst eingeschlafen. Ächzend erhebe ich mich. Ich schaue aus dem Fenster. Die Stadt wirkt wie eine schlechte Monochromprojektion. Ich wasche mir das Gesicht und fahre hinunter in die Lobby.
Als ich aus dem Hotel auf die Straße trete, trifft der Schub mich ohne Ankündigung und mit voller Wucht. Meine Brust fühlt sich an, als habe jemand sie mit Beton ausgegossen. Jede Bewegung fällt mir schwer. Depressionen gelten als mentales Problem. Den meisten Menschen ist deshalb nicht klar, wie enorm körperlich die Symptome sind. Es ist, als stecke man bis zum Hals in Industrieschlacke. Selbst der Griff nach einem Glas Wasser wird zu einer mühsamen Angelegenheit. Mal abgesehen davon, dass man gar keine Lust auf Wasser hat.
Normalerweise warte ich, bis die Scheiße vorüberzieht, wie ein Kapitän, der einen Sturm abwettert. Ich lege mich in meinem Apartment stundenlang auf den Teppich oder spiele den immer gleichen Saxlauf, in der Regel »Lonnie’s Lament«. Aber nun muss ich zu diesem verdammten Interview und später sogar … auf eine Party. Das Interview würde ich noch irgendwie hinkriegen. Als Depressiver lernt man, sozial zu funktionieren. Ich kann im tiefsten Tal sein und bei einem kurzen Gespräch oder Telefonat dennoch extrem gut gelaunt rüberkommen. Das kostet natürlich Kraft. Und danach ist alles noch viel schlimmer. Aber eine Party? Mit lauter Menschen? Nie und nimmer.
Ich hasse es, das zu tun, aber es muss wohl sein. An eine Hauswand gelehnt, hebe ich langsam meine Betonhand. Mit tonloser Stimme spreche ich in das Mikro meiner Armbanduhr: »Dispenser. Fluxovint, dreihundert Milligramm.«
Vor mir erscheint leuchtender Text: »Dosis wird vorbereitet. Doppelte Authentifizierung. Retina-Scan.«
Ich halte die Uhr vor mein rechtes Auge.
»Erste Autorisation erfolgt. Sagen Sie bitte das Passwort.«
»Bitches Brew«, antworte ich.
»Zweite Autorisation erfolgt.«
Ohne dass ich etwas davon merke, schleust der Dispenser dreihundert Milligramm Glücklichmacher in meine Blutbahn. Ich warte. Es dauert vielleicht eine Minute. Dann fühle ich, wie meine Glieder leichter werden. Die Welt scheint nun heller. Erstmals nehme ich den hübschen Jungen wahr, der ein paar Schritte weiter auf einer Parkbank sitzt. Ich bin nun wieder ein guter Quästor und ein miserabler Saxofonist. Gott, wie ich dieses Zeug hasse. Ich fahre mit der Linken über meinen Nacken und atme ein paarmal durch. Nicht ärgern. Zeit für die Show. Federnden Schrittes gehe ich auf eines der Taxis vor dem Hotel zu.
Eine Viertelstunde später stehe ich vor einem nichtssagenden Bürogebäude in der Nähe des Trocadéro. Aus der großen Zahl Namensschilder schließe ich, dass hier viele kleinere Firmen sitzen, die meisten vermutlich nur auf Zeit. Man nennt diese kleinen Start-ups Hit-and-Runs. Sie verlegen ihren Sitz alle paar Monate in die Stadt, die ihnen gerade die besseren Konditionen oder Subventionen bietet. Da die Räumlichkeiten in diesen Bürotürmen in der Regel genormt sind, müssen die Firmen lediglich ihre Holotexturen über die Einrichtung legen, und schon ist alles wie zuvor, inklusive Gummipalme und Mitarbeiter-des-Monats-Urkunde an der Wand.
Cryptocarbon sitzt im siebenundzwanzigsten Stock. Wie erwartet, handelt es sich um ein Blankobüro. Es gibt viel Holz und eloxiertes Aluminium, ganz nett eigentlich. Die Vorzimmerdame begrüßt mich mit einem reizenden Augenaufschlag, für den ich nicht empfänglich bin. Ich klimpere trotzdem zurück. Vermutlich bin ich etwas manisch. Vielleicht hätten hundertfünfzig Milligramm auch gereicht.
Sie schickt mich den Gang hinunter, in einen Konferenzraum. Dort angekommen, nehme ich mir eine der bereitstehenden Limos und stelle mich damit ans Fenster. Es ist ein sonniger Apriltag, draußen hat es inzwischen um die sechsundzwanzig Grad. Noch vier oder fünf Wochen, dann wird es in Paris unerträglich sein. Ich vernehme Schritte und drehe mich um. Der Mann, der durch die Tür tritt, ist Ende vierzig. Er trägt ein Stehkragenhemd unter blauem Anzug in Windowpane-Muster, was ich ziemlich mutig finde. Sein Vollbart wirkt gepflegt, sein Körper einen Tick zu wohlgenährt.
»Monsieur Singh?«, sagt er. »Ich bin 77C Faucheux, der Geschäftsführer.«
Wir reichen uns die Hände. Ich bedanke mich, dass er sich die Zeit nimmt. Wir setzen uns. Er legt seine haarigen Hände auf den Konferenztisch und spreizt die Finger. »Sie versuchen also, Juliette zu finden.«
»Das ist mein Job.«
Ich hole mein Notizbuch hervor. »Wenn ich richtig informiert bin, hatten Sie beide vor drei Tagen einen Termin, am vierzehnten?«
»Korrekt. Aber sie kam nicht.«
»Und wann haben Sie sie davor zuletzt gesehen?«
Faucheux überlegt einen Moment. »Ist schon etwas her. Ich war ein paar Tage in Toronto, geschäftlich, bei einem unserer Partner dort. Danach wollte ich mit Juliette etwas durchsprechen. Sie leitete eines unserer wichtigsten Projekte.«
Ich schlage die Beine übereinander. »Worum ging es dabei?«
»Monsieur Singh, das ist … sehr vertraulich.«
Statt zu antworten, schaue ich ihn fragend an. Er scheint einzusehen, dass er mir zumindest ein paar Details verraten sollte, wenn ich seine Chefprogrammiererin auftreiben soll.
»Sie wissen, woran wir hier arbeiten?«
»An Verschlüsselungsverfahren für irgendwelche Daten.«
»Nicht irgendwelche. Wir verschlüsseln ausschließlich Cogits. Unsere Verschlüsselungsverfahren sind sehr speziell. Maßgeschneidert für Uploads. Wie Sie sich vorstellen können, sind das so ziemlich die sensibelsten Daten, die es gibt. Darf ich fragen«, er lächelt, »ob Sie Quant sind, Monsieur Singh?«
Vor etwa gut vierzig Jahren gelang es erstmals, ein menschliches Gehirn komplett einzuscannen und digital nachzubilden. Das Ergebnis bezeichnet man als Cogit. Als Faucheux fragte, ob ich auch Quant sei, fragte er eigentlich Folgendes: ›Haben Sie Ihr Gehirn scannen und auf eine Festplatte bannen lassen? Haben Sie danach Ihr Kranium aufsägen und das Cerebrum herausnehmen lassen? Haben Sie sich stattdessen ein e-Cephalon einsetzen lassen, einen kleinen Quantencomputer, der sich nun dort befindet, wo vorher Ihre grauen Zellen waren?‹
»Nein«, erwidere ich. »Ehrlich gesagt sind mir Uploads ein bisschen suspekt.«
Faucheux nimmt sich eine Pervi Pepsi. Damit will er von dem ablenken, was in seinem Gesicht passiert. Er runzelt die Stirn, presst die Lippen aufeinander. Augenscheinlich hält er meine Einstellung für altmodisch und überkommen.
»In meinem Job bin ich keinen sonderlich großen Gefahren ausgesetzt«, fahre ich fort. »Und wenn ich die Sache richtig verstehe, bringt der Wechsel ansonsten nicht allzu viel.«
Der Vorteil eines Cogits ist, dass man den Körper wechseln kann. Ein digitaler Verstand lässt sich in einen entsprechend präparierten Klon hochladen, allerdings nur für ein paar Tage. Danach muss man in die eigenen vier Wände zurück – in seinen Stammkörper. Ansonsten stirbt man. Warum? Niemand weiß es. Sicher ist lediglich: Geht man zu lange fremd, geht man drauf. Der einzige Vorteil der Upload-Technologie sind folglich Body Holidays. Hätte ich die heimliche Fantasie, einmal eine langbeinige blonde Quarktasche zu sein, würde ich es vielleicht machen. Habe ich aber nicht.
»Ich verstehe, was Sie meinen«, sagt Faucheux. »Die meisten denken so, noch. Aber die Technologie wird immer populärer werden, je näher wir der Lösung des Descartes-Conundrums kommen.«
»Des was?«
»Wissen Sie, was das Ein-Körper-Problem ist?«
Ich nicke. »Ein Quant kann seinen Stammkörper nicht länger als einundzwanzig Tage verlassen. Sonst ist es aus.«
»Korrekt. Braincrash – Absturz des Cogits mit kompletter Zerstörung der Datenstruktur. Gleichzeitig erleidet das Gefäß einen letalen anaphylaktischen Schock.«
»Gefäß?«
»So nennen wir einen uploadfähigen Klon.«
»Komischer Begriff«, sage ich.
»Ist aus dem Korintherbrief. ›Wir haben den Schatz in irdenen Gefäßen.‹ Auf jeden Fall kommt das Cogit nicht dauerhaft ohne den Stammkörper aus. Und ganz ohne Körper schon gar nicht: Wenn man versucht, ein Cogit in einer virtuellen Umgebung laufen zu lassen, also im nackten Rechner, dann tritt der Braincrash sofort ein, nach Millisekunden. Es scheint eine Verbindung zwischen Körper und Geist zu geben, die wir noch nicht kennen. Und diese Verbindung, dieses Rätsel, wurde nach dem Philosophen René Descartes benannt.«
»Weil?«, frage ich. Philosophie ist eines der vielen Schulfächer, in denen ich ziemlich schlecht war.
»Descartes postulierte, dass Geist und Körper voneinander getrennt sind. Er nannte sie res cogitans und res extensa, die denkende Sache und die ausgedehnte Sache. Er glaubte, beide würden über einen geheimen Ort und auf unbekannte Weise miteinander interagieren. Neuroprogrammierer suchen fieberhaft nach diesem Ort. Wenn sie ihn finden, wäre es eine große Sache. Denn wenn man wüsste, wie Körper und Geist verknüpft sind, könnte man diese Verknüpfung vielleicht manipulieren oder sogar auflösen.«
Er schmunzelt. »Der Heilige Gral. Dann könnte man ewig leben, sich alle paar Jahrzehnte in ein frisch geklontes Gefäß uploaden lassen.«
Ich trinke noch einen Schluck Limo und mustere Faucheux. »Und? Sollte man schon die Luft anhalten?«
Faucheux schüttelt den Kopf. »Das wird noch Jahrzehnte dauern. Jahrhunderte, vielleicht. Aber es regt die Fantasie der Leute an.«
»Sie glauben nicht?«
»Bisher wissen wir ja nicht einmal genau, wie das menschliche Gehirn überhaupt funktioniert. Wir wissen nur, wie man eine Kopie macht und sie in einen Emulator lädt. Aber was da oben genau vor sich geht … ich befürchte, die Natur lässt sich nicht überlisten.«
Ich nicke abwesend. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Faucheux ein bisschen von dem Perrotte-Thema ablenkt. Aber vielleicht ist er auch einfach nur ein Schwätzer.
»Und was genau war jetzt Perrottes Aufgabe bei Ihnen?«
»Sie war Kryptoanalytikerin. Uploads sind ein Boom-Markt. Die Technologie wird immer billiger. Inzwischen gibt es an die zehn Millionen Quants, Tendenz stark steigend. Zehn Millionen digitale Gehirne, da braucht man absolut unknackbare Verschlüsselungsverfahren.«
»Ich dachte, Cogit-Krypto wäre schon ziemlich gut. Oder ist das nur ein Werbeversprechen?«
»Ist es. Cryptocarbons Verschlüsselung gilt, und das sage ich nicht nur so daher, als der Goldstandard. Juliette war maßgeblich an der neuesten Version beteiligt. Die Verschlüsselung erfolgt nun schon im Moment des ersten Brainscans, sodass die Cogit-Daten niemals ungeschützt sind. Zudem arbeiten wir mit einem sogenannten Matrioschka-Modell.«
»Diese russischen Puppen?«
»Ja, wie eine Matrioschka hat unser Krypto mehrere Lagen oder Hüllen, durch die man nacheinander hindurchmuss. Entschlüsselt man Hülle eins, lässt sich das Cogit kopieren. Aber nur, wenn man auch die Codes für Hülle zwei hat, kann man es auch mounten, also in einem Gefäß laufen lassen. Und selbst dann schützt Hülle drei immer noch davor, dass jemand den eigentlichen Inhalt des Cogits zu sehen bekommt. Wir verwenden zudem Quantenkrypto. Sobald ein Hacker die Schlüssel auch nur betrachtet, verändert sich deren Zustand. Es ist so gut wie unmöglich, ein Cogit zu knacken. Dennoch arbeiten wir stetig daran, unsere Standards noch weiter zu verbessern.«
»Ich verstehe«, sage ich. »Könnte Ihr Sekretariat mir Perrottes Reisen der vergangenen Monate schicken, ihre Termine?«
»Im Prinzip schon. Ich müsste allerdings erst unseren Justiziar fragen, ob wir das alles rausgeben dürfen. Sie sind ja kein Polizist.«
»Das nicht. Aber meine Auftraggeberin, Madame Mumeishi, ist die Anwältin von Perrottes Mutter. Sie bestätigt Ihnen sicherlich gerne, dass ich von der Familie mandatiert bin, falls das den Justiziar beruhigt. Ich nehme an, Perrotte war auch ein Quant?«
»Natürlich.«
»Okay. Noch eine ganz andere Frage.«
»Hm?«
»Was glauben Sie denn, warum Perrotte verschwunden ist?«
Faucheux saugt an seinem Strohhalm. Ein röchelndes Geräusch ist zu hören. Konsterniert mustert er die Flasche, so als sei es ein Desaster, dass ihm gerade jetzt die Cola ausgeht.
»Ich habe keine Ahnung. Juliette war eigentlich sehr zuverlässig.«
»Ist sonst irgendwas weg?«, frage ich.
»Wie weg?«
»Daten, Unterlagen. Zeug, an dem sie gearbeitet hat.«
»Nein, soweit ich weiß nicht.«
An seinem Gesicht kann ich ablesen, dass er noch nicht überprüft hat, ob Perrotte möglicherweise mit irgendwelchen Forschungsergebnissen durchgebrannt ist. Mir scheint, ihm dämmert überhaupt erst, dass diese Möglichkeit besteht. 77C Faucheux sagt einen Moment lang gar nichts. Dann entfährt ihm ein einziges Wort: »Industriespionage?«
»Ist auf jeden Fall denkbar«, erwidere ich. »Sie wusste doch sicher eine Menge Dinge, die für Wettbewerber von Nutzen wären, oder?«
»Ja … ja, natürlich.«
Ich bringe meinen Block in Schreibposition. »Wer sind Ihre Hauptkonkurrenten?«
Faucheux greift nach einer weiteren Pervi Pepsi, sieht dann aber ein, dass er das seinem Herz besser nicht antun sollte. Er wendet sich wieder mir zu.
»Das ist kein sehr weites Feld. Wir sind zwar eine kleine Firma, aber es gibt nur noch drei andere Kryptoboutiquen, die auf diesem Feld tätig sind – 123 Outcomes, Alumia, BGT Security.«
»Ich verstehe. Nun, Monsieur Faucheux, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.«
»Ich habe zu danken. Wir versuchen, Ihnen so schnell als möglich Perrottes Kalender zu besorgen. Und falls Sie etwas hören sollten – vor allem, wenn es auf Industriespionage hindeutet …«
»… verständige ich Sie sofort.«
Wir erheben uns. Ich schüttle Faucheux’ Hand, dann bringt er mich zur Tür.
»Eine Sache noch.«
»Hm?«
»Ihr Monsieur Descartes. Hatte der eine Theorie, was das für ein Ort ist, wo sich Geist und Körper treffen?«
»Zuerst dachte er an die Zirbeldrüse. Später an Gott«, erwidert Faucheux.
»Gott?«
»Descartes nannte es concursus dei. Er glaubte, dass die Interaktion durch Gott geschehe. Anders gesagt: Er hatte keine Ahnung.«
Ich bedanke mich nochmals. Als ich mich ein letztes Mal umdrehe, die Hand zum Abschied erhoben, fällt mir ein Bild an der Wand auf, zwei Meter breit und nicht sehr hoch. Es handelt sich um einen Klassiker, die Evolution des Homo sapiens. Anders als beim Original kann man den hintereinander herlaufenden Affen, Neandertalern und Menschen auf dem Bild allerdings in die Köpfe schauen. Das Affengehirn ist ziemlich klein, bei seinen evolutionären Nachfahren wird es größer und größer, bis zum Menschen mit seinem Riesengerät. Danach folgt noch ein weiterer Mensch. Er hat einen Quantencomputer im Kopf – einen Qube, höchstens so groß wie eine Walnuss.
Eine Kopfnuss, haha.
Der ist natürlich nicht von mir. Irgendwann werden vermutlich alle so ein Ding im Schädel haben, umpackt mit viel Füllmaterial, damit es beim Laufen nicht klackert. Die Avantgarde, die sich bereits ein Cogit hat implantieren lassen, nennt sich Quants. Uns Normalos nennt sie Schwammschädel. Die weiterhin analog denkende Mehrheit hat sich für diese Schmähung revanchiert. Sie bezeichnet die Quants als Hohlköpfe.
Ich streife durch die Straßen, auf der Suche nach einem Happen zu essen. Eigentlich ist es dafür zu heiß. Ich wünsche mich zurück nach London, wo es zu dieser Jahreszeit noch deutlich kühler ist. Die meisten Passanten, die mir entgegenkommen, scheinen Touristen zu sein. Echte Pariser haben sich vermutlich schon in ihre Frühlingsfrische in der Bretagne zurückgezogen oder sich gleich nach Quebec verabschiedet.
Als ich mich endlich für ein kleines Bistro entscheide, ist mein Hemd bereits durchgeschwitzt. Ich nehme im klimatisierten Innenbereich Platz und bestelle einen Salat, den ich nicht aufesse. Es liegt an der Hitze oder, was wahrscheinlicher ist, an dem Fluxovint.
Ich gehe meine Notizen durch. Falls die Konkurrenz Perrotte gekidnappt hat oder sie freiwillig übergelaufen ist, bin ich am Arsch. In beiden Fällen wäre ihr Verschwinden von langer Hand vorbereitet worden. Sie hätte sich auf jeden Fall eine gute Holomasque zugelegt. Theoretisch kann man mit der richtigen Software unter die Holotextur von Personen gucken – Level II rausstrippen, wie das im Jargon heißt. So etwas vermag nur die Polizei, mit richterlicher Anordnung. Aber selbst dann könnte die Suche aussichtslos sein. Das Holonet wurde so konzipiert, dass Individuen darin möglichst wenig Spuren hinterlassen. Datenechos werden nach kurzer Zeit gelöscht. Man darf außerdem nicht vergessen, dass Perrotte Kryptologin war. Unwahrscheinlich, dass so jemand digitale Spuren hinterlässt.
Eigentlich ist es noch schlimmer. Mein Zielobjekt ist ein Hohlkopf. Ich überlege, wie ich an Juliette Perrottes Stelle vorgegangen wäre. Sicher hätte ich keine Holomasque verwendet, um meinen Abgang zu kaschieren. Stattdessen wäre ich in ein anderes Gefäß gewechselt und hätte meinen Stammkörper irgendwo geparkt. Wenn man sich vorab diskret einen Klon anfertigen lässt, findet einen nicht einmal der Geheimdienst.
Ich überlege. Perrotte ist vor drei Tagen verschwunden. Sollte sie sich in einem anderen Körper hochgeladen haben, müsste sie diesen in spätestens achtzehn Tagen wieder verlassen, damit ihr Gehirn nicht durchschmort. Tot wäre sie in diesem Fall zwar nicht. Man müsste sie aber aus einem Back-up wiederherstellen und in ihren Stammkörper uploaden. Alle ihre Erinnerungen an die vergangenen einundzwanzig Tage wären futsch.
Ich überprüfe meine Inbox. Der Amanuensis hat eine Nachricht mit Suchergebnissen eingestellt. Das eine Foto ist auf einem Tennisplatz in der Nähe von Tromsø aufgenommen worden. Das ist nicht sonderlich überraschend. Die Gegend rund um Tromsø ist beim EURUS-Geldadel beliebt, da sie im Sommer angenehm kühl bleibt. Wer auch immer Perrottes Vater war, er muss wohlhabend gewesen sein. Es gibt nämlich keinen Anhaltspunkt dafür, dass ihre Mutter je einer Arbeit nachgegangen wäre. Reich geboren wurde sie allerdings nach meinen Unterlagen auch nicht. Weshalb das Geld von Daddy stammen muss.
Mumeishi hat den vereinbarten Vorschuss überwiesen. Außerdem ist da eine Mail von der Flughafenbehörde, wegen eines Koffers. Ich kann mich an keinen erinnern. Es dauert ein paar Sekunden, bis es mir dämmert. Quästorat Nummer fünfhundertsiebenundsechzig, den Fall hatte ich fast vergessen. Es handelt sich um einen Londoner Börsenmakler namens Hugh Iverson. Er hat seinen Arbeitgeber um mehrere Millionen Eurodollar beschissen, was jedoch nicht der Grund ist, dass ich hinter ihm her bin. Seine Ehefrau hat mich beauftragt, die Countess of Mertonshire. Sie ist ein entsetzlicher Drache, der ihren Gatten anscheinend seit Jahren tyrannisiert. Vermutlich verdrosch sie ihn sogar regelmäßig. Ich kann gut verstehen, dass der arme Hugh sie nicht an seinen ergaunerten Millionen teilhaben lassen wollte. Meine Theorie ist, dass er den ganzen Wertpapierbetrug nur deshalb einfädelte, um endlich finanziell unabhängig von seiner Frau zu sein und das Weite suchen zu können.
Ich bin etwas baff, dass das mit dem Koffer wirklich funktioniert hat. Iverson ist nach Amerika geflohen, nach AMEAST, und hat am Kanye-West-Airport allen Ernstes einen seiner Koffer auf dem Band vergessen – ein echter Profi. Dort war das Gepäckstück mehrere Wochen in Verwahrung, ich bin eher zufällig darauf gestoßen. Mithilfe von Iversons Hausdrachen habe ich es tatsächlich geschafft, mir den Koffer zustellen zu lassen, frei Haus. Meine – eher schwache – Hoffnung ist, dass er einen Hinweis auf Iversons jetzigen Aufenthaltsort enthält. Ich werde also später in seiner Unterwäsche herumschnüffeln.
Ich zahle und verlasse das Bistro. Es ist noch wärmer geworden, zumindest kommt es mir so vor. Ich will mein Hemd kein zweites Mal durchschwitzen, deshalb rufe ich mir ein Taxi, das mich zurück ins Hotel bringt.
Als ich das Zimmer betrete, finde ich auf dem Bett eine voluminöse Schachtel vor. Das muss das Kostüm sein. Ich packe es aus. Es besteht aus Churidar-Pyjamahosen und einem knielangen Gehrock. Außerdem gibt es ein Seidenhemd mit Stehkragen sowie eine Kappe. Die Sachen sitzen wie angegossen. Ich mustere mich im Spiegel. Mit der Kappe sehe ich ein bisschen aus wie Nehru. Ohne ist es besser. Die Kleidungsstücke sind safranfarben und eher schlicht, was mir angesichts des Partymottos »Crazy Funky India« ein wenig langweilig erscheint. Da ich nichts Besseres zu tun habe, verschwende ich die nächsten eineinhalb Stunden darauf, mir verschiedene Farben und Texturen auszusuchen und mit einem Holoeditor einige Designs auszuprobieren. Als ich fertig bin, ist die Hose goldfarben, der Rock azurblau. Letzteren zieren nun ebenfalls in Gold gehaltene Blumenstickereien, die sich die Ärmel hinabschlängeln und in prächtigen, mit Pailletten bedeckten Manschetten enden. Ich überlege, aus der freudlosen Nehrukappe einen maharadschamäßigen Turban zu machen, aber das wird nicht funktionieren. Kleidung mit Holotexturen ist so eine Sache. Zwar kann man einen Minirock wie ein Ballkleid aussehen lassen – die Trägerin wird sich aber nicht so bewegen wie jemand in einem Ballkleid. Sie kann schließlich nicht fühlen, wie der schwere Rock hin- und herschwingt. Selbiges gilt für Turbane von der Größe des Tadsch Mahal. Wer solch ein Ungetüm auf dem Kopf hat, bewegt sich anders als jemand mit einer Kappe. Das Ergebnis wäre auch hier, dass Gang und Haltung nicht zum Outfit passen. So etwas raubt dem Träger jegliche Anmut und Eleganz. Also werde ich barhäuptig gehen.
Inzwischen ist es später Nachmittag. Da ich immer noch etwas müde bin, lege ich mich wieder hin. Dazu gönne ich mir einen Scotch aus der Hotelbar und lese mich ein wenig in das Thema Uploads ein. Ich schaffe nur ein paar Seiten, bevor ich wegdöse.
Verdammt. Ich bin so was von underdressed. Nun, vielleicht ist das nicht das richtige Wort. Indisches Maharadscha-Gepränge war zwar die richtige Richtung, aber während der »India«-Aspekt passt, habe ich das »Crazy Funky« unterbewertet. An den meisten Gästen haftet mehr Farbe als an den Teilnehmern eines Holi-Festivals. Einige tragen im wahrsten Sinne des Wortes haushohe Turbane, holographisch vergrößerte Monstrositäten, die wie Minarette emporragen. Realismus und Authentizität hätte ich mir schenken können.
Von einem Kellner lasse ich mir ein Glas regenbogenfarbenes Blubberwasser in die Hand drücken. Ich nippe daran und schlängele mich durch die Menge. Das ›Marmotte‹ besteht im Wesentlichen aus einem riesigen Raum, die Kubatur ist bestimmt fünfzehn Meter hoch. Ich tippe auf eine alte Schalterhalle. Ob die Innenarchitektur diese These bestätigen würde, kann ich nicht sagen. Denn natürlich hat man Texturen über Wände und Decke gelegt. Nun sieht der Raum aus wie die große Halle des Akshardham-Tempels, nur farbenfroher.
Die Gäste sind durchweg jung, reich und schön oder sehen zumindest so aus – definitiv upper crust. Eine Menge Leute haben sich nicht als Maharadschas oder Nawabs verkleidet, sondern als indische Gottheiten. Auf der Tanzfläche sehe ich einen Elefantenmann, der schüttelt, was er hat. Weiter hinten lümmelt eine vierarmige Frau mit tiefschwarzer Haut auf einem Sofa.
So viele Verrückte, so viele Farben. Ich muss mich erst einmal setzen. Das Fluxovint hellt meine Stimmung immer noch etwas auf, dennoch ist das alles nicht leicht zu ertragen. Um die Tanzfläche herum gibt es Emporen mit Sitzgelegenheiten. Die meisten sind besetzt. Ich finde jedoch ein Sofa, auf dem nur eine Person sitzt, eine junge Frau in einem Sari, der unaufhörlich zwischen orange und lila changiert.
»Ist da noch frei?«, frage ich.
Sie lächelt. »Klar doch.«
Ich setze mich und proste ihr mit meinem Champagner vom Mars zu. Sie hebt ebenfalls das Glas.
»Ich bin Francesca«, sagt sie.
»Sehr erfreut, Francesca. Galahad«, erwidere ich. Francesca ist Ende zwanzig und hat einen Wahnsinnskörper, melting-pot-style: ein bisschen Schweden, ein bisschen Asien, dazu eine Prise Karibik. Echt ist der sicher nicht. Handelte es sich um eine Holomasque, müsste sie einen Brassard tragen, eine farbige Armbinde. Tut sie aber nicht. Also ist es vermutlich ein Gefäß, ein Designerklon vom Allerfeinsten. Ich könnte fragen, aber das wäre ein Bruch der Etikette. Man fragt ja beim ersten Treffen auch nicht, ob die Titten echt sind.
Eine Weile sitzen wir da und lauschen der Musik, wenn man das rhythmische Gewummer als solche bezeichnen mag. Irgendwann sagt sie: »Jetzt wäre der Moment, wo du mich fragen könntest, ob ich eine Freundin von Aubrie bin.«
Francescas Gesichtsausdruck verrät mir, dass sie die Frage wahnsinnig langweilig fände. Okay, dann eben anders.
»Keinen blassen Schimmer, wer Aubrie ist. Ich bin mit einer geklauten Einladung reingekommen.«
Sie lacht, schlägt die Beine übereinander, stützt das Kinn auf die Hände und schaut mich aus ihren sehr großen grünen Augen an. Ich müsste nun wohl dahinschmelzen.
»Und wem hast du die Einladung geklaut?«
»Einer Freundin von Aubrie.«
»Klingt logisch.« Sie legt mir eine Hand aufs Knie. »Hör zu, ich muss mal kurz für kleine Mädchen. Hältst du mir solange den Platz frei?«
»Wird gemacht.«
Francesca steht auf und verschwindet in der Menge. Es besteht natürlich die Gefahr, dass sie die Sache mit der Einladung der Security petzt und ich gleich getasert und rausgeworfen werde. Aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Sie will zunächst den Rest meiner Räuberpistole hören. Danach ruft sie entweder die Security oder sie versucht, mich zu vögeln. Beides gilt es zu vermeiden.
Sie braucht ziemlich lange für ihre Toilette. In der Zwischenzeit unterhalte ich mich mit einem Russen, der links von mir in einem Sessel hängt und schon ziemlich besoffen ist. Die Basisinfos aus ihm herauszuholen ist einfach. Bei Aubrie handelt es sich um die Tochter eines EURUS-Industriebarons, der mit Rohstoffen aus dem Asteroidengürtel reich geworden ist, vor allem Europium und Yttrium. Das Mädchen ist berühmt für seine extravaganten Partys. Der Russe, er heißt Sergei, erinnert sich nur sehr vage an Juliette Perrotte. Wenn er immer so viel säuft, ist das wenig überraschend. Seiner Meinung nach besteht die Verbindung zu Aubrie darin, dass Perrotte regelmäßig mit der Schwester der Gastgeberin Tennis spielte. Aber ganz sicher ist er sich nicht.
Irgendwann taucht meine Sofabekanntschaft wieder auf, ohne Sicherheitsleute. Sogar neue Getränke hat sie mitgebracht. Francesca reicht mir ein Glas mit etwas Knallgrünem, das wie Scotch riecht.
»Praskoveyskoye«, sagt sie. »Ich fand, du siehst wie ein Whisky-Mann aus.«
»Volltreffer«, erwidere ich und proste ihr zu.
»Sind deine Features eigentlich echt?«, fragt sie. »Passen gut zur Party.«
»Alles original. Ich bin ein echter Inder. Bengale, um genau zu sein.« Das ist die Wahrheit, zumindest zu dreißig oder vierzig Prozent. Der Rest von mir stammt aus Irland und weiß der Himmel woher noch.
»Du trägst keinen Brassard«, bemerke ich.
Francesca zuckt mit den Schultern. »Ein Gefäß«, erwidert sie, »ich hab mehrere davon.«
Wie ich schon sagte: upper fucking crust. Um sich mehrere Klone dieser Güte leisten zu können, ist es mit ein bisschen Wohlstand nicht getan. Man muss stinkend reich sein, was vermutlich auf die meisten Gäste zutrifft. War Juliette Perrotte ebenfalls stinkend reich? Es scheint so. Aber warum arbeitete sie dann als angestellte Programmiererin? Wenn jemand so viel Geld hat, warum tut er sich das an? Auf einmal wird mir klar, dass ich die Antwort natürlich kenne. Ich müsste das hier auch nicht machen, tue es aber dennoch – mein eigenes Ding und so weiter. Das Fluxovint scheint nicht gut für die Selbstreflexion zu sein.
Francesca ist ein bisschen näher gerückt. Wieder sagt eine Zeit lang keiner von uns etwas. Das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich. Die meisten Leute tanzen inzwischen. Der Holi-Farbpuder fliegt, die Turbane wippen. Einige Meter entfernt steht ein Gogotänzer auf einer Säule und windet sich. Er hat den Körper eines Catchers und den Kopf eines Affen. Ich meine das nicht im übertragenen Sinne – der Typ sieht wirklich aus wie der indische Gott Hanuman.
»Erzählst du mir jetzt deine Story?«
Der heiße Affe muss mich abgelenkt haben. Ich wende mich wieder meiner neuen Freundin zu.
»Du meinst die mit der Einladung?«
Sie nickt.
»Die Einladung gehörte einer Frau namens Juliette, Juliette Perrotte. Kennst du sie?«
Sie macht eine Handbewegung, die wohl andeuten soll, dass sie eine vage Erinnerung an den Namen hat. Ich beobachte ihre Gesichtszüge, in der Hoffnung, dass sie mir mehr verraten. Aber entweder beherrscht Franzi Pokerface oder die Gesichtsmuskulatur ihres Gefäßes ist eingerostet.
»Juliette konnte nicht kommen«, sage ich.
»Und da hat sie dir die Einladung gegeben?«
Sie verschränkt die Arme vor der Brust und macht einen leichten Schmollmund. »Das zählt aber nicht als geklaut.«