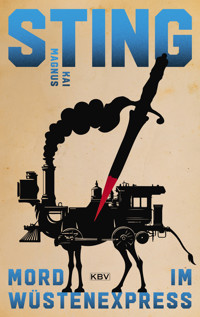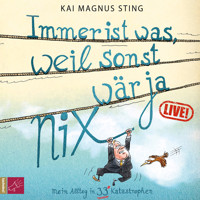13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein schreiend komisches Psychogramm über das Leben und Treiben der Ruhrpottler – jetzt zum ersten Mal in Buchform! Wie begrüßt man sich im Ruhrpott, wie verabschiedet man sich und vor allen Dingen: Was passiert dazwischen?! Kai Magnus Sting, Kind, Kenner und Freund des Potts, erklärt anhand urkomischer Geschichten und im sogenannten Ruhrhochdeutsch, wie der Mensch im Ruhrgebiet so denkt und tickt. Das Ganze führt von Tante Frieda und Omma über Grammatikverschränkungen in der siebten Person bis hin zum echten Ruhrpott-Klassiker: der A40-Odyssee. Das Buch ist eine einzige Liebeserklärung an die Sprache und die Menschen dieser Region: "Hömma, datte Bescheid weiß: so isset!"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Ebook Edition
Kai Magnus Sting
HÖMMA, SO ISSET!
Mit Zeichnungen von Günter Rückert
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig.
Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-86489-798-6
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2020
Foto Umschlag: Harald Hoffmann
Umschlaggestaltung: Dirk Rudolph
Zeichnungen: Günter Rückert
Satz und Datenkonvertierung: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Für Lotta
Frag doch wem
In Dortmund, Duisburg, Essen
gilt eingeschränkte Beugungspflicht.
Fälle gibt’s, die gibt’s da nicht,
die darfst du dort vergessen.
Du musst Derdiedas nicht stressen.
Das Geschlechtswort hat’s bequem.
Wenn du Fragen hast, frag wem.
Frag nicht umständlich nach wessen.
Fang bloß nicht am Radebrechen.
Fragen kost nix, ist kein Ding.
Also frag Kai Magnus Sting.
Frag und wem wird zu dir sprechen.
Fritz Eckenga
KAIMAST SEIN VORWORT
Schreibst Du mir ein Vorwort?
Mal, sehen. Wann brauchst Du das?
Na, wenn ich mit dem Buch fertig bin.
Ach so. Irgendwann. Bis dahin. Ja, natürlich. Ich dachte, Du bräuchtest das bald.
Ja, eben. Ich bin ja bald fertig.
Ja, mach erst mal und dann sag mir Bescheid und ich schreib Dir das zeitnah.
Ich hasse das Wort »zeitnah«.
So etwas wie »fußläufig«.
Hunde sind läufig, doch keine Füße.
Wo kämen wir denn da hin, wenn Füße immer hinter anderen her wären, weil die gerade läufig sind.
Aber, ich glaube, ich schweife ab. Warum schweife ich ab? Ehrlich gesagt, weil ich mich um ein Vorwort drücken will. Mir fallen Vorworte so schwer ein.
Oder heißt das Vorwörter?
Ich glaube beinahe, dass Vorwörter die Wörter sind, die vor Wörter kommen. So wie »tu« bei Tuwort. Oder »Un« bei Unwort, was sie ja jedes Jahr neu suchen.
Das muss man sich wörtlich vorstellen. Fertig studierte Frauen und Männer suchen Jahr für Jahr ein Wort, das sie dann als »un«, also als »nicht« Wort bezeichnen können. Letztendlich dann als ein Wort, das genau genommen nicht existiert, aber das dann doch für ein ganzes Jahr gelten soll.
Während so ein Vorwort? Das gilt ja nichts.
Nein, überhaupt nichts. Das steht da und wird teilweise gar nicht gelesen, weil es mit dem eigentlichen Text, der danach kommt, aber damit noch lange nicht das Nachwort ist und erst recht nicht das Hauptwort, was ja als solches eben nur ein einziges Wort und darum in keiner Weise ein ganzer Text sein kann, nichts zu tun hat. Meistens verfasst dieses nun schon mehrfach erwähnte Vorwort auch gar nicht der Autor selbst, sondern irgendein Bekannter vom Autor. Wobei der Autor schon auch großen Wert darauf legt, dass sein Bekannter möglichst bekannt ist.
Wenn ich mir jetzt diese Aneinanderreihung so vieler Wörter durchlese, komme ich letztendlich zu dem Schluss, dass zumindest eines davon durchaus als Vorwort zu verwenden ist. Welches, werden wir alle nicht erfahren, weil es eine ganz persönliche Entscheidung des jeweiligen Lesers ist und wir alle nach sorgfältiger Lektüre des vorliegenden Textes gelernt haben, dass es für Vorworte, oder heißt es Vorwörter? keine Leser gibt.
Jochen Busse
HÖMMA, SO ISSET
»Hömma, is wat?!«
»Wat soll sein?«
»Frach ja bloß.«
»Wat frachse?«
»Wie et is!«
»Wie soll et sein?«
»Ja, weiß ich donnich. Sach doch, wie et is.«
»Ich sach dir, wie et is. Et is, wie et is. Wenn et so wär, wie et sein soll, dann wär et wat. Aber da et so is, wie et is, un nich so is, wie et wat wär, wennet wat wär, dat et wat wär, isset, wat et is. Wat et wär, wennet wat wär, is nich klar, da et nich is, wie et sein könnt. Aber klar is, dat et wat wär, wennet wat wär, wenn et dat wär, wat et sein könnt.«
»Un wat wäret dann?«
»Anders.«
»Un wie wäret, wenn wat wie wär, dat et wat wär, wie et wat wär, wenn et wat wär?«
»Sach ich ja, dann wäret wat.«
»Un wie isset getz?«
»Et is nich einfach.«
»Un getz?«
»Et is, wie et is.«
»Hömma, so isset!«
DER ANFANG VOM POTT
Am Anfang war Nix.
Also nicht nix.
Sondern das Nix.
Muss auch sehr schön gewesen sein, seinerzeit.
Nix.
Außer Gott.
Und seine Frau.
Und als sich die beiden grade so daran gewöhnt hatten, wie sie das so machen zu zweit im Alltag, ER ständig zu Hause, weiß alles besser, kann nicht nur alles reparieren, nein, er kann erschaffen und vermutlich auch besser kochen, genau in dem Moment kam was.
Und das, was da kam, das war die Erschaffung der Welt. Kam wahrscheinlich mit dem Paketboten, grad als einer der beiden in der Badewanne lag.
Kommt ja immer genau dann, wenn’s am wenigsten passt.
Und ER macht das Paket auf und zack! waren das Universum und die Welt da.
Also mit allem Drum und Dran.
Wussten die beiden auch erst mal nicht, wohin damit.
Haben sie dann einfach mal so stehen lassen. Oder eher schweben.
Mit der Welt hatten der liebe Gott und seine Frau gar nicht gerechnet.
War auch so schön ruhig gewesen bis jetzt.
Klar, wenn nix ist.
Hielten Gott und seine Frau eigentlich für einen Witz, das Ganze.
Dann kam aber noch ein Einschreiben, da hieß es dann: »So, das ganze Nix ist jetzt das Universum, also die Gesamtheit der Dinge. Und in dieser Gesamtheit der Dinge finden wir Sterne und Monde und Planeten und Elementarteilchen und Atome und Moleküle und das ganze andere Zeug. Und die Welt. Und da lassen wir mal die Menschen drauf und dann wollen wir doch mal sehen, was die da so anstellen.«
ER fand das witzig. Hat dann auch mal Hand angelegt, auch an der Welt, auf Himmel hatte er Lust, Meer ebenfalls, klar, Sterne fand er auch ganz nett, Hell und Dunkel, gebongt, hier ein bisschen gewerkelt, da ein bisschen rumgeschraubt, manches erschaffen, anderes auch wieder verworfen, einiges bis heute bereut, da schüttelt ER immer noch den Kopf.
Dann war erst mal Ruhe.
Eigentlich.
Und dann füllte sich Leben auf der Erde an, Flora und Fauna.
Und plötzlich hatte ER eine Idee. Da kam der Mensch. Über den lacht ER bis heute noch am liebsten.
Und der Mensch siedelte überall an. Den ließ ER auch fast überall hin. Oben, unten, links und rechts. Und den Menschen ließ ER überall anders sprechen. Dass sich der Mensch Mühe geben muss, um verstanden zu werden.
ER denkt sich wahrscheinlich, ER wird ja auch oft nicht verstanden und ER versteht auch vieles nicht.
Und der Mensch sah dazu auch noch oft anders aus.
Und das alles hatte man IHM auf die Fahnen geschrieben. ER selber ließ einfach locker laufen. SEINE Frau hüllt sich über alles bis heute noch in Schweigen.
Aber als ER alles so Stücksken für Stücksken einrichtete, blieb ein Gebiet auf der Erde leer. Da fiel IHM nichts mehr ein.
Berge waren aus, Meer auch, weite Fläche ebenfalls.
In das Gebiet wollte auch keiner so richtig hin.
Und das schaute ER sich mal länger an. Und dann sprach ER: »Euch möchte ich reich beschenken. Wenn da schon nix Vernünftiges ist, dann sollt ihr es da unten richtig schön haben. Bei euch soll’s aussehen wie hier oben. Und dann nenne ich euch Ruhrgebiet.«
Und was sagte ER, als er das Ruhrgebiet erschaffen hatte?
Nein, nicht »Essen is feddich!«, sondern: »So, die Bude steht!«
Denn das Erste im Ruhrgebiet war die Bude.
Sozusagen das Epizentrum des Ruhrgebiets.
Und damit das dann nicht so allein da steht, hat Gott drumrum noch Duisburg, Mülheim, Bottrop, Herne, Essen, Witten, Wanne-Eickel, Hagen, Datteln, Gelsenkirchen, Gladbeck, Dinslaken, Oberhausen, Recklinghausen, Bochum, Castrop-Rauxel, Marl, Dortmund und wie sie alle heißen, hingesetzt.
Und dazu noch die Zechen und Kauen und Bergwerke und die Schlote, die Schornsteine, die Fabrikgebäude, dann die Seen, die Wälder und die Auen und für abends, wenn es dunkel wird, die Abstiche, die den Abendhimmel schön rot färben und man sofort denkt: »Kumma, hier bin ich zu Hause.«
Ich glaube, dass ER die Bude als Erstes gemacht hat, damit ER sein Leben lang immer mal wieder runterschauen, einen Blick auf die Bude und ihre Bevölkerer werfen und Spaß haben kann.
Aus der Bude heraus entwickelte sich das Leben. Und das ist heute noch so. Das Leben im Ruhrgebiet ist quasi ohne Bude gar nicht denkbar.
Da kannze wat einkaufen.
Da kannze aber auch nur stehen und quatschen.
Im Prinzip ist das das Entstehungs-Triptychon.
Man kann auch sagen: die Entstehungs-Etagere.
Also je nachdem, wie man es sieht, entweder waagerecht oder senkrecht.
Das Nix, die Bude, die Welt.
Oder:
Das Nix.
Die Bude.
Die Welt.
Und das Ruhrgebiet haben im Laufe der Jahrhunderte einige erlebt.
Wer war nicht alles hier?!
Der Grieche, der Römer, der Etrusker, der Vandale, der Wikinger, der Türke und der Krupp.
Und der Holländer. Aber der ist nur ganz nah drangekommen. Geschafft hat der uns nicht.
Aber die anderen alle: Sind die geblieben?!
Die sind hier hin, haben sich umgeschaut und gesagt: »Das ist so schön hier, da fahren wir gleich wieder weiter.«
Hier war erst mal nur Wasser. Also der Rhein. Der machte dann aber eine Biege und überließ der Ruhr das meiste.
Und dann war da noch Gegend. Und um die Gegend rum war Umgegend, also Umgebung. Vielmehr so viel Umgebung, dass es schon eher Umgebiet war. Und um das Gebiet die Ruhr. Deshalb auch Ruhrgebiet.
Und inmitten des Ganzen: die Bude.
Und an der Bude stehen seit Jahrzehnten immer dieselben. Sind immer andere, aber immer dieselben.
Das ist ein Horst, im Pott Hoast genannt, klingt schöner, spricht sich einfacher und durch das A macht es den Horst auch größer, als er ist, dann ein Karl-Heinz, im Pott Kalleinz, das ist kürzer und knapper und entspricht auch vielmehr dem Karl-Heinz: Es ist reduziert, und ein Özgür.
Und in der Bude steht, in ihren weißen Schluppen am Boden festgedübelt: Tante Erna.
Ist gar keine Tante, sagt man aber immer.
Liegt wahrscheinlich am geblümten Haushaltskittel.
Irgendwann hat es Tante Erna nicht mehr gemacht wegen der Beine, sie konnte nicht mehr stehen, da hat die Bude dann der Tommi gemacht.
Den haben aber auch alle Tante Erna genannt. Was einmal so drin ist inne Leute und im Kopp, dat krisse so schnell nicht mehr raus.
Manchmal hat er auch den geblümten Haushaltskittel übergeworfen.
Nur so für zum Spaß.
Und dann hat immer einer von vor der Bude eine Runde geschmissen.
Auch für zum Spaß.
Und dann gibt’s für alle, die da stehen, Chipse und ein Pils. Vielleicht auch mal einen Kurzen, also Verteiler.
Im Rheinland würde das sofort in Geselligkeit umkippen.
Da geht man ja auch in eine Kneipe, wird immer zu anderen Leuten dazugesetzt, da gibt es große Tische mit vielen Stühlen, man kennt die Leute nicht, man sitzt zusammen mit diesen fremden Leuten, nach fünf Minuten kommt man ins Gespräch, nach zehn Minuten unterhält man sich angeregt, nach fünfzehn Minuten duzt man sich und nach zwei Stunden weiß man eigentlich fast alles über diese Leute, man ist befreundet, fast schließt man Blutsbrüderschaft, man hakt sich unter, man schunkelt und man singt zusammen.
Das ist der rheinische Frohsinn, das ist rheinische Geselligkeit.
Das gibt es im Ruhrgebiet so nicht.
Oder besser: gibt’s auch, aber anders.
Ruhrpottgeselligkeit sieht so aus: Man steht alleine im Feinrippunterhemd an der Bude, in der Hand die Flasche Pils und dann hält man einfach mal die Schnauze.
Und auch damit kann alles gesagt sein.
Mitunter wird über das Leben philosophiert.
Auch oder gerade weil man überhaupt nichts zu sagen hat, trotzdem alles besser weiß und kann.
Dieses typische Rumphilosophieren im Ruhrpott, das machen wir gerne in der Gruppe, ob an der Bude oder an der Theke in der Kneipe oder samstags auf dem Weg zum Fußballspiel.
Aber am allerliebsten machen wir das hier alleine. Mit uns selbst und vor und für uns hin.
Das hat eigentlich keinen speziellen Namen. Es ist so was wie grübeln, nachdenken, brüten (also mit dem Kopp), überlegen, sinnieren.
Der Rheinländer nennt diesen Vorgang oder eher Zustand (weil wir uns in dieses Grübeln mit uns selbst ganz hineinversenken können) »simmelieren«.
Der Ruhrpott macht’s einfach. Ohne zu wissen, wie es heißt. Bis hierhin jedenfalls.
Denn mir ist ein neuer Begriff dafür eingefallen. Ich würde das Nachgrübeln so nennen: kalfaktieren.
Das Wort gibt es bis jetzt noch gar nicht, deswegen passt es auch so gut.
»Kalfaktor« kennt man ja. Das ist einer, der für einen anderen untergeordnete Hilfsdienste verrichtet. Also nix Dolles.
Einer, der so mitläuft.
Und so ist das »Kalfaktieren« auch gemeint. Das führt zu nix, das bringt vielleicht etwas, höchstwahrscheinlich aber nicht, das kriegen nicht viele mit, das dreht sich gern im Kreis, das macht man, um es zu machen. Mehr isses nicht. Mehr will es aber auch nicht sein. Es genügt sich.
Und deswegen prägen wir fortan diesen Begriff: Wenn man im Pott vor sich hin grübelt und nachdenkt und brütet, dann nennt man das: »Der Experte kalfaktiert da für sich hin.«
Und dieses Kalfaktieren an der Bude, das war immer so und genau so wird es auch in den nächsten Jahrhunderten weitergehen.
Drei an der Bude.
»Hömma, kricht ihr nowatt?«
»Ja, sicha. Wat denks du denn? Mamma’n Pilsken.«
»Ou, kumma, wer da kommt.«
»Ich werd nich mehr. Der Kalleinz.
»Kalleinz, alter Stratege, wie is denn?«
»Muss. Un selbs?«
»Muss au. Un selbs?«
»Muss, ne.«
»Ja, klar, muss eben.«
»Kannz nich klagen.«
»Nee, kannze nich.«
»Nee, kannz au nich.«
»Könnz klagen …«
»Klar, könnz klagen, kannz imma klagen, bringt abba nix.«
»Nee, bringen tut et nie wat.«
»Nee nee nee nee nee.«
»Wat willze auch klagen?«
»Bringt ja nix.«
»Nee, hört au keiner.«
»Wat?«
»Ich sach, dattet keiner hören tut.«
»Wat?«
»Dat Klagen.«
»Nee, drum musse nich klagen.«
»Nee, musse au nich.«
»Bringt au nix.«
»Sach ich ja.«
»Un sons?«
»Sonz nix.«
»Weiße eintlich dat Neuste?«
»Nee.«
»Doch!«
»Nee, weiß ich nich. Wat denn?«
»Dat Neuste?«
»Ich weiß et nich. Samma.«
»De Fritz.«
»Nee, de Fritz?«
»Jou, de Fritz!«
»Wie: de Fritz?! Wat hatter denn?«
»De Fritz will sein Schrebergarten abgeben.«
»Dat kann donnich.«
»Kann dat wohl.«
»Hömma, ich war doch die Tage mit den Habicht noch aufn Monte Schlacko.«
Das ist ein typischer Ruhrpottbegriff: der Monte Schlacko. Muss man vielleicht erklären.
Wenn bei uns Mist anfiel, ob unter Tage oder über Tage, dann hat man das irgendwo draußen, ein bisschen vom Stadtkern entfernt, abgelagert. Auf der grünen Wiese. Auch nicht allzu weit weg, man wollte ja keine weiten Wege haben. Und da landete alles aufeinander: Müll, Abfälle, Schutt, Mist. Schon hatte man eine Halde, dann ein bissken Erde drüber, Grassamen, bissken Wasser und viel Zeit.
Und dann ein paar Jahre weggucken.
Und dann? Haben wir uns über diese Müllberge aufgeregt?
Drüber gemeckert?
Nein. Wir haben uns gefreut, dass da nach ein paar Jahren im wahrsten Sinne des Wortes Gras drüber gewachsen ist.
Wir haben da noch Büsche und Bäume draufgepflanzt, ein paar Bänke draufgestellt, dazwischen pflanzten wir ein paar Blümkes und stellten vielleicht noch ein verzinktes Stahlgerüst drauf, was wir dann allen als Kunstwerk verkaufen, und nennen alles das dann nicht blöd und unromantisch Halde, nein, wir gehen ins Südländische und geben dem Ganzen einen wohlklingenden, italienischen Namen.
Wir sagen dazu: Monte Schlacko.
Schon ist es international und hat gleich eine ganz andere Wirkung.
»Hömma, da war ich doch die Tage mit den Habicht noch aufn Monte Schlacko.«
»Wann soll dat denn genau gewesen sein?«
»Ja, sachich ja: die Tage ebent.«
»Dat kannich. Die Tage war ich doch mit den bein Kegeln.«
»Dann waren dat andere Tage.«
»Dat kann au gut sein.«
»Un da war ich mit den Habicht aum Monte Schlacko wegen die Aussicht.«
»Samma, wat nennt ihr der Fritz eintlich immer Habicht, dat hab ich noch nie verstanden?«
»Ja, wegen den sein weggen Auge.«
»Der hat’n Auge wech?«
»Jou. Et linke. Oder et rechte, weiß grad nich. Ebent dat, wat wech is.«
»Abba dann sieht der doch nich so gut.«
»Nee, nur auf den einen Auge. Er sacht abba, damit siehter anne 200 Prozent.«
»Ach, kumma. Dann braucht er dat annere ja gar nich.«
»Nee, sachter, wofür au? Er sacht, mit zwei Augen sehen manche nur 100 Prozent. Er mit den einen abba 200. Er wär froh, nur dat eine zu haben, mit dem er mehr sieht als mit zweien. Würd er auf beiden so gut sehen, dann säh er für seim Geschmack zu viel. So, getz kommz du.«
»So habbich dat no nie gesehn.«
»Sisse. Wie auch? Mit dein zwei Augen.«
»Hasse recht.«
»Un wat macht de Fritz getz, sachse? Gibt sein Schrebergarten ab?«
»Jou.«
»Wieso datt denn? Wat hamwa da immer schön drinne gefeiert.«
»Un immer schön gegrillt.«
»Da konnt et sippen wie Sau, wat hamwa da immer schön gegrillt. Un getz gibter den Schrebergarten ab? Wat dat denn?«
»Ja, er wüsst au nich.«
»Wie: Er wüsst au nich?!«
»Ja, dat würd ihn nimmer ausfüllen.«
»Wie: nimmer ausfüllen? Der hat se doch nimmer alle.«
»Ja, er hat doch de letzt Jahre immer ma wat gemacht. Hatter doch letzt Jahr hatter doch allet umgepflügt.«
»Ja un?«
»Hatter doch dat ganze Gemüs rausgeschmissen, er wollt getz nur noch Blümkes. War er mit sein Frau doch in England da in Urlaub gewesen, mussten domma abschalten.«
»Wie: abschalten?! Warum dat denn?«
»Ja, die ham doch son Knies mitti Kinder.«
»Wie: Knies?!«
»Ja, die Kinder von denen ham doch getz letzthin geheiratet un sachten, se wollten fünf bis sechs Kinder.«
»Fünf bis sechs Kinder?! Ja, wer soll dat denn zahlen?!«
»Ja, nee, die machen se schon noch selber. Un getz sind die im Urlaub gewesen. England.«
»Wie lang waren die denn da?«
»In England?«
»Jou.«
»Drei Wochen.«
»Drei Wochen?«
»Ich sachet doch, drei Wochen.«
»In echt: drei Wochen?«
»Wenn ich et doch sach.«
»Drei Wochen?«
»Ja, wat denn?«
»Also drei Wochen England … Ich könnt dat nich.«
»Wieso?«
»Ja, bei den Wetter …«
»Wie: Wetter?!«
»Ja, ich mein: bei den Wetter da immer.«
»Wie?«
»Ja, is doch immer am Regen da.«
»Woher hasse dat denn?«
»Weiß man doch: Is doch immer nur am Regnen da. Siehsse doch au immer in die alte Krimi-Filme da.«
»Se sachten, se hätten drei Wochen Sonne.«
»Ja, dat würd ich getz au so sagen, wennet nur gerechnet hätt.«
»Is ja au egal, se waren in England, de ganzen Tach nur englische Gärten am Gucken un dat hatter dann mit na Haus genommen.«
»De englische Gärten?«
»Nee, aber dat Prinzip. Er sacht: Sein Motto is getz: Zierrosen un Kunsthecken un schottischen Rasen.«
»Ja, abba wat hat denn de schottischen Rasen mitti englische Gärten am Tun?«
»Ja, dat wüsst er selber nich, dat wär mehr son Gefühl.«
»Ach, mehr son Gefühl?«
»Ja, mehr son Gefühl.«
»Un wat sacht dat Gefühl sons so?«
»Ja, Fisch un Chips, ne.«
»Wie: Fisch un Chips?«
»Ja, der isst nur noch Fisch un Chips. Also mehr Fisch. Un de Kartoffelchips dann abends für aufm Sofa für beim Bierchen. Abba Fisch den ganzen Tach.«
»Wie: den ganzen Tach?«
»Morgens Rollmops, mittags Backfisch, abends roter Heringssalat.«
»Ach. Jeden Tach?«
»Montach bis Donnerstach.«
»Un Freitach?«
»Nich.«
»Wat machter denn Freitach?«
»Da machter morgens roter Heringssalat, mittags Backfisch un abends Rollmops.«
»Un sein Frau?«
»Auch.«
»Da wirste doch krank bei.«
»Er nich, sachter. Dat wär getz so.«
»Ja, abba da musser doch den Garten nich für abgeben. Dat hat doch nix mit Fisch un Chips zu tun.«
»Doch, hattet. Weil sein Doktor hat zu ihm gesacht: Fisch is gut, abba er muss mehr Obst. Fisch, sacht de Doktor, sachter, Fisch, dat geht au mitti Zeit inne Finger. Vonne Gicht her. Getz stehste da in dein englischen Garten, hasse nur Zierrosen un Kunsthecken un schottischer Rasen, un de Doktor sacht dir: Muss mehr Obst.«
»Ja, un?«
»Hatter allet rausgerissen.«
»Nee.«
»Doch.«
»Nee.«
»Doch.«
»Ja, glaubsset nich. Un getz?«
»Ja, nur noch Obst. Nur noch Obst. Kirschbaum, Apfelbaum, Birnbaum, Johannisbeeren Stachelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Tomaten, Gurken.«
»Tomaten un Gurken is abba kein Obst.«
»Ja, sachter er, macht ihm nix, allein der Wille zählt. Säh er nich so eng.«
»Un dat mit nur eim Auge.«
»Abba mit 200 Prozent. Kennzen Fritz ja.«
»Ja sicher. Abba dat mitti Bäume … Dat bringt do nix. Bis die ersma stehn … Dat dauert doch.«
»Ja, sicher. Abba dat dollste kommt ja noch.«
»Wat denn?«
»Hatter die erste Ernte eingefahren, wat fällt ihm auf?«
»Ja, watt denn?«
»Steht er da an sein Laube, beißt inne Himbeeren, un wat fällt ihm auf?«
»Ja, ich weißet nich.«
»Wat is ihm da aufgefallen?«
»Sachet.«
»Steht er da …«
»Ja sachet schon.«
»Steht er da, un: Obstallergie. So, getz stehter da mit sein Garten voll mit Obst.«
»Un?«
»Getz issert leid.«
»Un?«
»Er is am Überlegen dran, watter macht.«
»Un, wat willer?«
»Er denkt, er reißt allet raus un baut ’ne Kegelbahn hin.«
»Mitten innen Schrebergarten?«
»Ja, sachter, hätter nix mehr mitti Allergie am Hut.«
»Hatter recht. Un Hauptsach is, im Sommer könnwa wieder schön grillen. Wann willer dat denn machen?
»Er sacht, die Tage. Ich hab gesacht, ich helf ihm.«
»Ja, kumma, un da soll nomma einer sagen, du kannz nix.«
Das ist ja das größte Lob, was man im Pott bekommen kann. A kriegt einen Auftrag von B, A soll das in einer Woche erledigt haben, A macht und tut, schafft es aber nicht, B hakt tausendmal nach, irgendwann hat A endlich alles fertig, B kommt, verschränkt die Arme vor der Brust, schaut sich das alles in Ruhe an und sagt dann: »Un da soll nomma einer sagen, du kannz nix.«
»Kannze denn Kegelbahn bauen?«
»Nee, warum auch? Er kannet doch au nich. Wat willze mehr?«
»Hasse recht. Kannich helfen?«
»Nee, lass ma. Wenn du anpacks, dat is so, wie wenn drei loslassen.«
»Abba nich, dattet nachher heißt …«
»Nee, komm, lass stecken.«
»Noch geemant’n Pilsken?«
Die Ruhrpottvariante von »jemand«: »geemant«. Selbe Silbenzahl, aber viel schöner zu sprechen. Ohne dieses leicht anlaufende J, sondern zack!, mit einem flotten G.
»Noch geemant’n Pilsken?«
Und alle drei, wie aus einem Mund: »Ja, sicha!«
Und dann stehen alle stumm rum und kalfaktieren für sich hin.
An der Bude. Aus dem Nix. Aber für die Welt.
»Un, wat meinze?«
»Ich mein nix.«
»Denks denn wat?«
»Nee, au nich. Wenn ich wat denken würd, meinze nich, dattich nachher au wat meinen könnt?«
»Meinze?«
»Denk ich.«
»Dann samma nix.«
»Nee, ich sach au nix.«
»Ich sach letztens noch, man könnt denken, dat man wat meint, aber wat meinze, wenne wat denks und käm nix bei rum?«
»Kenn ich.«
»Ach.«
»Schlimm isset nich.«
»Denkse.«
»Nee, sach ich.«
»Na, wennze meinz.«
Von nix eine Ahnung.
Aber immer was zu sagen haben und den ganzen Tag am Kalfaktieren dran.
Lern mich die alle bloß nicht kennen.
BEGRÜSSUNG UND VERABSCHIEDUNG
»Tach.«
Das ist unsere Begrüßung.
Da ist in der Regel alles mit gesagt.
Und es ist die Mischung aus einem sublimierten »guten Tag« und dem Ausdruck größter Lastempfindung in einer Silbe, bestehend aus einem Vokal und einem Guttural: »ach«.
»Tach.«
Wenn einer zur Begrüßung sagt: »Tach«, da weiß man schon, was los ist: nicht viel. Da steckt der Weltkummer drin, die Last der Menschheit, die Erschöpfung vom harten Leben, aber auch der nervige Partner zu Hause.
»Tach.«
Das erwidert man entweder mit einem stummen Nicken oder ebenfalls mit einem »Tach«. Mehr nicht.
»Tach« reicht.
Bei »Tach« weiß man: Den lässt man mal besser in Ruhe.
Das ist das normale »Tach«.
Und es ist wie das norddeutsche »Moin!« zeitenunabhängig einsetzbar.
Das »Tach« sagt man im Vorübergehen. Oder wenn man sich in der Kneipe zusammensetzt, wie jeden Montag – und Dienstag – und Mittwoch – und Donnerstag – und Freitag. Am Wochenende sowieso. Also wenn man da sitzt, es aber erst mal nichts zu sagen gibt.
Dann sagt man bei uns »Tach«.
Es gibt aber auch das »Tach«-zum-Quadrat, das dem Gegenüber sofort signalisiert: Da ist erhöhte Gesprächsbereitschaft, wenn nicht sogar -bedarf.
Zugegeben, das kommt nicht allzu häufig vor, aber es kommt vor.
Und das »Tach«-zum-Quadrat ergibt sich durch eine Worterweiterung durch Adverb-Kombination, wir sagen: »Tach auch!«
Wir kleben diese beiden Wörter fast zusammen, dass es fast ein »Tachauch!« ist.
Es heißt eigentlich nichts anderes, als dass man selber einen »Tach« hat und dem anderen unterstellt, selber auch so einen »Tach« zu haben. Also mal wieder eine klassische Überflüssigkeit, die uns aber oft als Gesprächseinstieg dient.
Oft merken wir auch genau in dem Moment, dass uns das als Unterhaltung schon genügt, und das Gespräch ist damit sofort wieder beendet, noch bevor es überhaupt angefangen hat.
»Tachauch.«
Es gibt eine einzige Steigerung, die ist aber für Fortgeschrittene.
Hört man ab und zu.
Setzt sich zusammen aus »Tach«-zum-Quadrat, also der Fokussierung auf »Tag« und »ach« im Zusammenspiel mit der Adverb-Kombination und einem vorangehängten Zwei-Wörter-Sublimierungs-Klassiker, und das ist: »Hömma, Tachauch!«
Eine schönere Begrüßung kann man im Pott nicht bekommen.
Aber auch die Verabschiedung ist mehr als herzlich, selbst wenn sie vielleicht im ersten Moment nicht so klingen mag.
Wir sagen nicht »Leb wohl!«, wo viel Abschiedsschmerz drinsteckt, nicht »Auf Wiedersehen!«, was zwar eine erneute Begegnung impliziert, aber im Ungenauen lässt, ob es überhaupt zu einem Wiedersehen kommt, nein, wir transponieren die Verabschiedungsfloskel »Auf Wiedersehen!« im Ruhrgebiet ins fast schon Philosophische.
Wir belassen es hier nicht bei einem bloßen zwischenmenschlichen Wiedersehen.
Wir floskolieren nicht vor uns hin, sondern werden ganz präzise.
Wir konzentrieren drei Wörter auf zwei.
Wir komprimieren die Sprache, um uns für das Kommende zu öffnen.
Wir gehen hinaus in die unbestimmte Zeit, überwinden somit persönliche und temporäre Grenzen.
Wir verabschieden uns mit den Worten: »Bissi Tage!«
»Bissi« nicht von »busy«, englisch »eifrig, geschäftig«, vielmehr eine Umkehrung vom »Geschäftigen« ins »Unendlich-Ungenaue«, also wieder eine Konzentration von »bis« und »die«, folglich wird aus »Bis die Tage« ein »Bissi Tage«.