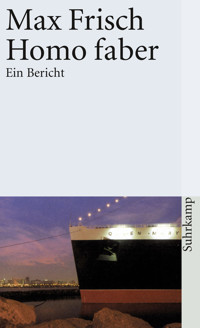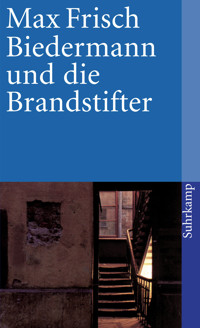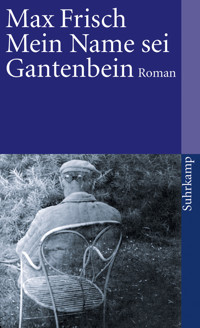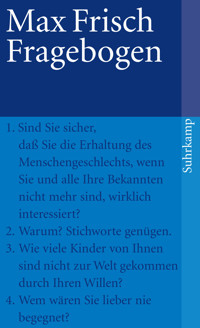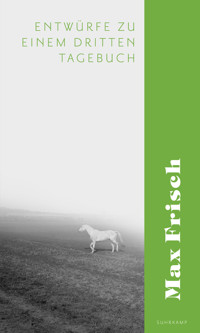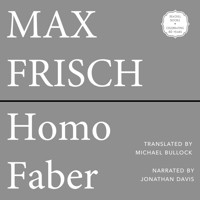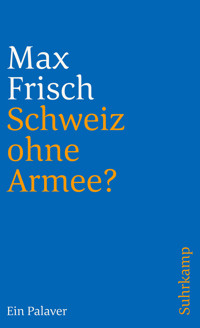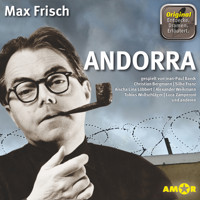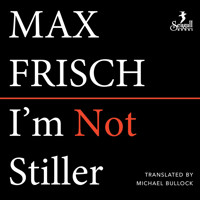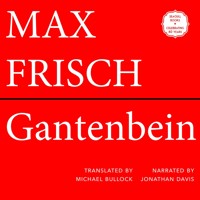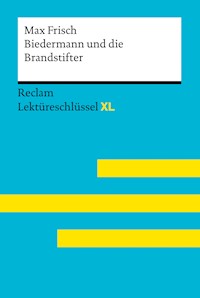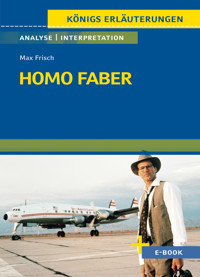
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bange, C., Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Spare Zeit und verzichte auf lästige Recherche! In diesem Band zu Max Frisch Homo faber findest du alles, was du zur Vorbereitung auf Referat, Klausur, Abitur oder Matura benötigst - ohne das Buch komplett gelesen zu haben. Alle wichtigen Infos zur Interpretation sowohl kurz (Kapitelzusammenfassungen) als auch ausführlich und klar strukturiert mit kostenlosem Zugang zum digitalen Buch und vielen nützlichen Materialien (z. B. Audios, Bilder, Videos). Inhalt: - Schnellübersicht - Autor: Leben und Werk - Inhaltsangabe - Aufbau - Personenkonstellationen - Sachliche und sprachliche Erläuterungen - Stil und Sprache - Interpretationsansätze - 6 Abituraufgaben mit Musterlösungen NEU: exemplarische Schlüsselszenenanalysen NEU: Lernskizzen zur schnellen Wiederholung Layout: - Randspalten mit Schlüsselbegriffen - übersichtliche Schaubilder NEU: vierfarbiges Layout PLUS: kostenlosem Zugang zum digitalen Buch Im Roman Homo faber von Max Frisch wird der rein technisch-praktisch orientierte Ingenieur Faber mit Liebe, Schuld, Schicksal und Tod konfrontiert und scheitert. .
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
KÖNIGS ERLÄUTERUNGEN
Band 148
Textanalyse und Interpretation zu
Max Frisch
Homo faber
Ein Bericht
Daniel Rothenbühler
Alle erforderlichen Infos zur Analyse und Interpretation plus Musteraufgaben mit Lösungsansätzen
Zitierte Ausgabe: Max Frisch: Homo faber. Ein Bericht. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 87. Auflage 2021 (suhrkamp taschenbuch 354) → Zitatverweise durch Seiten- und Zeilenzahlen in Klammern.
Über den Autor dieser Erläuterung: Dr. phil. hist. Daniel Rothenbühler wurde 1951 in Porrentruy geboren. Er hat in Heidelberg und in Bern Germanistik und Romanistik studiert und 1992 in Bern mit einer Dissertation über Der grüne Heinrich 1854/55 promoviert. Von 1991 bis 2016 unterrichtete er Deutsch und Französisch am Gymnasium Köniz-Lerbermatt bei Bern. Er publiziert regelmäßig über die deutsch- und französischsprachige Literatur der Schweiz, hat das Schweizerische Literaturinstitut mitbegründet, ist in der Literaturvermittlung und -förderung der deutsch- und französischsprachigen Schweiz aktiv und hat bisher drei Bücher auf Französisch übersetzt. Im Jahr 2015 wurde er mit dem Kulturvermittlungspreis des Kantons Bern ausgezeichnet.
Hinweis: Die Rechtschreibung wurde der amtlichen Neuregelung angepasst. Zitate Max Frischs müssen aufgrund von Einsprüchen in der alten Rechtschreibung beibehalten werden.
1. Auflage 2024
978-3-8044-7084-2
© 2024 by Bange Verlag GmbH, Marienplatz 12, 96142 Hollfeld – www.bange-verlag.de Alle Rechte vorbehalten, darunter fällt auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von §44b UrhG! Titelbild: Sam Shepard als Walter Faber in der Romanverfilmung von 1991 © picture alliance / Everett Collection | ©Castle Hill/Courtesy Everett Collection
Hinweise zur Bedienung
Inhaltsverzeichnis Das Inhaltsverzeichnis ist vollständig mit dem Inhalt dieses Buches verknüpft. Tippen Sie auf einen Eintrag und Sie gelangen zum entsprechenden Inhalt.
Fußnoten Fußnoten sind im Text in eckigen Klammern mit fortlaufender Nummerierung angegeben. Tippen Sie auf eine Fußnote und Sie gelangen zum entsprechenden Fußnotentext. Tippen Sie im aufgerufenen Fußnotentext auf die Ziffer zu Beginn der Zeile, und Sie gelangen wieder zum Ursprung. Sie können auch die Rücksprungfunktion Ihres ePub-Readers verwenden (sofern verfügbar).
Verknüpfungen zu Textstellen innerhalb des Textes (Querverweise) Querverweise, z. B. „s. S. 26 f.“, können durch Tippen auf den Verweis aufgerufen werden. Verwenden Sie die „Zurück“-Funktion Ihres ePub-Readers, um wieder zum Ursprung des Querverweises zu gelangen.
Verknüpfungen zu Inhalten aus dem Internet Verknüpfungen zu Inhalten aus dem Internet werden durch eine Webadresse gekennzeichnet, z.B. www.wikipedia.de. Tippen Sie auf die Webadresse und Sie werden direkt zu der Internetseite geführt. Dazu wird in den Web-Browser Ihres ePub-Readers gewechselt – sofern Ihr ePub-Reader eine Verbindung zum Internet unterstützt und über einen Web-Browser verfügt. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Webadressen nach Erscheinen dieses ePubs gegebenenfalls nicht mehr aufrufbar sind!
Inhaltsverzeichnis
1. Das Wichtigste auf einen Blick – Schnellübersicht
2. Max Frisch: Leben und Werk
2.1 Biografie
2.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund
Verdrängte Vergangenheit
Prägende Gegenwart
Sonderstellung im Zeitbezug
2.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken
Frühphase (1934–1944)
Hauptphase (1944–1964)
Spätphase (1964–1991)
3. Textanalyse und -Interpretation
3.1 Entstehung und Quellen
Entstehung in zwei Phasen
Verschiedenartige Quellen
3.2 Inhaltsangabe
Erste Station
Zweite Station
3.3 Aufbau
Der Titel
Erzählsituation
Schreibstationen
Wechselnde Erzähldistanz
Verdecktes Wissen
Strukturierende Elemente
Zeitebenen
Orte
Zufälle und Begegnungen
Krankheit
3.4 Personenkonstellation und Charakteristiken
Walter Faber
Hanna
Sabeth
Herbert Hencke
Joachim Hencke
Ivy
Marcel
Figurenkonstellation: Korrespondenzen und Kontraste
Spiegelungen zwischen Faber und Hanna als Mann und Frau
Spiegelungen zwischen den Frauenfiguren
Spiegelungen zwischen den Männerfiguren
3.5 Sachliche und sprachliche Erläuterungen
3.6 Stil und Sprache
Das Sprachverständnis des Autors
Die Sprache Fabers
Rhetorik der Verdrängung
Satzbau
Wortwahl
Nüchternheit und Poesie
3.7 Interpretationsansätze
Poetologische Gesichtspunkte
Gesellschaftskritische Gesichtspunkte
Anthropologische Gesichtspunkte
Mythos
Frauenbild
Krankheit
Postkolonialismus
3.8 Schlüsselstellenanalysen
4. Rezeptionsgeschichte
Großerfolg in vier Phasen
Wertungen der Literaturkritik
Dramatisierungen und Verfilmungen
5. Materialien
Max Frisch: „Am Ende ist es immer das Fälligste, was uns zufällt“
Jürgen Habermas: „Wissenschaft und Technik blenden Wirklichkeit ab“
Simone de Beauvoir: „Gegenwart ohne Dichte“
Simone de Beauvoir: Der homo faber – „der Mann erkennt darin sein Menschsein“
6. Prüfungsaufgaben mit Musterlösungen
Aufgabe 1 *
Aufgabe 2 **
Aufgabe 3 ***
Aufgabe 4 ***
Aufgabe 5 ***
Aufgabe 6 ***
Lernskizzen und Schaubilder
Literatur
Zitierte Ausgabe
Weitere Primärliteratur
Zitierte Sekundärliteratur
Verfilmungen
1. Das Wichtigste auf einen Blick – Schnellübersicht
Damit sich alle Leser:innen in unserem Band rasch zurechtfinden und das für sie Interessante gleich entdecken, hier eine Übersicht.
Im zweiten Kapitel beschreiben wir Max Frischs Leben und stellen den zeitgeschichtlichen Hintergrund dar:
Max Frisch lebte von 1911 bis 1991, veröffentlichte schon mit 23 Jahren seinen ersten Roman, wurde aber zunächst hauptberuflich Architekt.
Die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und der Kontakt mit der deutschen Emigration am Zürcher Schauspielhaus veränderten seine Weltsicht und sein Schreiben grundsätzlich.
Er schrieb Homo faber nach dem Welterfolg von Stiller, der Trennung von seiner Familie und der Aufgabe seines Architekturbüros.
Homo faber zeigt drei Generationen, deren Leben vom Zweiten Weltkrieg gezeichnet sind, die sich aber, mit Ausnahme der Hauptfigur, wenig mit ihrer Vorgeschichte auseinandersetzen.
Die Vergangenheit wurde von den Menschen jener Zeit oftmals unter dem Eindruck des Kalten Kriegs, des „Wirtschaftswunders“ und der Verbreitung des American Way of Life vergessen.
Die Pannenanfälligkeit der technischen Zivilisation, der fortdauernde Rassismus, gerade in den USA, und die nur langsam voranschreitende Gleichberechtigung der Frauen prägten die Zeit und spielen im Roman eine Rolle.
Homo faber nimmt dadurch eine Sonderstellung ein, dass der Roman die zeitgeschichtlichen Ereignisse und Hintergründe aufgreift und die Ideologie des raschen wirtschaftlichen und technischen Fortschritts hinterfragt.
Im 3. Kapitel bieten wir eine Textanalyse und -interpretation.
Homo faber – Entstehung und Quellen:
Der Roman entstand in zwei Arbeitsphasen, in der zweiten stellte Frisch in seiner Komposition eine größere Distanz zu jener in Stiller her.
Frisch schöpfte in der Haupthandlung aus seinen Reiseerfahrungen in die USA und nach Zentralamerika, in Fabers Vorgeschichte mit Hanna auch aus seiner eigenen Lebensgeschichte.
Wichtige Quellen Frischs waren die Mythen der griechischen Antike (Orestie, Ödipus, Hermes) sowie Sachtexte, vor allem Das andere Geschlecht (1949) von Simone de Beauvoir (1908–1986) und mehrere Werke aus dem Bereich der Mathematik, Logik und Philosophie.
Anklänge an literarische Quellen gibt es vor allem zu eigenen Werken, aber auch zum Roman Es ist genug (1932) von Georg Kaiser (1878–1945).
Inhalt:
Der Schweizer Ingenieur Walter Faber fliegt im Auftrag der UNESCO nach Caracas (Venezuela), erleidet bei einer Zwischenlandung in Houston (Texas) einen Schwächeanfall, setzt seine Reise aber fort, bis ein Motorschaden des Flugzeugs eine Notlandung in der mexikanischen Wüste erzwingt. Beim Warten mit den anderen Passagieren auf Hilfe freundet er sich mit dem jungen Deutschen Herbert Hencke an und reist dann mit diesem zur Tabakfarm von dessen Bruder weiter, Fabers einstigem Studienfreund Joachim. Dort angekommen, finden sie aber nur noch dessen Leiche, weil er sich selbst erhängt hat. Herbert bleibt vor Ort, Faber kehrt nach New York zurück, verlässt seine Geliebte Ivy, von der er sich ohnehin trennen will, und überquert den Atlantik auf einem Schiff, um an einer Konferenz in Paris teilzunehmen. Auf dem Schiff verliebt er sich in die zwanzigjährige Sabeth, die sich später als Tochter Hannas herausstellen wird, Fabers einstiger Geliebten, die er 1936 verlassen hat. In Paris nutzt er das Urlaubsangebot seines Chefs, um mit Sabeth durch Südfrankreich und Italien nach Griechenland zu fahren. Er übersieht alle Indizien, dass sie seine leibliche Tochter sein könnte, und schläft in Avignon mit ihr. In Griechenland stirbt Sabeth nach einem Schlangenbiss und anschließendem Sturz auf den Hinterkopf, und Faber, nachdem er seine einstige Geliebte Hanna wiedergesehen hat, fliegt am Tag darauf nach New York. Auf dem Weg nach Caracas macht er einen Abstecher zu Herbert, kann mit dessen neuer Lebensweise auf der Plantage aber nichts mehr anfangen. In Caracas ist er aufgrund heftiger Magenschmerzen zweieinhalb Wochen bettlägerig und schreibt einen Bericht über die Ereignisse zwischen dem Abflug in New York und Sabeths Tod. Da er dann beruflich in Caracas nicht mehr gebraucht wird und um dem Zwischenhalt in New York auszuweichen, macht er diesen in Havanna (Kuba) und erlebt dort ein ganz neues Lebensgefühl. Mit Zwischenhalten in Düsseldorf und Zürich fliegt er schließlich nach Athen zurück, wo er nach einer Krebsdiagnose ins Krankenhaus muss. In den fast anderthalb Monaten Wartezeit auf die Operation schreibt er einen zweiten Bericht über die Zeit nach Sabeths Tod bis zu seiner Hospitalisierung. Wenn ihm in Ruhestunden seine Schreibmaschine weggenommen wird, macht er handschriftliche Notizen, um die Besuche von Hanna und die Gespräche mit ihr festzuhalten. So erhalten wir im Lauf des Romans bis zum Schluss immer mehr Informationen über deren Leben und ihre Beziehungen zu verschiedenen Männern und zu Sabeth. Faber möchte in Athen mit Hanna weiterleben, muss seine Notizen aber kurz vor der Operation beenden, deren Ausgang ungewiss bleibt.
Chronologie und Schauplätze:
Die Haupthandlung umfasst gute fünf Monate von Ende März bis Ende August 1957. In immer längeren Rückwendungen erschließt sich bis zum Schluss auch die Vorgeschichte zwischen Faber und Hanna in den 1930er Jahren und deren spätere Lebensgeschichte. Die Chronologie wird durch diese Rückwendungen und mehrere Vorausdeutungen unterbrochen, auch wenn Faber bis zur Liebesnacht mit Sabeth zeitlich dem Geschehen folgt. Danach ergeben sich immer mehr Brechungen des linearen Erzählens.
Hauptsächliche Handlungsorte sind in der Vergangenheit Zürich, in der Haupthandlung New York, die mexikanische Wüste Tamaulipas, die mexikanische Maya-Stadt Palenque, die Tabakplantage Joachims in Guatemala sowie die kubanische Hauptstadt Havanna, in Europa Paris, Rom und Athen. Jeder dieser Schauplätze hat eine eigene Atmosphäre, die für Fabers Lebensgefühl und seine Entwicklung wichtig wird.
Personen:
Im Zentrum des Romans stehen Walter Faber und Hanna, zwischen ihnen Sabeth; wieder zueinander finden die drei durch die zufällige Begegnung Fabers mit Herbert Hencke.
Joachim Hencke, Ivy, Marcel und weitere Nebenfiguren markieren verschiedene Lebensstadien Fabers und seine jeweiligen Grundhaltungen.
In wechselseitigen Spiegelungen zeigen sich Entsprechungen und Gegensätze zwischen den Figuren, die wesentlich zu ihrer Charakterisierung beitragen. Für die damit offenbarten Korrespondenzen und Kontraste spielen auch alle Nebenfiguren eine mehr oder weniger wichtige Rolle.
Stil und Sprache:
Max Frisch pflegt über den Berichtsstil seines Protagonisten und Ich-Erzählers Faber hinaus generell einen eher knappen, nüchternen und der Alltagssprache nahestehenden Sprachstil, um das zu umkreisen, was er das „Unsagbare“ nennt, und um die Leserschaft zum eigenen Weiterdenken anzuregen.
Die Sprache des Ich-Erzählers ist über sein offensichtliches Bemühen um Sachlichkeit und Zweckgerichtetheit hinaus durch eine Rhetorik der Verdrängung geprägt.
Faber bevorzugt die Parataxe (Satzreihung statt -verschachtelung), Satzellipsen (Wegfall des Prädikats) und Nominalgefüge (Reihung von Hauptwörtern).
In Beschreibungen sieht er sich immer wieder auf Wörter aus dem technisch-naturwissenschaftlichen Bereich verwiesen und pflegt diese Wortwahl manchmal auch ganz bewusst.
Er mischt gehobene Sprache mit Umgangssprache und streut oft englische und französische Wörter ein, die seine Weltgewandtheit bezeugen, verrät in einzelnen Helvetismen aber auch seine Herkunft aus der Schweiz.
In der Begegnung mit Sabeth und dann vor allem auf Kuba gewinnt sein sprachlicher Ausdruck eine größere Farbigkeit und einen lebendigeren Rhythmus und wirkt stimmungsvoller.
Interpretationsansätze:
In poetologischer Hinsicht zeigt sich in Fabers Bericht das Grundproblem und zugleich die schriftstellerische Chance, die für Frisch jedes Erzählen kennzeichnen: Im Erzählen können wir das Leben nur quasi gleichnishaft in Bildern wiedergeben, und diese geben mehr über die Erzählenden Auskunft als über die Wirklichkeit.
In gesellschaftskritischer Hinsicht geht es im Roman vor allem um die Frage, wie der technische Fortschritt und moderne Lebensweisen mit anderen Kulturen und vergangenen Zivilisationen verbunden werden können.
In anthropologischer Hinsicht stellt der Roman den Stellenwert antiker Mythen, die Entwicklung der Geschlechterverhältnisse, die Frage von Krankheit und Tod sowie das Neben- und Gegeneinander verschiedener Kulturen zur Diskussion.
2. Max Frisch: Leben und Werk
2.1 Biografie
Max Frisch
(1911–1991) © picture alliance / ullstein bild | RDB
JAHR
ORT
EREIGNIS
ALTER
1911
Zürich
Geburt von Max Rudolf Frisch am 15. Mai als Sohn des Architekten und Liegenschaftsmaklers Franz Bruno Frisch (1871–1932) und dessen zweiter Ehefrau Karolina, geborene Wildermuth (1875–1966). Max wächst mit zwei älteren Geschwistern in eher ärmlichen Verhältnissen auf.
1–12
1924–1930
Zürich
Kantonales Realgymnasium Zürich. Max schreibt mehrere Stücke. Max Reinhardt (1873–1943), damaliger Leiter der Salzburger Festspiele, ermuntert ihn, weitere Text einzuschicken. Sein Vater verhindert dies.
13–19
1931–1934
Zürich
Studium der Germanistik, Kunstgeschichte und Romanistik an der Universität Zürich. Journalistische Beiträge in der Neuen Zürcher Zeitung(NZZ).
20–23
1932
Zürich
Tod des Vaters, aus finanziellen Gründen Einschränkung des Universitätsbesuchs.
21
1932–1936
Zürich
Freier Journalist bei der NZZ, der Zürcher Illustrierten und weiteren Zeitungen.
21–25
1933
Prag, Budapest, Dalmatien, Istanbul, Griechenland, Rom
Sportreportage zur Eishockeyweltmeisterschaft in Prag, Reiseschilderungen aus Osteuropa, dem Balkan und Italien.
22
1934–1944
München
Romantrilogie um den Protagonisten Jürg Reinhart in: Jürg Reinhart. Eine sommerliche Schicksalsfahrt (1934), Antwort aus der Stille (1937),
23–33
Zürich
J’adore ce qui me brûle oder Die Schwierigen (1944).
1934–1936
Zürich
Liebesbeziehung zu Käte Rubensohn (1914–1998), einer aus Deutschland emigrierten Jüdin.
23–25
1935
Stuttgart, Berlin
Deutschlandreise, Begeisterung für Leistungen deutscher Technik, Empörung über den NS-Rassismus.
24
1936–1940
Zürich
Architekturstudium an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH).
25–29
1936
Zürich
Käte Rubensohn lehnt den Heiratsantrag Frischs ab.
25
1937
Zürich
Nach mehrerer ablehnenden Reaktionen auf seinen zweiten Roman verbrennt Frisch alle bisherigen Manuskripte, darunter zwei Stückentwürfe und zwei Romane. Trennung von Käte Rubensohn, die 1938 nach Basel zieht.
26
1938
Zürich
Stipendium der Conrad-Ferdinand-Meyer-Stiftung der Stadt Zürich.
27
1939–1945
Sporadischer Aktivdienst als Kanonier in der Schweizer Armee.
28–34
1940
Zürich
Blätter aus dem Brotsack. Tagebuch eines Kanoniers im Atlantis-Verlag Zürich. Architektur-Diplom der ETH Zürich während eines Diensturlaubs.
29
1. Das Wichtigste auf einen Blick – Schnellübersicht
2. Max Frisch: Leben und Werk
2.1 Biografie
2.2 Zeitgeschichtlicher Hintergrund
Verdrängte Vergangenheit
Prägende Gegenwart
Sonderstellung im Zeitbezug
2.3 Angaben und Erläuterungen zu wesentlichen Werken
Frühphase (1934–1944)
Hauptphase (1944–1964)
Spätphase (1964–1991)
3. Textanalyse und -Interpretation
3.1 Entstehung und Quellen
Entstehung in zwei Phasen
Verschiedenartige Quellen
3.2 Inhaltsangabe
Erste Station
Zweite Station
3.3 Aufbau
Der Titel
Erzählsituation
Schreibstationen
Wechselnde Erzähldistanz
Verdecktes Wissen
Strukturierende Elemente
Zeitebenen
Orte
Zufälle und Begegnungen
Krankheit
3.4 Personenkonstellation und Charakteristiken
Walter Faber
Hanna
Sabeth
Herbert Hencke
Joachim Hencke
Ivy
Marcel
Figurenkonstellation: Korrespondenzen und Kontraste
Spiegelungen zwischen Faber und Hanna als Mann und Frau
Spiegelungen zwischen den Frauenfiguren
Spiegelungen zwischen den Männerfiguren
3.5 Sachliche und sprachliche Erläuterungen
3.6 Stil und Sprache
Das Sprachverständnis des Autors
Die Sprache Fabers
Rhetorik der Verdrängung
Satzbau
Wortwahl
Nüchternheit und Poesie
3.7 Interpretationsansätze
Poetologische Gesichtspunkte
Gesellschaftskritische Gesichtspunkte
Anthropologische Gesichtspunkte
Mythos
Frauenbild
Krankheit
Postkolonialismus
3.8 Schlüsselstellenanalysen
4. Rezeptionsgeschichte
Großerfolg in vier Phasen
Wertungen der Literaturkritik
Dramatisierungen und Verfilmungen
5. Materialien
Max Frisch: „Am Ende ist es immer das Fälligste, was uns zufällt“
Jürgen Habermas: „Wissenschaft und Technik blenden Wirklichkeit ab“
Simone de Beauvoir: „Gegenwart ohne Dichte“
Simone de Beauvoir: Der
homo faber
– „der Mann erkennt darin sein Menschsein“
6. Prüfungsaufgaben mit Musterlösungen
Aufgabe 1 *
Aufgabe 2 **
Aufgabe 3 ***
Aufgabe 4 ***
Aufgabe 5 ***
Aufgabe 6 ***
Lernskizzen und Schaubilder
Literatur
Zitierte Ausgabe
Weitere Primärliteratur
Zitierte Sekundärliteratur
Verfilmungen
Orientierungsmarken
Inhaltsverzeichnis