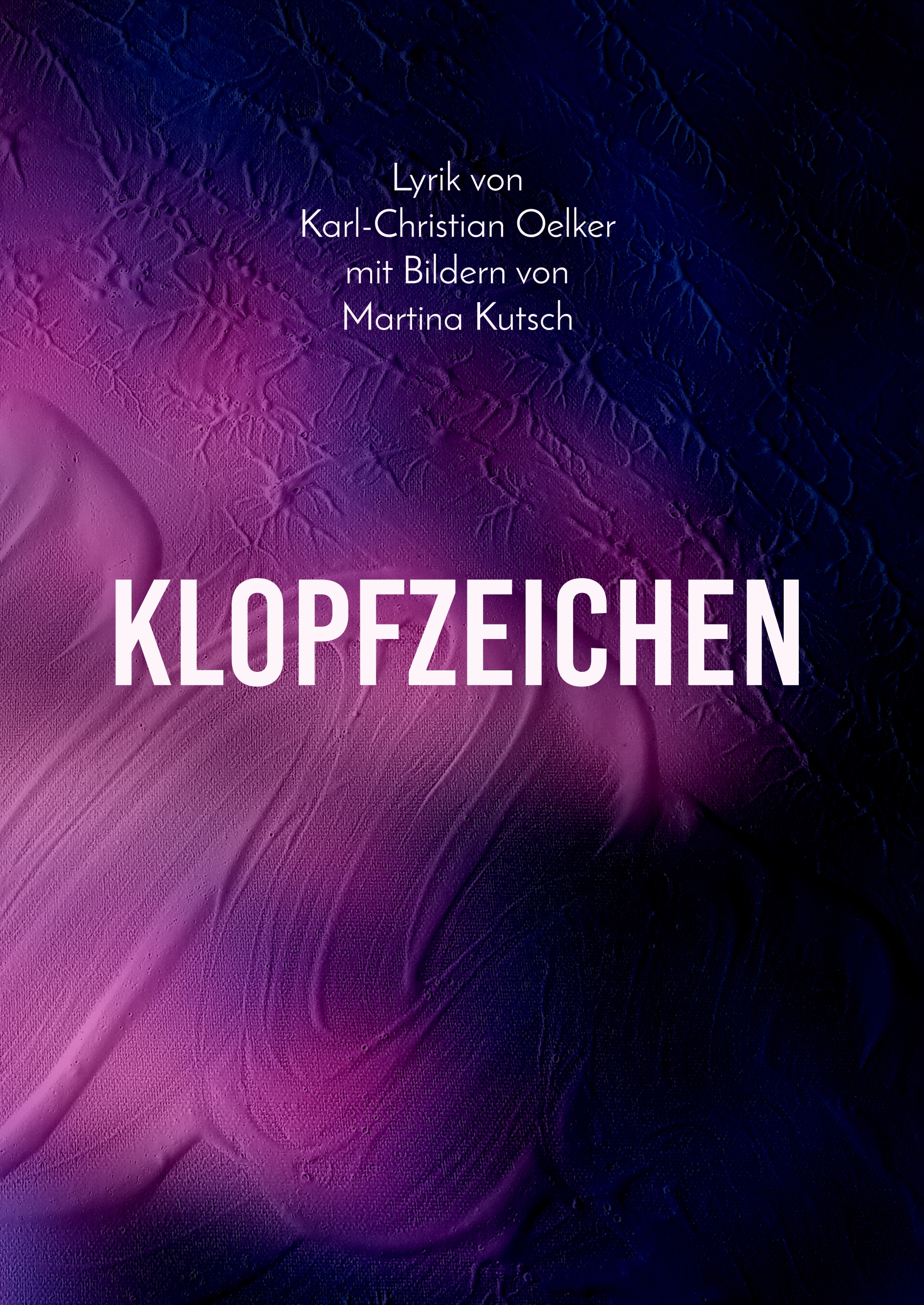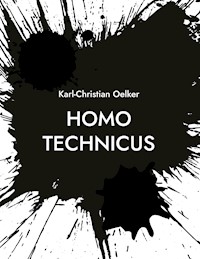
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es geht um UNS. Was wir sind und was wir vielleicht einmal sein können. Es geht um unsere EINZIGARTIGKEIT: Unsere Fähigkeit zu GLAUBEN und zu LIEBEN. Unseren WISSENSDURST und unsere AGGRESSIONEN. Was müssen wir auf die Waagschale legen, wenn wir den Planeten erhalten und den Frieden gewinnen wollen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Sabine
Es geht um UNS.
Was wir sind und was wir
vielleicht einmal sein können.
Es geht um unsere
EINZIGARTIGKEIT:
Unsere Fähigkeit zu
GLAUBEN und zu LIEBEN.
Unseren
WISSENSDURST
und unsere
AGGRESSIONEN.
Was müssen wir auf die Waagschale
legen, wenn wir den Planeten erhalten
und den Frieden
gewinnen wollen?
Inhaltsverzeichnis
1. Buch
Untergang
2. Buch
Zukunft
3. Buch
Trennung
1. Buch Untergang
Der Irrsinn ist bei Einzelnen etwas Seltenes aber bei Gruppen,
Parteien und Völkern die Regel.
Friedrich Nietzsche (1844 bis 1900)
Afrika
Anfang und Ende
Enkil geht mit schweren Schritten die flache Furche entlang, in der sich die trockenen Krumen der rotbraunen Erde sammeln. Seine Füße sind nackt und manchmal drücken sich kleine, spitze Steine zwischen seine Zehen, die ihm beim Auftreten Schmerzen bereiten. Zwei alte, graue Wasserbüffel ziehen den Hakenpflug, der nur eine Handbreit in die trockene Erde eindringt. Enkil drückt mit aller Kraft auf den hölzernen Pflugbaum, die rotbraune Erde reißt auf und fällt aufgelockert zu beiden Seiten. In die schmale Furche wird die Saat gestreut, in einem zweiten Arbeitsgang wird das Feld geeggt und die Saat mit frischer Erde bedeckt. Oberhalb des Feldes befindet sich eine kleine Quelle. Mit dem Wasser kann Enkil seine Feldfrüchte bewässern, so sichert er sich zwei bis drei Ernten in jedem Jahr.
Zwei Monate später ist das Gras bereits dreißig bis vierzig Zentimeter lang, in den nächsten Wochen wird es weiterwachsen, kleine dünne Ähren mit braunen Samenkörnern werden sich ausbilden. Wenn die Hirsehalme gelb werden, ist es Zeit für die Ernte.
Als heute um fünf Uhr die Sonne aufging, ist Enkil von seinem Strohsack aufgestanden. Jeden Abend legt er sich zusammen mit seiner Frau Abelka auf den Fußboden seiner runden Lehmhütte zum Schlafen nieder, beide sind dann völlig erschöpft von der schweren Feldarbeit. Sie schmiegen ihre warmen Körper aneinander, manchmal streicheln sie sich über den Rücken und an wenigen Tagen in der Woche erhitzt die Lust ihr Blut, dann stillen sie ihre Sehnsucht in der sexuellen Vereinigung. Danach fallen sie wieder erschöpft auf ihren Strohsack zurück und versinken in einen traumlosen Schlaf.
Die Feldarbeit ernährt die ganze Familie, zu ihr gehören neben den Eltern von Enkil und Abelka, auch zwei Großmütter, der Vater von Enkil und die sieben Kinder im Alter zwischen zwei und vierzehn Jahren. Wenn die Regenzeit ausreichend Feuchtigkeit auf den bepflanzten Boden bringt, gibt es eine gute Ernte und der Überschuss kann auf dem Markt in Goba verkauft werden. Von den Einnahmen wird die neue Saat gekauft und auch kleinere Anschaffungen für die Familie sind möglich. In den letzten Jahren hat sich das Einkommen aus der Landwirtschaft stetig verbessert, durch den Einsatz von Kunstdünger konnte Enkil die Erträge steigern und die Preise auf dem Markt sind auch gestiegen. Die Familie ist zufrieden, weil sie spürt, dass es von Jahr zu Jahr etwas besser wird.
In diesem Jahr hat Enkil für die Familie ein Radio gekauft, abends sitzt die ganze Familie vor dem Gerät und hört die Nachrichten. In Äthiopien ist Krieg und jeden Tag sterben Menschen. In dem Krieg kämpfen die Anhänger Christi gegen die Anhänger von Mohammed, Gotteshäuser werden angezündet, Frauen entführt, Schulen geschlossen und Ernten vernichtet.
Enkil hört diese Nachrichten voller Angst und Sorge. Er hat Angst um seine Ernte und um das Leben seiner Familie. Er hat keine Waffe, er kann sich nicht verteidigen.
Heute ist die Hirse reif und soll geerntet werden. Die Familie von Enkil, seine Frau, die Großmutter und die Kinder, gehen mit Handsicheln bewaffnet auf das Feld und schneiden die Halme in gebückter Haltung knapp über dem Erdboden ab. Es ist eine mühsame und schwere Arbeit, schon nach einer halben Stunde schmerzt der Rücken, die Kinder fangen an zu quengeln und haben Durst.
Mit einer hölzernen Harke werden die frisch geschnittenen Hirsehalme zusammengetragen und mit Handflegeln gedroschen, die kleinen Hirsekörner fallen auf den harten, trockenen Boden und werden mit einem Handbesen zusammengekehrt. Jetzt liegen Millionen von kleinen Hirsekörnern auf kleinen Haufen.
Enkil nimmt eine flache Schaufel, mit der er die Hirsekörner in kleine Säcke schaufelt. Abends stehen fünfzig gefüllte Leinensäcke in Reih und Glied auf einem gummibereiften Ackerwagen. Sorgsam entfaltet Enkil eine gummierte Plane, um die kostbare Fracht abzudecken und vor Feuchtigkeit zu schützen. Die gefüllten Säcke will er morgen auf dem Markt verkaufen.
Abelka hat mit ihrer Mutter Injera zubereitet. Das Fladenbrot aus Hirseteig wird im Steinofen gebacken, bis der Teig braun wird und kleine Luftlöcher bildet. Dann wird das Brot zu einer langen Rolle gewickelt. Heute gibt es dazu einen Brei aus roten Linsen. Die schwere Feldarbeit des Tages macht durstig und hungrig, doch nun sind die Bäuche gefüllt und es schleicht sich die abendliche Müdigkeit in die Glieder. Die Familie legt sich auf das Strohlager in dem großen Raum neben der Kochstelle. Enkil und sein ältester Sohn Asari wollen morgen noch vor dem Sonnenaufgang aufstehen, um auf dem Markt in Goba ihre kostbare Ernte zu verkaufen.
Enkil sitzt neben seinem Sohn auf dem Ackerwagen, schnalzt mit der Zunge und lässt die Peitsche knallen, aber die beiden alten Wasserbüffel lassen sich nicht antreiben. In gemütlichem Zottelgang ziehen sie den Wagen mit den Hirsesäcken über den holprigen Feldweg, der mit ungezählten Windungen ins Tal führt, vorbei an kahlen Felsen, dann wieder entlang an grünen Kaffeewäldern. Hier wird der äthiopische Hochlandkaffee geerntet. Am Straßenrand liegen kleine Pakete mit frischen Kaffeebohnen, die in den Kaffeewäldern gepflückt wurden. Das Gebiet ist die grüne Lunge des Landes. Sie ist das Zuhause der beliebten Arabica-Kaffeebohnen. Uralte, hohe Wildkaffeesträucher bilden ganze Wälder und spenden Schatten gegen die Hitze des Tages. Die Sträucher hängen voll knallroter Beeren.
Die Wasserbüffel ziehen den Wagen durch tiefe Furchen, der lehmige Boden ist feucht und klebt an den schmalen Gummirädern des Ackerwagens. Wie ein riesiger Ball schiebt sich die glutrote Sonne über die östliche Bergkette. Die beiden Männer dösen auf ihrem Wagen mit herunterhängenden Köpfen, die Wasserbüffel folgen auch ohne ihr Zutun der Spur des Weges. Bisher ist ihnen niemand begegnet.
Asari wacht aus seiner Kutscherhaltung auf, reckt seine Arme in die Luft und dehnt seinen Körper. Er dreht seinen Kopf in Richtung Tal. Ist da nicht ein ungewohntes Geräusch? Jetzt ist er hellwach, er hört das Brummen von Motoren, schnell kommt es näher. Mit dem Ellbogen stößt er seinen Vater an, der beinahe vom Wagen fällt, doch schnell hat er sich gefangen.
Nun hören beide das schnell näherkommende Motorengeräusch. Enkil weiß aus Erfahrung, wie selten Autos diese abgelegenen Straßen befahren. Er wird nervös, schnalzt mit der Zunge und lässt seine Peitsche knallen, aber die Büffel gehen davon unbeeindruckt ihren Trott weiter und steuern die nächste Kurve an.
Plötzlich peitschen Schüsse durch die Luft, das Rattern eines Maschinengewehrs. Eine Salve, zehn, zwanzig Schuss. Enkil drischt mit seiner Peitsche auf die Wasserbüffel ein, endlich gehorchen sie und gehen in einen leichten Trapp über. Der Wagen bewegt sich schneller. Im selben Moment biegt ein Pickup um die nur dreihundert Meter entfernte Kurve und rast in hoher Geschwindigkeit auf sie zu, auf der Ladefläche sitzen fünf Männer mit Gewehren. Die Gesichter der Männer sind halb verdeckt, auf dem Kopf tragen sie ein zum Turban gewickeltes Tuch. Hals, Kinn und bei einigen auch der Mund sind ebenfalls durch ein Tuch verdeckt, die Augen verstecken sich hinter schwarz gefärbten Sonnenbrillen. Die Männer tragen Knobelbecher an den Füßen, einige von ihnen Gamaschen. Das schwarze Leder ist von dem gelbbraunen Staub, den das Fahrzeug aufwirbelt, dicht überzogen. Im Hochland ist es kühl, obwohl die Sonne scheint. Also tragen die Männer, vielleicht auch wegen des Fahrtwindes, warme Steppjacken über ihren Kampfanzügen. Eine der Jacken ist braun, eine andere grün und die nächste gelb. Es sind keine Soldaten, es ist ein zusammengewürfelter Haufen Banditen.
Die Straße ist schmal, Enkil reißt die Leine mit aller Kraft gegen seine Brust, um die Wasserbüffel zu stoppen. Das Fahrzeug rast direkt auf ihn zu. Die Wasserbüffel drücken ihre kräftigen Beine in den sandigen Boden, bleiben stehen und glotzen auf das entgegenkommende Auto.
Asari und Enkil wollen sich schon mit einem Sprung in den Straßengraben retten, als der Pickup sich vor ihnen mit einer Vollbremsung querstellt und direkt vor den Büffeln zum Stehen kommt. Zwei von den Männern springen von der Ladefläche und gehen mit ihren Gewehren im Anschlag auf sie zu. Die Männer unterhalten sich auf Amharisch. Asari und Enkil können nur Bruchstücke verstehen, sie sprechen Oromo. Sprechen wollen die Männer jedoch ohnehin nicht, sie machen mit den Gewehren eine eindeutige Bewegung. Absteigen. Dann springt einer von ihnen auf die Ladefläche und beginnt damit, die Säcke in Richtung Pickup zu werfen. Lachend fangen die anderen Männer die Säcke auf und legen sie ordentlich gestapelt auf den Pickup.
Enkil fängt an zu jammern und zu schreien, dann springt er auf die Ladefläche und will dem Mann einen Sack entreißen, im selben Moment schlägt der andere Mann seinen Gewehrkolben gegen Enkils Beine. Er stürzt auf die Ladefläche und sein Gesicht vergräbt sich in den Leinensäcken.
Noch mal Glück gehabt, durchfährt es ihn, doch nahezu zeitgleich trifft ein zweiter Gewehrkolben seinen Kopf und er bleibt bewusstlos zwischen den Säcken liegen. Das alles geschieht in wenigen Sekunden.
Asari will seinem Vater helfen, doch ein weiterer Mann drückt ihm seinen Gewehrlauf zwischen die Rippen und bedeutet ihm, abzusteigen. Asari zittert am ganzen Körper, mit schlotternden Beinen steht er von seinem Strohsack auf und klettert den Wagen herunter. Der Mann nimmt eine schwarze Kapuze aus der Tasche und stülpt sie über den Kopf von Asari, dann werden ihm die Hände auf den Rücken gebunden. Wieder unterhalten sich die Männer, Asari versteht kein einziges Wort.
Alles ist sehr schnell gegangen. Asari hockt jetzt zusammengekrümmt und verängstigt in der vorderen Ecke der Ladefläche des Pickups, der mit einem waghalsigen Tempo ins Tal fährt.
Den rechten Weg nennen wir das Tao: die Einheit.
Wenn wir beginnen, den Weg zu gehen,
nennen wir die Bewegung das Yang.
Die Bewegung geht über in die Ruhe,
wir nennen die Ruhe das Yin.
Yin und Yang
sind Prinzipien des Universums
und des Lebens,
sie wechseln sich ab und sie bedingen sich gegenseitig.
Asien
Waktu gejolak
Zeit des Aufruhrs
Wenn morgens die Sonne aufgeht, schimmert das Wasser in dem riesigen Becken vor der Moschee rotgolden. Die stille, unbewegte, blaugrün glänzende Wasserfläche spiegelt die fünf schwarzen Türme wider. Ati geht jeden Morgen tausend Schritte an dem Beckenrand entlang, strebt dem mittleren Eingang zu, geht mit dynamischen Schritten die sieben Stufen hinauf zum Haupteingang.
Die doppelflügeligen Eingangstüren stehen offen. Ati zieht seine Straßenschuhe aus und stellt sie sorgfältig zur Seite. Nachdem er Füße, Gesicht und Hände gewaschen hat, betritt er mit nackten Füßen den Gebetsraum. Er geht in die erste Reihe, dort rollt er den Gebetsteppich aus. Ati legt seine Hände auf die Knie, verbeugt sich in Richtung Mekka, berührt mit der Stirn den Teppich und spricht sein Morgengebet.
Beschwingt von seinem morgendlichen Ritual geht er über den Marktplatz, zu seinem Gewürzstand. Der Marktplatz ist auch der Vorplatz der Moschee. Die Marktstände stehen dicht an dicht und bilden ein Gewirr von schmalen Gassen, nur ab und zu unterbrochen von etwas breiteren Wegen, durch die, auf zweirädrigen Karren frische Waren angeliefert werden. Ati schlängelt sich leichtfüßig durch Wege und Gassen, immer wieder muss er tänzelnd anderen Händlern ausweichen, die ihre Waren zu den Marktständen tragen.
Hier riecht es nach Leben und Tod. Mal duftet es nach Gewürzen und dem erdigen Geruch von Gemüse und frischen Pflanzen. Mal liegt ein bestialischer Geruch von Blut und Eingeweiden toter Tiere in der Luft. Zwei Männer tragen getötete Gänse an einem Haken über der Schulter. Aus den Hälsen tropft das frische Blut auf den festgestampften gelben Lehmboden. Eine ältere Frau trägt mit der linken Hand einen schweren Sack mit grünen Kohlköpfen, in der rechten hält sie einen Korb, prall gefüllt mit Austernpilzen. Die Frau schlurft mit ihren Sandalen über den lehmigen Boden, bleibt an einem Stein hängen und stolpert Ati entgegen. Der breitet instinktiv seine Arme aus und fängt die fallende Frau auf, bevor sie ihre Ware zu Boden fallen lässt. Die beiden schauen sich verdutzt in die Augen, die Frau lächelt und deutet eine leichte Verbeugung an.
„Terima kasih – Danke.“
Ati lächelt mit seinen strahlenden Augen zurück, schon ist er weitergegangen. Zielsicher strebt er den leicht abfallenden Weg zum Hafen hinunter, schon hört er das Rauschen der Brandung, die stetig gegen die Kaimauer rollt. Hier am Meer verändern sich die Gerüche, es riecht nach Salzwasser und Fisch.
Vom Hafenbecken hallt das Geknatter der einlaufenden Fischerboote herüber, neben ihm preisen die ersten Händler schreiend ihre Waren an. Arbeiter und Arbeiterinnen laufen, vollbepackt mit frischen Waren, vorbei und verschwinden in den engen Gassen. Eine Horde Kinder drängelt sich durch das Gewühl, die Jungen schubsen und stoßen, einer beginnt zu laufen, die anderen rennen johlend hinterher.
Ati geht an der halbhohen Kaimauer entlang, ein Angler zieht mit großem Gejohle einen zappelnden Kugelfisch aus dem Hafenbecken. Die Marktstände stehen hier noch dichter gedrängt, einige sind noch geschlossen, die Waren abgedeckt, an anderen drängen sich bereits die ersten Kunden. Die Kaimauer macht einen großen Bogen, die leichten aus Bambusholz gebauten Marktstände gehen über in eine Passage mit festen Gebäuden, die sich zum Meer hin in eine Galerie öffnen.
Nur wenige Meter entfernt winkt eine junge Frau, es ist Asmara. Sie schiebt gerade die Fensterläden zur Seite, um ihren Tuchladen zu öffnen, Ati geht schneller.
„Asmara!“, ruft er bereits von weitem, „Asmara!“
Die schöne Asmara blickt Ati aus ihren mandelförmigen dunkelbraunen Augen an, ein strahlendes Lächeln huscht über ihr Gesicht.
„Hallo Ati, du bist heute spät dran“, sagt sie und dreht ihren schlanken Körper zu ihm herum.
„Ja, ja, das Morgengebet und das Gedränge, die alten Frauen und die Kinder. Alles läuft mir heute über den Weg, aber jetzt sehe ich dich und die Sonne geht ein zweites Mal auf.“
Immer noch machen Asmara die Komplimente von Ati verlegen. Sie fühlt sich geschmeichelt, eine leichte Röte steigt in ihr gebräuntes Gesicht. Sie rastet die Fensterläden ein und tut so, als würde sie die Auslage ihrer bunten Tücher neu sortieren. „Es ist ein schöner Tag. Ein Tag für gute Geschäfte. Komm doch nachher auf eine Tasse Tee vorbei.“
Ati wendet sich mit strahlendem Gesicht zu Asmara. „Ich freue mich, dich nachher zu sehen, bis dann.“
Er geht die zwanzig Schritte unter den Arkaden entlang, bis er seinen Gewürzstand erreicht hat. Sein Laufjunge Eko steht vor dem Gewürzstand an einen Holzpfeiler gelehnt und schaut gelangweilt den Fischern zu, die in großen Körben ihren Fang zum Fischmarkt tragen. „Hallo, Eko, schnell, schnell, öffne die Läden und deck schon mal die Waren ab, die ersten Kunden warten bereits.“
Ati öffnet das Schloss zu seinem Laden, geht zur Kasse, um sie ebenfalls zu entriegeln, und beginnt damit, die frisch angelieferten Säcke mit Kräutern in die Auslage zu stellen. Er holt die alte Balkenwaage mit den beiden Messingschalen aus dem Schrank, stellt sie auf ein kleines Holzpodest und legt daneben die Palette mit den Gewichten bereit, dann setzt er sich wie jeden Tag auf seinen Schemel, der hinter der Waage steht. Er sitzt jetzt in der Mitte weißer Leinensäcke, die prall gefüllt sind mit Gewürzen. Es riecht nach Sternanis, Gewürznelken, Koriander, Kardamom, Kreuzkümmel, Muskat, Safran, Liebstöckel und Zimt.
An diesem Vormittag sind die Geschäfte gut gelaufen. Ati zählt die Geldscheine und schmunzelt zufrieden.
„Eko, jetzt gibt es auch für dich etwas zu tun. Die Einnahmen waren gut, heute Abend werde ich Asmara zum Fischessen einladen. Hier hast du zweihundert Rupien, kaufe den besten Kabeljau, aber nur einen Jin und nicht mehr, eher etwas weniger. Nimm meine Kühltasche zum Aufbewahren. Schnell, schnell, bevor die beste Ware verkauft ist. Geh zu dem alten Raman. Du weißt schon, sein Boot liegt im alten Hafen in der zweiten Reihe. Dort, wo die kleine Hafenbar ist. Nun lauf schon, schnell, schnell.“
Eko macht sich auf den Weg zum alten Hafen, er geht durch die Kolonaden des Basars und dann immer an der halbhohen Kaimauer entlang. Eine Gruppe von zehn, zwanzig Möwen kreischt aufgeregt und sehr laut. Die Vögel zanken sich um einen noch zappelnden Fisch, der am Spülsaum liegt. Ein Fisch – nein, hier liegen viele Fische! Es sind hunderte Möwen, die sich über die verendenden Fische hermachen. Sie flattern aufgeregt hin und her, picken an den Fischen herum, werden von einer anderen Möwe gestört, flattern aufgeregt mit den Flügeln, steigen ein paar Meter in die Luft und stürzen sich auf den nächsten Fisch. Die Luft ist gesättigt vom Geschrei der Tiere.
Seltsam, wo kommen nur die vielen toten Fische her? Eko interessiert sich nicht dafür, er schlendert weiter, weicht den entgegenkommenden Menschen aus. So dicht am Fischmarkt wird das Gedränge immer größer. Auf der Kaimauer sitzen Frauen und flicken zerrissene Fischernetze, Hausfrauen mit leeren und vollen Körben streben den Marktständen zu oder sind auf dem Weg nachhause. Ein Marktaufseher in seiner blauen Uniform drängelt sich eilig an Eko vorbei, hinter ihm schiebt ein Mann einen zweirädrigen Karren, voll beladen mit Reissäcken.
Die Luft ist angefüllt vom Geschrei der Möwen, es riecht intensiv nach Salzwasser und toten Meerestieren. Eko hat eine empfindliche Nase und langsam wird der Geruch für ihn unerträglich.
„Einen Jin des besten Kabeljaus, nicht mehr, eher etwas weniger. Einen Jin Kabeljau, nicht mehr, eher etwas weniger.“ Gebetsmühlenartig murmelt Eko seinen Auftrag vor sich hin. Beinahe hätte er darüber die beiden Stufen vor dem Torbogen, der den Eingang zum Fischmarkt markiert, übersehen, doch geistesgegenwärtig hebt er seine Füße im letzten Moment an, weicht einer ihm entgegenkommenden Marktfrau aus und rempelt einen alten Mann an, der ihm entgegenkommt.
„Pass doch auf, Junge, hast du keine Augen im Kopf?“, schimpft dieser und verpasst Eko einen leichten Schubs, sodass er gegen die Kaimauer gedrückt wird. Für einen winzigen Moment spürt Eko den harten Druck der Steine an seiner Hüfte, doch schnell geht er weiter, bis zu einer Lücke in der Mauer, balanciert über einen schmalen Brettersteg zu den Booten. Die kleinen hölzernen Fischerboote dümpeln verlassen in dem trüben Hafenwasser.
Das Geschrei der Möwen wird nochmals um einige Oktaven höher, Eko hält sich mit beiden Händen die empfindlichen Ohren zu. „Einen Jin des besten Kabeljaus, nicht mehr eher etwas weniger, einen Jin Kabeljau, nicht mehr eher etwas weniger.“ Immer noch murmelt er seinen Auftrag vor sich hin, ist dadurch abgelenkt und übersieht den alten Mann, der schaukelnd auf dem Rand seines Bootes sitzt.
„Hallo, Eko, willst du zu mir?“ Eko blickt nach vorne, sieht den alten Mann auf seinem Boot. Es ist Raman.
„Hallo Raman.“ Eko betet seinen Auftrag herunter und wiederholt: „Raman, einen Jin Kabeljau, nicht mehr eher etwas weniger. Bitte den besten Kabeljau für meinen Herrn, er will Asmara zum Essen einladen.“
Raman, erhebt sich schwerfällig von der Bordwand seines Holzbootes und geht zu einem Korb mit toten Fischen, aus dem das Meerwasser noch auf die Schiffsplanken tropft.
„Schlechter Fang, leere Netze. Nur wenige Fische, ganz schlechter Fang.“ Der Alte murmelt die Worte in einem wirren Singsang immer wieder vor sich hin, dann wühlt er in der Kiste mit den toten Fischen und schließlich reicht er Eko einen kleineren Kabeljau. „Hier Junge, halte ihn frisch. Die Hitze ist heute unerträglich. Draußen auf dem Meer war es den ganzen Morgen windstill, das Wasser platt wie auf einem Teich, eine seltsame drückende Hitze. Keine Abkühlung. Habe ich in den letzten siebzig Jahren noch nie erlebt. Seltsam, seltsam und jetzt die ganzen toten Fische hier im Hafen angespült. Fangen schon an zu stinken. Schlechter Fang, leere Netze. Schlechter Fang, leere Netze.“ Der Alte murmelt es immer wieder in seinen schütteren grauen Bart, mühsam setzt er sich wieder auf die hölzerne Bordwand, seine trüben Augen starren an dem Jungen vorbei ins Leere. Eko gibt dem Alten die zweihundert Rupien und steckt den Fisch in die Kühltasche. Der alte Raman macht ihm Angst. Eko will zurück auf den Markt und Ati den Fisch bringen, nur schnell weg hier. Mit der gefüllten Kühltasche in der Hand balanciert der Junge über den wackeligen Steg, erreicht die Lücke in der Kaimauer und drängelt sich durch das Gewühl der Menschen, die dem Markt entgegenstreben.
Ohne dass der Junge es bemerkt hat, ist es plötzlich still geworden. Obwohl am Spülsaum immer noch tote Fischen liegen, haben sich die schreienden und zankenden Möwen in die Luft erhoben. Sie fliegen in großen Schwärmen landeinwärts. Jetzt liegen die Fische im Dreck des Hafenbeckens, das Wasser ist zurückgegangen, die ersten Fischerboote sind bereits trockengefallen und kippen zur Seite.
Die Sonne strahlt von einem wolkenlosen Himmel, es ist drückend heiß, kein Windzug bringt Abkühlung. Das Gedränge auf dem Markt hat nachgelassen, die Menschen suchen Schutz vor der Sonne, sitzen unter den Arkaden, ziehen sich in die kleinen Bars und Kneipen zurück, die sich rund um den Hafen angesiedelt haben.
Eko hat die schwere Kühltasche mit beiden Händen gepackt und trägt sie vor sich her. Immer wieder wechselt er die Halteposition, denn die große Tasche behindert ihn beim Gehen. Er legt eine Pause ein, lehnt sich gegen die halbhohe Kaimauer und blickt auf das Meer. Warum sind die Boote zur Seite gekippt? Wo ist das Wasser geblieben? Der Hafen ist eine große Sandgrube, in der riesige Mengen von stinkendem Müll lagern. Jetzt bleiben die ersten Menschen stehen und blicken mit staunenden Augen auf das leere Hafenbecken. Für einen Moment ist es still geworden, als würde die Stadt den Atem anhalten, dann fangen die Ersten an zu schreien.
„Sunami sedang! Sunami sedang!“
Wild schreiend laufen die Menschen durcheinander, für einen Augenblick ist keine Richtung auszumachen, dann kanalisiert sich das Gewühl. Alle streben in Richtung Stadt, den leicht ansteigenden Hügel empor, schnell weg vom Hafen, weg vom Meer.
Eko zuckt zusammen. Der Schreck fährt ihm durch alle Glieder, seine dünnen Beine fangen an zu zittern. Sunami sedang. Noch nie hat er einen Tsunami erlebt, aber er kennt die Erzählungen, es bleibt keine Zeit zum Nachdenken.
Obwohl er an der Kaimauer steht, wird er von der Menschenmenge mitgerissen. Mit beiden Händen umklammert er die Kühltasche, will sie nicht loslassen, doch sie entgleitet seinen Händen, fällt zu Boden und wird von vielen Füßen in den Lehm getreten. Der Menschenstrom reißt ihn mit, er hat keinen Einfluss auf die Richtung.
Draußen auf dem Meer, noch weit entfernt, aber schon sichtbar, türmt sich eine riesige Welle auf. Erst hat der Sog das Hafenbecken geleert, jetzt kommt das Wasser mit der Riesenwelle zurück. Einige Boote sind noch draußen, jetzt kentern sie, werden unter der Riesenwelle begraben. Masten kippen, Holz zersplittert, Seeleute gehen schreiend in den Fluten unter.
Die Welle kommt schnell näher, prallt gegen den Leuchtturm am äußersten Ende der Mole und begräbt ihn unter sich. Die Riesenwelle reißt die Kaimauer in tausend Stücke, sie begräbt die ersten, schreienden Menschen unter sich. Das Holz der Marktstände splittert. In Sekunden reißt die Welle alles mit, was sich ihr entgegenstellt, nichts kann standhalten.
Eko wird von dem Menschenstrom in Richtung Moschee getragen. Er ist klein, seine Glieder sind beweglich, er passt sich der Bewegung der Menge an, spürt nicht die Stöße und Quetschungen, die sein Körper erleidet. Es geht alles so schnell. Die tausend Kehlen der Menge vereinigen sich in einem Schrei der Verzweiflung. Vom Hafen her dringt das Geräusch von splitterndem Holz, darunter mischen sich gurgelnde Schreie von Ertrinkenden.
Eko wird vom Menschenstrom in die Moschee getragen. Die Riesenwelle hat den gesamten Marktplatz verwüstet, jetzt knallt sie gegen die breiten Steinmauern der Moschee, die Wände sind wie ein Wellenbrecher im Chaos. Auf einmal steht Eko bis zum Hals im Wasser, dann drückt die Welle seinen Kopf gegen einen Mauerpfeiler, vor seinen Augen wird es dunkel, er sinkt auf die Knie und fällt zu Boden.
Stürmisch näherte sich der Stier
der schönen Europa,
sie zähmte ihn
und ritt auf seinem Rücken
in eine bullische Zukunft.
Europa
Sinnenfroh
Wotan ist ein breitschultriger Riese mit kräftigen Armen. Auch an den von seiner Kleidung verdeckten Stellen ist seine Haut tätowiert, sein ganzer Körper hat die Eigenschaften einer unbekannten Landschaft, er will entdeckt werden. Das volle, lange graue Haar hat er streng nach hinten gekämmt und zu einem Zopf zusammengebunden, den grauschwarzen Bart trimmt er jeden Tag. Sehr penibel beschneidet er die störrischen Haare, wenn sie über seine Lippen wachsen wollen. Seltsam, dass ihn die unzähligen Piercings in seinen Lippen, der Zunge, der Nase und den Ohren nicht stören. Nur wenige Menschen kennen die anderen Stellen seines Körpers, an denen sich blank poliertes Metall verbirgt. Wotan trägt den schwarzen Umhang der Raver. Um seinen Hals hängt eine lange silberne Kette, auf dem runden Medaillon ist ein Totenkopf mit gekreuzten Beinknochen eingeprägt. Jeder seiner Finger ist beringt, er liebt es immer wieder andere Ringe zu tragen: Totenköpfe, Ringe mit riesigen glitzernden Steinen, blau, rot, grün und gelb.
Heute Nacht steht Wotan an der härtesten und an der besten bewachten Tür der Stadt, deshalb trägt er an der linken Hand die Totenkopfringe und an der rechten die Faustschnalle. Jeden Abend stehen hier Hunderte junge Frauen und Männer in der Warteschlange und wollen eingelassen werden. Nicht jedem wird Einlass gewährt, viele stehen stundenlang in Regen und Kälte, und wenn sie dann endlich bis vor die Tür kommen, blickt ihnen Wotan tief in die Augen und schüttelt unmerklich seinen Kopf. Wer dieses Zeichen nicht versteht oder zu spät reagiert, wird von starken Händen gepackt und zur Seite geschoben. Sich dagegen zu wehren, ist zwecklos, die zupackenden Arme sind zu stark.
Heute genießen Emma und Ben sein Wohlwollen. Niemand weiß, warum. Freudig, aber auch ängstlich gehen sie an Wotan vorbei und stehen vor der imposanten mit Eisenringen beschlagenen Eingangstür. Vor ihnen öffnet sich die schwere breite Tür und schwenkt von hydraulischen Zylindern gezogen nach innen, bis sie hart gegen einen Anschlag knallt. Wie auf einer Woge, die sich im schnellen Tempo nähert, schwappt ihnen der Rhythmus entgegen. Er fährt unter die Haut und von unsichtbarer Hand gesteuert beginnen sich die Körper von Emma und Ben im Gleichklang der Musik zu bewegen.
Der Vorraum, den sie betreten, ist riesig, die Wände sind aus gegossenem grauem Beton. Im Fußboden eingebaute Strahler zeichnen eine streng begrenzte Linie aus weißem Licht an die kahlen Wände, die Decke wird von dem Lichtstrahl nicht erfasst, sie ist zu hoch.
Emma und Ben streifen sich die Kapuzen vom Kopf, schütteln ihre langen gewellten Haare, legen ihre durchnässten Jacken in eine der sich selbst öffnenden Schubladen, aus denen ihnen eine angenehme Wärme entgegenströmt.
Der Rhythmus ist lauter geworden, er schallt aus den Raumecken und bricht sich an den glatten Betonwänden. Die Bässe springen nun deutlich hervor, sie erfassen nicht nur ihre Körper, sondern nisten sich langsam, aber stetig im Gehirn ein.
Plötzlich erwacht die hohe Decke über ihnen aus der Dunkelheit, Schallwellen zerschneiden die Schwärze und malen farbige Lichtspuren auf den grauen Beton, Nebel bildet sich an der weit entfernten Decke und fällt in grauen Schwaden zu Boden. Die Musik hämmert gegen ihre Körper, die nicht anders können als sich tanzend zu dem grell leuchtenden Rechteck im Raum zu bewegen. Die Riffs versetzen den Körpern Peitschenschläge und lassen sie mit zuckenden Bewegungen auf das erleuchtete Rechteck zugehen.
Die Eingangstür zur großen Halle gleicht einer gleißende Lichtinstallation, die sich im Rhythmus der Musik leuchtend auf und ab bewegt. Ist sie real, oder ist sie eine Erscheinung wie die hämmernde Musik in ihren Köpfen? Als sie den Lichtvorhang durchschreiten, nimmt die Intensität der Musik nochmals zu, jetzt ist sie nicht nur spür- und hörbar, sie kriecht von außen nach innen, erobert jeden Muskel, jede Blutbahn, jede Synapse im Gehirn. Die Musik ist Schwingung. Die Arme, die Beine, der Kopf, der Körper, alles ist Schwingung.
Sie haben das Heilige, das Innere, die Kathedrale betreten. Jetzt verschmelzen ihre Körper mit der zuckenden, atmenden, pulsierenden Menschmaschine, von der sie angezogen und abgestoßen werden, in die sie sich fallen lassen und der sie sich hingeben. Sie ist überall. Die Menschmaschine bewegt sich pulsierend, die Musik bewegt die Maschine, oder ist es umgekehrt? Niemand weiß das so genau. Es ist wie beim Echo, irgendwann kann man den Rufer nicht mehr vom Echo unterscheiden. Im Rausch verlieren sich Emma und Ben aus den Augen, verlieren ihr Selbst und werden Teil der Körpermasse.
Die Körpermasse ist heiß, zu heiß. Emma öffnet die oberen Knöpfe ihrer weißen Bluse, sie spürt ihre Brüste, spürt, wie die Brustwarzen anschwellen und sich vergrößern. Kalte Schauer ekstatischer Verzückung rasen durch ihren Körper, durch alle Körper. Die Körpermasse ist überall. Körper reiben sich aneinander, dicht gedrängt, unglaublich dicht. Es gibt kein entweichen. Jeder wird durch die Musik, sich selbst und die anderen bewegt. Alles verwandelt sich in Ekstase, Fantasie, Ganzheit, Einklang und Harmonie.
Stunden vergehen, die Rhythmen wiederholen sich nicht, sie sind immer wieder neu, aber ähnlich. Emma spürt jetzt ihre Erschöpfung, sie schwitzt aus allen Poren, die Muskeln ihrer Beine sind weich und kraftlos. Sie weiß nicht, ist es ihr Schweiß oder der Schweiß der Körpermasse, der an ihr klebt.
Mit schlaffen Beinen stolpert sie gegen andere Körper, es drängt sie zu der blauen Lichtinstallation auf der anderen Seite des Saals. Langsam bewegt sie sich in Richtung des blauen Lichtes, immer wieder drückt sie gegen die Körpermasse, die gibt nach wie eine Membran, nimmt sie auf und bewegt sich dann doch wieder auf der Stelle. Mit einer leichten Eigenschwingung steuert sie ihr Ziel an, es dauert eine ganze Weile, bis sie die blaue Wand erreicht hat.
Ben wartet schon auf sie. Er breitet seine Arme aus und umschlingt Emma, als wollte er sie in seinen Körper hineinziehen. Emma schmiegt sich schweißnass an Ben und gibt ihm einen langen intensiven Kuss mit ihren glänzenden feuchten Lippen, sie ist erschöpft und kann kaum auf den eigenen Beinen stehen. Sie spürt ihre Erschöpfung überdeutlich, jetzt erst merkt sie, wie sehr die Körpermasse ihr Kraft und Halt gegeben hat. Sie klammert sich an Ben, der sie mit seinen starken Armen festhält. Er schaut sie mit erstaunten Augen an, auf ihrer schneeweißen, schweißnassen Bluse sind dunkelrote Spritzer. Er drückt sie fester an sich, ohne etwas zu sagen, ganz nah, ganz bei ihr.
Nachdem sie neue Kraft geschöpft haben, gehen Emma und Ben Hand in Hand die breite Treppe zur Panorama- bar hinauf. Immer wieder werden ihre Blicke von der pulsierenden Menschmaschine angezogen, die sich unter ihnen im Hauptschiff der Kathedrale wie ein lebender Organismus im Rhythmus der Musik aufbläht und zusammenzieht. Das Laserlicht durchschneidet den hohen Raum und taucht ihn in dunkelrotes Licht. Jetzt sieht die Menschmaschine aus wie ein blutiges pulsierendes Herz, das ohne Unterlass pumpend die Körper anzieht und abstößt. Die beiden haben den oberen Absatz der Treppe erreicht, Emmas Herz pumpt ihr Blut hämmernd gegen ihre Halsschlagader, sie ist erschöpft. Die vielen Treppenstufen haben sie angestrengt, sie ringt nach Luft und lässt sich von Ben nach oben ziehen.
Die Panoramabar ist in dunkelrotes Licht getaucht. Der von innen beleuchtete Bartresen pulsiert im Rhythmus der Musik, auch er scheint ein lebender Organismus zu sein. Die Menschen stehen dicht gedrängt, eingehüllt in schwarze Kleidung, einige haben ihre Kapuzen eng über den Kopf gezogen. Die Gesichter sind bleich und fahl, nur die Lippen sind blutrot. Im Zwielicht sind sie das einzige, gut erkennbare Körpermerkmal. Der allgegenwärtige Rhythmus wird jetzt untermalt durch ein stetes Gemurmel vieler Stimmen. Wenn man dicht nebeneinandersteht, lassen sich die Worte deuten, ein Wort wird immer wieder genannt: „Die Seuche.“
Ben bestellt zwei Red Snapper, der Barkeeper lächelt ihm verständnisvoll zu, fügt verschiedene Zutaten in ein silbernes Gefäß und beginnt, im Rhythmus der Musik zu schütteln, dann leert er den Inhalt in zwei halbhohe, dickwandige Gläser. Der Inhalt leuchtet blutrot im Licht der Barbeleuchtung. Der Barkeeper schlitzt mit einem spitzen Messer eine Chilischote längs auf, steckt sie mit dem grünen Stiel auf den Glasrand, und schiebt die Gläser über den Tresen: „Cheers.“
Ben reicht Emma das Glas herüber, sie schauen sich verliebt in die Augen und prosten sich zu. Während Ben die rote Flüssigkeit in sich hineinschüttet, nippt Emma genüsslich an ihrem Glas. Ihre rot geschminkten Lippen hinterlassen einen dunkelroten Halbkreis auf dem Glasrand.
Als Ben sich zu ihr hinüberbeugt, bemerkt er, dass die roten Flecken auf ihrer Bluse größer geworden sind. „Emma, du blutest“, schreit er sie an.
Emma fährt zusammen, als würde jemand einen Dolch in ihren Unterleib rammen. Die schrille Stimme von Ben hat jäh die entspannte Atmosphäre zerstört. Bens Finger betasten die roten Flecken auf der Bluse, es ist zweifellos Blut. Emmas Blick geht zu den tastenden Fingern von Ben, folgt seinen Fingerbewegungen und erkennt die roten Flecken, die sich in vielen kleinen Punkten auf die weiße Bluse verteilen, als seien sie gewollte Punktmuster auf schneeweißem Grund. „Ich weiß nicht, wo das herkommt“, schreit sie. „Jemand von den Infizierten muss mich berührt haben.“
In den letzten Tagen hat es immer wieder Berichte von einer Seuche gegeben, die sich über Europa ausbreitet. Sie hat im Süden begonnen, ist in wenigen Tagen bis nach Norden vorgedrungen. Die Menschen bluten aus Mund, Nase und Ohren.
Zunächst beginnt es harmlos, die Menschen wachen morgens auf, gehen ins Badezimmer, schnäuzen sich die Nase und haben Blut im Taschentuch - nicht so schlimm. Sie putzen sich die Zähne und haben Blut an der Zahnbürste kommt ja mal vor.
Sie beginnen ihre täglichen Dinge zu erledigen, aber das Bluten wird schlimmer. Immer wieder blutet die Nase, der Speichel ist mit Blut vermengt, das Bluten wird stärker, schließlich bluten sie auch aus den Ohren. Die Menschen fühlen sich schwach, der Blutverlust macht sich bemerkbar, die Blutungen sind nicht mehr zu stillen. Viele sterben, bevor sie einen Arzt aufsuchen können.
Ben drückt Emma mit beiden Armen fest an sich. Er hat Angst, sie haben Angst. Ben will Emma trösten, gerade noch war die Stimmung gelöst, jetzt kriecht ein grauer Schleier durch den Raum und legt sich über die Gemüter. Ben drückt Emma fester an sich, ihr Gesicht liegt in seiner Halsbeuge, er spürt ihre feuchten Augen, doch dann löst sie sich von ihm und sagt: „Now you can call me bloody Emma”.
Ben kann sein Lachen nicht unterdrücken, er prustet los und schlägt sich auf die Schenkel. Schwarzer Humor, denkt er und drückt Emma einen Kuss auf die Wange.