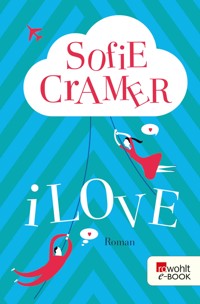4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautorin Sofie Cramer verbindet in ihrem neuen Roman die Themen Selbstfindung und Landlust: zwei sympathische Frauenfiguren mit viel Identifikationspotential, eine idyllische Kulisse und eine charmante Liebesgeschichte. Valerie steht kurz vor einem Burnout, als sie von ihrer Chefredakteurin auf Recherchereise geschickt wird. Das Thema: «Pilgern vor der eigenen Haustür – Selbstfindung pur?». Widerwillig macht sich die Journalistin auf den Heidschnuckenweg südlich von Hamburg – und hat bereits nach wenigen Tagen genug von Rückenschmerzen und geschundenen Füßen. In einer kleinen Pension am Rande des Naturschutzgebietes legt sie eine Pause ein. Die rüstige Besitzerin Annegret erkennt Valeries grundsätzliche Erschöpfung und bringt ihr mit Hilfe eines Bienenzüchters die Natur näher: Honig schleudern, Brot backen und Fliederbeersaft herstellen ... Aber Valerie ahnt, es braucht noch mehr, um zu sich selbst zu finden - und zum kleinen, großen Glück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sofie Cramer
Honigblütentage
Roman
Über dieses Buch
Bestsellerautorin Sofie Cramer verbindet in ihrem neuen Roman die Themen Selbstfindung und Landlust: zwei sympathische Frauenfiguren mit viel Identifikationspotenzial, eine idyllische Kulisse und eine charmante Liebesgeschichte.
Valerie steht kurz vor einem Burnout, als sie von ihrer Chefredakteurin auf Recherchereise geschickt wird. Das Thema: «Pilgern vor der eigenen Haustür – Selbstfindung pur?». Widerwillig macht sich die Journalistin auf den Heidschnuckenweg südlich von Hamburg – und hat bereits nach wenigen Tagen genug von Rückenschmerzen und geschundenen Füßen. In einer kleinen Pension am Rande des Naturschutzgebietes legt sie eine Pause ein. Die rüstige Besitzerin Annegret erkennt Valeries grundsätzliche Erschöpfung und bringt ihr mit Hilfe eines Bienenzüchters die Natur näher: Honig schleudern, Brot backen und Fliederbeersaft herstellen … Aber Valerie ahnt, es braucht noch mehr, um zu sich selbst zu finden – und zum kleinen großen Glück.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Umschlagabbildung Olga_Ionina,kobeza/shutterstock
Umschlaggestaltung ZERO Werbeagentur, München
ISBN 978-3-644-40473-1
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Die eigentlichen Entdeckungsreisen bestehen nicht im Kennenlernen neuer Landstriche, sondern darin, etwas mit anderen Augen zu sehen.»
Marcel Proust
Tag 1
Das geht ja gut los! Meine Reise hatte noch nicht einmal richtig begonnen, und schon war mir nach Aufgeben zumute. Vor dem Schloss in Celle musste ich mir einen Weg durch eine Traube schöner Menschen bahnen, die offensichtlich auf ein Brautpaar warteten. Und ich steckte mittendrin, mit schwerem Outdoor-Rucksack und hochrotem Kopf.
Und meine Blase drückte. Wieso nur hatte ich auf der Bahnfahrt von Hamburg auch diesen riesigen Latte Macchiato getrunken? Es war ja klar, dass ich gleich nach dem Aussteigen dringend aufs Klo musste. Die öffentlichen Toiletten am Bahnhof waren noch nicht geöffnet gewesen an diesem frühen Montagmorgen.
Seltsam, dass sich um diese Uhrzeit schon so viele Hochzeitsgäste versammelt hatten. Jedenfalls nahm ich an, dass sie für eine Trauung hier waren. Die Frauen trugen schicke Kleider und Hüte, die Männer gutsitzende Anzüge.
Hilfesuchend blickte ich mich nach einem Hinweis auf ein Klo um. Denn ich konnte mich wohl kaum in aller Öffentlichkeit hinter einen der zahlreichen Bäume hocken. Langsam kroch Panik in mir hoch. Wenn dieser verdammte Rucksackgurt nicht auch noch so drücken würde …
Also in Richtung Fußgängerzone. Ich war das erste Mal in Celle, aber allein schon, weil Tessa, meine Chefredakteurin, so von der Altstadt geschwärmt hatte, beschloss ich die Stadt nicht zu mögen. Auch wenn der Schlossplatz mit seinem großen parkähnlichen Gelände, umrahmt von Wassergräben, eigentlich hübsch anzusehen war.
Trotz meines fast zwölf Kilo schweren Gepäcks ging ich eilig über die Straße in Richtung Innenstadt. Sofort begann ich wieder zu schwitzen und spürte, wie meine Wangen glühten.
Endlich, hinter der zweiten Straßenecke fand ich ein Café, vor dem zwei Kellnerinnen gerade Stühle für das beginnende Tagesgeschäft bereitstellten.
«Entschuldigen Sie, dürfte ich vielleicht mal …», begann ich zaghaft und wurde sogleich unterbrochen.
«Durch den Gang und dann links», rief mir die ältere der beiden Damen zu.
Ich nickte dankbar, betrat das kühle, etwas plüschig eingerichtete Café und flitzte den Gang entlang. Umständlich quetschte ich mich mitsamt dem Rucksack auf die Toilette, weil ich es sonst einfach nicht länger ausgehalten hätte.
Puh!
Am liebsten wäre ich einfach sitzen geblieben und hätte mich die nächsten vier Wochen hier im Café versteckt. Denn schon der Gedanke an die bevorstehende Strecke ließ mich erschaudern: über 200 Kilometer zu Fuß, mit schwerem Gepäck und ohne WLAN. Ein totaler Irrsinn!
«Das ist genau das Richtige für dich», hatte Tessa vor einigen Wochen in der Redaktionssitzung befunden. Die Blicke aller Kollegen hatten sich erwartungsvoll auf mich gerichtet. Ich konnte zwar ganz gut schreiben, war aber in der direkten Kommunikation meist nicht besonders schlagfertig. Deshalb hatte ich leider nichts Verwertbares erwidern können – und hatte nun diesen absolut schwachsinnigen Auftrag am Hals. Oder besser gesagt an den Hacken. Pilgern vor der Haustür sollte meine Reportage heißen. Laut Tessa ein echtes Trendthema. Dafür sollte ich den angeblich schönsten Wanderweg Deutschlands gehen, den Heidschnuckenweg – von Celle quer durch die Lüneburger Heide bis zurück nach Hamburg. Und wenn es nach Tessa ging, sogar bis vor die Tür der Redaktion. Caro hatte mich mit großen Augen angestarrt und mir später zugeraunt, dass das Angebot doch ziemlich ungewöhnlich sei angesichts des allgemeinen Sparzwangs auf dem Printmarkt und ich deshalb keine Wahl hätte. Dreißig Tage gewährte Tessa mir für die Reise und bis zur Abgabe meines Berichts. Trotzdem hätte ich liebend gern auf diese Erfahrung verzichtet.
Es war außerdem der denkbar schlechteste Zeitpunkt, jetzt nicht zu Hause zu sein, dachte ich, als ich die Toilette verließ und in den mit zahlreichen Geranien bepflanzten Hinterhof des Cafés trat. Ob ich mir hier unauffällig mal die klobigen Schuhe ausziehen konnte? Die Behauptung stimmte wohl: Man musste Wanderschuhe einlaufen.
An einem schattigen Tisch setzte ich ächzend den Rucksack ab und ließ mich auf einen Stuhl fallen. Die jüngere Kellnerin kam heraus, um nach meiner Bestellung zu fragen.
«Äh … Könnte ich einfach nur einen frisch gepressten O-Saft bestellen?», fragte ich schuldbewusst. Ich wollte die Toiletten nicht ohne Gegenleistung benutzen.
«Gerne, kommt sofort!» Sie verschwand wieder im Inneren des Cafés.
Anstatt mir sofort die Schuhe von den Füßen zu streifen, kramte ich erst mal mein Handy hervor. Dabei stieß ich auch auf mein kleines Notizbüchlein, das ich mir unterwegs besorgt hatte. Ich legte es auf dem Tisch ab und blickte neugierig aufs Display. Ob Frieda sich schon gemeldet hatte? Im selben Augenblick erschien es mir reichlich absurd. Sie war schließlich noch in der Schule und hatte gar kein Handy dabei. Wenigstens in diesem Punkt konnte ich mich zu hundert Prozent auf meine Tochter verlassen. Zwar war sie im besten Teenageralter, aber sie würde nie eine Schulregel brechen, auch das Handyverbot nicht. Aber ich war nervös, weil sie heute zwei wichtige Zeugnisnoten erfahren würde. Und ich fragte mich, ob sie und Simon während meiner Abwesenheit allein zurechtkamen.
Es fiel mir wirklich nicht leicht, loszulassen. Zumal heute auch noch die neue Ausgabe unseres monatlichen Magazins Feel feminine erschien. Zu diesem Anlass kam immer die gesamte Redaktion zusammen, um sich der Blattkritik zu stellen. Dieser Termin war allseits gefürchtet, weil Tessa immer etwas zu beanstanden hatte. Trotz stabiler Verkaufszahlen blieb die Branche angespannt, weil kein Anzeigenkunde und damit auch kein Job mehr sicher war. Von außen betrachtet war alles Hochglanz, einschließlich unseres verspielten, aber hochwertigen Layouts und des imposanten Verlagsgebäudes in der Hafencity. Doch hinter den Fassaden regierten Rotstift und Ellenbogen. Schon vier enge Kolleginnen hatte ich in den vergangenen zwei Jahren gehen sehen. Meine Freundin Caro, mit der ich mir seit Jahren das Büro teilte, sagte immer, ich solle keine Perlen vor die Säue werfen und mich nicht länger für die Feel feminine prostituieren, sondern als freie Autorin Romane oder Kinderbücher schreiben. Dabei wusste doch jeder, dass es dem Buchmarkt mindestens genauso schlecht ging wie dem Zeitschriftenmarkt. Natürlich träumte ich wie die meisten Redakteure heimlich von einem Bestseller. Und von einem verwunschenen Ort zum Schreiben, an dem ich ganz für mich sein konnte. Doch das war eben nur ein Traum. Nicht mehr und nicht weniger.
Und deswegen schrieb ich weiter für Tessa über aktuelle Kulturtipps und neue Entschleunigungstrends. Einfach, weil ich nichts anderes konnte. Weder konnte ich mit Zahlen etwas anfangen, noch hatte ich eine besondere Begabung oder Spezialwissen auf einem bestimmten Gebiet. Mir fehlte das Händchen fürs Backen und das Näschen fürs Kochen. Meine Welt als Lifestyle-Redakteurin bestand aus Zeilen und Deadlines und leicht verdaulichen Themen zur Entfaltung der weiblichen Persönlichkeit. Die vielen Interview- und Recherchetermine ließen mir gar keine Zeit für ein Hobby. Und ich hatte meines ohnehin zum Beruf gemacht. So gesehen war der Heidschnuckenweg vielleicht doch eine gute Gelegenheit, um im wahrsten Sinne mal rauszukommen und etwas anderes zu sehen.
«Hier kommt eine gesunde Stärkung für den Weg», sagte die nette Kellnerin, als hätte sie meine Gedanken gelesen. «Sie wollen doch Schnucken gucken?»
Ich lächelte sie dankbar an, als sie mir das gutgefüllte Glas hinstellte.
«Wollen Sie den ganzen Weg laufen?»
Ich nickte zaghaft. «Etwa 15 Kilometer habe ich mir pro Tag vorgenommen. Keine Ahnung, ob das realistisch ist.»
Das hatten Caro und ich jedenfalls grob überschlagen: vierzehn Tage wandern und zwischendurch vierzehn weitere Tage, um meine Eindrücke aufzuschreiben. Allerdings sah mein geheimer Notfallplan vor, Abkürzungen einzubauen und auf die letzte Etappe bis zum Ziel zu verzichten. Schließlich wollte ich in Hamburg, wo ich seit mehr als einem Jahrzehnt zu Hause war, ganz sicher niemandem begegnen. Es wäre doch auch vollkommen sinnlos, durch mir bereits vertraute Gegenden zu latschen. Für alles andere gab es zur Not auch Google Maps. Und das Internet lieferte mir ohnehin alle erdenklichen Infos, da musste ich nun wirklich nicht bis in die Hafencity laufen.
«Freuen Sie sich drauf», sagte die Kellnerin mit einem warmherzigen Lächeln. «So eine Wanderung kann das ganze Leben verändern.»
«Ach ja?» Fragend sah ich sie an.
«Ich bin den Heidschnuckenweg mal von Hamburg aus gegangen und dann hier gestrandet.» Ihr hübsches Gesicht wurde von beneidenswerten Locken in Rotblond umrahmt.
«Sie kommen auch aus Hamburg?», fragte ich erstaunt, als könnte man sich freiwillig für die Provinz entscheiden.
Doch die Frau bejahte und erklärte, sie habe schon etliche Touren quer durch Europa unternommen. «Mit einer Freundin zusammen bin ich sogar den Jakobsweg gegangen. Aber wirklich bei mir angekommen bin ich erst, als ich allein direkt aus Ottensen losgelaufen oder besser gesagt weggelaufen bin. Danach habe ich mein Studium abgebrochen, mein WG-Zimmer untervermietet, und jetzt jobbe ich hier erst einmal eine Saison durch.»
Nach dem Beginn einer ganz großen Karriere klang das nicht gerade. Trotzdem: Wäre es nach Tessa gegangen, hätte ich auch direkt von zu Hause aus loslaufen sollen, dachte ich etwas beschämt. Doch der umgekehrte Weg war mir sinnvoller erschienen, weil ich mich dann mit jedem Tag meinem gewohnten Leben näherte.
«Ich mache das eigentlich nur zu Recherchezwecken.» Ich suchte nach den richtigen Worten. «Ich hoffe, ich werde überhaupt durchhalten. Mir ist eher nach Entspannung in einem Wellnesshotel …»
Die junge Frau grinste und setzte sich kurzerhand mir gegenüber an den Tisch. «Haben Sie was zum Schreiben?» Ihre leuchtend grünen Augen versprühten pure Lebensfreude. «Dann gebe ich Ihnen die Adresse einer sehr süßen Unterkunft, direkt am Naturschutzgebiet. Und auch meine Nummer, wenn Sie wollen. Vielleicht brauchen Sie unterwegs ja noch mal den einen oder anderen Tipp. Zum Durchhalten.»
Ich nickte etwas überrumpelt und reichte ihr einen Stift und das kleine Notizbuch.
«Falls Sie dort Rast machen, grüßen Sie die Gastgeberin von mir!» Nachdem sie in schöner Handschrift ihre Nummer und die Anschrift von Haus Annegret notiert hatte, sagte sie: «Ich bin übrigens Jana.»
«Ich bin Valerie», entgegnete ich und reichte ihr die Hand. Dann bezahlte ich den O-Saft mit reichlich Trinkgeld und griff nach meinem Handy.
«Soll ich schnell noch ein Foto machen?», fragte Jana. «Ist doch ein feierlicher Moment, so kurz vor der ersten Etappe.»
Ich wollte schon dankend ablehnen, musste aber an Tessas mahnende Worte denken, auch ja genügend Bilder mitzubringen. Womöglich wollte sie sichergehen, dass ich auch wirklich recherchierte und mir nicht bloß vier Wochen lang die Sonne auf den Bauch scheinen ließ. Also nahm ich das freundliche Angebot an und lächelte tapfer in die Kamera.
Ohne das sicher ernüchternde Ergebnis eingehender zu betrachten, steckte ich das Handy weg und setzte den Rucksack wieder auf, wobei ich ein leises Stöhnen nicht unterdrücken konnte.
«Der Anfang ist immer mühsam.» Mitfühlend sah Jana mich an. «Eine wundervolle Reise wünsche ich!»
«Danke.» Ich drehte mich noch einmal um und winkte zum Abschied, ehe ich nach draußen trat.
In der Zwischenzeit hatte sich die Luft spürbar aufgeheizt und die Fußgängerzone gut gefüllt. Alle Passanten schienen ein klares Ziel vor Augen zu haben. So wie ich es wohl auch haben sollte. Allerdings fand ich noch nicht einmal den Ausgangspunkt des Weges, der eigentlich direkt am Schloss beginnen sollte. Die Strecke sei super ausgeschildert, hatte ich im Internet gelesen, und mittlerweile so was wie ein Hot Spot unter Wanderern.
Doch was für Menschen wie Jana und sicher viele andere eine wahnsinnig inspirierende Auszeit bedeuten mochte, war für mich der reinste Horrortrip. Trotz meiner dreiundvierzig Jahre war ich zwar eigentlich ganz gut in Form. Guten Genen, Pilates und gelegentlichem Joggen an der Alster sei Dank. Aber Wandern durch die Walachei war einfach nicht mein Ding. Dafür hatte ich viel zu viel im Kopf. Die Streitereien mit Simon zum Beispiel oder die Herausforderungen mit unserer Tochter sowie die ewigen Auseinandersetzungen mit meiner Mutter. Sicher hätte sie jetzt gesagt, ich hätte mich besser vorbereiten sollen auf diese Reise.
Ich kam mir jedenfalls ziemlich dämlich vor in meinen drückenden Wanderschuhen und mit dem großen Rucksack, als ich wieder verloren auf dem weitläufigen Schlossplatz stand. Statt eines Wegweisers entdeckte ich nur ein silberfarbenes, mit weißen Rosen geschmücktes Käfer-Cabriolet. Der Fahrer stieg aus und öffnete dem Brautpaar, das hinten auf der Rückbank saß, die Tür.
Unwillkürlich blieb ich in der Nähe des Wagens stehen und lächelte versonnen, was mir erst bewusst wurde, als die glückliche strahlende Braut mir kurz direkt in die Augen sah und mir zunickte. Sie trug ein umwerfend schönes Kleid im Prinzessinnenstil, nicht zu pompös und nicht zu schlicht. Ich dagegen steckte in einem verschwitzten Top und alten Shorts, in denen ich mich normalerweise nicht einmal zum Briefkasten getraut hätte.
Sie und ihr Zukünftiger schienen noch genauso jung zu sein wie die meisten der Hochzeitsgäste, die ich zuvor gesehen hatte. Ich war ein bisschen neidisch, wie viel Glück sie mit dem Wetter hatten. Das war Simon und mir leider nicht vergönnt gewesen, als wir vor fünfzehn Jahren geheiratet haben. Eigentlich hatten wir im Garten meiner Schwiegereltern in Poppenbüttel ein entspanntes Fest feiern wollen. Doch unser schreiendes Baby und Dauerregen hatten den großen Tag auf das reduziert, was am Ende von ihm übrig geblieben war: eine bloß standesamtlich beurkundete Lebensgemeinschaft ohne jede Leidenschaft.
Aber daran wollte ich mich jetzt gar nicht erinnern. In Gedanken wünschte ich dem Brautpaar eine bessere Ehe, als ich sie gehabt hatte, und ging weiter.
Auf meinem Weg ums Schloss stieß ich endlich auf eine dunkelblaue Hinweistafel, die in großen Buchstaben mit dem Wort Heidschnuckenweg überschrieben war. Eine Karte zeigte die gesamte Strecke von 223 Kilometern und informierte über markante Orte wie Soltau oder den Wilseder Berg, nicht nur im übertragenen Sinne «Höhepunkt» der Strecke mit seinen gerade mal 169 Metern, den ich zuletzt als Kind bei einem Schulausflug besucht hatte. Leise murmelnd las ich den Text. Es war die Rede von Glockenheide, einer kleinen, regional gezüchteten Schafrasse, den Heidschnucken, die sich fast ausschließlich von Besenheide ernähren, und von vielfältigen, teils kuriosen Formen von Wacholdern. Und als Slogan darunter stand: Wandern, wo die Schnucke grast.
«Na bravo», zischte ich. Wenn das keine Strafarbeit war: aus einem Rentnerthema eine Titelstory für hippe Großstädterinnen zu machen! Ich hatte absolut keinen Schimmer, wie ich der Reportage auch nur ansatzweise den Glanz einhauchen sollte, der stets von mir erwartet wurde. Angeblich war ich das beste Pferd im Stall, wie Tessa nicht müde wurde, zu betonen. Doch wenn unsere Chefin Komplimente aussprach, klangen sie wie eine Drohung. Bei jeder zugeteilten Aufgabe fühlte ich mich, als würde das Stöckchen zum Drüberspringen immer ein Stück höher gehalten. Wenn Tessa den Rotstift zückte, wartete ich quasi auf mein Todesurteil. Jeder andere Chefredakteur sah Texte am Computer durch. Nur die allseits gefürchtete Tessa liebte es, auf Ausdrucken herumzukritzeln und ihre angeblich so geschätzten Mitarbeiter vor allen anderen vorzuführen. Schon jetzt sah ich mich im Büro sitzen und den Text wieder einmal in einer Nachtschicht umschreiben. Der Druck war enorm und würde sicher nicht durch achtsames Wandern besser werden oder durch die Schönheit der Glockenheide, die noch nicht einmal blühte.
Ich stöhnte und sah mich missmutig um. Das Schloss lag in all seiner Pracht vor mir. Die Eichen, die jetzt, Anfang Juli, in sattem Grün standen, umrahmten das riesige, vierflügelige Bauwerk. Mit der weißen Fassade und den orangerot umrandeten Sprossenfenstern erinnerte es mich an die Schwedenurlaube, als meine Kindheit noch unbeschwert gewesen war.
Dank der Hinweistafel wusste ich jetzt zwar, was mich auf dem Weg erwartete, aber noch immer nicht, wo genau es denn nun losging. Also entschied ich mich dafür, das ganze Schloss zu umrunden, bis ich das «H» fand, mit dem der Heidschnuckenweg entlang der gesamten Strecke angeblich markiert war.
Nach einem nicht unerheblichen Umweg über den Wassergraben fand ich mich wenig später erneut vor derselben Hinweistafel wieder und kam mir ziemlich blöd vor. Das Brautpaar war inzwischen in den Innenhof getreten, wie ich durch das offenstehende Tor gesehen hatte. Kurz überlegte ich, ebenfalls noch mal dort hineinzugehen. Aber wenn ich noch im Hellen bei meinem heutigen Etappenziel ankommen wollte, musste ich jetzt los. Für den allerschlimmsten Notfall hatte ich zwar Friedas Isomatte und ihren leichten Schlafsack an den Rucksack geschnallt. Doch ich wollte keinesfalls ohne Dach über dem Kopf der wilden Natur ausgeliefert sein. Spinnen und andere Krabbeltiere waren keine willkommenen Gäste, vor allem nicht in der Nacht. Sogar Wölfe sollte es in der Heide geben!
Ach was, ich konnte jederzeit ein Taxi rufen und mich ins Hotel fahren lassen, falls ich irgendwo im Niemandsland feststeckte. Oder aber die Tour gleich ganz abbrechen und versuchen, die Reportage heimlich im Home Office zu Ende zu bringen.
Eine durchaus verlockende Vorstellung, dachte ich schnaufend, weil mir mein Gepäck jetzt schon mächtig schwer erschien.
Ich hatte mich gerade entschlossen, auf einer der Parkbänke eine Pause zu machen und nun doch die Wanderkarte aus dem Rucksack ganz unten hervorzukramen, da entdeckte ich an einem Laternenpfahl endlich das erste «H». Allerdings zeigte der Pfeil in Richtung Bahnhof, von wo aus ich am Morgen gekommen war.
Mist! Ich hätte mich tatsächlich gründlicher vorbereiten sollen.
Also marschierte ich zurück. Ich kam am Gefängnis vorbei und musste lange an einer viel befahrenen Straße warten. Ein kurzer Blick auf eine öffentliche Uhr, die auch die Temperatur anzeigte, verriet, dass sich die Luft schon auf 27 Grad aufgeheizt hatte, obwohl es erst halb elf war.
Ich ärgerte mich, dass ich nicht doch noch zwei, drei Dosen Cola eingesteckt hatte. Dabei hatte ich schon in der vollkommen irrationalen Annahme gepackt, ich könnte unterwegs verhungern oder vor Sehnsucht nach einem Stück Schokolade irre werden: vier belegte Brote, drei Äpfel, eine Tüte Chips, Schoko- und Müsliriegel sowie zwei Literflaschen Wasser, die jeweils links und rechts im Seitenfach steckten. Aber keine Cola. Dabei liebe ich das Zeug, bin quasi süchtig davon. Aber wenn ich jetzt weiter an eisgekühlte Cola dachte, würde das augenblicklich eine Heulattacke provozieren.
Wäre ich doch nur in Hamburg geblieben!
Ob Frieda sich schon gemeldet hatte? Als ich durch ein Wohngebiet ging, versuchte ich umständlich mein Handy aus der obersten Tasche zu ziehen. Und weil ich es nicht sofort ertasten konnte, wurde ich panisch. Ob ich es im Café liegen gelassen hatte? Im Seitenfach wurde ich dann zum Glück fündig. Die vielen Taschen des neuen Rucksacks waren mir einfach noch nicht vertraut, und ich vermisste schon jetzt meine geliebte Liebeskind-Handtasche. Ich schaute aufs Display und wollte unbedingt für Frieda erreichbar sein. Aber außer einer belanglosen Gruppennachricht von ihrem Hockeytrainer war nichts gekommen.
Am Stadtrand folgte ich dem nächsten «H», das mich unter einer marode erscheinenden Brücke herführte. Langsam wurden die Häuser spärlicher und die Grundstücke weitläufiger. Bislang fand ich die Wanderroute eher enttäuschend. Und plötzlich hatte ich wieder die Stimme meiner Mutter im Ohr, die sagte, ich solle nicht immer so undankbar sein. Ich hätte doch schließlich alles im Leben – einen tollen Mann, der erfolgreicher Architekt war, eine hübsche Tochter, die in der Schule bestens zurechtkam, einen abwechslungsreichen Job und eine begehrte, alsternahe Altbauwohnung in einer der schönsten Ecken Hamburgs. Sie verstand einfach nicht, warum ich oft so unzufrieden war. Und das Schlimmste daran war, dass ich es selbst nicht verstand.
Irgendwo drückte eben immer ein Schuh. Und so war es auch jetzt, wortwörtlich. Ich hatte gerade mal ein paar Kilometer hinter mich gebracht, und schon machte sich die Naht meiner Socken oberhalb der Zehen bemerkbar.
Hätte ich doch bloß auf den Verkäufer bei Globetrotter gehört! Er hatte mir nicht nur dazu geraten, in einen vernünftigen Rucksack und stabile Wanderschuhe zu investieren, sondern wollte mir auch noch Spezialsocken andrehen, was ich reichlich übertrieben gefunden hatte.
«Am besten, Sie laufen die Schuhe mit den Socken ein und waschen sie dann nicht mehr», hatte er vorgeschlagen. Darauf hatte ich bloß irritiert gelächelt. Ich fand es schon heldenhaft, dass ich statt der günstigeren und hübscheren Schuhe die sauteuren genommen hatte, weil diese angeblich atmungsaktiv, wasserabweisend und besonders leicht waren. Dabei wollte ich ja keinen Achttausender bezwingen, sondern eigentlich nur einen sehr langen Spaziergang machen. Ja, ich wollte mich mehr spüren, aber doch nicht so!
Kurzerhand ließ ich mich am Straßenrand nieder und legte den blöden Rucksack ab. Als ich meine Schuhe und Socken ausgezogen hatte, um meine Füße eingehender zu betrachten, verzog ich die Mundwinkel. Denn oberhalb der Zehen, wo die hauchdünne Sockennaht drückte, war die Haut bereits wund gescheuert. Wenn ich so weitermachte, würde ich tatsächlich Blasen bekommen. Ich seufzte. Und jetzt? Zurücklaufen und neue Socken kaufen? Das erschien mir absurd. Irgendwo klingeln und um eine Sockenspende bitten? Wohl kaum. Barfuß in den Schuhen weiterlaufen? Unmöglich, denn dann bereitete die Übergangsstelle von Nylon und Lederspitze sicher erst recht Probleme. Also beschloss ich, die Sockennaht beim Anziehen weiter hochzuschieben, in der Hoffnung, damit Schlimmeres zu verhindern. Und tatsächlich, als ich die ersten Schritte getan hatte, wurde es angenehmer. Erleichtert ging ich weiter.
Da bellte plötzlich lautstark ein Schäferhund und hörte nicht mehr auf. Zum Glück trennte uns ein grüner Metallzaun. Davor verwies ein Schild auf den Verein für Deutsche Schäferhunde. Ich erstarrte vor Schreck, während mein Herz wie wild hämmerte. Das Fläschchen mit dem Reizgas, das Simon mir besorgt hatte, steckte irgendwo in den Untiefen des Rucksacks. Wie in Zeitlupe drehte ich mich um, um zu sehen, ob irgendwo der Besitzer auftauchte und die Bestie zurückrief. Aber da war niemand! Nur ich und der kläffende Hund mit seinen spitzen Zähnen. Mit weichen Knien ging ich vorsichtig weiter, immer in der Sorge, er könnte gleich über den Zaun springen oder irgendeinen anderen Ausweg aus seinem Gefängnis finden. Erst als ich etwa 20 Meter weitergeschlichen war, verstummte der Hund endlich. Ängstlich sah ich mich um – und stellte erleichtert fest, dass er sich verzogen hatte.
Nach einer Weile, die ich wie in Trance hinter mich gebracht hatte, musste ich links in eine Straße abbiegen, auf deren rechter Seite sich etliche kleinere Häuser aneinanderreihten. Gegenüber lag ein kleines Waldstück. Es war von einer niedrigen Betonmauer umgeben. Dort ließ ich mich noch einmal nieder, um den Schock zu verdauen. Ich trank ein paar Schlucke Wasser und kramte mühsam das Reizgas hervor, das ich von nun an permanent in der Hand halten wollte. In der anderen das Handy.
Als ich erneut aufs Display sah, wunderte ich mich, dass ich den Eingang einer WhatsApp-Nachricht von Frieda gar nicht mitbekommen hatte. Sofort stellte ich den Ton etwas lauter. Sie schrieb:
und? bist du schon erleuchtet? ;-) bekomme in mathe btw doch noch ne 2 und in englisch auch, yes!!
Erleichtert atmete ich auf. Ich freute mich sehr über die guten Noten. Die in Mathe war nun doch besser, als Friedas Lehrerin zuvor angekündigt hatte. Zügig schrieb ich zurück:
Na, ein Glück! Da bin ich erleichtert. Melde mich später noch mal, wenn ich eine Unterkunft habe. Nudelauflauf steht im Kühlschrank. Kuss, Mami
Bevor ich weiterging, schaute ich noch schnell, ob ich irgendeine wichtige E-Mail bekommen hatte und ob das Wetter in der Heide auch halten würde. Wobei ich mir gar nicht mehr sicher war, ob mir Regen nicht lieber gewesen wäre als diese drückende Hitze. Schon jetzt am Vormittag war es eigentlich viel zu heiß zum Wandern. Zum Glück schien der Weg am Ende der Straße wieder in ein Waldstück überzugehen, das hoffentlich ausreichend Schatten bot.
Was Frieda bei der Hitze heute wohl anstellte? Am liebsten hätte ich die Frage gleich hinterhergeschickt. Aber dann hätte es wieder so ausgesehen, als traute ich meiner Familie nicht zu, alleine zurechtzukommen. Und wenn ich eines nicht gebrauchen konnte auf dieser Tour, dann einen neuen Streit, von denen es in letzter Zeit ohnehin viel zu viele gegeben hatte.
So herausfordernd hatte ich mir die Pubertät nicht vorgestellt. Natürlich kannte ich all die Geschichten von Bekannten, deren Kinder plötzlich nicht mehr redeten und nur noch hinter ihren Displays oder in ihren Zimmern verschwanden. Trotzdem hatte ich mir eingebildet, mit Frieda würde es anders werden. Wir hatten schließlich schon immer ein enges und vertrauensvolles Verhältnis gehabt und sogar über Sex, Verhütung oder Drogen offen geredet. Und nun war doch alles anders. Frieda wollte die Schule abbrechen.
Urplötzlich war sie mit dieser komischen Idee um die Ecke gekommen: Sie wolle Hebamme werden und die Wartezeit bis zur Ausbildung als Au-pair-Mädchen im Ausland überbrücken, am liebsten in Neuseeland. Dabei war sie noch nicht einmal siebzehn! Das hatten wir Lilly, der besten Freundin von Frieda, zu verdanken, deren Mutter Hebamme war und ihr offenbar diesen Floh ins Ohr gesetzt hatte. Aber wie sollte sich meine Tochter um Babys oder kleine Kinder kümmern, wenn sie selbst noch eines war? Vielleicht nicht nach außen hin, mit ihrer gewinnenden Art, die sie von ihrem Vater geerbt hatte. Aber im Inneren war sie doch immer noch das kleine Mädchen, das noch nie einen festen Freund gehabt hatte und noch nie länger als eine Woche von mir getrennt gewesen war. Ich war stolz darauf, wie nahe wir uns standen und wie offen wir miteinander reden konnten. War es da wirklich unnormal, wenn ich nicht wollte, dass sie einfach so ging – dazu noch ohne Abitur?
Bei ihrem guten Notendurchschnitt gab es auch gar keinen Grund, die Schule hinzuschmeißen, dachte ich, als ich endlich den schattigen Weg abseits der Straße erreicht hatte.
Die Vorstellung, dass meine Tochter womöglich schon nach den Sommerferien unser Zuhause verließ, schnürte mir die Kehle zu. Eben noch war sie ein kleines Mädchen mit Zahnlücke und Haarspangen gewesen. Und nun wollte sie in die weite Welt. Dabei hatte sie enge Freunde, ein großes Zimmer, ihre Hockeymannschaft, ihre Oma, ihren Vater, mit denen sie sich eigentlich gut verstand, und natürlich mich. Womöglich würde ich nie wieder abends vor dem Zubettgehen meinen Kopf in ihre Zimmertür stecken und mich auf die Bettkante setzen, um noch ein paar Minuten mit ihr über einen Streit mit Lilly, Kummer wegen erster unerwiderter Verliebtheit oder ihre neueste Shoppingausbeute zu plaudern. Vielleicht würde ich sie nie wieder spontan mit ihrem Lieblingsessen, Senfeier und Kartoffelbrei mit Gurkensalat, überraschen können.
Ich bekam Beklemmungen. Natürlich wusste ich, dass Loslassen zum Elternsein dazugehörte. Das war beim ersten Übernachtungsbesuch von Frieda bei ihrer Oma so, beim Start in der Kita, bei der Einschulung, der ersten Klassenfahrt … Aber von jetzt auf gleich auf quasi kalten Entzug gesetzt zu werden, gepaart mit der übergroßen Angst, ihr könnte sonst was passieren am anderen Ende der Welt, brach mir das Herz.
Während ich hier durch die Heide wanderte, fühlte ich mich noch ohnmächtiger als zu Hause. Auch wenn ich Frieda unter der Woche kaum noch zu Gesicht bekam, wusste ich sie immer in Sicherheit. Natürlich war sie kein kleines Kind mehr. Aber sie brauchte mich noch. Das spürte und wusste ich. Ob ich ihr einfach zu wenig Raum gelassen hatte? Oder lag es an der Situation zu Hause? Vielleicht wollte sie weg, weil Simon und ich im Grunde wie zwei schlechtgelaunte WG-Bewohner zusammenlebten? Vielleicht hielt sie das unbewusst nicht mehr aus und wollte deswegen aus ihrem Nest fliehen? Das wäre ein Grund mehr, die Ehe mit Hilfe meiner Therapeutin zu retten. Denn wenn ich es nur irgendwie schaffte, unsere Ehe einigermaßen wieder ins Lot zu bringen, würde die Stimmung zu Hause sicher wieder entspannter werden, und dann müsste unsere Tochter nicht nach Neuseeland fliehen.
Ich stoppte, weil sich plötzlich eine Lichtung auftat, und ließ meinen Blick über die Landschaft schweifen. Obwohl die Stadtgrenze immer noch nicht ganz überwunden schien, zeigte sich der Weg hier zum ersten Mal von seiner sehr grünen Seite.
Eine Hinweistafel verriet, dass es sich um die Allerwiesen handelte, die bei Wasserhochstand überflutet wurden. Mich zog es schnell weiter auf dem Weg, der jetzt von einer ganzen Reihe von Bäumen flankiert war. Ein weiteres Schild erklärte, dass hier je ein Exemplar aller bisherigen Bäume des Jahres eine Allee bildeten. Die Stiel-Eiche war demnach der erste Baum aus dem Jahr 1989, gefolgt von der Rotbuche, der Sommer-Linde, der Berg-Ulme und so weiter. Unweigerlich blieb mein Blick bei 2002 hängen, dem Jahr, in dem Frieda geboren worden war. Ich las, dass damals ausgerechnet der Wacholder Baum des Jahres gewesen war. Irgendwie mochte ich dieses Gestrüpp nämlich nicht besonders und fand es sogar gruselig, weil die Bäume immer wie alte, einsame Seelen inmitten der Landschaft wirkten.
«Da haben Sie sich ja ordentlich was vorgenommen, bei diesem Wetter!»
Ich hatte die zwei Radfahrer, die auf einer Bank saßen und über die Allerwiesen blickten, gar nicht bemerkt. Ihre Räder lehnten ein Stückchen entfernt im Schatten einer Buche.
Der Mann mit den Trekkingsandalen und dem rot-karierten Hemd hob seine Hand zum Gruß. Seine Begleiterin trug das gleiche Modell, nur in der taillierten Variante.
«Ja, aber lieber ein bisschen zu warm als Regen», schwindelte ich. Die Hitze machte mir mehr zu schaffen, als ich gedacht hatte. Ich fühlte wieder, wie meine Wangen glühten.
«Sie sollten besser eine Kopfbedeckung tragen. Da kommen noch viele Abschnitte ohne schattige Bäume», schaltete sich die Frau jetzt ein. Sie hatte einen dunklen Pagenkopf und trug eine rote Brille. Ich blickte auf die Fahrradhelme der beiden und atmete tief durch, weil ich wieder einmal nicht wusste, was ich darauf erwidern sollte. Sie hatten ja recht. Trotz ihrer Funktionskleidung und ihres Partnerlooks waren sie mir nicht mal unsympathisch, sondern im Gegenteil: Man sah ihnen schon von weitem an, was für ein harmonisches Team sie waren.
«Na, Sie sind sicher bestens ausgestattet, bei so viel Gepäck?!», fragte der Mann neugierig weiter.
Jetzt wurde das Rot meiner Wangen sicher noch intensiver. Fehlte nur noch, dass ich meine Sachen vor ihm ausbreiten und mich überführen lassen musste, wie beratungsresistent ich bei Globetrotter gewesen war.
«Das geht schon», wehrte ich daher freundlich ab, «ich denke, ich habe alles, was ich brauche. Und noch weiß ich auch gar nicht, ob ich überhaupt die ganze Strecke laufe.»
«Das Wichtigste ist sowieso etwas zu trinken, Regen- und Sonnenschutz», mischte sich die Frau wieder ein. «Und Pflaster natürlich. Aber das brauchen wir Ihnen ja sicher nicht zu sagen!» Sie lachte laut auf.
Eingeschüchtert von dieser geballten Reisekompetenz ließ ich meinen Rucksack zu Boden und gab mit einer Geste zu verstehen, dass ich besser mal nachsehen würde. Gespannt beobachteten die beiden, wie ich zwischen meinen Sachen nach dem Necessaire wühlte. Ich beförderte Wäsche, Sudokus und Klatschblätter hervor und schließlich auch meine Badutensilien. Nach einem kurzen Blick bestätigte sich meine böse Ahnung, dass ich tatsächlich vollkommen plan-, weil pflasterlos von zu Hause aufgebrochen war. Bis eben hatte ich gehofft, dass sich in einem der kleinen Seitenfächer noch irgendwo eines von vorangegangenen Reisen versteckte. Aber dort fanden sich nur Tampons, Feuchttücher und Gesichtsmasken, die ich tunlichst vor meinem Publikum verbarg.
«Kein Sonnenschutz?» Besorgt legte die Frau ihre Stirn in Falten.
«Doch, doch!», entgegnete ich und hielt stolz meine «Nuance-Sunprotect-Creme» mit Anti-Aging-Effekt und Lichtschutzfaktor 15 in die Höhe, die mich in der Apotheke ein Vermögen gekostet hatte.
Die beiden tauschten einen missbilligenden Blick.
«Ich habe aber tatsächlich kein Pflaster dabei. Das kaufe ich mir noch irgendwo unterwegs», sagte ich, um davon abzulenken, dass mein leider durchsichtiges Schminktäschchen fast genauso groß war wie mein Necessaire. Ich hätte auch lieber geheim gehalten, dass ich niemals ohne Chanel Nr. 5 und Fußdeo aus dem Haus ging.
«Da kommt nix unterwegs», erklärte der Mann und raubte mir damit alle Illusionen. Ich hatte mich nach jeder absolvierten Etappe mit Shoppingtrophäen belohnen wollen. Er stand auf und kramte an der prall gefüllten Satteltasche seines E-Bikes herum und zog eine Packung High-End-Spezialpflaster heraus.
«Nehmen Sie die! Und packen Sie die schweren Sachen nach unten und hinten in den Rucksack», befahl er und deutete auf meine aktuelle Lektüre, einen Thriller mit immerhin vierhundert Seiten.
Ich meinte sogar, ein verständnisloses Kopfschütteln beobachtet zu haben, als ich beschämt anfing, meinen Rucksack neu zu packen.
«Und den Schlafsack schnallen Sie obendrauf und nicht drunter. Da gehört die Isomatte hin!», erklärte die Frau und beeilte sich sogar, mir zur Hand zu gehen.
Die beiden waren so liebenswürdig in ihrer Art, dass ich mir gar nicht so schrecklich blöd vorkam, auch wenn ich mich hier als Oberdepp präsentierte.
Als alles verstaut war, reichte mir der freundliche Mann noch eine Tüte Studentenfutter, mit dem Hinweis, dass ich das sicher brauchen würde.
Ich hoffte inständig, dass er meine Schokoriegel und Lakritze nicht entdeckt hatte, und bedankte mich vielmals.
«Na, dann drücken wir Ihnen die Daumen, dass Sie gut durchkommen. Alles Gute, und genießen Sie es!», rief die Frau noch.
«Danke, Ihnen auch einen schönen Tag», erwiderte ich und ging schnellen Schrittes weiter, ohne mich noch einmal umzudrehen.
Wenn die wüssten!, dachte ich und ahnte, dass die beiden mir kopfschüttelnd hinterhersahen.
Dann endlich verlief mein Weg um eine Kurve herum, sodass ich außer Sichtweite war. Alles in mir sträubte sich jetzt noch mehr gegen diese fragwürdige Unternehmung, die mir bislang wie reine Zeitverschwendung vorkam. Und auch jede Kommunikation darüber war mir lästig. Seltsam, früher war ich nie so zugeknöpft gewesen. Da hätte ich mit solchen Leuten eine entspannte Unterhaltung über Gott und die Welt geführt und so vielleicht noch ein paar wissenswerte Insidertipps erhalten. Zum Beispiel, wo man in der Nähe gut essen konnte.
Irgendwann verlangsamte ich mein Tempo. Der Weg führte wieder in ein kleines, idyllisches Waldgebiet, das nach einigen Metern sogar den Blick auf einen See freigab. Direkt am Ufer fand sich eine Bank. Also beschloss ich, dort meine erste längere Pause zu machen. Mit einem tiefen Seufzer löste ich mich von meinem Gepäck und setzte mich. Zunächst starrte ich eine Weile auf mein Handy, dann löste sich mein Blick, und ich betrachtete einfach nur die ruhige, grünliche Wasseroberfläche, ohne an etwas Bestimmtes zu denken, wie mir nach einer ganzen Weile bewusst wurde.
Es fühlte sich an wie morgens nach dem Aufwachen, wenn ein Traum noch vage im Gedächtnis ist und dann nur allzu schnell verschwindet. Plötzlich wurde mir klar, dass ich mich schon lange nicht mehr an meine Träume erinnerte. Das lag sicherlich daran, dass ich zu Hause einfach funktionieren musste. Meist stand ich als Erste auf, damit Frieda auch pünktlich zur Schule kam und Simon pünktlich ins Büro. Vielleicht wäre es all die Jahre anders gewesen, wenn wir auch so ein Arsch-auf-Eimer-Pärchen gewesen wären wie die beiden Radfahrer. Vielleicht hätte ich gleich von Friedas Geburt an auf absolute Gleichberechtigung in allen Fragen der Erziehung und auch der Haushaltsführung bestehen sollen. Aber es hatte sich einfach so ergeben, dass ich zu Hause geblieben war, weil ich nun einmal stillte und Simon längst sein eigenes Architekturbüro mit drei Angestellten leitete. Sein Job war jedenfalls immer wichtiger gewesen als meiner. Dabei hatte ich es durchaus genossen, mich um Frieda zu kümmern, all die Krabbelgruppen und Kurse zu besuchen und andere Mütter kennenzulernen.
Bis ich selbst Mutter wurde, hatte ich immer innerlich mit dem Kopf geschüttelt, wenn Frauen in meinem Umfeld kein anderes Thema mehr zu haben schienen als ihren ach so einzigartigen Nachwuchs.
Doch als Frieda kam, wurde auch ich urplötzlich auf einen anderen Planteten gebeamt. Wäre es nach mir gegangen, hätten Simon und ich noch ein, zwei Kinder mehr bekommen. Doch Simon war in seiner Rolle als Vater eines Einzelkindes so zufrieden gewesen, dass ich meinen Wunsch irgendwann schweren Herzens aufgab.
Frieda machte mich trotz all meiner Fehler als Mutter zu einem besseren Menschen. Ich mochte meine Rolle. Vielleicht sogar zu sehr. Jedenfalls hatte mich das Muttersein wohl eine viel zu lange Zeit davon abgelenkt, wie viel eigentlich schieflief in unserer Ehe. Tief in mir drin fühlte ich mich nämlich allzu oft ungerecht behandelt. Es war selbstverständlich, dass ich mich um die Wäsche kümmerte, dafür sorgte, dass unsere Wohnung immer vorzeigbar, der Kühlschrank gefüllt war und Essen auf den Tisch kam. Wir hatten zwar unsere liebe Natascha, die mir das Bügeln und Fensterputzen abnahm. Dennoch hatte ich immer das Gefühl, alles andere blieb an mir hängen, weil es Simon schlichtweg gleichgültig zu sein schien, ob sich die Schmutzwäsche stapelte, was Frieda in der Schule trieb, wo all die Geschenke für Kindergeburtstage, Freunde und Geschäftspartner herkamen, wohin wir in den Urlaub fuhren und wann die Steuererklärung zum Finanzamt musste.