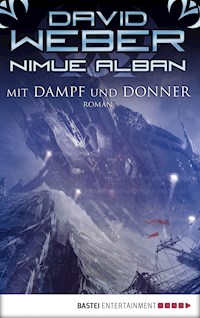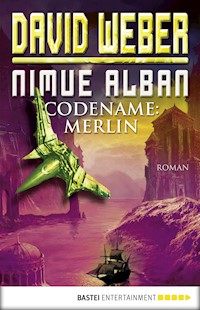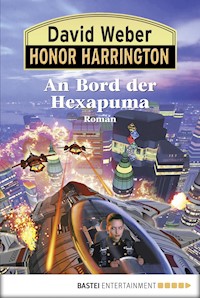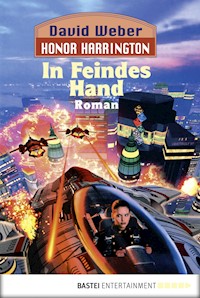
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Honor Harrington
- Sprache: Deutsch
Diesmal sitzt Honor wirklich in der Klemme. Die Republik von Haven hat endlich einen General gefunden, der es versteht, Schlachten zu gewinnen. Honor und ihre Crew geraten in einen Hinterhalt und müssen kapitulieren. Man verspricht ihnen jedoch, sie mit allen Ehren zu behandeln - nur dass dieses Versprechen sehr schnell gebrochen wird. Honor befindet sich plötzlich auf dem Weg zu einem Gefängnisplaneten mit dem vielsagenden Namen "Hölle", ihre Exekution ist bereits beschlossene Sache. Alleine, ohne ihre Offiziere und ihre Baumkatze Nimitz, und den Demütigungen ihrer Wärter ausgesetzt, sieht es schlecht aus für die Zukunft - für die Zukunft ihrer Feinde, denn es ist gefährlich, eine Honor Harrington in die Enge zu treiben ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 916
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
In FeindesHand
Roman
Ins Deutsche übertragenvon Dietmar Schmidt
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstveröffentlichung
© 1997 by David M. Weber
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »In Enemy Hands«
Published by arrangements with Bean Publishing Enterprise
Dieses Buch wurde vermittelt durch die Literarische AgenturThomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Für die deutschsprachige Ausgabe:© 2000/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Ruggero Leò / Stefan Bauer
Titelillustration: David Mattingly / Agentur Schlück
Umschlaggestaltung: QuadroGrafik, Bensberg
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-2264-1
Sie finden uns im Internet unterwww.luebbe.de
Bitte beachten Sie auch: www.lesejury.de
Prolog
»Nach meinem Dafürhalten ist das ein Fehler – ein großer Fehler«, erklärte Cordelia Ransom. Nur das Funkeln in ihren blauen Augen verriet Gefühl; ihre sonst so leidenschaftliche Stimme, mit der sie mühelos Menschenmassen zu frenetischen Sprechchören anzustacheln vermochte, klang kalt, fast ungerührt. Daraus schloss Robert Stanton Pierre, wie sehr die Frage, die das Triumvirat gerade diskutierte, die Informationsministerin aufgewühlt hatte.
Er bemühte sich, gerade genügend Härte in seine betont gelassene Antwort zu legen, um Ransoms Bestimmtheit den Boden zu nehmen; ihre Unerbittlichkeit ließ ihn frösteln. »Da muss ich wohl anderer Meinung sein, sonst hätte ich den Vorschlag nicht ausgesprochen«, entgegnete er und sah ihr in die Augen. Obwohl Ransom letztlich zuerst den Blick senkte, strengte das Kräftemessen Pierre deutlich stärker an, als es sollte, dessen war er sich deutlich bewusst. Er konnte nur hoffen, dass Ransom sein Unbehagen nicht bemerkt hatte.
Offiziell gebot in der gewaltigen Volksrepublik von Haven niemand über mehr Macht als Rob S. Pierre. Als Begründer und Kopf des Komitees für Öffentliche Sicherheit war sein Wort Gesetz und seine Macht über die Bürger der Republik absolut. Dennoch stieß selbst er rasch an Grenzen, und nur eine dieser Grenzen hatte ihn von der Unumgänglichkeit des Vorschlags überzeugt, den er soeben geäußert hatte. Dass die Schranken, an denen Pierre nicht weiterkam, unsichtbar sein mussten für jeden, der nicht dem Komitee für Öffentliche Sicherheit angehörte, bedeutete leider längst noch nicht, dass sie nicht existierten.
Sein Regime war eine Revolutionsregierung und hatte die Herrschaft über die Republik gewaltsam an sich gebracht. Nach dem Umsturz hatte das Quorum des Volkes dem neuen Kabinett einen geschäftsführenden Charakter zugestanden; doch war es ein offenes Geheimnis, dass die Regierung die Kompetenzen schon seit langem überschritt, die ihr zugestanden worden waren. Im Glauben, lediglich ein Übergangskabinett ins Leben zu rufen, stimmte das Quorum ab und bewilligte Pierres Vorschlag, das Komitee zu gründen. Man bestätigte ihn als Vorsitzenden und ging allgemein davon aus, dass das Komitee so rasch wie möglich die innere Sicherheit wiederherstellte – und mehr nicht. Binnen kurzem musste das Quorum erkennen, was es wirklich in die Welt gesetzt hatte: eine oligarchische Diktatur, die zum Machterhalt und zur Durchsetzung ihrer Ziele vor Nötigung, Unterdrückung und unverhohlenem Staatsterror nicht zurückschreckte. Genau darauf aber lief Pierres Problem hinaus: Indem er rücksichtslos und unter Anwendung von Gewalt seine Befugnisse überschritt, hatte er seine Macht zwar deutlich demonstriert, zugleich aber seine Autorität jener subtilen Eigenschaft beraubt, die man gemeinhin als ›Legitimität‹ bezeichnet. Eine Herrschaft jedoch, die auf Gewalt oder Gewaltandrohung beruht, kann leicht durch Gewalt gestürzt werden.
Als ein Gebilde der Gewalt durfte Pierres Komitee sich nicht auf das Gesetz oder das Gewohnheitsrecht berufen. Merkwürdig, wie wenig Gedanken sich die Menschen um eine Regierung machen, die diese Rechtfertigung besitzt, dachte er wehmütig. Ebenso merkwürdig, wie sehr es eine Gesellschaft zu erschüttern vermochte, wenn man sie eines grundlegenden Gesellschaftsvertrages beraubte, der zweifelsohne ausgesprochen schlecht gewesen war. Die Erschütterungen pflanzten sich stets so lange fort, bis ein neuer Vertrag, den alle Beteiligten als rechtens erachteten, den alten ersetzte. Pierre hatte sich längst eingestanden, die Folgen seiner Revolution bei weitem unterschätzt zu haben, als er sich damals für den Weg der Gewalt entschied. Für die Zeit nach dem Umsturz hatte er zwar mit Unruhen gerechnet, war jedoch davon ausgegangen, dass er und seine Mitverschwörer nur die heiklen ersten Monate überstehen müssten. Danach hätte sich seinen Erwartungen zufolge die Herrschaft des Komitees in den Augen der Regierten von selbst legitimieren müssen. Ja, so hätte es sein sollen, sagte er sich einmal mehr, doch dass es in der Realität ganz anders gekommen war, ließ sich nicht bestreiten.
Das Komitee hielt die Macht nun so fest in der Hand wie zuvor die Legislaturisten, die es niedergeworfen hatte. Im Gegensatz zu den Legislaturisten war Pierre von der Notwendigkeit und Durchführbarkeit von Reformen überzeugt gewesen und hatte ehrlich geglaubt, durch seine Reformen eine Wende zum Besseren einzuleiten; deshalb war er zum Revolutionär geworden. Doch seine Machtübernahme hatte eine Situation erschaffen, in der für Pierres Neider nur noch eines zählte: ihm diese Macht wieder zu entreißen. Denn seine eigene Vorgehensweise hatte nicht nur sämtliche gewaltfreien Wege zur Macht beseitigt, sondern auch jeden einschränkenden Rechtsgebrauch ihrer Ausübung eliminiert.
Unter dem Strich war das nach außen hin allmächtige Komitee für Öffentliche Sicherheit deshalb ein weitaus zerbrechlicheres Gebilde, als es den Anschein hatte. Den Dolisten und Proles gegenüber stellte das Komitee unerschütterliche Zuversicht zur Schau, doch Pierre und seine Amtsgenossen wussten nur zu gut, dass ständig Verschwörer am Werk waren und auf einen neuen Umsturz hinarbeiteten. Wer könnte es ihnen verdenken? fragte sich Pierre. Hatte das Komitee denn nicht selber die vorherigen Herren und Meister der Volksrepublik gestürzt? Und hatte das lange Monopol der Legislaturisten auf die Staatsgewalt nicht Verrückte und Fanatiker aller Couleur im Überfluss hervorgebracht? Das Komitee war kein Sammelbecken aller revolutionären Strömungen gewesen, bei weitem nicht. Vielmehr verfolgte es alle ›Volksfeinde‹ mit solcher Rücksichtslosigkeit, dass es sich ständig neue potentielle – und inbrünstige – Gegner schuf.
Einige Feinde des Komitees legten die gefährliche Entschlossenheit an den Tag, ihrem Groll Taten folgen zu lassen. Die offensichtlich Verrückten erwiesen sich (wie die Zeroisten, die Charles Froidans Forderung nach der Abschaffung des Geldes unterstützten) zum Glück meist als zu unfähig, um auch nur eine Bottle-Party zu organisieren – von einem Staatsstreich ganz zu schweigen. Andere hatten sich zunächst als bessere Verschwörer erwiesen – etwa die Parnassisten, zu deren Zielen die Hinrichtung aller Bürokraten gehört hatte, weil deren Berufswahl angeblich bereits einen Prima-facie-Beweis für Verrat gegen das Volk darstellte; aber auch die Parnassisten waren offenbar außerstande gewesen, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten. Indem sie ihren Zug zu früh machten, hatten sie sich unter den konkurrierenden Extremisten zu viele Feinde gemacht. So fiel es Pierre und dem Amt für Systemsicherheit nicht schwer, eine Fraktion gegen die andere auszuspielen und am Ende alle zu vernichten. (Um der Wahrheit die Ehre zu geben, war Pierre diese Entscheidung schwergefallen. Er brachte den Ansichten der Parnassisten eine gewisse Sympathie entgegen, weil er ständig mit dem aufgeblähten, schleichend langsam operierenden Beamtenapparat zu tun hatte, den ihm die Legislaturisten hinterlassen hatten. Am Ende musste er jedoch zum eigenen Bedauern einsehen, dass das Komitee nicht auf die Bürokraten verzichten konnte, wenn es die Republik in Gang halten wollte.)
Bei anderen Komiteegegnern handelte es sich zwar ebenfalls um Irrsinnige – allerdings um eine viel gefährlichere Variante: Diese Gegner wussten den geeignetsten Zeitpunkt abzuwarten und verstanden sich außerordentlich gut auf Geheimhaltungsmaßnahmen. In diese Kategorie hatten LaBœufs Levellers gehört. Als Gesellschaftsideal propagierten die Levellers ein System, demgegenüber eine Anarchie fürchterlich reglementiert erschien. Zwar lehnten sie jegliche Form von Organisation ab, waren aber jedoch bei ihrem Aufstand so gezielt und koordiniert vorgegangen, dass in den schweren Kämpfen mehrere Millionen Menschen den Tod gefunden hatten, obwohl der Aufruhr keinen Tag lang andauerte. Erstaunlich, was ein bisschen kinetisches Bombardement aus der Umlaufbahn und ein paar kleine Atombomben in einer Sechsunddreißig-Millionen-Stadt anrichten können, dachte Rob S. Pierre. Im Grunde haben wir noch Glück gehabt, denn die Zahl der Opfer hätte viel höher sein können … Wenigstens hat keiner der bekannten Levellers-Anführer das Blutbad überlebt. Keiner der bekannten … – Für Pierre stand fest, dass zumindest einige, wenn nicht gar alle Angehörigen des innersten Levellers-Kaders Sitze im Komitee für Öffentliche Sicherheit innehatten. Anders ließ sich nicht erklären, dass der Putsch beinahe erfolgreich verlaufen wäre; die Unbekannten waren jedoch unerkannt davongekommen … bis jetzt jedenfalls.
In Anbetracht der Umstände verwunderte es Pierre nicht weiter, dass er seine bedrückende, ständig zunehmende Unsicherheit nicht abzuschütteln vermochte und sein ursprüngliches Reformbestreben unter der immer schwerer werdenden Last seiner Sorgen zermalmt wurde. Schlimm genug, wenn sein Gefühl der Verletzlichkeit bloßer Verfolgungswahn ohne sachliche Grundlage gewesen wäre. Seit dem Aufstand der Levellers aber besaß Pierre den handfesten Beweis, dass er nicht nur Feinde hatte, sondern dass diese Feinde ihm zudem nach Leib und Leben trachteten. Nach jedem Strohhalm hätte er gegriffen, um dem Komitee auch nur ein Quäntchen mehr Stabilität zu verleihen; egal mit welchen Mitteln, Pierre musste sich Rückhalt verschaffen. Zu diesen Sorgen gesellte sich die Notwendigkeit, den Krieg zu gewinnen, den die vorherige Regierung der Volksrepublik angezettelt hatte. All diese Fakten hatten Pierre dazu bewogen, jenen Vorschlag zu machen, dem Ransom mit solcher Ablehnung begegnet war. Nun bat er Oscar Saint-Just mit Blicken um Rückendeckung.
Ein Außenstehender hätte Oscar Saint-Just gewiss für das zweitmächtigste Mitglied des Triumvirats gehalten, das an der Spitze des Komitees und damit der VRH stand. In taktischer Hinsicht hätten ihm einige sogar noch mehr Macht zugetraut als Robert Pierre, denn Oscar Saint-Just gehörte die eiserne Faust, die über das gefürchtete Amt für Systemsicherheit gebot. Doch auch hier mochte der äußere Anschein trügen. Als Minister für Systemsicherheit war Saint-Just der Vollstrecker des Komitees, und die Grundlage seiner Macht war daher erheblich leichter zu erkennen als im Falle Ransoms. Schließlich war Pierre willens gewesen, Saint-Just diese Macht anzuvertrauen, was eindeutig bewies, dass Saint-Just für ihn niemals zu der Bedrohung werden konnte, als die Cordelia Ransom sich eines Tages vielleicht entpuppte. Oscar wusste, dass sein Ruf als oberster Gefängniswärter der Republik es ihm unmöglich machte, lange an der Macht zu bleiben, sollte er sie sich aneignen. Man setzte ihn mit dem Staatsterror der SyS gleich; er war die Zielscheibe aller Furcht, allen Hasses und allen Grolls, den das Komitee für Öffentliche Sicherheit erweckte. Zudem hegte er nicht den Ehrgeiz, seinen Vorgesetzten von seinem Platz zu verdrängen. Pierre hatte Saint-Just hinreichend Fallen gestellt, doch Oscar hatte keine einzige dieser scheinbaren Gelegenheiten ergriffen, denn er wusste genau, wie weit er gehen durfte.
Ransom hingegen war anders gestrickt; sie kannte ihre Grenzen nicht, und niemals hätte Pierre ihr Saint-Justs Position anvertraut. Ransom war zu unberechenbar – was für Pierre gleichbedeutend war mit ›unzuverlässig‹. Und während er entschlossen war, auf den Ruinen des alten, gemeuchelten Machtgebildes etwas Neues, Dauerhaftes zu errichten, schien sie meist mehr an der bloßen Ausübung ihrer Macht interessiert zu sein, anstatt sie zweckdienlich zu nutzen. Ging es darum, den Massenzorn des Pöbels zu lenken, so war sie in ihrem Element; sie verstand es ausgezeichnet, diesen Zorn von Pierre und seinem Regime abzuhalten und auf Sündenböcke zu richten – deshalb war sie so wertvoll. Doch weil sie dieses Talent besaß, präsentierte das ihr unterstellte Amt für Öffentliche Information jedes Thema letztendlich auf die von ihr gewünschte Weise. Ransom erlangte dadurch gewaltigen Einfluss – Einfluss, den man zwar nicht greifen konnte, der jedoch furchteinflößend real war und sie fast auf dieselbe Stufe wie Saint-Just stellte. Und Pierre durfte einen weiteren Faktor, der zu Ransoms Macht beitrug, niemals aus den Augen verlieren: Sie verfügte über zahlreiche Spitzel innerhalb von Oscars Organisation.
Unmittelbar nach dem Putsch, bevor Pierre ihr den Ministertitel verlieh – oder sollte man gleich sagen: überließ? -, hatte Ransom zu den umherreisenden Propagandisten des Komitees für Öffentliche Sicherheit gehört und mit der SyS zusammengearbeitet. Nach wie vor pflegte sie die persönlichen Kontakte, die sie damals geknüpft hatte. Dass sie und Saint-Just mit gleicher Leidenschaft Hausmächte errichteten (wenn auch aus unterschiedlichen Beweggründen), verschlimmerte die Lage in vielerlei Hinsicht. Wenigstens erhielt Pierre dadurch Gelegenheit, Saint-Just und Ransom gegeneinander auszuspielen, indem er ihre überlappenden ›Geschäftsbereiche‹ in empfindlicher und manchmal bedenklicher Balance hielt, soweit dies seine eigene Position stärkte und nicht unterminierte.
»Ich vermag Cordelias Bedenken durchaus nachzuvollziehen, Rob«, beantwortete Saint-Just nach längerem, gewichtigen Schweigen Pierres unausgesprochene Frage. Er lehnte sich vom Konferenztisch zurück und faltete die Hände in einer Weise, die ihn noch mehr als sonst wie einen harmlosen, unscheinbaren Onkel wirken ließ. »Mehr als fünf T-Jahre lang haben wir versucht, jedermann einzureden, die Flotte sei für das Harris-Attentat verantwortlich. Obwohl wir so gut wie alle befehlshabenden Offiziere aus der Zeit vor dem Staatsstreich ›entfernt‹ und damit zahlreiche Beförderungen ermöglicht haben, hat es uns bei ihren Nachfolgern nicht viele Freunde gemacht, dass an Bord jedes einzelnen Flottenschiffs einer meiner Kommissare tätig ist. Ob wir es uns nun eingestehen wollen oder nicht – wenn man politischen Agenten, die man, wenn wir ehrlich sind, ›Spione‹ nennen sollte, die Autorität verleiht, jeden Befehl von Berufsoffizieren zu widerrufen, dann darf man sich nicht wundem, dass unsere Flotte ein Fiasko nach dem anderen einfährt. Das Offizierskorps weiß das. Wenn Sie nun noch die vielen Offiziere hinzunehmen, die wir ›zur Ermunterung der anderen‹ hinrichten oder einsperren ließen, könnten Sie wohl anführen, dass wir der Flotte nicht ausgerechnet jetzt die sprichwörtliche Faust aus dem Nacken nehmen sollten; Sie könnten diese Entscheidung in Zweifel ziehen – obwohl die Flotte uns vor LaBœuf den Hals gerettet hat. Ich meine, geben wir uns keinen Illusionen hin: Im Vergleich mit den Levellers sieht praktisch jeder gut aus. Vergessen Sie auch nicht, dass das Programm der Levellers forderte, alle Offiziere mit höherem Rang als ein Lieutenant Commander beziehungsweise Major zu erschießen, weil der ›militärisch-industrielle Komplex den Krieg auf verräterische Weise fehlerhaft geführt hat‹. Wer garantiert uns denn, dass die Flotte uns gegen jemanden beistehen würde, der diesbezüglich – sagen wir: weniger entschieden auf tritt?«
Saint-Justs Tenorstimme klang milde und farblos, trotzdem wurde Ransoms Blick hart, denn sie bemerkte das unausgesprochene ›Aber‹ hinter seinen Ausführungen. Auch Pierre registrierte, dass Saint-Just noch nicht zum Schluss gekommen war, und sah ihn nachdenklich an.
»Aber verglichen mit unseren Alternativen?«, forderte er Saint-Just leise zum Weitersprechen auf.
Der Minister für Systemsicherheit zuckte mit den Schultern. »Angesichts unserer Alternativen fürchte ich, dass wir keine andere Wahl haben. Die Manties waschen unseren Flottenkommandeuren einem nach dem anderen den Kopf, und wir geben unseren Leuten die Schuld daran. Nach einer Weile ist das nicht nur schlechte Propaganda, sondern auch eine schlechte Strategie. Sehen wir doch den Tatsachen ins Auge, Cordelia« – Saint-Just richtete seinen unaufdringlichen Blick auf seine goldhaarige Amtskollegin – »der Öffentlichen Information fällt es zunehmend schwerer, unseren ›kühnen Verteidigern‹ an der Heimatfront den Rücken zu stärken, wenn wir gleichzeitig genauso viele von ihnen über die Klinge springen lassen, wie uns von den Manties zusammengeschossen werden!«
»Das mag wohl sein«, entgegnete Ransom, »aber das ist nicht so schlimm und längst nicht so gefährlich wie zuzulassen, dass das Militär einen Fuß in die Tür zum Komitee bekommt.« Sie richtete die zwingende Macht ihrer Persönlichkeit ganz auf Pierre. »Wenn wir einen Militär ins Komitee aufnehmen, wie wollen wir dann verhindern, dass er oder sie etwas herausbekommt, was die Streitkräfte niemals erfahren dürfen? Zum Beispiel, wer die Regierung Harris wirklich beseitigt hat?«
»Die Chance dafür ist sehr gering«, erklärte Saint-Just nüchtern. »Zum einen hat es niemals einen greifbaren Beweis gegeben, dass wir dahinter stecken; abgesehen von sehr wenigen Leuten, die alle in das Unternehmen verwickelt gewesen sind, ist keiner mehr übrig, der unsere Version der Geschehnisse anzweifeln könnte.« Er lächelte sie frostig an. »Wer etwas weiß – und noch am Leben ist -, würde sich mit einer Aussage selbst belasten. Darüber hinaus habe ich dafür gesorgt, dass alle Dossiers der Systemsicherheit die offizielle Version wiedergeben. Jeder, der versucht, die Last dieser vielen ›objektiven Beweise‹ in Frage zu stellen, müsste wohl ein konterrevolutionärer Volksfeind sein.«
»Eine sehr geringe Chance ist nicht das gleiche wie gar keine Chance«, widersprach Ransom.
Ihr Einwand klang schärfer als gewöhnlich, denn trotz ihrer großen Talente als Manipulantin war sie allen Ernstes von der Stichhaltigkeit des Konzepts der Volksfeinde überzeugt, und ihr Argwohn gegenüber allem Militärischen grenzte an Besessenheit. Obwohl sie ständig Kriegspropaganda ersann, welche die Tugenden der Volksflotte als Beschützer der Volksrepublik rühmte, brannte in ihr ein geradezu krankhafter, persönlicher Hass auf die Streitkräfte. Voller Abscheu verachtete Ransom das Militär als überkommene und zudem dekadente Institution, dessen Traditionen es noch immer mit dem alten Regime verbanden und vermutlich dazu inspirierten, den Sturz des Komitees zu planen und die Herrschaft der Legislaturisten zu restaurieren. In Ransoms Augen ließen sich die wiederholten Fehlversuche, den Feind zurückzuschlagen und die Republik zu retten, auf einen grundlegenden Mangel an politischer Zuverlässigkeit zurückführen. Zu ihrer Ablehnung gesellte sich die starke Furcht, dass die Streitkräfte das Komitee ausgerechnet dann im Stich lassen könnten, wenn die Regierung das Militär am dringendsten benötigte. Diese Paranoia der Informationsministerin geriet nach Pierres Auffassung allmählich außer Kontrolle, und tatsächlich waren ihre antimilitärischen Vorurteile ein weiterer Grund für seinen Entschluss, als Gegengewicht zu ihr einen Vertreter der Streitkräfte in das Komitee für Öffentliche Sicherheit aufzunehmen.
Robert Stanton Pierre hatte schon oft darüber nachgedacht, wie seltsam es war, dass sich Ransoms Hass ausgerechnet gegen das Militär richtete. Anders als er hatte sie vor der Revolution im vollziehenden Arm der Bürgerrechtsunion gedient und fast vierzig T-Jahre lang im Kampf gestanden. Aber sie hatte nicht etwa gegen das Militär gekämpft, das sich so gut wie nie in innenpolitische Angelegenheiten einmischte, sondern gegen das Amt für Innere Abwehr. Deshalb hätte Pierre eigentlich erwartet, dass Ransoms leidenschaftlicher Hass sich gegen diesen Apparat und seine Folgeinstitution richtete. Gerade das war jedoch nicht der Fall. Mit Oscar Saint-Just, dem ehemaligen zweiten Mann der Inneren Abwehr, arbeitete sie Hand in Hand und schien weder ihm noch irgendeinem Angehörigen der Systemsicherheit eine frühere Verbindung zur InAb vorzuhalten. Vielleicht tut sie das nicht, dachte Pierre, weil Ransom und die InAb damals das gleiche Spiel nach den gleichen Regeln gespielt haben. Zwar waren sie Feinde gewesen, aber Feinde, die einander verstanden, während Ransom als Ex-Terroristin die Rituale, Traditionen und Wertvorstellungen der militärischen Gemeinschaft weder zu begreifen noch ihnen irgendwelche Sympathien entgegenzubringen vermochte.
Was auch immer die Ursachen für Ransoms Haltung waren – weder Pierre noch Saint-Just teilte ihre giftige Intensität. Dass es Feinde des Komitees gab, bestritt keiner von beiden; für deren Existenz existierten unumstößliche Beweise. Doch im Gegensatz zu Ransom verstanden sie klar zwischen dem Komitee für Öffentliche Sicherheit und der Volksrepublik von Haven zu unterscheiden und konnten militärische Fehlschläge hinnehmen, ohne sie als unwiderlegbaren Beweis für verräterische Umtriebe zu betrachten. Das vermochte Ransom nicht. Vielleicht, überlegte Pierre, sind Oscar und ich wesentlich pragmatischere Naturen als Cordelia. Oder entstand der Zwist dadurch, dass Saint-Just und er etwas aufzubauen versuchten, während sich Cordelia noch immer mit dem Niederreißen des Althergebrachten beschäftigte? Persönlich hegte Pierre den Verdacht, dass sich die zwei stärksten Motive Cordelias gegenseitig verstärkten: nämlich Egoismus und Verfolgungswahn. Sie war von der Vorstellung besessen, das Volk, das Komitee für Öffentliche Sicherheit und Cordelia Ransom müssten am Ende eins werden. Wer sich irgendeinem Teil ihrer persönlichen Dreifaltigkeit widersetzte – oder ihn enttäuschte – stand offenbar dem Ganzen feindlich gegenüber. Deshalb verlangte Cordelias Selbsterhaltungstrieb von ihr, unablässig wachsam zu sein und alle Volksfeinde aufzustöbern und zu vernichten, bevor diese sich gegen sie wenden konnten.
»Und selbst wenn Ihre ›Legende‹ bis in alle Ewigkeit standhält«, fuhr sie energischer fort, »wie können Sie auch nur in Betracht ziehen, jemandem aus dem Offizierskorps zu vertrauen? Sie haben es selbst gesagt: Wir haben zu viele von ihnen getötet und zu viele andere – mitsamt deren Familien – verschwinden lassen. Das werden sie uns niemals verzeihen!«
»Ich glaube, Sie unterschätzen die Macht des Eigeninteresses«, antwortete Pierre anstelle des SyS-Chefs. »Ganz gleich, wem wir ein Stück vom Kuchen anbieten: er hat fortan genug gute Gründe, uns im Sattel zu halten. Zum einen wird jeder wissen, dass er bereits größere Kompromisse eingehen musste, um den Posten zu erhalten, und dass aller Einfluss, den er besitzt, unserer Billigung unterliegt. Und wenn wir den Offizieren etwas entgegenkommen, …«
»… werden sie glauben, er habe das bewirkt, und dann haben sie noch mehr Grund, loyal zu ihm zu stehen und nicht zu uns!« Ransoms Tonfall kam mittlerweile einem Keifen gleich.
»Möglich«, gab Pierre zu, »vielleicht aber auch nicht. Wir werden streng darauf achten, dass wir es sind, die seinen Rat in die Tat umsetzen, und wir werden dies deutlich machen.« Ransom öffnete erneut den Mund, doch Pierre hob die Hand und brachte sie mit der Geste zum Schweigen – zumindest vorläufig. »Ich will nicht bestreiten, dass unserem Auserwählten auch ein Teil der Anerkennung zufallen wird. Anfangs könnte man ihm sogar beinah alle Veränderungen als alleiniges Verdienst anrechnen. Aber wenn wir diesen Krieg noch gewinnen wollen, dann müssen wir unser Militär motivieren – sonst erhalten wir nichts außer tumber Sklavenarbeit. Das Konzept der Kollektiven Verantwortung‹ haben wir mit einigem Erfolg angewendet – schließlich«, er lächelte dünn, »ist es ein starker Ansporn, wenn man weiß, dass die eigene Familie für etwaiges Versagen gleich mitbestraft wird. Leider ist dieses Konzept jedoch auch kontraproduktiv, denn es ruft zwar Gehorsam hervor, aber keinerlei Bindung. Indem wir die Familien der Befehlshaber bedrohen, betrachten sie uns neben den Manties ebenfalls als Feind. Manche sehen in uns vielleicht sogar den schlimmeren Gegner, denn die Manties versuchen lediglich, unsere Befehlshaber im Gefecht zu töten, aber sie bedrohen nicht deren Kinder oder Ehepartner.
Unter den gegebenen Umständen wäre es also höchst unvernünftig zu erwarten, dass das Offizierskorps uns irgendwelches Vertrauen entgegenbringt. Meiner Ansicht nach zeigen die jüngsten Fehlschläge, dass wir uns in den Augen unserer Offiziere ›rehabilitieren‹ müssen, wenn wir von ihnen verlangen, dass sie eine effektive – eine motivierte – Streitmacht bilden. Wir hatten schon einmal unglaubliches Glück mit der Flotte: dass man nämlich nicht einfach dagestanden und zugesehen hat, wie die Levellers uns überrollten. Ich möchte Sie daran erinnern, dass nur ein einziges Großkampfschiff – nur eines, und das gehörte nicht einmal zur Zentralflotte – genügend Initiative und Mut aufbrachte, um ohne Befehl einzugreifen. Wenn die Rousseau sich aus allem herausgehalten hätte, dann wären Sie und Oscar und ich bereits tot. Auf solche Hilfe können wir kein zweites Mal hoffen, wenn wir nicht eindeutig klarstellen, dass wir uns unserer Schuld gegenüber unseren Rettern bewusst sind. Und dazu sehe ich nur eine einzige Möglichkeit: Wir müssen dem Militär eine Stimme auf höchster Ebene zugestehen, dafür sorgen, dass Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften erfahren, was wir entschieden haben. Dieser Stimme müssen wir tatsächlich eine gewisse Aufmerksamkeit schenken – wenigstens nach außen hin.«
Ransom wölbte die Augenbrauen, ansonsten wirkte ihr Gesichtsausdruck wie eingefroren. »Nach außen hin?«, wiederholte sie.
Pierre nickte. »Nach außen hin. Oscar und ich haben bereits über eine Rückversicherung gesprochen, nur falls unser zahmer Kampfhund außer Kontrolle gerät. Oscar?«
»Ich habe jeden der Offiziere überprüft, die Rob vorgeschlagen hat«, erklärte der SyS-Chef. »Ihre Dienstakten und die Berichte ihrer Volkskommissare zu bearbeiten ist nicht allzuschwer. Wir können jeden einzelnen von ihnen als weißen Ritter erscheinen lassen, wenn wir ihn oder sie der Öffentlichkeit präsentieren. Alle sind auf ihrem Gebiet sehr tüchtig und haben genügend Zeitbomben in der Führungsakte. Jede dieser Zeitbomben können wir auslösen, wann immer wir wollen, und jede einzelne zerreißt den Helden buchstäblich in der Luft. Natürlich«, er lächelte schwach, »zöge ich es vor, dass der fragliche Offizier schon tot wäre, wenn wir mit diesen Bomben an die Öffentlichkeit gehen. Einem Toten fällt es erfahrungsgemäß sehr schwer, Vorwürfe zu entkräften.«
»Ich verstehe.« Nun lehnte sich Ransom zurück, massierte sich eine Weile nachdenklich das Kinn und nickte langsam. »Schön, ein guter erster Schritt«, gab sie zu. Sie klang nach wie vor mürrisch, aber nicht mehr unnachgiebig. »Allerdings möchte ich mir diese ›Zeitbomben‹ vorher etwas näher ansehen. Wenn wir eine Marionette wollen, gegen die wir jederzeit Anklage erheben können, dann muss die Öffentliche Information ihre Vernichtung schon im Vorfeld behutsam präparieren. Schließlich wollen wir doch alle vermeidbaren Ungereimtheiten ausschließen, nicht wahr?«
»Das ist kein Problem«, versicherte ihr Saint-Just. Dennoch wirkte Ransom nach wie vor unzufrieden; plötzlich hörte sie auf, sich das Kinn zu reiben, straffte den Rücken und beugte sich über den Tisch zu Pierre vor.
»So weit, so gut, Rob«, sagte sie, »aber Ihr Vorschlag birgt ein gewaltiges Risiko, das möchte ich noch einmal betonen. Ganz egal, wie wir Ihren Plan durchführen, wir geben damit kein eindeutiges Signal. Ich meine, gerade erst haben wir Admiral Girardi hinrichten lassen, weil er Trevors Stern verloren hat, und trotz all unserer Erklärungen gegenüber den Proles wissen wir, dass er nicht die Alleinschuld trug.«
Dieses Zugeständnis einem Raumoffizier gegenüber, so unbedeutend es auch sein mochte, überraschte Pierre ein wenig, vielleicht musste selbst eine Cordelia Ransom zugeben, dass tote Männer keinen Verrat mehr planen können.
»Die hohen Offiziere der Flotte sind da sowieso anderer Meinung«, fuhr Ransom fort. »Sie sind davon überzeugt, wir hätten Girardi nur erschießen lassen, um dem Pöbel zu ›beweisen‹, dass die Niederlage nicht unsere Schuld gewesen ist. Selbst Mannschaftsdienstgrade missbilligen, dass wir ihn zum ›Sündenbock‹ gemacht haben! Ich vermag nicht zu erkennen, wie Ihr Vorschlag binnen absehbarer Zeit solche Positionen verändern soll.«
»Nun, Sie wissen ja auch nicht, wen ich vorschlagen will!«, rief Pierre aus und setzte sich ohne ein weiteres Wort; er grinste sie nur an. Ransom bedachte ihn mit einem wütenden Blick und versuchte vorzutäuschen, dass sein Spiel mit ihrer Ungeduld nicht funktioniere. Leider wussten sie beide, dass das Gegenteil der Fall war. Fast eine Minute verstrich, dann hob sie resigniert die Schultern.
»Also sagen Sie’s sch- n!«
»Esther McQueen«, antwortete Pierre, und Ransom setzte sich blitzschnell aufrecht hin.
»Das kann doch nicht Ihr Ernst sein!«, fauchte sie, und als Pierre daraufhin nur den Kopf schüttelte, verfinsterte sich ihr Gesicht. »Besser wäre das aber, verdammt noch mal! Verflucht, Oscar! McQueen!« Der Blick, den sie Saint-Just zu warf, hätte den SyS-Chef eigentlich auf der Stelle in Brand setzen müssen. »Diese Frau ist ohnehin schon verdammt populär. Ihre eigenen Spione melden doch, wie ehrgeizig sie ist und dass sie eigene Pläne verfolgt. Wollen Sie allen Ernstes vorschlagen, jemandem einen geladenen Pulser in die Hand zu drücken, von dem wir wissen, dass er bereits kurz vor dem Amoklauf steht?«
»McQueens Ehrgeiz könnte sich letztendlich als unser treuester Verbündeter erweisen«, entgegnete Pierre, bevor Saint-Just antworten konnte. »Jawohl, Brigadier Fontein hat uns gewarnt, dass die Bürgerin Admiral eigene Ziele verfolgt. Genauer gesagt, hat sie mehrmals versuch!, unter ihren Flaggoffizierskameraden ein geheimes Netz zu errichten. Diese Bemühungen sind allerdings von wenig Erfolg gekrönt gewesen, ihre Kameraden wissen nämlich so gut wie wir, was sie im Schilde führt. Die meisten von ihnen sind viel zu verschüchtert, um den Kopf zu heben, und der Rest betrachtet McQueen sowohl als eine Art Politikerin wie auch als Offizier. Angesichts der Endgültigkeit, mit der heutzutage auf dem politischen Parkett gespielt wird, trauen die Militärs keinem Neueinsteiger über den Weg, auch nicht, wenn er aus den eigenen Reihen kommt. Wenn wir andererseits McQueen einen Platz am Tisch zugestehen, dann wird ihr gerade dieser Ehrgeiz alle Gründe liefern, um den Fortbestand des Komitees – und damit ihrer eigenen Machtgrundlage – sicherzustellen.«
»Pah!« Ransom entspannte sich ein wenig, verschränkte die Arme vor der Brust und dachte nach. Wieder wiegte sie den Kopf, langsamer und nachdenklicher als zuvor. »Nun gut«, sagte sie, »nehmen wir an, Sie lägen in dieser Beziehung richtig. McQueen wäre trotzdem eine Gefahr für uns. Der Pöbel sieht sie als die Heldin, die das Komitee vor den Levellers gerettet hat – und das halbe Komitee glaubt mittlerweile, sie könne auf dem Wasser wandeln! Dabei wissen wir nicht einmal, ob sie überhaupt beabsichtigt hat, uns alle zu retten. Wenn die Pinasse nicht abgestürzt wäre … vielleicht hätte McQueen weitergemacht und uns gleich mit in die Luft gejagt!«
»Könnte sein, aber das glaube ich keinen Augenblick lang«, entgegnete Pierre mit größerem Nachdruck als gerechtfertigt. »Das Komitee verfügt durch den Quorumsbeschluss immerhin über eine Legitimation und regiert seit sechs T-Jahren die Republik. Welche Machtgrundlage wäre McQueen geblieben, wenn sie uns ausradiert hätte? Bedenken Sie: Nur ihr eigenes Flaggschiff hat eingegriffen, alle anderen ließen sie im Stich, obwohl sie damit nur ihre Pflicht tat. Bei einem eventuellen Coup d’État hätte McQueen keinesfalls auf die Unterstützung der restlichen Flotte bauen können – eben weil sie im Ruch steht, politische Ziele zu verfolgen.«
»Es kommt mir vor, als versuchten Sie mehr sich selbst davon zu überzeugen als mich«, brummte Ransom finster. »Und selbst wenn Sie recht hätten – entkräften Sie mit Ihrer Logik nicht die eigenen Argumente, ihr einen Sitz am Tisch zu geben? Wenn der Rest des Offizierskorps sie als politisch ambitioniert betrachtet, warum sollten wir dann ausgerechnet diese Leute auf unsere Seite ziehen können, indem wir McQueen ins Komitee berufen?«
»Weil wir, ob McQueen nun politische Ambitionen hegt oder nicht, keinen besseren Kommandeur haben als sie, und das wissen die anderen Flaggoffiziere auch«, erklärte Saint-Just. »Man misstraut nicht McQueens Tüchtigkeit, Cordelia – nur ihren Motiven. Eigentlich könnten wir es uns besser gar nicht wünschen: ein Offizier mit einer Befähigung, die alle Kameraden anerkennen, und dem Makel der politischen Ambition, der sie von den ›richtigen‹ Raumoffizieren abgrenzt.«
»Wenn McQueen so verdammt gut ist, warum haben wir dann Trevors Stern verloren?«, erkundigte sich Ransom, und Pierre fuhr sich mit der Hand über den Mund, um sein Lächeln zu verbergen. Cordelias Ministerium hatte aus Trevors Stern eine Art metaphorisches Bollwerk für die gesamte Volksrepublik gemacht – ein ›Bis hierher und nicht weiter‹ zwischen den Sternen, einen Punkt, von dem aus ein Rückzug nicht einmal erwogen werden konnte. Auf Pierres Bitten, sie möge die Rhetorik ein wenig im Zaume halten, war sie nicht eingegangen. Gewiss hatte das Trevor-System eine außerordentliche strategische Bedeutung besessen, und die militärischen Folgen seines Verlustes hatten Pierre den ersten Anstoß versetzt, einen Repräsentanten der Volksflotte ins Komitee aufzunehmen. Doch im Verhältnis zur gewaltigen Ausdehnung der Volksrepublik war auch Trevors Stern letzten Endes entbehrlich. Worauf das Komitee hingegen nicht verzichten konnte, waren öffentliche Moral und der Kampfeswille der Volksflotte – und beides hatte einen heftigen Schlag auf die Nase bekommen, als die ›letzte Walstatt zwischen den Sternen‹ der königlich-manticoranischen 6. Flotte zum Opfer fiel.
»Wir haben Trevors Stern verloren«, sagte er zu Ransom, »weil die Manticoraner bessere Schiffe haben und ihre Technik der unsrigen überlegen ist. Zudem werden Manticores befehlshabende Offiziere immer beschlagener, während es unseren Kommandeuren oft an Erfahrung mangelt – dank unserer Gepflogenheit, besiegte Admirale hinzurichten.«
Ransom riss ob der sarkastischen Bemerkung die Augen auf, und Pierre lächelte sie bissig an.
»McQueen konnte das System zwar nicht halten, aber sie hat den Manties schwere Verluste zugefügt. Angesichts der relativen Größe unserer Flotte erleidet die Allianz proportional höhere Verluste als wir – zumindest gilt das bis zum letzten, entscheidenden Gefecht. Während der Auseinandersetzungen haben die Kommandanten unserer Schiffe und die jüngeren Geschwaderchefs ebenfalls sehr viel gelernt, und wir haben rund ein Drittel von ihnen im Rotationsverfahren in die Heimat versetzt, damit sie ihr Wissen weitergeben. Trotzdem war es schon vor einem Jahr offensichtlich, dass White Haven am Ende Trevors Stern kassieren würde. Deshalb habe ich McQueen abgelöst und Girardi dorthin geschickt – damit er die Konsequenzen trägt.« Ransom blickte ihn erstaunt an, und Pierre zuckte die Achseln. »McQueen wollte ich auf keinen Fall verlieren, und in Anbetracht unserer Vorgehensweise wäre mir keine andere Wahl geblieben, als sie erschießen zu lassen, wenn sie zum Zeitpunkt der unausweichlichen Eroberung immer noch Systemkommandeurin von Trevors Stern gewesen wäre.« Er grinste spöttisch. »Nach den Aufregungen im vergangenen Monat bin ich geneigt zu glauben, dass ich in diesem Krieg keinen brillanteren Zug gemacht habe.«
»Pah!«, rief Ransom noch einmal, ließ sich wieder zurücksinken und blickte angespannt auf die Tischplatte, die aus edlem Kristallglas bestand. »Und Sie sind sich wirklich sicher, dass Sie McQueen für diese Aufgabe wollen? Ich muss Ihnen nämlich eins sagen: Je mehr Sie betonen, wie tüchtig sie ist, desto nervöser werde ich.«
»Tüchtigkeit auf dem eigenen Gebiet ist eine Sache; für unser Metier braucht man andere Talente«, entgegnete Pierre selbstsicher. »Was das Verständnis der Politik angeht, so übertreffen McQueens Ambitionen ihren Horizont bei weitem. Sie wird eine ganze Weile brauchen, bis sie begriffen hat, wie die Regeln auf unserer Seite der Straße lauten. Oscar und ich werden sie nicht aus den Augen lassen. Sobald wir den Eindruck erhalten, dass sie allmählich den Bogen raus hat – nun, Unfälle lassen sich nie ganz vermeiden …«
»Und welche negativen Gedanken bei ihrer Wahl auch aufkommen mögen«, fügte Saint-Just hinzu, »sie ist eine bessere Kandidatin als der nächste in der Warteschlange.«
»Und wer wäre das?«, fragte Ransom.
»Wenn unsere Raids auf den manticoranischen Handelsverkehr in Silesia nicht nach hinten losgegangen wären, dann wäre Javier Giscard eine noch bessere Wahl gewesen als McQueen. Aber wie es im Moment aussieht, bleibt er für absehbare Zeit untragbar. Seine politischen Ansichten sind weitaus akzeptabler als die McQueens – Kommissarin Pritchard lobt ihn nach wie vor in höchsten Tönen. Um fair zu bleiben: Was geschehen ist, war nicht seine Schuld. Aber wir haben ihn abgelöst, und er steht für sein ›Versagen‹ noch immer unter Bewährung.« Ransom legte den Kopf schräg, und Saint-Just zuckte mit den Schultern. »Eine reine Formsache – er ist viel zu gut, als dass wir ihn erschießen sollten, es sei denn, uns bleibt überhaupt keine andere Wahl. Doch selbst ihn können wir nicht über Nacht rehabilitieren.«
»Gut, das sehe ich ein«, nickte Ransom, »aber Sie haben mir nur verraten, wer nicht der nächste Kandidat sein wird.«
»Verzeihen Sie«, entschuldigte sich Saint-Just, »ich bin vom Thema abgekommen. Um Ihre Frage also zu beantworten, McQueens einziger ernstzunehmender Konkurrent heißt Thomas Theisman. Er ist zwar erheblich dienstjünger als sie, aber er ist auch der einzige Flaggoffizier, der aus dem Unternehmen Dolch mit dem Ruf eines Kämpfers hervorging. In den Schlachten um Trevors Stern hat er sich ausgezeichnet, bevor wir ihn abzogen. Seine Verteidigung von Seabring ist einer der wenigen Siege, derer wir uns bisher überhaupt rühmen können. Während die Flotte ihn als Strategen und Taktiker respektiert, war er stets sehr sorgfältig darauf bedacht, völlig unpolitisch zu bleiben.«
»Und das soll ein Nachteil sein?« Ransom klang erstaunt, und Pierre blickte sie kopfschüttelnd an.
»Begehen Sie keinen Denkfehler, Cordelia«, schalt er sie milde. »Wenn er unpolitisch bleibt, kann er dafür nur einen Grund haben: dass er nichts für uns übrig hat. Vielleicht scheut er das politische Parkett aufgrund der dort lauernden Gefahren, aber jemand mit seinem Werdegang kann kein Idiot sein. Nur ein Idiot würde nämlich übersehen, wie viele hübsche kleine Möglichkeiten es doch gibt, um uns zu signalisieren, er sei ein gehorsamer, lieber Junge. Diese Signale müssten nicht einmal aufrichtig gemeint sein, trotzdem würde es ihn rein gar nichts kosten, sie zu senden.«
»Mit dieser Einschätzung stimmt sein Volkskommissar überein«, stimmte Saint-Just zu. »Bürger Kommissar LePics Berichte stellen klar, dass er Theisman als Mensch und Offizier respektiert und dass für ihn kein Zweifel an Theismans Treue zur Republik besteht. Demgegenüber hat er uns jedoch gewarnt, dass Theisman mit etlichen Aspekten unserer Politik alles andere als zufrieden ist. Der Admiral sei sorgfältig darauf bedacht, nicht darüber zu sprechen, aber seine Haltung verrät sich eben doch.«
»So ist das also«, knurrte Ransom erheblich grimmiger als zuvor.
»Auf jeden Fall wäre Theisman vom professionellen Standpunkt aus akzeptabel«, sagte Pierre rasch, um nicht die Kontrolle über das Gespräch zu verlieren, bevor Ransom sich in eine ihrer Verdächtigungstiraden hineinsteigerte. »Aber er ist ein Brutus, und wir brauchen einen Cassius. McQueens Ehrgeiz macht sie zwar gefährlicher, aber Ehrgeiz ist erheblich berechenbarer als Prinzipienreiterei.«
»Dagegen lässt sich nichts einwenden«, brummte Ransom. Wieder starrte sie düster auf den Tisch, dann nickte sie knapp. »Also schön, Rob. Ich sehe, dass Sie und Oscar diese McQueen ins Komitee holen wollen, ganz gleich, was ich dagegen einwende, und ich muss zugeben, dass Ihre Argumente ansatzweise Sinn ergeben. Aber behalten Sie McQueen gut im Auge. Das letzte, was wir gebrauchen könnten, wäre eine ehrgeizige Admiralin, die einen echten Militärputsch zustande bringt und uns stürzt.«
»Dann wären wir uns allerdings selber auf den Leim gegangen«, meinte Pierre.
»Aber nach allem, was Sie gerade sagten, muss ich mir nicht nur um McQueen große Sorgen machen, sondern auch um Theisman«, fuhr Ransom fort. »Denn wenn ich richtig verstanden habe, übernimmt er McQueens Platz, sobald sie zu politischen Aufgaben abgestellt wird, weil er nach Einschätzung des Offizierskorps der beste Kommandeur der Volksflotte ist?« Als Saint-Just nickte, vertiefte sich ihr Stirnrunzeln. »In diesem Fall halte ich es für das Beste, wenn ich mir Admiral Theisman persönlich sehr genau ansehe.«
»Sie meinen mit ›persönlich‹, dass Sie die Sache selbst in die Hand nehmen?«, erkundigte sich Pierre in gezielt beiläufigem Tonfall.
»Vielleicht.« Ransom zupfte sich an der Unterlippe. »Augenblicklich ist er im Barnett-System stationiert?«
»Er ist Systemkommandeur«, sagte Saint-Just. »Schließlich braucht die DuQuesne-Basis einen guten Befehlshaber.«
Ransom nickte zustimmend. Mit der Eroberung von Trevors Stern hatte die Manticoranische Allianz zwar einen nahezu unüberwindlichen Keil zwischen das Herz der Volksrepublik und das Barnett-System gestoßen, doch die gewaltige Infrastruktur der DuQuesne-Basis und der anderen Militäranlagen im System blieben in havenitischer Hand. Barnett war von Anfang an als Startpunkt für den unausweichlichen Krieg gegen Manticore ausersehen gewesen, und das legislaturistische Regime hatte zwanzig T-Jahre investiert, um dieses Konzept in die Tat umzusetzen. So gern die Manticoraner es wohl getan hätten, es war unmöglich, ein Sonnensystem abzuschneiden, und eine Bastion, die so stark war wie Barnett, konnten sie nicht in ihrem Rücken dulden. Im Gegensatz zu den Schiffen der Seeflotten vermochte ein Sternenschiff jedem Abfangversuch leicht auszuweichen, wenn es seine Route durch den Hyperraum sorgfältig plante. Haven konnte daher jederzeit Nachschub und auch Verstärkung zur DuQuesne-Basis bringen, und obwohl durch solche Umwege Zeit verlorenging, erreichten die Schiffe Barnett letztendlich unbeschadet.
Die Manticoraner hingegen konnten Barnett mit geringem Zeitverlust anlaufen. Während ihre 6. Flotte mit der Eroberung von Trevors Stern beschäftigt war, hatten sich andere alliierte Kampfverbände die Ablenkung der Volksflotte zunutze gemacht und die vorgeschobenen Basen Treadway, Solway und Mathias genommen. Am ärgerlichsten daran war, dass die Flottenwerften im Treadway-System praktisch unbeschadet in Feindeshand gefallen waren; von entscheidender Bedeutung jedoch war, dass die Manticoraner den Bogen von Basen durchbrachen, die Barnetts südöstliche Flanke geschützt hatten … Hinzu kam der Verlust von Trevors Stern. Dank der Eroberung dieses Systems hatte die Royal Manticoran Navy auch den letzten Terminus des Manticoranischen Wurmlochknotens in ihre Gewalt gebracht, und nun konnten Geleitzüge und Kampfverbände direkt und ohne Zeitverzögerung vom Doppelstern Manticore bis zu Trevors Stern springen und sich von Norden auf das Barnett-System stürzen.
Im Grunde kämpfte Barnett also auf verlorenem Posten. Andererseits hatten die Manticoraner bei der Eroberung von Trevors Stern hohe Verluste in Kauf nehmen müssen. Die Royal Manticoran Navy brauchte Zeit, um sich zu reorganisieren und Atem zu schöpfen, aber sobald sie wieder marschbereit wäre, würde hoffentlich Barnett ihre Aufmerksamkeit wecken und sie vom Herzen der Republik ablenken; der Feind sollte sich wieder auf die Grenze konzentrieren. Dazu aber musste Barnett so lange gehalten werden wie irgend möglich, auch wenn es sich dabei nur um ein Ablenkungsmanöver handelte. Ein Täuschungsmanöver, das allerdings die Hand eines kompetenten Systembefehlshabers erforderte.
»Ihren Worten entnehme ich, dass Sie nicht beabsichtigen, Theisman im Barnett-System zu lassen, bis die Basis in Flammen steht«, bemerkte Ransom nach einem Augenblick, woraufhin Pierre nickte. »In diesem Fall werde ich einen kurzen Abstecher nach Barnett machen, um mir einen persönlichen Eindruck von Theisman zu verschaffen«, sagte sie. »Letztendlich muss die Öffentliche Information verarbeiten, was dort geschieht, und wenn er mir politisch zu unzuverlässig erscheint, lassen wir ihn vielleicht doch dort zurück – und schreiben ein ergreifendes Epos über seinen heroischen und doch zum Scheitern verurteilten Opfergang, mit dem er die heranstürmenden manticoranischen Horden abzuwehren versucht hat. Von der Sorte: ›Theisman stellt sich zum letzten Gefecht‹.«
»Wenn Ihnen nicht gerade etwas auffällt, was LePic in all den Jahren entgangen wäre, ist Theisman zu wertvoll, um ihn zu opfern«, gab Saint-Just zu bedenken.
»Oscar, für ein kaltherziges Schreckgespenst sind Sie mir manchmal zu zimperlich«, widersprach Ransom ernst. »Nur beseitigte Risiken sind annehmbare Risiken, ganz gleich, wie ungefährlich sie erscheinen mögen. Für eine Flotte, die so oft die Fresse poliert bekommt wie unsere, kann ein Offizier als toter Held erheblich wertvoller sein denn lebend. Außerdem bereitet es mir besondere Freude, potentielle Bedrohungen in Propagandavehikel zu verwandeln.«
Sie verzog die Lippen zu jenem dünnen, kalten, gierigen Lächeln, das selbst Oscar Saint-Just einzuschüchtern vermochte, doch Pierre tat ihre Worte mit einem Achselzucken ab. Was Theismans Wert anging, hatte Oscar recht. Pierre war es völlig egal, wie gern und mit welcher Lust Cordelia den Admiral vernichtet hätte – er beabsichtigte nicht, ihr den Mann ohne weiteres vorzuwerfen. Andererseits war Cordelia der Liebling der Proles, das Sprachrohr und der Bezugspunkt ihrer Gewaltausbrüche. Wenn Ransom entschlossen war, Theismans Kopf neben die anderen Trophäen an ihrer Wand zu hängen, so würde Pierre ihn ihr überlassen – besonders, wenn ihm dieser Zug die Unterstützung Cordelias (und damit des Amts für Öffentliche Information) einbrachte, um McQueen ins Komitee für Öffentliche Sicherheit zu berufen. Nicht, dass er beabsichtigt hätte, diesen Handel offen vorzuschlagen.
»Drei Wochen hin, drei Wochen zurück«, erklärte er statt dessen. »Können Sie es sich leisten, Haven so lange zu verlassen?«
»Wieso nicht?«, entgegnete Ransom. »Für die nächsten zwei, drei Monate wollen Sie doch keine weitere Plenarsitzung des Komitees anberaumen, oder?« Als er verneinte, breitete sie die Hände aus. »Also brauchen Sie und Oscar meine Stimme nicht, um die Maschine in Gang zu halten, und ich habe die Tepes so ausstatten lassen, dass das Schiff als mobile Kommandozentrale für die Öffentliche Information dienen kann. Nichts und niemand schreibt vor, dass unsere Propaganda hier auf Haven ihren Ausgang nehmen und sich nach draußen verbreiten muss. Mein Stellvertreter kann während meiner Abwesenheit die Routineentscheidungen treffen, und neues Material produzieren wir dann auf der Tepes. Sobald ich die Beiträge gesichtet und freigegeben habe, geben wir sie in die Provinznetze und verbreiten sie von der Grenze nach innen statt vom Zentrum nach außen.«
»Also gut«, stimmte Pierre nach kurzem Überlegen zu. »Wenn Sie sich selbst ein Bild von der Lage verschaffen möchten und zuversichtlich sind, die Aufgaben der Öffentlichen Information von dort wahrzunehmen, dann können wir Sie wohl für die Dauer der Reise entbehren. Achten Sie nur darauf, genügend starke Sicherheitskräfte mitzunehmen.«
»Das werde ich«, versprach Ransom. »Dazu eine komplette technische Kolonne des Ministeriums. Wir werden sehr viele Originalaufnahmen machen und Flottenangehörige interviewen – Material, das wir veröffentlichen können, sobald das System gefallen ist … dergleichen eben. Wenn wir Barnett schon nicht halten können, dann sollten wir aus seinem Verlust doch wenigstens so viele Vorteile ziehen wie irgend möglich!«
1
An diesem Tag hing besonders viel Staub in der Luft. Obwohl die Schwermetallkonzentrationen nicht ausreichten, um einen gebürtigen Grayson zu beunruhigen, waren sie doch hoch genug, um jedem Fremdweltler ernste Sorgen zu bereiten.
Der Admiral der Grünen Flagge Hamish Alexander, Dreizehnter Earl von White Haven und designierter Chef der 8. Flotte (falls diese sich am Ende doch noch zusammenfand), war auf dem Planeten Manticore geboren, und die Hauptwelt des Sternenkönigreichs barg in der Planetenkruste nicht solch hohe Anteile toxischer Elemente. Weil White Haven als einziges Mitglied der Entourage auf dem Landeplatz eine Atemmaske trug, kam er sich ein wenig exotisch vor. Andererseits hatte ihm der Dienst im Weltraum eines beigebracht: schädliche Umwelteinflüsse niemals auf die leichte Schulter zu nehmen und er diente nun schon fast ein Jahrhundert lang dem Sternenkönigreich. Deshalb war er durchaus bereit, ein wenig exotisch zu wirken, wenn er dafür kein Cadmium und kein Blei einzuatmen brauchte.
Zudem trug außer ihm niemand auf dem ganzen Landeplatz die weltraumschwarz-goldene Uniform der Royal Manticoran Navy. Rund die Hälfte der übrigen Anwesenden waren Zivilisten, darunter auch die beiden einzigen Frauen; letztere steckten in traditioneller graysonitischer Damenmode: Kleider, die bis zu den Fußknöcheln reichten und lange Westen, die an Wappenröcke erinnerten. Die eine Hälfte der Uniformierten stellte die beiden Grüntöne der Harringtoner Gutsgarde zur Schau, die andere die beiden Blautöne der Grayson Space Navy. Selbst Lieutenant Robards, White Havens Adjutant, war ein Grayson. Anfänglich hatte dies den Admiral ein wenig irritiert, denn er war gewöhnt, dass Angehörige verbündeter Raumflotten zu Gast ins Sternenkönigreich kamen. Sich ihnen auf ihrem eigenen Terrain zu präsentieren, stellte für ihn eine völlig neue Erfahrung dar. Jedoch hatte er sich mit dieser ungewohnten Konstellation erstaunlich rasch abgefunden, weil sie Sinn ergab: Die Achte sollte die erste alliierte Flotte werden, die aus überwiegend nicht-manticoranischen Einheiten bestand. Angesichts der ›Seniorität‹ der manticoranischen Navy hatte von vornherein festgestanden, dass der Flottenchef aus ihren Reihen kommen würde, doch gut zwei Drittel ihrer Sternenschiffe sollten aus der rasant expandierenden GSN und der erheblich kleineren Erewhon Navy stammen. Daher musste White Haven als ›CO 8 FLT (DESIGNIERT)‹ seinen Stab zwangsläufig um einen graysonitischen Kern aufbauen, und genau damit hatte er die letzten anderthalb Monate zugebracht.
Alles in allem hatten ihn die Entdeckungen durchaus beeindruckt, die er dabei gemacht hatte. Durch die Expansion war das Offizierskorps der GSN sehr dünn verteilt tatsächlich waren rund zwölf Prozent aller Offiziere in Diensten der graysonitischen Navy zeitweilig überstellte Manticoraner. Obwohl die institutionelle Unerfahrenheit der GSN häufig zutage trat, erschien sie White Haven im Ganzen auf geradezu aggressive Weise befähigt. Graysonitische Geschwader- und Kampfverbandchefs gaben sich mit dem Leistungsniveau ihrer Offiziere nicht so schnell zufrieden, weil sie ganz genau wussten, wie rasch diese auf den gegenwärtigen Rang befördert worden waren. Gnadenlos drillten sie ihre Untergebenen, und sowohl ihre taktischen als auch ihre Manöverbefehle wurden in einer Ausführlichkeit erteilt, die für manticoranische Gewohnheiten fremdartig wirkte. Solch starre Verhaltensregeln führten manchmal Resultaten, die für White Havens Geschmack zu mechanisch waren. Er war in der manticoranischen Tradition herangewachsen, nach der ab einem bestimmten Dienstalter von Offizieren erwartet wurde, dass sie nicht erst auf spezifische Anweisungen von Vorgesetzten warteten, sondern sich selbständig mit den Einzelheiten befassten. White Haven gestand einer jungen Navy wie der von Grayson durchaus zu, ausführlichere Befehle zu benötigen. Wenn die graysonitischen Flottenmanöver manchmal auch einen mechanischen Eindruck erweckten, so hatte White Haven andererseits bei der GSN noch nicht jene Sorte von Desastern erlebt, die mitunter auftraten, wenn ein Flaggoffizier irrtümlich annahm, seine Untergebenen hätten verstanden, was er beabsichtigte.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!