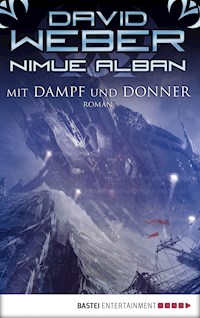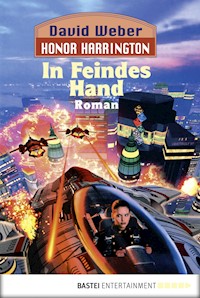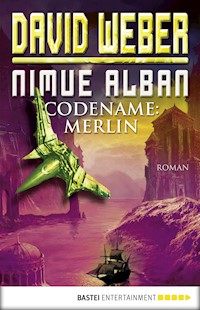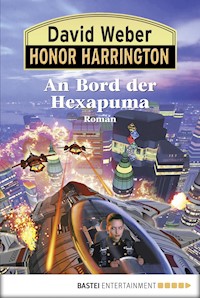9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Nimue-Reihe
- Sprache: Deutsch
Cayleb Ahrman hat die größte Seeschlacht der Menschheitsgeschichte gewonnen. Sein Land Charis ist ein Ort des Friedens. Wenn nicht die Kirche wäre: Ihre mächtige Flotte wird bald mit neuen Waffen gegen Charis auslaufen. Doch weiß die Kirche nichts von Caylebs Berater, dem Kriegsmönch Merlin. Der ist nämlich in Wahrheit ein Cyborg mit Wissen über modernste Kriegsführung...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 756
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
März, im Jahr Gottes 894
.I.- HMS Dancer, vor der Thairmahn-Halbinsel, Südozean
.II. - Gipfelhaus, Provinz Gletscherherz, Republik Siddarmark
.III. - HMS Chihiro, Gorath Bay, Königreich Dohlar
.IV. - Kahsimahr-Gefängnis, Stadt Manchyr, und Klippenhaus, Stadt Vahlainah, Grafschaft Craggy Hill
.V. - Kaiserlicher Palast, Stadt Cherayth, Königreich Chisholm
.VI. - Rhobair Duchairns Privatkapelle, der Tempel, Stadt Zion, die Tempel-Lande
April, im Jahr Gottes 894
.I. - Königlicher Palast, Stadt Talkyra, Königreich Delferahk
.II. - Rhobair Duchairns Arbeitszimmer, der Tempel, Stadt Zion, die Tempel-Lande
.III. - Pater Paityr Wylsynns Arbeitszimmer, Goldmark-Straße, Stadt Tellesberg, Altes Königreich Charis
.IV. - Das Schloss, Lock Island, der Schlund, Altes Königreich Charis
.V. - Zitadelle King's Harbour, Helen Island, Howell-Bay, Altes Königreich Charis
.VI. - Kathedrale von Manchyr, Stadt Manchyr, Fürstentum Corisande
.VII. - Das Klippenhaus, Stadt Vahlainah, Fürstentum Craggy Hill, Fürstentum Corisande
Mai, im Jahr Gottes 894
.I. - HMS Chihiro, Gorath Bay, Königreich Dohlar
.II. - HMS Dancer, vor der Klaueninsel, Harchong-See
.III. - HMS Dancer, vor der Fundinsel, Golf von Dohlar
.IV. - HMS Chihiro, Gorath Bay, Königreich Dohlar
.V. - HMS Squall, Hankey-Sund, Königreich Dohlar
Juni, im Jahr Gottes 894
.I. - Königlicher Palast, Stadt Manchyr, Fürstentum Corisande
.II. - Vor der Dracheninsel, Hankey-Sund, Königreich Dohlar
.III. - HMS Kaiserin von Charis, Tellesberg, Altes Königreich Charis
.IV. - HMS Chihiro, Gorath Bay, Königreich Dohlar
.V. - HMS Dancer, Fundinsel, Golf von Dohlar
.VI. - HMS Ahrmahk, Charis-See, und HMS Dawn Wind, Carters Ozean
.VII. - Erzbischöflicher Palast, Stadt Tellesberg, Altes Königreich Charis
Juli, im Jahr Gottes 894
.I. - König Gorjahs Schlafgemach, Königlicher Palast, Stadt Tranjyr, Königreich Tarot
.II. - Merlin Athrawes' Aufklärer-Schwebeboot, über der Howell Bay, Altes Königreich Charis
.III. - Kaiserlicher Palast, Stadt Tellesberg, Altes Königreich Charis
August, im Jahr Gottes 894
.I. - HMS Dancer, Harchong-See
.II.- HMS Rakurai, Golf von Dohlar
.III. - HMS Dancer, Golf von Dohlar
.IV. - Kathedrale von Tellesberg, Stadt Tellesberg, Altes Königreich Charis
.V. - Östlich der Harchong-Meerenge, Golf von Dohlar
.VI. - Kaiserlicher Palast, Stadt Tellesberg, Altes Königreich Charis
September, im Jahr Gottes 894
.I. - Sir Koryn Gahrvais Stadtvilla und Königlicher Palast, Stadt Manchyr, Fürstentum Corisande
.II. - Stadt Telitha, Telith Bay, Grafschaft Storm Keep, Fürstentum Corisande
.III. - Kaiserlicher Palast, Stadt Tellesberg, Altes Königreich Charis
.IV. - Der Tempel, Stadt Zion, die Tempel-Lande
.V. - HMS Royal Charis, Stadt Tellesberg, Altes Königreich Charis
Oktober, im Jahr Gottes 894
.I. - HMS Royal Charis, Zebediah-See, HMS Ahrmahk, Charis-See, und HMS Destroyer, Thol Bay
.II. - HMS Destiny, vor dem Terrence-Kap, Golf von Mathyas, und Arbeitszimmer des Herzogs Kholman, Stadt Iythria, Desnairianisches Reich
.III.- HMS Ahrmahk, Markovianische See
.IV. - HMS Destroyer, Larek, Howell Bay, Altes Königreich Charis
November, im Jahr Gottes 894
.I. - NGS Schwert Gottes, vor der Windmoor-Küste, Golf von Tarot
.II. - HMS Ahrmahk, Golf von Tarot, und Kaiserlicher Palast, Cherayth, Königreich Chisholm
.III. - Vor der Windmoor-Küste, Golf von Tarot
.IV. - Kaiserlicher Palast, Stadt Cherayth, Königreich Chisholm
Charaktere
Glossar
Eine Anmerkung zur Zeitmessung auf Safehold
Über den Autor
David Weber ist ein Phänomen: Ungeheuer produktiv (er hat zahlreiche Fantasy- und Science-Fiction-Romane geschrieben), erlangte er Popularität mit der HONOR-HARRINGTON-Reihe, die inzwischen nicht nur in den USA zu den bestverkauften SF-Serien zählt. David Weber wird gerne mit C. S. Forester verglichen, aber auch mit Autoren wie Heinlein und Asimov. Er lebt heute mit seiner Familie in South Carolina.
David Weber
NIMUE ALBAN:
HAUS DERLÜGEN
Aus dem Amerikanischen vonUlf Ritgen
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
© 2010 by David Weber
Titel der Originalausgabe: »A Mighty Fortress« (Teil 2)
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2011/2014 by Bastei Lübbe AG, Köln
This work was negotiated through
Literary Agency Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen,
on behalf of St. Martin’s Press, L.L.C.
Textredaktion: Beate Ritgen-Brandenburg
Lektorat: Ruggero Leò
Titelillustration: © Arndt Drechsler, Regensburg
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
E-Book-Produktion: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-1106-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für Bobbie Rice
Warte auf uns, Schwieger-Omi!
Wir vermissen dich,
aber Sharon, die Kinder und
ich kommen nach.
März,im Jahr Gottes 894
.I.
HMS Dancer, vor der Thairmahn-Halbinsel, Südozean
Trotz des gleißenden Sonnenlichts war es kühl an Deck von HMS Dancer. Ein frischer Ostwind trug sie unaufhörlich nach Westen. Man hörte den Wind in der Takelage singen und die Wellen gegen den Rumpf schlagen, das Rauschen des Wassers, wenn der Bug hineintauchte. Die Galeone fuhr fast mit Höchstgeschwindigkeit. Der Wind kam von Steuerbord achteraus. Da alle Segel gesetzt waren, einschließlich der Oberbram, machte die Dancer fast zehn Knoten. Das war eine beachtliche Geschwindigkeit für eine Galeone, selbst für eine, die vor noch nicht einmal zwei Monaten die Werft verlassen hatte. Wie bei jeder Galeone der Imperial Charisian Navy war auch der Rumpf der Dancer unter der Wasserlinie mit Kupfer beschlagen. Das schützte den Rumpf vor dem Befall durch Bohrer. Diese Muschelart zerfraß nur allzu oft die Planken eines Schiffes, ohne dass es aufgefallen wäre (jedenfalls nicht, bis dem Schiff förmlich der Rumpf wegbrach). Zugleich verhinderte der Kupferbeschlag auch übermäßigen Algenbewuchs, der ein Schiff erschreckend viel Geschwindigkeit kosten konnte. Natürlich vermochte nichts die Alterung des Rumpfes zu verhindern. Doch das Kupfer verlieh der Dancer auch in dieser Hinsicht einen beachtlichen Vorteil. Daher war sie schneller als die meisten Schiffe, auf die sie stoßen mochte. Das galt auch so weit von der Heimat entfernt wie eben jetzt, im Golf von Dohlar.
Trotzdem könnte sie noch mehr Fahrt aufnehmen, wäre sie allein unterwegs, dachte Admiral Sir Gwylym Manthyr. Er ging gerade auf der Galerie auf und ab, die sich über die gesamte Breite des Hecks erstreckte. Schiffe, die im Konvoi fuhren, waren immer langsamer als bei Einzelfahrt. Denn jedes Schiff besaß nun einmal seine Eigenheiten, und so besaß jedes Schiff auch seinen eigenen idealen Kurs zum Wind. Selbst Schwesterschiffe aus ein und derselben Werft, für das Auge nicht zu unterscheiden, verhielten sich Wind und Wellen gegenüber immer ein wenig unterschiedlich. Sie benötigten immer etwas anders geartete Bedingungen, um Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Ein Kapitän, der sein Schiff so gut kannte, wie das für Captain Raif Mahgail galt, wusste genau, wie man die Dancer dazu bringen konnte, ihr Bestes zu geben. Doch wenn Schiffe gemeinsam fuhren, dann musste man sich unabhängig von Wind- und Wetterbedingungen immer an die Geschwindigkeit des langsamsten Begleiters anpassen.
Solange Manthyr das Kommando über HMS Dreadnought innegehabt hatte, das Flaggschiff des damaligen Kronprinzen Cayleb, waren solche Überlegungen für ihn nur hypothetischer Natur gewesen. Es hatte nicht zu den Aufgaben eines einzelnen Captains gehört, auch nicht des Flaggschiff-Kommandeurs, über die nächste Aufgabe der ganzen Flotte zu entscheiden. Oder sich darum zu kümmern, wie lange es dauerte, um sämtliche Schiffe einer Flotte von einem Punkt zum nächsten zu bringen.
Aber Manthyr war jetzt nicht mehr nur Kommandeur des Flaggschiffs.
Die Dreadnought hatte er im Darcos-Sund verloren. Diese Erinnerung schmerzte immer noch. Er hatte das Schiff geliebt, und dennoch hatte er sie gezielt in eine corisandianische Galeere hineingesteuert. Unter allen Segeln, die man nur setzen konnte, hatte er das gegnerische Schiff gerammt. Obwohl er genau mit dem Bug getroffen hatte, war die Dreadnought doch zu schnell gewesen. Die Wucht des Aufpralls hatte fast alle Fugen aufplatzen lassen. Zudem war ihr Bug gute zwanzig Fuß tief in den Rumpf des gegnerischen Schiffes eingedrungen. Sie hatte auch unter der Wasserlinie zu viel Schaden genommen, um noch gerettet werden zu können, allen Bemühungen der Mannschaft zum Trotz. Manthyr hatte gewusst, dass ihm dieses Ramm-Manöver sein Schiff kosten könnte. Doch nichts von alledem war der Grund, warum die Erinnerung an den Verlust der Dreadnought so schmerzlich war. Manthyr quälte, dass er zu spät gekommen war. Seine Mannschaft und er hatten alles Menschenmögliche getan. Dennoch waren sie zehn Minuten zu spät gekommen. Zehn Minuten. Wären sie nur diese zehn Minuten früher da gewesen, hätten sie das Leben ihres Königs noch retten können.
Gwylym Manthyr wäre bereit gewesen, ein ganzes Dutzend Galeonen auf den Meeresgrund zu schicken, hätte er sich damit die zehn fehlenden Minuten erkaufen können.
Ohne es zu bemerken, war er stehen geblieben. Die Hände an der Reling der Heckgalerie, starrte er ins Kielwasser der Dancer. Er hob den Blick, sah hinaus auf die unermessliche Weite des Südozeans und riss sich zusammen. Der Einzige, der ihm vorwarf, zu spät gekommen zu sein, war er selbst. Das wusste er genau. Seine Erhebung in den Ritterstand, seine Beförderung vom Captain zum Admiral sprachen für sich. Seines derzeitigen Auftrags als Vertrauensbeweis in seine Fähigkeiten hätte es also nicht bedurft.
Sein Geschwader operierte am weitesten von Charis entfernt: Um die große Flottenbasis auf Lock Island zu erreichen, wäre Manthyr zwei Monate unterwegs. Das Geschwader bestand aus achtzehn Kriegsgaleonen, sechs Schonern und nicht weniger als dreißig Transportern. Bislang hatten Wind und Wetter sich in unberechenbarem Maße freundlich gezeigt. Manthyr war seinem Zeitplan um beinahe zwei Fünftage voraus und befand sich nun einige Hundert Meilen südlich der Thairmahn-Halbinsel. Das Geschwader umrundete die Südspitze des Kontinents Howard und steuerte die Gosset-Passage zwischen der Westbreak-Insel und der Westspitze der ungleich größeren Insel an, die überall nur das ›Ödland‹ hieß. Von dort aus sollte es dann in die Harthianische See weitergehen. Damit wäre Manthyr dann neuntausend Meilen weit von Lock Island entfernt – Luftlinie. Nun, kein Schiff vermochte durch die Luft zu fliegen! Um diesen Punkt zu erreichen, hatte Manthyrs Geschwader mehr als fünfzehntausend Meilen zurücklegen müssen, und vor ihnen lagen noch fünftausend weitere. Derart weit von seinen Vorgesetzten entfernt, war Manthyr ganz auf sich allein gestellt. Deutlicher ließ sich nicht zeigen, dass besagte Vorgesetzte immenses Vertrauen in ihn setzten und auch auf sein Urteilsvermögen bauten, egal, wie er selbst über sein Scheitern im Darcos-Sund denken mochte. Schließlich verfügte Manchyr hier nur über die Ressourcen, die er an Bord seiner eigenen Schiffe mit sich führte – und die, die er sich zu ›organisieren‹ verstand. Aber Anleitung oder Empfehlungen fand er hier nirgendwo.
Damit unterschied er sich keineswegs von allen anderen Kapitänen, die sich mit ihrem Kriegsschiff im eigenständigen Einsatz befanden. Letztendlich war jeder Kapitän in einer solchen Situation ganz auf sich allein gestellt. Jede Entscheidung wollte allein getroffen und verantwortet sein. Im Nachhinein gäbe es wahrscheinlich auch immer jemanden, der zu dem Schluss käme, die getroffene Entscheidung sei falsch, und es auch lauthals verkündete. Das aber war der Preis, den ein jeder zu zahlen hatte, der ein Schiff Seiner Majestät des Königs (oder jetzt eben des Kaisers) befehligte.
Trotzdem, dachte Manthyr und ließ den Blick über die gewaltigen, dunkelblauen Weiten schweifen, muss ich zugeben, dass ich, als ich noch einfacher Captain war, nie richtig eingeschätzt habe, um wie viel … komplizierter alles wird, wenn man erst einmal Flaggoffizier ist.
Er verzog das Gesicht zu einem schiefen Grinsen. Schon vor langer Zeit hatte er gelernt, dass Standpunkte veränderlich waren. Als Midshipman hatte er gedacht, ein Captain wäre Gott und die Lieutenants Erzengel. Als Lieutenant hatte er allmählich begriffen, dass ein Captain nur unmittelbar nach Gott kam, aber in Autorität und Macht den Erzengeln relativ gleichgestellt war. Als Manthyr selbst zum Captain aufgestiegen war, verstand er schließlich – dieses Mal richtig –, welche Verantwortung ein Captain als Gegenleistung für seine allmächtige Autorität auf See zu schultern hatte. Doch nun, da er Admiral war, begriff er, dass es von allen Offizieren ein Flaggoffizier am schlechtesten hatte. Ja, sie hatten viel Macht: Sie befehligten Geschwader und Flotten, nicht bloß Schiffe. Sie wiesen an, sie verwalteten, sie entwickelten Strategien. Das ganze Gewicht der Verantwortung für Sieg oder Niederlage lastete auf ihnen. Dennoch waren sie dabei auf andere angewiesen: Sie mussten sich darauf verlassen, dass andere ihre Pläne in die Tat umsetzten und ihren Befehlen Folge leisteten. Nur bis es zur Schlacht kam, waren sie die Götter der Flotte. Aber in der Schlacht waren Admiräle plötzlich nur noch unbeteiligte Zuschauer. Passagiere. In ihrer Macht stand es zwar, viele Schiffe zu befehligen, ja. Aber sie selbst würden nie wieder ein eigenes Schiff haben. Erst langsam begann Manthyr zu begreifen, wie schmerzlich das war.
Ach, jetzt hör aber auf, Gwylym! Rau lachte er in sich hinein. Wenn du das wirklich so siehst, kannst du ja immer noch darum bitten, dass man dir diesen hübschen Admiralswimpel wieder abnimmt! Oder hättest ihn gleich ablehnen können! Alles hat seinen Preis, und das wusstest du schon lange, bevor du dein Patent erhalten hast. Glaubst du wirklich, irgendjemand nimmt dir ab, dass du in Wirklichkeit gar nicht tun willst, was du gerade jetzt hier draußen treibst? Das glaubst du doch selbst nicht!
Nein, wahrscheinlich nicht, ging es ihm durch den Kopf. Auf ein unmissverständliches Knurren seines Magens hin zog Manthyr seine Taschenuhr hervor.
Kein Wunder, dass er allmählich Hunger bekam! Schon vor zehn Minuten hätte er beim Essen sein sollen. Er zweifelte keinen Moment daran, dass Captain Mahgail und der Rest seiner Offiziere bereits in der Messe auf ihn warteten.
Noch ein Beweis für die Privilegien, die mit dem Rang kommen, dachte er, grinste erneut und klappte seine Taschenuhr zu. Er ließ die Reling los, richtete sich auf und sog noch einmal tief die klare Salzluft ein. Die sitzen alle da und warten auf mich, während ich in hochherrschaftlicher Pracht ganz allein hier herumstehe. Ich frage mich, wie viel Zeit sie mir noch zugestehen, bis sie Dahnyld nach mir losschicken, ganz respektvoll natürlich!
Manthyr musste sich eingestehen, dass ein winziger, gehässiger Teil versucht war, es auszuprobieren: Wie lange würde Dahnyld Rahzmahn, sein höchst effizienter Flaggleutnant, wohl noch warten, bis er seinen Admiral ach-so-diplomatisch darauf hinwiese, dass man in der Messe seiner harrte? Die Versuchung war nicht groß, aber doch zweifellos da – was nicht gerade für Manthyrs Charakter sprach.
Er grinste breit und schüttelte den Kopf.
Hat ja schon was, Admiral zu sein, was, Gwylym!, sagte er sich. Nur zu Kopf steigen sollte dir das nicht. Etwas in dieser Art hat Admiral Lock Island bei der Ausgabe der aktuellen Befehle ja wohl gemeint – natürlich in der ihm eigenen unnachahmlich diplomatischen Art!
Dieser Gedanke verwandelte Manthyrs Grinsen in schallendes Gelächter. Noch einmal schüttelte er den Kopf. Dann wandte er sich um und trat durch die verglaste Tür in sein Arbeitszimmer.
.II.
Gipfelhaus, Provinz Gletscherherz, Republik Siddarmark
»Wie lange, Eure Eminenz, bin ich nun schon Euer Kammerdiener?«
Nachdenklich blickte Zhasyn Cahnyr zu Fraidmyn Tohmys hinüber. Diese Art geduldig scheinenden Tonfalls kannte er nur zu gut.
»Schon eine ganze Weile«, gab er milde zurück. Tohmys verschränkte die Arme vor der Brust und blickte sein Gegenüber streng an.
Der Erzbischof von Gletscherherz saß vor einem herrlich prasselnden Kaminfeuer. Das Gipfelhaus, ein Stück außerhalb der Stadt Tairys, lag höher in den Bergen als die Stadt selbst. Vor vielen Jahren hatte einer von Cahnyrs Vorgängern auf dem Bischofsstuhl seiner Sommerresidenz diesen Namen gegeben. Selbstredend besaß das Gipfelhaus die bei Bauten in den Bergen übliche steile Dachstuhlkonstruktion (damit Schnee abrutschte und die Schneelast nicht zu groß würde). Nichtsdestotrotz war das relativ bescheidene Gebäude eigentlich nur für die Nutzung im Sommer gedacht. Es sollte ein Rückzugsort für den Erzbischof und einige ausgewählte Gäste sein, ein Ort für Einkehrtage und Besinnlichkeit. (Cahnyr vermutete, mindestens einer seiner Vorgänger hatte das Haus auch als hinreichend abgelegenen Schauplatz für ausschweifende Festlichkeiten und die eine oder andere Orgie genutzt. Es lag weit genug von den Wohnhäusern der Gemeindemitglieder entfernt, die ein derartiges Verhalten nicht gutgeheißen hätten. Skandale waren also schon deshalb nicht zu fürchten.) Das für den Sommer gedachte Gebäude, so wetterfest es auch sein mochte, war allerdings nicht darauf ausgelegt, im kältesten Monat eines East-Haven-Winters genutzt zu werden. Trotz des beachtlichen Kohlenfeuers im Kamin des Salons ließ die Temperatur in den Räumlichkeiten doch sehr zu wünschen übrig. Deswegen trug Cahnyr auch einen dicken Pullover über seiner schweren, wollenen Winter-Soutane.
Die Temperaturen waren geeignet, Cahnyrs Vorstellungskraft zu beschäftigen: Ob sich so ein großer Schinken im Kühlhaus fühlte?
»Seit dreiundvierzig Jahren, Eure Eminenz«, erklärte Tohmys nun. »So lange bin ich nun schon Euer Kammerdiener.«
»Ach, tatsächlich?« Cahnyr neigte den Kopf zur Seite. »Ja, Sie könnten Recht haben. Sonderbar. Irgendwie dachte ich, es wäre noch länger gewesen.«
Tohmys’ Augen blitzten auf. Vielleicht zuckten sogar seine Mundwinkel, dem gestrengen Blick zum Trotz. Vielleicht.
»Also, Eure Eminenz, ich hoffe, Ihr werdet mir meine Unverblümtheit nicht verübeln. Aber das hier ist von allen Schnapsideen, die Euch im Laufe der Jahre gekommen sind, mit Abstand die dümmste! Selbst eingedenk der ›kleinen‹ Feier, derentwegen Ihr beinahe aus dem Priesterseminar geflogen wäret!«
»Leider habe ich im Augenblick kaum eine andere Wahl, Fraidmyn«, erwiderte Cahnyr ernst. »Ich bedauere wirklich zutiefst, Sie in diese ganze Sache hineingezogen zu haben. Aber …«
Er zuckte mit den Schultern, und Tohmys stieß ein Schnauben aus.
»Meiner Erinnerung nach, Eure Eminenz, stand meine Begeisterung der Euren in nichts nach. Ich an Eurer Stelle würde mir nicht allein jede Schuld zuschreiben.«
»Nun, das stimmt wohl. Nur bin ich hier der Erzbischof. Es ist nicht recht, dass Sie unter einer meiner Entscheidungen zu leiden haben. Oder Sie hier oben zusammen mit mir festsitzen und darauf hoffen, dass der geheimnisvolle Briefschreiber wirklich meint, was er – zumindest andeutungsweise – verspricht.«
»Ach, und wo, glaubt Ihr, wäre ich jetzt lieber als hier?«, verlangte Tohmys zu wissen. »Wir sind beide erwachsene Menschen, Eure Eminenz, und Ihr braucht nun einmal jemanden, der sich um Euch kümmert – eine Aufgabe, die mir Gewohnheit geworden ist.« Er zuckte mit den Schultern. »Von welcher Warte aus auch immer betrachtet: Es hat nur wenig Sinn, geschehene Dinge zu bedauern. Und es hat noch viel weniger Sinn, etwas ändern zu wollen, was bereits geschehen ist.«
»Na ja …« Cahnyr lächelte, und aus unerfindlichen Gründen brannten seine Augen ein wenig. »Wenn Sie das so sehen, warum dann die plötzliche Kritik an meinen Plänen?«
»Also, was das betrifft: Hätten Sie überhaupt irgendwelche Pläne, die dieser Bezeichnung würdig wären, hätte ich sicher nichts gesagt.« Das zu glauben fiel Cahnyr ernstlich schwer. »Aber bislang, so scheint es mir zumindest, bestehen Eure Pläne darin, mitten in der Nacht, mitten in den Bergen, mitten im Winter einfach hier aufzutauchen und nichts bei sich zu haben als die Kleider, die Ihr tragt. Und dann hofft Ihr darauf, dass jemand, dem Ihr nie begegnet seid und dessen Namen Ihr nicht einmal kennt, hier auf Euch wartet. Trifft das in etwa den Kern der Sache, Eure Eminenz?«
»Ich halte das sogar für eine geradezu meisterhafte Beschreibung«, gestand der Erzbischof.
»Ach, und Ihr haltet das allen Ernstes für eine gute Idee?«, setzte Tohmys nach.
»Nein. Es ist einfach nur die beste Idee, die wir derzeit haben«, erwiderte Cahnyr. »Warum fragen Sie? Ist Ihnen etwa etwas Besseres eingefallen?«
»Nein, und es ist auch nicht meine Aufgabe, mir Besseres einfallen zu lassen!« Falls Cahnyrs Frage Tohmys aus dem Konzept gebracht hatte, so ließ er sich das nicht anmerken. Abgesehen davon wussten sie beide doch ganz genau, dass es seine erste Pflicht als Kammerdiener war, für Weltuntergangsstimmung zu sorgen. Ganz gewiss war es mitnichten seine Aufgabe, Vorschläge zu unterbreiten, wie man dem dräuenden Weltuntergang entgehen könnte. »Ich wollte nur sicher sein, die Lage richtig verstanden zu haben.«
»Das scheint mir durchaus der Fall«, gab Cahnyr bedächtig zurück.
»Nun gut, wenn dem so ist und Euer Entschluss offenkundig feststeht, sollte ich mich wohl um unser Gepäck kümmern, nicht wahr?«
Sehr viel später an diesem Tag erhob sich Zhasyn Cahnyr und blickte aus dem Schlafzimmerfenster. Es war spät am Abend, und das Gipfelhaus befand sich auf der Ostseite des Mount Tairys, des höchsten Gipfels der Tairys-Kette. Auch unter idealen Wetterbedingungen wäre daher zu dieser Stunde der Abend finsterster Nacht gewichen. Beim derzeitigen Wetter erkannte der Erzbischof kaum mehr als die Flocken des heftigen Schneetreibens. Sie tanzten durch den matten Schein der wenigen Laternen.
Sturm umtoste das Gipfelhaus, und trotz des Feuers, das immer noch im Kamin loderte, sah Cahnyr seinen eigenen Atem aufsteigen. Eine wahrhaft wunderbare Nacht, um zu erfrieren!, ging es ihm durch den Kopf.
Er drehte sich um und betrachtete das kleine Schlafgemach. In dieser Nacht würde er hier doch keinen Schlaf finden. Er verstand, warum seine Entscheidung, für Einkehrtage zum Gipfelhaus zu reisen, den jungen Gharth Gorjah so bestürzt hatte. Da waren die schlichte Einrichtung des Hauses, die kaum isolierten Wände und die Möglichkeit, dass sich genau die Sorte Wetter einstellte, die diese Nacht verhieß: Mehr war wohl kaum nötig, um sich Sorgen zu machen. Cahnyr musste auch zugeben, dass er zumindest einige der Sorgen, die Gorjah umtrieben, durchaus teilte. Andererseits wusste er etwas über das Gipfelhaus, über das sein offenkundig besorgter Sekretär gewiss nicht nachgedacht hatte. Nun, Gorjah hatte ja auch keinerlei Veranlassung, darüber nachzudenken. Schließlich hatte Cahnyr sorgsam darauf geachtet, den jungen Unterpriester nichts von den schweren Sorgen wissen zu lassen, die seinen Erzbischof niederdrückten. Was Gorjah Sorgen machte (ein alter Herr, der unbedingt einige Fünftage hoch oben in den Bergen verbringen wollte), trieb auch Bryahn Teagmahn um … der ganz gewiss nichts von den Besonderheiten des Gipfelhauses wusste.
Allerdings war es möglich, dass Bischof-Vollstrecker Wyllys von diesen Besonderheiten wusste, jenen Besonderheiten, die das Gebäude für Cahnyrs derzeitige Absichten so perfekt geeignet machten – trotz des Winterwetters. Bevor Cahnyr in den Stand eines Erzbischofs erhoben worden war, hatte Wyllys bereits acht Jahre lang Cahnyrs Vorgänger gedient. Während dieser Zeit hatte er das Gipfelhaus häufig genutzt, bevorzugt während der heißesten Sommertage. Daher war es durchaus möglich, dass Wyllys die gleiche Entdeckung gemacht hatte wie Cahnyr. Doch auch dann war es nicht wahrscheinlich, dass er auf dieselbe Idee gekommen war wie Cahnyr, was die Residenz betraf.
Nicht wahrscheinlich. Nun ja …
Cahnyr wusste nicht, ob der Bischof-Vollstrecker aktiv im Dienst der Inquisition stand. Eigentlich bezweifelte er es. Liebend gern sogar, und das war das Gefährliche daran: sein eigener Wunsch, Wyllys’ Loyalität gehöre mitnichten dem Großinquisitor. Cahnyr mochte Wyllys Haimltahn. Wyllys war fleißig, arbeitete mit Hingabe für die Erzdiözese und die Gemeinde, und er war bemerkenswert zurückhaltend, was das Einstreichen von Schmiergeldern betraf. Gut, auch er war nicht immun gegen die in der Kirche allgegenwärtige Korruption. Das wäre wohl auch zu viel erhofft gewesen. Schließlich wurde ja gewissermaßen von ihm erwartet, die eine oder andere Mark in die eigene Tasche zu wirtschaften. Es war betrüblich, aber allgemeine Praxis. Das Schatzamt des Tempels berücksichtigte Einnahmen dieser Art sogar bei der Bemessung der offiziellen Dienstbezüge.
Haimltahn war Teil eben dieses Systems – und das war alles, was Cahnyr ernstlich an seinem Bischof-Vollstrecker zu kritisieren hatte. Allerdings – auch das bedauerlich, aber nicht zu ändern – hatte Haimltahn nie durchblicken lassen, er wisse um die deutlich schlimmere Korruption im Herzen des Tempels oder sei gar bereit, sich ihr entgegenzustellen. Nicht, dass er diese Korruption gutgeheißen hätte. Zumindest dessen war sich Cahnyr sicher. Doch Wyllys Haimltahn war Bischof-Vollstrecker in der tiefsten Provinz, und man hatte ihn in eine der ärmsten Erzdiözesen in ganz East Haven geschickt. Er würde also niemals in Zion oder gar im Tempel selbst Dienst tun. Daher hatte er sich ganz auf seine Welt konzentriert und auf die Pflichten, die ihm in dieser Welt zukamen. Die Probleme der Großen und Mächtigen überließ er auch den Großen und Mächtigen.
Auch daraus konnte Cahnyr dem Bischof-Vollstrecker keinen Vorwurf machen. Dennoch hatte es keinerlei Basis für Vertraulichkeit in einer gewissen Sache zwischen ihnen gegeben. Also hatte Cahnyr Haimltahn wohl kaum fragen können, ob er vermute, aus welchem eigentlichen Motiv heraus der Erzbischof sich ins Gipfelhaus zurückzog.
Ach, Schluss jetzt!, schalt er sich. Zunächst einmal tust du Wyllys wahrscheinlich Unrecht, überhaupt nur darüber nachzudenken, ob er sich vielleicht mit Teagmahn verschworen hat. Zweitens: selbst wenn dem so wäre, hat sich Teagmahn ja ganz offenkundig nicht gegen deine Reise hierher ausgesprochen. Also weiß er entweder nichts von deinem kleinen Geheimnis, oder aber er vermutet keine Auswirkungen auf die derzeitige Lage.
Die Lage war ernst. Dennoch konnte Cahnyr nicht anders: Er schnaubte belustigt. Denn Teagmahns Reaktion auf die Entscheidung seines Erzbischofs, einige Tage im Gipfelhaus zu verbringen, ließ vermuten, dass der Intendant zu genau dem Schluss gekommen war, auf den Cahnyr auch gehofft hatte: Es war ganz im Sinne der Inquisition, wenn sich der Erzbischof in eine abgelegene Residenz zurückzog, die nur über eine einzige, sehr schmale Straße erreichbar war (eigentlich war es sogar mehr ein Feldweg). So wüsste Teagmahn von jedem Schritt, den der Erzbischof machte.
Und das stimmte ja auch … aber es war gänzlich bedeutungslos für Cahnyrs eigene Pläne. Wenn man sich bei dem, was er sich zurechtgelegt hatte, überhaupt von ›Plänen‹ sprechen durfte.
Es klopfte an der Tür zu seinem Schlafgemach, so leise, dass man es bei dem tosenden Sturm kaum hörte. Als die Tür sich leise öffnete, wandte sich Cahnyr vom Fenster ab.
»Es ist Zeit, Eure Eminenz«, sagte Fraidmyn Tohmys und reichte ihm eine schwere Winterjacke.
Gletscherherz lebte vom Bergbau. Das hatte es immer schon getan. Niemand wusste, wie viele Schächte, Stollen und Höhlen Generation um Generation von Bergarbeitern in das Gestein getrieben hatten. Natürlich gab es Karten und dergleichen. Aber niemand war töricht genug zu glauben, sie seien auch nur ansatzweise vollständig. Oder genau.
Der Stollen, der sich unter dem Felsbrocken befand, auf dem später das Gipfelhaus errichtet worden war, befand sich auf keiner einzigen jener Karten, und es existierten auch sonst keine Aufzeichnungen darüber. Der Stollen war sehr alt, und Cahnyr hatte sich schon oft gefragt, wer ihn wohl angelegt haben mochte. Es war ganz offenkundig, dass der Stollen ursprünglich einem Kohleflöz gefolgt war. Doch ebenso offenkundig war auch, dass sich dieses Flöz hier, unter dem Gipfelhaus, längst erschöpft hatte. Das Gipfelhaus aber war meilenweit vom Grauwasser oder dem Tairys-Kanal entfernt. Außerdem vermutete Cahnyr, dass dieses Bergwerk hier schon lange aufgelassen gewesen war, als der Kanal schließlich angelegt und die Schleusen im Fluss gebaut worden waren. Also musste es damals, als der Stollen noch ergiebig gewesen war, unfassbar anstrengend gewesen sein, diese Kohle zu verkaufen.
Doch im Augenblick war nur von Bedeutung, dass Zhasyn Cahnyr vor vielen, vielen Jahren, während eines Besuchs im Sommer, auf eine der verrotteten Planken getreten war, mit denen die Abzugsschächte dieser Mine abgedeckt waren. Unter seinem Gewicht war die Planke sofort geborsten, und Cahnyr war in die Tiefe gestürzt.
Der Abzugsschacht befand sich ganz in der Nähe eines Stollens, der unmittelbar unter dem Gipfelhaus endete. Deshalb war er nur dreißig, vielleicht auch vierzig Schritt lang. Damals war für Cahnyr noch viel wichtiger eines gewesen: Der Abzugsschacht war schräg angelegt, nicht senkrecht. Gewiss, bei dem Sturz hatte sich Cahnyr einige unschöne Prellungen zugezogen. Doch damals war er noch deutlich jünger gewesen, und die Neugier hatte recht rasch das Bedürfnis verdrängt, im Dunkeln sitzen zu bleiben, sich das aufgeschrammte Schienenbein zu reiben und Worte auszustoßen, die Mutter Kirche gewiss nicht gutgeheißen hätte. Also war Cahnyr in das Gipfelhaus zurückgekehrt und hatte Gharth Gorjah und Fraidmyn Tohmys zu sich gerufen. Beide kannten des Erzbischofs Begeisterung für Höhlen und unterirdische Gänge. Und so hatten sie einen Sack Kerzen, ein Stück Kreide und ein Knäuel Bindfaden zusammengepackt und waren aufgebrochen.
Cahnyr hatte keine Ahnung, warum er anderen gegenüber von seiner Entdeckung unter dem Gipfelhaus geschwiegen hatte. Ganz gewiss hatte er es nicht getan, weil er sich schon damals gedacht hatte, es geheim zu halten sei gewiss hilfreich, nur für den Fall, dass er eines Tages vor der Inquisition fliehen müsste. Und um ganz ehrlich zu sein: irgendjemandem gegenüber hätte er es erwähnen sollen, vor allem, weil er die Absicht hatte, sich noch weiter im Inneren dieses Berges herumzutreiben. Er war zwar nicht hier in Gletscherherz aufgewachsen, aber als erfahrener Höhlenforscher war ihm nur zu bewusst, welche Gefahren dort unten stets lauern konnten: Ein Gang konnte einstürzen; man konnte Schwierigkeiten mit Grubengas oder plötzlich einströmendem Wasser bekommen; man konnte einfach nur unglücklich fallen – Mutter Natur kannte viele Möglichkeiten, sich der Männer zu entledigen, die sie um ihre Reichtümer bestehlen wollten. Bisher war Cahnyr immer sehr vorsichtig gewesen. Nie zuvor war er allein auf Erkundungstour gegangen. Trotzdem hatte Cahnyr über all die Jahre hinweg seine Entdeckung für sich behalten.
Zum Teil, das hatte er später begriffen, lag das daran, wie herrlich still es in dieser Mine war. Völlig lautlos. Gut, der alte Kohlenstollen war etwas völlig anderes als die natürlichen Höhlen und Felsspalten, die Cahnyrs Höhlenforscherdrang geweckt hatten. Eigentlich war der alte Stollen auch nicht sonderlich interessant. Es war einfach nur ein sehr langes, sehr tiefes, sehr dunkles Loch im Boden.
Doch es war ein sehr, sehr altes Loch, und dieses Loch war von Menschenhand gemacht, nicht von Wasser, das sich mit unendlicher Geduld stets neue Wege suchte. Hier hatte der Erzbischof das Gefühl, in die Vergangenheit zu reisen, das Leben der Bergarbeiter kennen zu lernen, die Dutzende oder gar Hunderte von Jahren vor Cahnyrs Geburt hier unten gearbeitet hatten. Es war sonderbar, aber wahr: Für Cahnyr war der alte Stollen zu einer Kathedrale geworden. Die völlige Stille, die ihn hier umgab, bot ihm ideale Bedingungen, nachzudenken und die Gegenwart Gottes zu spüren. In vielerlei Hinsicht war dieser Ort hier für spirituelle Einkehrtage schlichtweg perfekt. Es war Cahnyrs eigener Rückzugsort, und er hatte ihn mit niemandem geteilt, außer mit seinem Sekretär, mit seinem Kammerdiener und mit Gott. Ausdrücklich aufgefordert, über diesen Ort Stillschweigen zu bewahren, hatte Cahnyr seine Mitarbeiter nie. Doch zweifellos wussten die beiden, wie sehr dem Erzbischof daran gelegen war, diesen Ort für sich zu behalten.
Allerdings hatte Cahnyr dort unten nicht ausschließlich meditiert. Tatsächlich hatte er so manche Stunde damit verbracht, das Gangsystem zu erkunden und sich die einzelnen Stollen und Schächte genau anzusehen. Das Gestein war zweifellos massiv, und das Holz der Grubenverzimmerung schien kaum verrottet zu sein. Damit bestand nicht die Gefahr, dass die Grube zur Todesfalle würde. Allerdings hatte Cahnyr einen bestimmten Nebenstollen sofort gemieden, nachdem er nur einen kurzen Blick auf die Stützbalken an der Decke geworfen hatte. Daneben gab es durch Wassereinbrüche unpassierbare Bereiche, was natürlich jegliche weitere Erkundung in diese Richtung verhinderte. Trotzdem hatte Cahnyr mehrere Meilen unter der Erdoberfläche zurückgelegt und die Wände dabei stets markiert. Und immer hatte er seinen Bindfaden ausgelegt, um im Notfall jederzeit auf dem kürzesten Weg wieder zurückzufinden.
Genau am Eingang jenes Stollens, den er vor so vielen Jahren entdeckt hatte, blieb Cahnyr nun stehen und klopfte sich mit den Handschuhen den Schnee von der Winterjacke. Der kurze Weg vom Gipfelhaus bis zum Eingang des Schachts war deutlich anstrengender gewesen, als Cahnyr gedacht hatte. Der Wind war noch heftiger als vermutet. Und die Temperatur sank immer noch. Am Tag nach ihrer Ankunft am Gipfelhaus hatte er zusammen mit Tohmys einen kleinen Bestand unerlässlicher Vorräte in den Schacht gebracht. Es war ganz offenkundig gut gewesen, damit nicht zu warten. Allein schon die Rucksäcke, die sie beide geschleppt hatten, wären bei diesem Wetter heute fast schon zu viel gewesen.
Nachdem Cahnyr sich nach Kräften abgeklopft hatte, streifte er einen Handschuh ab und zog sein Zunderkästchen hervor. Es war eisig kalt, und seine Hände zitterten so sehr, dass er deutlich länger brauchte als sonst, um die Blendlaterne zu entzünden. Aber nachdem endlich der Docht brannte, entschädigte ihn das Licht für die Anstrengung. Die meisten hätten den Anblick des kalten, nackten Gesteins kaum als angenehm empfunden. Doch Zhasyn Cahnyr war nicht wie die meisten Menschen, und die meisten Menschen auf Safehold wussten auch nicht, dass die Inquisition nur noch ein wenig abwartete, bevor sie mit ganzer Härte zuschlüge.
»Na ja, so weit, so gut!«, sagte er fröhlich.
»Ach ja?« Im Schein der Laterne blickte Tohmys ihn skeptisch an. »Und wie weit ist dieses ›so weit‹, Eure Eminenz?«
»Die Heilige Schrift lehrt uns, selbst die längste Reise beginne mit dem ersten Schritt«, erwiderte Cahnyr gelassen.
»Das stimmt wohl, Eure Eminenz, und ich werde den Erzengeln gewiss nicht widersprechen. Aber trotzdem will es mir scheinen, als lägen noch jede Menge weitere Schritte vor uns.«
»Nun, das, Fraidmyn, ist eine Auslegung, die der kirchlichen Lehre voll und ganz entspricht.« Cahnyr hob die Laterne und griff nach der Deichsel des kleinen, zweirädrigen Karrens, auf den sie ihre Vorräte geladen hatten. »Wollen wir?«, fragte er.
Mehrere Stunden später waren Cahnyr die Beine so schwer geworden wie noch nie.
Es war wirklich schon einige Zeit her, seit er das letzte Mal so tief in das Gangsystem vorgedrungen war. Er hatte dessen Ausdehnung ganz vergessen gehabt. Oder vielmehr: als er das letzte Mal hier gewesen war, war er noch deutlich jünger gewesen. Deswegen hatte er nicht daran gedacht, wie viel länger der Weg allein durch den Lauf der Jahre wurde. Es würde noch sehr, sehr lange dauern, bis Tohmys und er das andere Ende des Stollens erreichten. Wahrscheinlich hätte sich bis dahin der Tag seinem Ende zugeneigt.
Dieser Gedanke brachte ein müdes Lächeln auf Cahnyrs Lippen. Er saß auf dem Karren und kaute an dem Sandwich herum, das Tohmys ihm angeboten hatte. Das Brot war dick geschnitten, und das Fleisch, der Käse und die Zwiebeln waren einfach köstlich. Gern hätte er auch noch ein Blatt Salat darauf gewusst. Aber Salat bekam man im Winter in Gletscherherz nur sehr selten zu Gesicht. Seit Jahren dachte Cahnyr schon darüber nach, ob er nicht auf dem Gelände des Erzbischöflichen Palastes ein kleines Gewächshaus errichten lassen sollte. Eigentlich hatte er das schon längst in Angriff nehmen wollen. Aber jetzt …
Er verdrängte diesen Gedanken, zog seine Taschenuhr hervor und hielt sie weit genug in den Lichtkegel der Laterne, um sie ablesen zu können. Hier, so tief unter der Oberfläche, war es nur allzu leicht, die Zeit aus den Augen zu verlieren. Wenn man weder die Sonne noch den Himmel sehen konnte und auch nichts vom Wetter mitbekam, war es viel schwieriger, Zeitspannen abzuschätzen, als man vermuten sollte. Wenigstens herrschte in diesem Gangsystem stets die gleiche, unveränderliche Temperatur, auch wenn Cahnyr niemals so weit gegangen wäre, es ›warm‹ zu nennen. Aber obwohl Tohmys und er sich hier den Weg durch ein gewundenes Gangsystem bahnen mussten, kamen sie doch deutlich schneller voran, als wenn sie sich draußen, oberhalb der Mine, mitten im heulenden Schneesturm hätten ihren Weg suchen müssen. Trotzdem mussten sie ihr Ziel unbedingt zu dem Zeitpunkt erreichen, den der geheimnisvolle Briefschreiber angegeben hatte.
»Wir müssen weiter«, bemerkte Cahnyr also, nachdem er einen Bissen Sandwich gekaut und heruntergeschluckt hatte.
»Zweifellos.« Tohmys reichte ihm einen großen Krug mit Bier. »Und sobald Ihr dieses Sandwich aufgegessen habt, können wir das auch tun.«
»Ich kann gleichzeitig gehen und kauen«, gab Cahnyr milde zurück und stopfte die Uhr wieder in seine Tasche, um eine Hand für den Krug freizubekommen. »Ich kann sogar gleichzeitig gehen und schlucken, wenn ich mich ein bisschen konzentriere.«
»Dass Ihr das könnt, Eure Eminenz, bedeutet nicht, dass es Euch auch gut täte«, erwiderte sein gänzlich unbeeindruckter Diener. »Jetzt esst!«
Einen Moment lang blickte Cahnyr Tohmys nur an. Dann schüttelte er den Kopf und aß widerspruchslos weiter.
»Und: Hat uns die kleine Essenspause aus dem Zeitplan gebracht, Eure Eminenz?«
Für Fraidmyn Tohmys’ Verhältnisse war der Tonfall nur mäßig selbstzufrieden. Resignierend schüttelte Cahnyr den Kopf. Allerdings war es noch schlimmer, wenn – selten, aber durchaus vorgekommen – Tohmys nicht Recht hatte. Dann stieß selbst die Leidensfähigkeit eines Erzbischofs an ihre Grenzen.
»Nein, Fraidmyn, tatsächlich sind wir sogar ein wenig zu früh«, gestand er.
»Wer hätte das gedacht!«, murmelte Tohmys in sich hinein. Cahnyr tat, als habe er nichts gehört.
»Und was tun wir jetzt, Eure Eminenz?«, fragte der Kammerdiener nach einer kurzen Pause.
»Jetzt stecken wir unsere Köpfe hinaus und schauen, wie das Wetter ist«, entschied Cahnyr, griff wieder nach der Blendlaterne und machte sich daran, das eben Entschiedene in die Tat umzusetzen.
Am Ausgang aus dem Tunnel musste er sich ein wenig bücken. Von früheren Erkundungsgängen wusste Cahnyr, dass dieser Teil des Schachts erst recht spät entstanden sein dürfte: vermutlich viele Jahre, nachdem die eigentliche Mine aufgelassen worden war. Dieser Schacht war von außen in den Fels getrieben. Cahnyr hatte sich immer gefragt, wie enttäuscht die Leute, die ihn gegraben hatten, wohl gewesen waren, als sie zum alten Stollen durchbrachen und feststellen mussten, dass die Kohle, die sie zu finden gehofft hatten, längst abgebaut war.
Glücklicherweise hatten sie nicht allzu viel Arbeit leisten müssen, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Der ›neue‹ Schacht war kaum einhundert Schritt lang; zudem war er niedrig und nie richtig ausgebaut und abgestützt worden. Also war Vorsicht geboten, denn an den grob behauenen Wänden konnte man sich schmerzhafte Schürfwunden beibringen. Außerdem durfte Cahnyr dem Ausgang nicht zu nahe kommen, schließlich hielt er eine brennende Laterne in der Hand. Etwa fünfzehn Schritt vor dem Ausgang verengte er die Blende der Laterne zu einem schmalen Schlitz und tastete sich Schritt für Schritt weiter vor.
Mit jedem Schritt, der Cahnyr näher zum Ausgang brachte, wurde es kälter. Wieder sinnierte Cahnyr darüber, was den geheimnisvollen Briefschreiber dazu bewogen hatte, diesen abgelegenen Stolleneingang eines längst aufgelassenen Bergwerks als Treffpunkt auszuwählen. Gut, der Ort war durchaus mit Bedacht gewählt: eine bescheidene Poststation irgendwo in der tiefsten Provinz, zudem an der Kreuzung zweier unbedeutender, unbefestigter Bergsträßchen (eher Pfade als Straßen), die einander nur wie zum Gruß zunickten und sich sogleich wieder trennten. Obendrein war die Straßenführung verschlungen. Daher bevorzugten die meisten Reisenden die Hauptstraße, die dem Hauptmassiv der Tairys-Kette auswich. Auch wenn diese Verbindung länger war, führte sie doch durch ein Gebiet, das in der Provinz Gletscherherz als ›Niederung‹ durchging.
Einer der beiden Bergwege führte in südwestliche Richtung, zu den südlichen Ausläufern der Tairys-Kette und der Stadt Bergsee am Ufer des Gletschersees. Er wurde im Winter so gut wie gar nicht genutzt.
Im Winter dürfte in der Poststation sowieso nicht viel los sein. Die Eigentümer wären gewiss hocherfreut, überhaupt einen Gast aufzunehmen. Aber die Abgelegenheit der Station garantierte, dass niemand von dem Fremden erführe, bis das kleine Zeitfenster, das der geheimnisvolle Briefschreiber ausgewählt hatte, schon lange verstrichen wäre. Darüber hinaus lag besagte Station, vom Erzbischöflichen Palast aus betrachtet, nicht gerade günstig. Tatsächlich war sie von Tairys beinahe achtzig Meilen entfernt – Luftlinie. Reiste man über Land, musste man fast dreihundert Meilen zurücklegen. Selbst vom Gipfelhaus, hätte es eine Straße gegeben, hätte Cahnyr bis zur Wegkreuzung immer noch fast fünfundvierzig Meilen weit marschieren müssen – mitten im tiefsten Winter, durch unwegsames Berggelände. Dank der aufgegebenen Kohlenstollen würden Tohmys und er allerdings kaum mehr als fünfzehn Meilen von ihrem Ziel entfernt wieder ans Tageslicht kommen. Nur: das konnte der geheimnisvolle Briefschreiber, der wahrscheinlich aus Zion stammte, wohl kaum wissen. Vom fernen Zion aus musste die Wegkreuzung zweifellos der am ungünstigsten gelegene der drei möglichen Treffpunkte sein, die der Briefschreiber vorgeschlagen hatte. Der Erzbischof vermutete, eigentlich habe die Poststation nur Erwähnung gefunden, sollten alle anderen Treffpunkte für Cahnyr gänzlich unerreichbar sein. Er hielt es daher für beliebig unwahrscheinlich, dass jemand damit rechnete, Cahnyr könne die Poststation überhaupt erreichen.
Wir sind also hier, dachte Cahnyr und tastete sich in der Dunkelheit vorsichtig weiter vor. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich es anstellen soll, Kontakt aufzunehmen. Soll ich einfach in die Poststation hineinspazieren? Ich bin ja nun nicht gerade die unbekannteste Person in ganz Gletscherherz! Ich kann natürlich immer noch darauf hoffen, dass mich hier, so weit von Tairys entfernt, niemand erkennt. Aber irgendwie scheint es mir nicht sonderlich ratsam, mich darauf zu verlassen. Tja, wie könnte ich also möglichst diskret …
Mitten im Gedanken brach Cahnyr ab und erstarrte. Seine Augen, die sich schon an die Dunkelheit gewöhnt hatten, weiteten sich plötzlich. Licht! Da vorne war Licht, und …
»Eigentlich, Eure Eminenz«, sagte eine Stimme vor ihm, »hatte ich schon gestern Abend mit Euch gerechnet.«
Cahnyrs Augen wurden noch größer. Das konnte doch nicht sein!
»Gharth?!«, hörte er sich selbst heiser ausstoßen.
»Nun ja«, antwortete sein Sekretär und trat, in der Hand ebenfalls eine Blendlaterne, um die letzte Biegung des Stollens. Er grinste über das ganze Gesicht. »Meine Verwickelung in das Ganze hat die Zustellung des Briefs doch ein wenig vereinfacht, oder nicht, Eure Eminenz?«
»Sie sind ja völlig verrückt, Gharth!«, stellte Zhasyn Cahnyr mit sanftem, aber doch unverkennbarem Nachdruck wenige Minuten später fest. »Ich habe Gott weiß viele Jahre damit verbracht, Sie aus dem Ganzen herauszuhalten! Sie sind Familienvater – und Sahmantha ist schwanger, um Pasquales willen!«
»Ja«, bestätigte Gharth Gorjah mit einem bemerkenswert ruhigen Nicken. »Clyntahn hätte sich wirklich einen besseren Zeitpunkt für das Ganze aussuchen sollen, findet Ihr nicht auch?« Er warf seinem Vorgesetzten einen unbestreitbar strengen Blick zu, und im Schein der Laterne wirkte sein jugendliches Gesicht erstaunlich alt. »Solltet Ihr wirklich geglaubt haben, es sei Euch gelungen, mich die ganze Zeit über im Unklaren über Eure Aktivitäten zu lassen, Eure Eminenz, muss ich mich erstaunt fragen, wie ein derart untalentierter Verschwörer so lange hat unentdeckt bleiben können.«
»Aber …«, setzte Cahnyr an.
»Eure Eminenz, wir können uns, wenn Ihr wünscht, noch ein bisschen länger deswegen streiten«, fiel ihm Gorjah ins Wort, »aber wir sollten währenddessen schon weiterziehen. Sofern Ihr nicht einfach kehrtmachen, den ganzen Weg durch den Berg zurückstapfen und das Ganze schlichtweg vergessen wollt. Das allerdings würde ich nicht empfehlen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Teagmahn, diese Aasechse, jederzeit den Befehl erwartet, Euch festzunehmen.«
Cahnyr schloss den Mund wieder, und Gorjah tätschelte ihm sanft den Arm.
»Eure Eminenz, Ihr habt mich nicht in Eure Angelegenheiten hineingezogen. Alles, was ich tue, tue ich, weil ich mich bewusst dafür entschieden habe. Sahmantha hatte im Übrigen schon eine ziemlich genaue Vorstellung von meinen Überzeugungen, bevor ich um ihre Hand angehalten habe. Ich habe nichts unternommen, ohne mich zuvor mit ihr abzusprechen, und sie hat mich stets rückhaltlos unterstützt. Glaubt mir, sie denkt, was Clyntahns Wahl des Zeitpunkts angeht, genauso wie Ihr und ich. Und ich will auch nicht behaupten, sie habe keine Angst vor dem, was mit uns allen geschehen wird, allen voran mit den Kindern. Und mir selbst geht es nicht anders. Wir haben beide sogar entsetzliche Angst davor. Aber es ist ja nicht so, als hätten wir das nicht schon längst kommen sehen.«
»Aber was genau tun Sie, Gharth?«, bohrte Cahnyr nach. »Ich mag nicht glauben, Sie hätten lediglich herumgesessen und mich im Auge behalten, nur für den Fall, dass ich irgendwie in Schwierigkeiten geriete. Aber wenn Sie nicht aktiv an dem beteiligt waren, was ich in letzter Zeit so getan habe, woran waren Sie dann beteiligt?«
»Eigentlich, Eure Eminenz, habe ich tatsächlich vor allem herumgesessen und Sie im Auge behalten.« Gorjah zuckte mit den Schultern. »Ich werde Euch darüber berichten, sobald ich kann – sobald mir das gestattet ist. Aber im Augenblick nehmt bitte einfach zur Kenntnis, dass noch jemand über Euch und Eure Freunde im Tempel Bescheid weiß. Wer das ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich weiß auch nicht über alles Bescheid, was Ihr getan habt. Aber ich weiß, warum Ihr mich nach einigen Dingen in den Unterlagen der Erzdiözese habt suchen lassen. Warum Ihr nach einem unumstößlichen Beweis für Korruption gesucht habt oder nach Anweisungen, die vom Tempel ausgingen, die für Gottes Vikare und Erzbischöfe schlicht unangemessen sind. Ich verstehe jetzt auch, warum Ihr manches Mal eigene Standpunkte vertreten habt in dem sicheren Wissen, damit bei den anderen Mitgliedern des Episkopats nicht gerade auf Begeisterung zu stoßen.
Ich muss zugeben, dass es mich zunächst tief getroffen hat, zu erfahren, dass etwas von wahrhafter Tragweite, etwas wirklich Gefährliches vorging, Ihr es mir aber vorenthalten habt. Anfangs dachte ich, Ihr würdet mir nicht vertrauen. Oder schlimmer noch: Ihr könntet denken, ich würde nicht empfinden wie Ihr, wann immer offenkundig wurde, dass Mutter Kirche ihre Pflicht zu tun versäumte. Dann aber habe ich begriffen, dass Ihr mich beschützen wollt – mich, Sahmantha, die Kinder. Und dafür war ich Euch noch inniger zugetan.«
Kurz drückte er Cahnyrs Arm, und seine Stimme war auf einmal sehr belegt. Er hielt inne und räusperte sich; dann sprach er weiter.
»Mir wurde auch klar, dass Ihr ganz Recht hattet. Ich musste auch an andere Menschen denken – Menschen, die dann, in Bédards Worten, zu Geiseln des Schicksals würden. Also habe ich zugelassen, dass Ihr mich ausschließt. Aber dann wurde ich angesprochen – von jemandem, der mich davon überzeugt hat, dass er nicht für die Inquisition arbeitet. Dieser Jemand wollte, dass ich in Gletscherherz bliebe und mir überlegte, wie man Euch von hier fortschaffen könnte, sobald das erforderlich würde. Darüber war ich froh, Eure Eminenz, wirklich froh.
Euer unbekannter Freund in Zion hat mich schon vor Monaten informiert, dass ein gewaltiger Schlag bevorstehe. Seitdem war ich mit Vorbereitungen beschäftigt. Teagmahn hat nichts mitbekommen, denn ich gehöre schon seit Jahren zum Kreis seiner Informanten.« Der Sekretär gestattete sich ein gehässiges Grinsen. »Das hat Euer Freund in Zion vorgeschlagen, um mich unverdächtig zu machen – neben anderen Strategien. Es gefiel mir nicht, aber Euer Freund hatte ganz Recht: Es war die ideale Tarnung. Alles, was ich Teagmahn berichtet habe, war die lautere Wahrheit. Also werde ich als sehr zuverlässige Quelle angesehen. Das hat zusätzlich noch einen anderen Vorteil: Teagmahn ist so sehr damit beschäftigt, Euch im Auge zu behalten, dass er nicht ein einziges Mal nach mir geschaut hat.«
Der Unterpriester zuckte mit den Schultern.
»Also, Eure Eminenz: Sahmantha und die Kleinen warten in der Poststation – deren Besitzer ist zufälligerweise einer ihrer Vettern. Er weiß nicht viel, nur, dass Ihr in Schwierigkeiten steckt. Aber ebenso wie eine erstaunlich große Zahl von Leuten hier in Gletscherherz verehrt er Euch zutiefst. Alles, was er tun muss, ist den Mund darüber zu halten, dass er uns gesehen hat. Meines Erachtens kann die Inquisition unmöglich auf die Idee kommen, Ihr hättet es irgendwie vom Gipfelhaus hierher auf die andere Seite des Tairys-Berges schaffen können – während einer der schlimmsten Schneestürme der letzten dreißig Jahre! Sie denken aber sicher auch nicht, Ihr wäret wieder den Berg hinabgestiegen und über Tairys selbst entkommen. Dennoch dürfte ihnen das immer noch deutlich einleuchtender erscheinen als das hier. Also werden sie sich wohl ganz auf den Verkehr konzentrieren, der durch die Stadt fließt, was heißt: auf den Verkehr auf dem Grauwasser und auf der Straße, die am Flussufer entlang nach Bergsee führt und von dort nach Siddar-Stadt. Währenddessen aber marschieren wir nach Westen, bis nach Klippenkuppe. Dann wenden wir uns nach Süden und durchqueren die Südmark bis nach Silkiah.«
Cahnyr starrte Gorath an. Es gab also einen geheimnisvollen Wohltäter, aha, einen mit so viel, ja schier unglaublich viel Weitblick, dass so weit im Voraus hatten Vorbereitungen für seine, des Erzbischofs, Flucht getroffen werden können! Nur Gorjah in die Sache hineinzuziehen, seine junge Familie diesen Gefahren auszusetzen, nein, das widerstrebte Cahnyr doch heftig. Nur hatte er ganz offenkundig die Dinge nicht mehr in der Hand – zumindest vorerst.
Die Heilige Schrift lehrt, dass Gottes Wege unergründlich sind, Zhasyn, mahnte er sich. Vergiss nicht, was du damals gedacht hast, als dieser Brief dich erreicht hat: Dieses Schreiben hat doch bewiesen, dass es noch andere gibt, die kommen sahen, was du vorausgesehen hast, die erkannt haben, was auch du und der ganze ›Kreis‹ erkannt habt. Cahnyr verzog die Lippen zu einem schiefen Grinsen. Und die besser organisiert sind als der ›Kreis‹! Wenn es andere gibt, fähig und willens, sich gegen einen übermächtig scheinenden Feind zu stellen, gänzlich unbemerkt, auch von mir, dann muss es in Clyntahns und Trynairs ach so sauberem Haus deutlich mehr Spinnenratten im Gemäuer geben, als ich mir hätte träumen lassen! Samyl hat wohl Recht – die wirkliche Veränderung, die echte Reform, braucht die Bedrohung von außen, durch die Kirche von Charis. Und im Schoß von Mutter Kirche gibt es mehr, die bereit sind zu handeln, als Clyntahn jemals vermutet hätte – oder ich jemals zu hoffen gewagt!
Bei diesem letzten Gedanken verspürte er tiefe Scham. Scham angesichts der Arroganz, die ihn davon abgehalten hatte, zu glauben, es könne noch andere solche Menschen geben. Scham, weil er Gharth Gorjah ausgeschlossen hatte, so hehr und edel seine Motive auch gewesen sein mochten – ausgeschlossen von etwas, dem der junge Priester doch so unbedingt angehören wollte. Scham, weil er, ein Erzbischof, daran gezweifelt hatte, Gott werde die Herzen und Seelen finden, wann immer Er sie brauchte und zu sich rief.
Sanft strich er dem jüngeren Priester über die Wange und lächelte ihn im trüben Licht der Laterne an.
»Ich halte Sie immer noch für verrückt«, sagte er leise, »aber wenn Sie verrückt sind, dann bin auch ich es. Und manchmal sind es Verrückte, die Gott braucht.«
.III.
HMS Chihiro, Gorath Bay, Königreich Dohlar
»Bischof Staiphan und Admiral Hahlynd kommen gleich längsseits, Mein Lord.«
Graf Thirsk blickte von dem Bericht auf, der auf seinem Schreibtisch lag. Gerade steckte Lieutenant Bahrdailahn den Kopf durch die Tür zur Kajüte hinein. Der Leutnant, ein recht gut aussehender junger Mann mit kohlenschwarzem Haar, war respektvoll wie immer. Er war Baron Westbars jüngster Bruder, daher bei gesellschaftlichen Anlässen nicht Lieutenant, sondern Sir Ahbail Bahrdailahn. Die Baronie seines Bruders lag im Südwesten des Herzogtums Windborne und besaß keinerlei Zugang zum Meer. Trotzdem hatte sich Bahrdailahn schon sehr früh für eine Karriere bei der Navy entschieden. Sein Bruder liebte es, von seinem Entsetzen zu berichten, als des kleinen Ahbails erste Worte ›Ahoi, du Landratte!‹ gewesen seien. Sicher war die Geschichte hemmungslos übertrieben. Doch ebenso sicher hatte Ahbails Familie, die schon seit Urzeiten Offiziere der Royal Army hervorbrachte, ihr Bestes getan, den Jüngsten von einem derart widernatürlichen Schritt abzuhalten. Zu Ahbails herausragendsten Eigenschaften aber gehörte Sturheit, und seine diversen Brüder, Schwestern, Cousins und Cousinen, Tanten und Onkel hatten jeglichen Versuch, ihn von seinem Entschluss abzubringen, bereits aufgeben, als er noch nicht einmal zwanzig Jahre alt gewesen war. (Seine Eltern waren schlau genug gewesen, bereits sehr viel früher die Segel zu streichen.)
Nun, etwa fünf Jahre später, war Bahrdailahn Thirsks Flaggleutnant. Der junge Mann hatte, gelinde gesagt, nicht allzu viel von diesem Posten gehalten, den man ihm angeboten hatte. Er hätte es vorgezogen, das Kommando einer der neuen Briggs zu übernehmen, oder, sollte das nicht möglich sein, als First Lieutenant auf einer Galeone zu dienen. Und ganz ehrlich: er wäre für beides mehr als qualifiziert gewesen. Gewiss, er war kein solcher Seebär wie manch Altgedienter bei der Navy. Das jedoch machte er mit seinem Eifer wett, die Seemannschaft zu erlernen – einem Eifer, den so mancher Offizier der so genannten Alten Navy vermissen ließ. An Mut oder Kampfkraft mangelte es Bahrdailahn auch nicht, ganz im Gegenteil.
Trotzdem hatte der junge Mann sich gefügt, ohne groß zu murren. Später gestand er Thirsk, ursprünglich habe er die Absicht gehabt, sich als hirnloser Adelsfatzke zu gebärden, damit Thirsk ihn so rasch wie möglich austauschen ließe. Er sei aber von diesem Plan rasch abgerückt, nachdem er erkannt habe, welch gewaltige Aufgabe es zu erfüllen gelte: der Aufbau einer brandneuen Navy. Es sollte eine Navy entstehen, die auf dem leistungsfähigen Modell der Charisianer basierte, was einen Aufbau von Grund auf bedeutete. Im Gegensatz zu allzu vielen Offizieren der Alten Navy hatte Bahrdailahn nicht nur verstanden, was Thirsk eigentlich zu erreichen versuchte, sondern war mit ganzem Herzen dabei. Zugleich war er auch scharfsinnig genug, zu erkennen, wie viele Feinde sich Thirsk dabei machte. Thirsk war bereit gewesen, das hinzunehmen – was Bahrdailahns Respekt vor seinem Vorgesetzten in Bewunderung für ihn umschlagen ließ. Dabei war es nicht geblieben: In den vergangenen anstrengenden Fünftagen und Monaten war aus Bewunderung Verehrung geworden.
Das erklärte vielleicht auch die versteckte Beklommenheit in Bahrdailahns Blick. Thirsk aber kannte den Leutnant mittlerweile zu gut, um das zu übersehen.
»Ich danke Ihnen für die Vorwarnung, Ahbail«, sagte der Graf jetzt. Er hörte schon die Pfeife des Bootsmanns und das Trappeln der Füße an Deck. Captain Baiket hatte die nahende Barkasse offenkundig ebenfalls bemerkt und ein Empfangskomitee antreten lassen.
»Bitte stellen Sie sicher, dass Mahrtyn sich uns anschließt!«, fuhr Thirsk fort. »Bitten Sie Paiair, eine Flasche meines besten Whiskys bereitzustellen und halten Sie selbst sich bereit, unsere Gäste nach achtern zu führen!«
»Jawohl, Mein Lord.« Bahrdailahn wollte sich schon wieder zurückziehen. Doch als Thirsk einen Finger hob, hielt der Leutnant inne. »Ja, Mein Lord?«
»Ich kenne Admiral Hahlynd schon seit vielen Jahren, Ahbail, und zumindest bislang habe ich den Eindruck, als sei Bischof Staiphan durchaus vernünftig. Ich rechne nicht damit, mir mit einem der beiden innerhalb der nächsten Stunden einen Kampf auf Leben und Tod zu liefern.« Er deutete ein Lächeln an. »Habe ich mich klar genug ausgedrückt?«
»Jawohl, Mein Lord. Selbstverständlich!« Vielleicht lief Bahrdailahn ein wenig rot an. Sonnenverbrannt wie er war, war das schlecht auszumachen. Der junge Mann lächelte verlegen. »Ich bitte um Verzeihung, Mein Lord«, sagte er in deutlich neutralerem Tonfall, »nur …«
Er unterbrach sich, schüttelte kurz den Kopf. Thirsks Lächeln wurde breiter.
»Glauben Sie mir, Ahbail, ich weiß genau, was Ihnen durch den Kopf geht! Ich weiß Ihre … Loyalität auch sehr zu schätzen.« In seinen Augen blitzte es schalkhaft auf, als Bahrdailahn die Geste machte, mit der ein Fechter einen Treffer bestätigte. »Aber ich glaube, niemand könnte die Arbeiter in den Werften noch mehr antreiben, als wir das ohnehin schon tun.« Das Lächeln wich einer deutlich ernsteren Miene. »Herzog Thorast und seine Freunde werden sich wohl einfach damit abfinden müssen, dass ich diese kleinen Ausbildungsmissionen durchführen lasse.«
Bahrdailahn wirkte, als hätte er dieser letzten Aussage nur zu gern widersprochen. Bahrdailahn war entfernt mit Herzog Windborne verwandt. Die Alltäglichkeit gewordenen, gelegentlich sogar tödlichen Streitigkeiten innerhalb des dohlaranischen Hochadels waren ihm so vertraut, als hätte er sie mit der Muttermilch aufgesogen. Er wusste ganz genau: Herzog Thorast und seine Verbündeten mochten in der Öffentlichkeit ihre Treue gegenüber Graf Thirsk betonen; sie ließen sich aber dennoch nie auch nur eine Gelegenheit entgehen, ihm in den Rücken zu fallen. Im Augenblick galten ihre Angriffe der ›schändlichen Trägheit‹, mit der die neue Flotte gebaut würde, und den von Thirsk befohlenen, wie sie fanden, unüberlegten und immens gefährlichen Ausbildungsmissionen. Beides hatte ganz offensichtlich zumindest am Rande mit der heutigen Besprechung zu tun – ob der Graf das nun einzugestehen bereit war oder nicht.
»Dann gehen Sie jetzt!« Mit einer Hand wedelte Thirsk, als wolle er seinen Untergebenen verscheuchen.
Bahrdailahn lächelte ihm noch einmal kurz zu, nickte und verschwand. Thirsk griff nach dem Bericht, in dem er gelesen hatte, und stieß die Blätter sorgfältig zu einem Stapel zusammen. Dann legte er sie in einen Aktenordner, den er in der Schublade seines Schreibtischs verschwinden ließ. Er erhob sich aus seinem Sessel und ging zum großen Heckfenster der Kajüte hinüber.
Die Hände hinter dem Rücken verschränkt, blickte er durch das salzgefleckte Glas auf die Gorath Bay hinaus. Es war kalt, ein frischer Wind wechselte beständig die Richtung. Thirsk hoffte, Bischof Staiphan Maik und Admiral Pawal Hahlynd wären während der langen Fahrt hinaus zur Chihiro nicht übermäßig nass geworden. Durchgefroren wären sie auf jeden Fall. Thirsk blickte über die Schulter, als mit raschen Schritten Paiair Sahbrahan eintrat, sein Kammerdiener.
Sahbrahan war ein bemerkenswert kleiner Mann, noch kleiner als Thirsk, mit raschen, geschickten Händen. Paiair war außerordentlich effizient und scheute sich nicht im Mindesten, seinen Admiral recht ruppig an gewisse Kleinigkeiten zu erinnern – wie beispielsweise zu essen oder sich schlafen zu legen. Zugleich war er ein ausgezeichneter Koch, der sich sein Auskommen vermutlich sehr gut auch als Küchenchef hätte verdienen können, wenn ihm der Sinn danach gestanden hätte. Thirsk brachte ihm uneingeschränktes Vertrauen entgegen, was die Verwaltung des gräflichen Weinkellers und der Spirituosen betraf.
Sonderlich beliebt aber war der Kammerdiener bei Thirsks Stab oder seinem Haushalt nicht. Sie wussten Paiairs Fähigkeiten sehr wohl zu schätzen. Sie kannten allerdings auch seine Eitelkeit und Arroganz. Sahbrahan achtete peinlich (für so manchen schmerzhaft) genau darauf, dass jeder, der dem Grafen an Geburt oder Rang nicht gleichgestellt war, Thirsk gegenüber entsprechend unterwürfig auftrat, auch wenn Thirsk selbst das nicht tat. Paiair konnte Angestellte in Herbergen und Hotels mit überzogenen Forderungen – frische Laken hier, saubere Handtücher da, heißes Wasser, aber bitte plötzlich! – an den Rand des Wahnsinns treiben. An Bord eines Schiffes verhielt er sich nicht anders. So hatte er sich redlich den Ruf erworben, Kammerdiener und Stewards einfacher Schiffskapitäne hemmungslos zu schikanieren. Seine Streits mit Köchen und Zahlmeistern verschiedener Flaggschiffe waren sogar legendär.
Thirsk kannte die Schwächen seines Kammerdieners ebenso wie jeder andere auch. Sahbrahan selbst wusste, dass er sich dergleichen niemals in Gegenwart des Grafen leisten durfte. Thirsk hingegen war klar, dass es schwierig wäre, einen gleichwertigen Ersatz für Paiair zu finden. Abgesehen davon stand Sahbrahan schon seit fast acht Jahren in seinen Diensten.
Nun balancierte der Kammerdiener raschen Schrittes ein Silbertablett mit zwei Karaffen Whisky und einer Karaffe Brandy über den dicken Teppich, der die blanken Schiffsplanken verdeckte. Paiair stellte seine Fracht auf einem Beistelltisch ab und wandte sich an seinen Herrn.
»Ich habe mir erlaubt, den Stahlmyn, den Waykhan und den Tharistan zu bringen, Mein Lord«, erklärte er und deutete auf die jeweiligen Karaffen. »Ist das zu Ihrer Zufriedenheit?«
»Voll und ganz«, erwiderte Thirsk.
»Weiterhin habe ich die Kombüse angewiesen, heiße Schokolade für Ihre Gäste bereitzustellen, falls dergleichen gewünscht wird«, fuhr Sahbrahan fort. »Und Ihrem Wunsch entsprechend wird das Essen pünktlich um vierzehn Uhr serviert.«
»Gut.« Thirsk nickte. Dann jedoch blickte er an seinem Kammerdiener vorbei: Mahrtyn Vahnwyk, sein Privatsekretär und Erster Adjutant, war in die Admiralskajüte getreten.
Der Sekretär war deutlich größer als Sahbrahan, obwohl er sich immer ein wenig gebückt hielt. Trotz seiner Kurzsichtigkeit war er einer der besten Sekretäre, die Thirsk je zu haben das Glück beschieden gewesen war. Sahbrahan und Vahnwyk hassten einander aus tiefstem Herzen.
Der Graf beobachtete, wie die beiden Männer sich redlich mühten, einander in seiner Gegenwart keine finsteren Blicke zuzuwerfen, und dachte nüchtern: Nun, ich fürchte, eigentlich hasst jeder Paiair. Und so ungern ich das zugebe: mit Grund, wahrlich mit Grund!
»Falls der Herr Graf keine weiteren Wünsche hat, ziehe ich mich dann jetzt zurück und kümmere mich um die weiteren Vorbereitungen«, verkündete Sahbrahan steif. Thirsk nickte zustimmend. Der Kammerdiener reckte sich zu voller Größe auf, verneigte sich dann kurz und zog sich gemessenen Schrittes zurück … und schaffte es dabei, die Anwesenheit Vahnwyks geflissentlich zu ignorieren.
Bei Langhorne!, dachte Thirsk. Und ich dachte immer, die Stimmung zwischen mir und Thorast sei angespannt!
Den amüsanten Gedanken unterbrach Lieutenant Bahrdailahn, der an die Tür der Kajüte klopfte und diese auf Thirsks »Herein!« öffnete, um die Gäste des Admirals in dessen Kajüte zu lassen. Thirsk ging den beiden hohen Herren zur Begrüßung rasch entgegen.
Pawal Hahlynd war etwa so alt wie Thirsk selbst, dabei aber etwa einen Fuß größer und deutlich weniger wettergegerbt. Weihbischof Staiphan lag von der Körpergröße ziemlich genau zwischen Thirsk und Hahlynd, hatte dichtes, silbriges Haar und auffallend lebhafte braune Augen. Er war ein sehr vitaler Mann, wirkte stets, als strotze er vor mühsam zurückgehaltener Energie. Allerdings hatte Thirsk erfahren, der Bischof habe eine ernstliche Schwäche für Süßigkeiten. Eben diese Schwäche für Süßes jedweder Art war einer der Gründe, weswegen Maik geradezu fanatisch Sport betrieb. Aus gleicher Quelle wusste Thirsk, dass Maik sich redlich mühte, diese Schwäche nicht allgemein bekannt werden zu lassen – vermutlich weil er der Ansicht war, das passe nicht so recht zu einem Schueleriten, Mitglied eines Ordens, der stets nach Enthaltsamkeit und Selbstdisziplin strebte. Thirsk selbst empfand diese Schwäche eher als beruhigend – wenigstens ein Beleg dafür, dass der offizielle Intendant der Flotte, Schuelerit hin oder her, ein ganz normaler Mensch war.
»Mein Lord.« Der Graf begrüßte zunächst Maik. Er verneigte sich und hauchte einen Kuss auf den Ring an Maiks Hand, dem Zeichen der bischöflichen Würde. Dann richtete er sich wieder auf und streckte Hahlynd die Hand entgegen. Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen griff sein Gast danach. »Pawal.«
»Admiral«, erwiderte Maik nun die Begrüßung und das Lächeln. »Es ist gut, Sie zu sehen, auch wenn ich gestehen muss, dass die Fahrt quer durch das Hafenbecken doch etwas … lebhafter war, als mir lieb gewesen wäre.«
»Ich bedauere, das zu hören, Mein Lord. Wie Sie wissen …«
»Bitte, bitte, Mein Lord!«, fiel ihm der Bischof ins Wort und hob mahnend die Hand, den Zeigefinger ausgestreckt. »Mir sind die Gründe – die offiziellen Gründe – für ein Zusammentreffen hier draußen durchaus bewusst.«
»Mein Lord?«, fragte Thirsk, zur Belustigung des Bischofs, ein wenig skeptisch nach. Doch die Belustigung war aufgesetzt, wie Bischof Maiks Stirnrunzeln deutlich verriet.