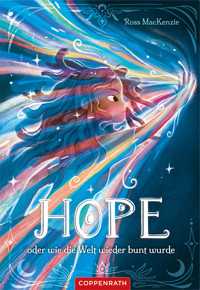
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Coppenrath Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Bunt ist die Hoffnung! Hope wächst in einer Welt ohne Farben auf – nur sie selbst und alles, was sie berührt, ist bunt. Deshalb trachtet der düstere König, der die Farben aus der Welt gestohlen hat, ihr nach dem Leben. Doch Hope hat mächtige Freunde: Den Magier Sandy, der sie vor den königlichen Höllenhunden gerettet hat; den Jungen Darroch, der malt und sich so sehnlich wünscht, Farben sehen zu können, dass es eigentlich in Erfüllung gehen muss; und natürlich Frau Tod, die gern Karten spielt und manchmal sogar selbst ein bisschen Hilfe braucht ... Kann Hope die grauen Mächte besiegen und den Menschen Hoffnung, Farben und Freiheit zurückgeben? Ein märchenhaftes Lesevergnügen mit liebenswerten Figuren und hinreißenden Dialogen! Fabelhaft übersetzt von Gabriele Haefs
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ross MacKenzie
Hope
oder wie die Welt wieder bunt wurde
Zur Erinnerung an Siobhan
54321
eISBN 978-3-649-64868-0
© 2022 by Andersen Press Limited
Originaltitel: The Colour of Hope
© 2024 Coppenrath Verlag GmbH & Co. KG,Hafenweg 30, 48155 Münster
Alle Rechte vorbehalten, auch auszugsweise
Text: © 2022 Ross MacKenzie
Übersetzung: Gabriele Haefs
Vignetten: Mareike Ammersken
Cover: Frauke Maydorn unter Verwendung einer Illustrationvon Mareike Ammersken
Lektorat: Frauke Reitze
Satz: Sabine Conrad, Bad Nauheim
www.coppenrath.de
Die Print-Ausgabe erscheint unter der ISBN 978-3-649-67248-7
Inhalt
Der Wunsch
Teil eins: Etwas, das Farbe heißt
Kapitel eins, in welchem eine Reise beginnt
Kapitel zwei, in welchem Darroch mit einem neuen Projekt beginnt
Kapitel drei, in welchem Mondlicht gesammelt wird
Kapitel vier, in welchem ein Monddrache vom Himmel fällt
Kapitel fünf, in welchem Hope die Sterne besucht
Kapitel sechs, in welchem Hope zum ersten Mal Baba begegnet
Kapitel sieben, in welchem ein kühner Plan Gestalt annimmt
Kapitel acht, in welchem eine Gabe überreicht wird
Teil zwei: Frau Tod und ihr Freund
Kapitel neun, in welchem eine Nachricht eintrifft
Kapitel zehn, in welchem wir Frau Tod und ihren Freund kennenlernen
Teil drei: Die Sammlerin
Kapitel elf, in welchem eine geheime Lieferung stattfindet
Kapitel zwölf, in welchem Hope einen Zauber lernt
Kapitel dreizehn, in welchem die Fetzerhunde kommen
Kapitel vierzehn, in welchem ein Zeichen gesetzt wird
Kapitel fünfzehn, in welchem Hope gesammelt wird
Kapitel sechzehn, in welchem der Flickenjunge um Hilfe bittet
Kapitel siebzehn, in welchem Flick seine Geschichte erzählt
Kapitel achtzehn, in dem Hope einen Plan in Worte fasst
Kapitel neunzehn, in welchem Darroch ein Zeichen setzt
Kapitel zwanzig, in welchem Baba ihren eigenen Zauber zu spüren bekommt
Kapitel einundzwanzig, in welchem es ein Wiedersehen und einen Abschied gibt
Teil vier: Die Zeitenwende
Kapitel zweiundzwanzig, in welchem wir einer unangenehmen Gestalt begegnen
Kapitel dreiundzwanzig, in welchem es üble Probleme gibt
Kapitel vierundzwanzig, in welchem sich die Macht der Farbe zeigt
Kapitel fünfundzwanzig, in dem Sandy einen Entschluss fasst
Kapitel sechsundzwanzig, in welchem ein Sturm heraufzieht
Kapitel siebenundzwanzig, in welchem sich die Regenbogenliga zum Kampf stellt
Kapitel achtundzwanzig, in welchem Hope endlich die Wahrheit erfährt
Kapitel neunundzwanzig, in welchem zwei wichtige Nachrichten überbracht werden
Kapitel dreißig, in welchem eine gewaltige Wahrheit enthüllt wird
Kapitel einunddreißig, in welchem Hope der Nekromantin wiederbegegnet
Kapitel zweiunddreißig, in welchem wir ans Ende und damit auch zu einem Anfang gelangen
Dank
Der Wunsch
»Erzähl mir noch mal von den Farben, Granny.« Der Junge sitzt zu Füßen der alten Frau auf dem Boden und schaut aus großen, leuchtenden Augen zu ihr hoch.
Die alte Dame verzieht die Lippen, als ob sie in eine Zitrone gebissen hätte, aber der Junge weiß, dass ihr Widerstand nur gespielt ist. »Na schön«, sagt sie und seufzt. »Was möchtest du wissen?«
Der Junge schweigt einen Moment und die Fragen wirbeln nur so durch seinen kleinen Kopf. Das einzige Geräusch im Zimmer ist das wunderbare Knistern des Feuers, während die weißen Flammen im Kamin züngeln.
Endlich lächelt der Junge und sagt: »Erzähl mir von Orange.«
Die Haut der alten Frau ist mittelgrau, ihre Wangen sind von Sommersprossen übersät. Ihre dunklen Augen liegen in einem Nest aus Fältchen, doch jetzt, als sie in Gedanken in eine andere Zeit zurückspringt – die gar nicht so lange her ist –, funkeln diese alten Augen. Sie lächelt zurück und sieht auf einmal viel jünger aus. »Orange? Mal überlegen. Ja. Also, du weißt doch, unsere Spaziergänge im Wald, wenn die Erntezeit zu Ende ist, mein Liebling? Die Tage, wenn die Luft scharf ist und du schon überall den Winter schmecken kannst?«
Der Junge nickt.
»Und du erinnerst dich, wenn wir von so einem Spaziergang zurückkommen, uns am Feuer die Finger wärmen und heißen Apfelsaft trinken? Wenn uns warm und kalt zugleich ist und wir uns so darüber freuen, dass wir leben, und uns der Apfelsaft von innen wärmt?«
Wieder nickt er.
»Dieses Gefühl von heiß und kalt und Leben und Gewürz, alles ordentlich zusammengewickelt«, sagt sie. »Wenn wir das sehen könnten, wäre es orange.«
Der Junge lächelt jetzt. Stellt sich alles vor, während seine Augen in die Ferne schauen.
Was für schöne Augen!, denkt die alte Dame. Wie die seiner Mutter, blau wie der Ozean – als der Ozean noch blau war.
Vorher.
Ehe die Farben aus der Welt verschwanden.
Nein, nicht verschwanden.
Ehe sie gestohlen wurden.
Einige Minuten später bringt die alte Frau den Jungen ins Bett und stopft die Decke um ihn herum fest. Er besteht darauf, dass sie unter sein Bett und in seinen Schrank schaut, um sicherzugehen, dass da keine Schwarzröcke oder Fetzerhunde auf der Lauer liegen.
»Alles bestens«, sagt sie und gibt ihm einen Kuss auf die Stirn.
Gleich darauf ist der Junge allein in der Dunkelheit. Er lauscht, wie die alte Dame alle Türen und Fenster verriegelt, die Lampen löscht und in ihr eigenes Zimmer geht. Erst als ihr dröhnendes Schnarchen zu hören ist, klettert er aus dem Bett und schleicht ans Fenster. Er öffnet die schweren Vorhänge, drückt das Schiebefenster nach oben und atmet die süße Wärme der Spätsommernacht ein.
Der Himmel ist klar und schwarz und die Sterne funkeln. Der Junge schaut nach Westen, über den Hof seiner Großmutter hinweg auf die sanften Hügel und den Wald, und dann nach Osten, hinüber zur Stadt und zum Meer. Er sehnt sich so sehr danach, das Grün der Schafswiesen zu sehen, das Blau des klaren Himmels, das Glitzern von goldenem Sonnenlicht auf den Dächern der Stadt.
Er seufzt und will das Fenster schon wieder zumachen, als etwas seinen Blick einfängt. Hoch über dem Meer jagt ein leuchtender Strich unter der Rundung des Mondes dahin und ist in Sekundenschnelle wieder verschwunden.
Eine Sternschnuppe.
Der Junge reißt die Augen auf und kneift sie dann zusammen, als in seinem Kopf eine Idee geboren wird.
Er flüstert: »Ich wünsche mir jemanden, der die Farben zurückbringt.« Er macht die Augen wieder auf, schließt das Fenster und klettert zurück ins Bett.
Ohne noch weiter an seinen Wunsch zu denken, schläft er ein. Er hat keine Ahnung, dass er soeben die Welt und das Schicksal eines Menschen für immer verändert hat.
Teil eins
Etwas, das Farbe heißt
(Sechs Jahre nach dem Wunsch)
Kapitel eins,
in welchem eine Reise beginnt
Das Reich des Königs ist unendlich groß, es zieht sich dahin, so weit das Auge reicht und noch viel weiter, und das in alle Richtungen. Es gibt verschneite Berggipfel und verschlungene Flüsse, es gibt bunte Ackerteppiche und schöne und auch verfallene Dörfer und Städte. Es gibt Schatten und Dinge, die in den Schatten leben.
Aber vor allem gibt es den Wald, grau und endlos und farblos.
Schaut her.
Seht ihr, tief da unten? Wo sich der breite Weg durch den Wald zieht, wie ein Schnitt mit dem Schwert eines Riesen? Auf dieser Straße bewegt sich etwas. Ein Wohnwagen, gezogen von einem prachtvollen Kaltblutpferd, einem Shire Horse. Auf dem Bock sitzt Sandy Burns und hält die Zügel in der Hand. Neben ihm ein kleines Mädchen mit einem ernsten Gesicht.
Sie heißt Hope.
»Noch immer sauer, Deern?«, fragt Sandy und schaut sie von der Seite her an.
Sie gibt keine Antwort, verschränkt einfach ihre kleinen Arme und schiebt eine glänzende Unterlippe hervor.
Sandy schüttelt den Kopf. »Na, dann sei du nur nach Herzenslust sauer, wirst schon sehen, waste davon hast.«
»Du hast mich angebrüllt«, sagt sie endlich und sieht ihn noch immer nicht an.
»Angebrüllt?« Sandy fällt fast vom Bock. »Zum Kranich, da kannste mir ja wohl keine Vorwürfe machen! Deinetwegen können wir niemals in dieses Kaff zurückkehren.«
»Das heißt Dorf«, weist sie ihn zurecht. »Wir können niemals in dieses Dorf zurückkehren. Oliver bringt mir bei, so zu sprechen wie er. Er sagt, ich soll mich … korrekt ausdrücken.«
Diesmal schiebt Sandy die Lippe vor. »Ach was. Und seit wann entscheidet Oliver, welche Ausdrucksweise korrekt ist? Aber egal wie, bleib gefälligst beim Thema. Was du da gemacht hast, war einfach unverzeihlich. Wir sind wandernde Magier. Unsre Aufgabe ist es, den Menschen zu helfen. Wir sollen uns nirgendwo in Politik einmischen – und das bedeutet, du darfst Leute nich in Schweine verwandeln. Schon gar keine Bürgermeister!«
»Der war aber schrecklich grob zu dir«, rechtfertigt sie sich.
Sandy versucht weiter, ein ernstes Gesicht zu machen, doch er spürt, dass ihm das nicht so richtig gelingt. »Na ja … stimmt. Manche Leute werden eben gemein, wenn sie merken, dass wir nicht all ihre Probleme lösen können. Aber ich hätte die Sache schon geklärt. Du kannst nich alle, die grob zu uns sind, in Tiere verwandeln. Wenn du das immer machst, sind bald keine Menschen mehr übrig.«
Sie schaut ihn an und schnaubt verächtlich.
»Nach meiner bescheidenen Meinung«, ertönt eine Stimme aus dem Wohnwagen, »wäre es gar nicht so schlecht, wenn alle Menschen auf der Welt zu Tieren würden. Ich würde das sogar für eine Verbesserung halten.« Ein kleiner, struppiger schwarzer Hund taucht in der Türöffnung auf, setzt sich hin und gähnt.
Sandy schaut ihn mit scharfem Blick an. »Jetzt ermutig du sie nich auch noch. Ich dachte, der Hund ist der beste Freund seines Herrchens?«
Der Hund macht eine Bewegung, bei der es sich um ein Schulterzucken handeln könnte. »Kommt ganz auf das Herrchen an.«
»Und wie hat Hope es dahinten im Dorf überhaupt geschafft, einen von meinen Zaubern in ihre Fingerchen zu kriegen?«, fragt Sandy. »Solltest du sie nich im Auge behalten?«
»Ich musste einem Ruf der Natur folgen, wenn du das unbedingt wissen willst«, klärt der Hund ihn auf.
Sandy schüttelt verzweifelt den Kopf. Er zieht an den Zügeln, und sein Pferd, Gloria, verlässt die Straße und trottet weiter über unebenen Boden dahin, zwischen zwei gewaltigen Mammutbäumen hindurch, wobei die ausgestreckten Zweige über das Dach des Wohnwagens kratzen. Schließlich erreichen sie eine Lichtung mit hohem Gras. Der Wagen kommt zum Halten, Sandy springt herunter und reckt seine ächzenden Knochen.
»Warum bleiben wir stehen?«, fragt Hope und sieht sich um.
Sandy geht auf die grauen Bäume zu. »Weil jetzt ich einem Ruf der Natur folgen muss.« Er verschwindet hinter einem der dicken Baumstämme, dann ertönt seine Stimme: »Oliver, geh mal mit Hope los, damit sie sich die Beine vertreten kann, ja? Aber lauft bloß nich zu weit weg!«
Oliver, der Hund, schaut Hope mit strahlenden Augen an. Er lässt sein aufgerichtetes Ohr zucken. »Könnte es dir gefallen, mich auf einem kleinen Spaziergang zu begleiten?«
Hope springt von dem hölzernen Bock vor dem Wohnwagen. Sie ist klein für ihr Alter, und sie hat dunkelgraue Haut, eine wild zerzauste Mähne und große, forschend blickende Augen, deren Weißes so hell und klar ist, dass sie fast schon leuchten. »Na, dann los«, sagt sie.
Sie gehen auf die andere Seite der Lichtung, weg von Sandy, folgen dem verschlungenen Lauf eines schmalen Bachs zwischen den Bäumen. Es ist Mittsommer und der Tag ist schön und warm.
»Sandy hat recht, weißt du.« Oliver schnüffelt an einem Baum. »Du solltest wirklich nicht an seinen Zaubern herumpfuschen. Du könntest dich verletzen.«
Hope hebt einen Zweig auf und wirft ihn in den Bach, dann sieht sie zu, wie das Wasser ihn davonträgt. »Er lässt mich nie echte Magie ausführen.«
»Du hilfst ihm doch beim Sammeln von Zauberzutaten, oder nicht?«
»Aber das ist langweilig!« Sie lässt sich auf den weichen grauen Moosteppich des Waldbodens sinken. Oliver reckt sich, legt sich neben sie und wälzt sich auf den Rücken. Hope fängt an, ihm den Bauch zu reiben.
»Das kommt dir vielleicht langweilig vor«, sagt er, »aber es ist wichtig. Er unterrichtet dich, verstehst du? Vermittelt dir Wissen. Sorgt dafür, dass du die Grundlagen der Magie verstehst, ehe du sie anwendest.«
Hope rümpft die Nase.
Oliver setzt sich auf. »Es geht darum, dass Sandy dich beschützt, wie er das immer schon getan hat.«
Hope krault das wirre Fell auf Olivers Kopf und er reckt sich und leckt ihr die Wange mit seiner nassen Zunge. Das bringt sie zum Kichern.
»Willst du Stöckchenholen spielen?«, fragt sie.
Er seufzt. »Muss das sein?«
»Das tun Hunde doch! Und ich weiß, dir macht es Spaß!« Sie steht auf, klettert auf einen umgestürzten Baumstamm und läuft auf Zehenspitzen darüber, die Arme nach beiden Seiten ausgestreckt, um das Gleichgewicht zu halten. Dann springt sie hinunter, hebt ein passendes Stöckchen auf und wirft es.
Oliver sieht zu, wie es zwischen den Bäumen dahinwirbelt und unter einigen knorrigen Baumwurzeln auf dem Waldboden landet. Hope beobachtet ihn lächelnd. Sie weiß, dass er mit aller Kraft versucht, an Ort und Stelle zu bleiben. Sie weiß auch: Egal, wie viele Bücher er vielleicht liest und wie viele hochgebildete Wörter er benutzt, so ist Oliver doch ein Hund, und alles in ihm schreit danach, diesem Stöckchen hinterherzujagen.
Schließlich kann er dem Drang nicht mehr widerstehen. Er rennt los und kehrt Sekunden später mit dem zwischen die Zähne geklemmten Stöckchen zurück. Er lässt es vor Hopes Füße fallen und schaut mit heraushängender Zunge zu ihr hoch, sein Schwanz peitscht wie wild hin und her.
Hope tut überrascht. »Ach, ich soll das noch mal werfen?«
»Ich verachte mich deshalb«, gesteht er. »Aber ja. Bitte.«
Hope hebt das Stöckchen auf, holt aus und wirft. Wieder jagt Oliver los. Auf dem Rückweg jedoch kommt er diesmal abrupt zum Stehen. Das Stöckchen fällt ihm aus dem Maul und liegt vergessen auf dem Boden, während er Hope anstarrt.
»Deine Hand«, sagt er leise.
Hope hebt beide Hände. Schon bald sinkt die linke wieder an ihre Seite. Doch die rechte … sie hält die rechte weiterhin hoch, sogar dann noch, als ihr der Atem in der Brust stockt und ihr Herz wilde Sprünge macht. Mit dieser Hand passiert etwas. Die grauen Fingerspitzen füllen sich langsam mit einer seltsamen warmen Helligkeit – so anders als der Rest der Welt, dass es im ersten Moment ihren Augen wehtut. Das hier, diese schleichende, wunderschöne Fremdheit, füllt ihre Finger ganz und gar, wandert weiter in ihre Handfläche und dann in ihr Handgelenk. Und da hält es inne.
»Bleib genau, wo du bist.« Die Furcht in Olivers Stimme ist geradezu greifbar. »Ich hole Sandy.«
Und schon stürzt er davon, zurück zur Lichtung, lässt Hope mit ihrer fremden Hand allein. Müsste sie jetzt Angst haben? Vielleicht. Aber als sie die warme Veränderung in ihrer Haut untersucht, ist sie kein bisschen erschrocken. Es tut nicht weh, es kitzelt nicht, nichts dergleichen. Es ist einfach da. Sie hebt wieder die linke Hand, hält sie neben die rechte … die linke sieht genauso aus wie immer, glatt und dunkelgrau.
Hinter ihr raschelt es, dann bricht Sandy zwischen den Bäumen hervor, kommt schliddernd zum Stehen und starrt Hopes Hand an. Er tritt einen Schritt vor, nimmt die Hand, dreht sie vorsichtig um; seine Augen leuchten unter der Hutkrempe. »Haste heute Morgen deinen Trank genommen?«, fragt er ein bisschen außer Atem.
Hope zieht die Nase kraus. »Was?«
»Haste deinen Trank genommen, Deern?« Er packt ihre Hand fester und zum ersten Mal bohrt sich ein Nadelstich der Unruhe in Hopes Rückgrat.
»Aye. Jeden Morgen, genau wie du immer sagst.«
Sandy führt sie an der Hand hinaus in die graue Helligkeit der Lichtung und hinein in den dunkelgrauen Wohnwagen. Der ist von innen größer, als man ihm zutrauen würde. Das liegt daran, wie Sandy Hope schon hundertmal erzählt hat, dass der Wohnwagen aus verzaubertem Holz gemacht ist. Dort links steht Sandys Schreibtisch, übersät mit Papieren und allerlei Ziergegenständen, und rechts ist die Küchenecke mit dem Schrank und dem kleinen Holzofen, dessen Schornstein durch das Dach aufragt. Ganz hinten befindet sich Sandys ordentlich gemachtes Bett. Hope schläft auf einem Zwischenboden, der über eine hölzerne Wendeltreppe zu erreichen ist. Die runden Wände und die Decke bilden ein einziges riesiges Bücherregal, das sich nach oben und rundherum wölbt, und obwohl die Bücher eigentlich kopfüber herunterfallen müssten, bleiben sie an ihrem Platz und blicken mit ihren Rücken auf die leuchtend grauen Bodenbretter hinunter.
»Hol den Trank«, sagt Sandy.
Hope wirft ihm einen verwirrten Blick zu, dann gehorcht sie und klettert die Treppe zu dem kleinen Zwischenboden hoch. Sie lässt sich auf die Knie fallen, greift unter ihr Bett, zieht ein Holzkästchen hervor und öffnet den Deckel über ihren Schätzen. Dort liegen ein paar blasse Murmeln, eine Handvoll Münzen, einige schwarz-weiße Angelköder und ein Zinnsoldat aus trübem grauem Metall. Und da ist eine winzige Flasche, auf die Sandy ein Etikett geklebt und mit seiner unordentlichen Handschrift darauf gekritzelt hat:
Hopes Trank
Hope nimmt die Flasche – und als sie danach greift, jagt das, was ihre Hand verändert hat, auch ihren Arm hoch zu ihrem Ellbogen und füllt ihre Haut mit diesem glänzenden Leuchten. Als Hopes Finger das Kästchen berühren, funkeln die Kanten einen Moment auf, und Hope schnappt nach Luft und reißt die Hand zurück.
»Hope? Was ist los? Ist noch etwas passiert?«
»Nein«, antwortet sie. »Bin gleich da.« Sie berührt das Kästchen noch einmal und sieht voller Staunen zu, wie es sich ebenfalls mit diesem seltsamen Etwas von ihrer Hand füllt, wenn auch viel dunkler als das auf ihrer Haut. Es verteilt sich über die Seiten des Kästchens, über Deckel und Boden und dann auch noch über den Inhalt. Die Murmeln sehen jetzt kalt aus. Aus irgendeinem Grund kommt Hope dabei Eis in den Sinn. Der Uniformrock des Zinnsoldaten ist plötzlich knallig und schrill und sie denkt unwillkürlich an Hitze. Als sie die Hand wegnimmt, kehrt alles zu leblosen Grautönen zurück.
Doch nun verändert sich die Flasche, als Hope nach ihr greift. Das Glas ist weiterhin durchsichtig, aber die Flüssigkeit darin füllt sich mit der Wärme des Sommers.
Hope geht mit der Flasche zu Sandy nach unten, drückt sie in seine wartende Hand und sieht zu, wie ihr Trank sich in die Grautöne zurückverwandelt, die sie immer schon gekannt hat.
Sandy hebt die Flasche hoch, schüttelt sie, zieht den Korken heraus und riecht daran.
»Na?«, fragt Oliver, der zu Sandys Füßen sitzt.
»Damit ist alles in Ordnung«, stellt Sandy fest, hält die Flasche ins Licht und mustert sie mit einem zusammengekniffenen Auge. »Alles bestens.«
Hope hat ihn aufmerksam beobachtet. Obwohl sie erst sechs ist, hat Sandy ihr schon beibringen können, wie man Menschen liest. Menschen, das hat er ihr gesagt, sind viel leichter zu lesen als Bücher. Hope kann ihm da nur zustimmen. Wörter sind trickreiche Wesen. Menschen sind dagegen schlicht und einfach. Die Geschichte der Menschen ist in ihr Gesicht, ihren Körper und ihre Hände geschrieben. In ihre Bewegungen. In ihre Blicke. In jede kurze Kopfbewegung. Und diese Geschichte erzählt immer die Wahrheit – selbst wenn der Mund eines Menschen das genaue Gegenteil versucht.
Jetzt liest Hope Sandy. Sie kann sehen, dass er erschrocken ist, und das macht ihr Angst, denn sie hat noch nie erlebt, dass Sandy sich vor irgendetwas fürchtet.
»Hab ich etwas falsch gemacht?«, fragt sie.
»Was?« Sandy reißt seinen Blick von der Zaubertrankflasche los, schaut zu Hope herunter und seine Schultern entspannen sich ein bisschen. »Nee, Deern, nix haste falsch gemacht.« Er schiebt sich an ihr vorbei, setzt sich auf die Bettkante. »Komm her.«
Sie setzt sich neben ihn. Er hält ihr das Zaubertrankfläschchen auf seiner Handfläche hin.
»Warum musste das jeden Morgen nehmen?«, fragt er.
Hope überlegt einen Moment. »Weil ich ein … ein Sündendrom habe.«
»Ein Syndrom.« Sandy nickt. »Aye. Und was bedeutet das?«
Beim Nachdenken rümpft Hope die Nase. »Das bedeutet, mit mir stimmt was nicht?«
Sandy hält ihr die Flasche hin. »Nimm sie in die Hand.«
Das tut sie, und sowie die Flasche Hopes veränderte Hand berührt, leuchtet in der Flüssigkeit wieder das warme Licht auf. Sie weiß noch nicht warum, aber es erinnert sie an Bienen, an Honig und an Sommermorgen.
Sandy sieht dabei zu – und wieder ist ihm die Angst ins Gesicht geschrieben.
»Ist es das hier, was mit mir nicht stimmt?«, fragt sie und hebt die Hand.
Oliver springt neben ihr auf das Bett und stupst sie sanft mit der Schnauze an. »Ich halte es für an der Zeit, es ihr zu sagen, Sandy.«
Sandy seufzt. »Ich hatte gehofft, sie würde schon ein bisschen älter sein, wenn ich ihr so eine Last auf die kleinen Schultern packen muss. Aber du hast recht.«
Hope schaut von einem zum anderen. »Seid ihr sicher, dass mit mir alles in Ordnung ist?«
»Aye, Deern. Ich bin sicher.« Sandy überlegt sich seine Worte genau. »Du hast recht, so ein Syndrom bedeutet, dass mit dir was nich stimmt. Jedenfalls bedeutet es das unter normalen Umständen. Aber deine Umstände sind nich normal. Die sind gewaltig unnormal. Verstehste, Hope, bei dir ist alles in Ordnung. Sogar total in Ordnung – und genau das ist mit dem Rest der Welt eben nich in Ordnung.«
Hope runzelt die Stirn. »Versteh ich nicht.«
»Das hier«, sagt Sandy und nimmt ihre Hand. Als ihre Haut seine berührt, verändert sich auch seine Hand, wird von Helligkeit überflutet. »So sollte die Welt eigentlich sein, Hope.«
Sie versucht zu begreifen, aber seine Worte passen nicht so richtig in ihren Kopf. Sandy hält noch immer ihre Hand und führt Hope wieder hinaus aus dem Wohnwagen, hinunter in das hohe Gras. Er weist mit seiner freien Hand auf die Lichtung. »So haste die Sachen immer schon gekannt. Aber das ist gelogen. Siehste deine Hand? Dieses komische Dings, das sie mit Wärme gefüllt hat? Das nennt sich Farbe, Deern. Farbe!«
Er lässt Hope los und die Wärme – die Farbe – verschwindet aus seiner Hand. »Die Farbe hat früher die ganze Welt angemalt. So viele Schattierungen und Töne, das würdste nich glauben.« Er läuft über die Lichtung zu den Bäumen, zupft ein breites Blatt von einem tief hängenden Zweig und kommt damit zurück. Er hält es ihr hin. Als Hope das Blatt nimmt, sieht sie, wie leuchtende, blendende Farbe jeden Winkel darin füllt.
»Das«, erklärt Sandy, »ist die Farbe Grün. Grün ist Natur, Hope. Dieser ganze Wald war mal ein Meer aus Grün – bis zum Herbst, natürlich, dann verwandelten sich die Blätter jedes Jahr in die Farbe von Feuer. Und guck hier, Deern.« Er ist jetzt richtig lebhaft geworden, diesmal pflückt er zwischen den hohen Grashalmen eine zarte Blume.
Hope nimmt sie. Die Blume hat einen langen Stängel, der sich oben biegt, und von dieser Biegung hängt vielleicht ein Dutzend kleiner glöckchenförmiger Blüten herab. Die Farbe kriecht aus Hopes Hand in den Stängel, färbt ihn grün, wie eben das Blatt, doch als sie die Blüten erreicht, füllt sie die mit einer anderen Farbe – und die ist so schön, dass Hope nach Luft schnappt.
»Und diese Farbe ist Blau«, sagt Sandy.
Hope kann ihren Blick nicht von den Blüten losreißen, von ihrer Schönheit. In ihrem tiefsten Herzen passiert jetzt etwas. Auf irgendeine Weise, in einem versteckten Teil ihrer selbst, weiß sie, dass das hier richtig ist. So sollte es sein!
»Blau«, erzählt Sandy, »ist die Farbe des Sommerhimmels, des Meeres, der Lochs und der Kristallseen im Westen. Blau. Allesamt. Das waren sie jedenfalls früher.« Er geht neben Hope in die Hocke, und sie beobachtet zu ihrem Entsetzen, dass seine Augen sich mit Tränen füllen.
Noch nie hat sie ihn weinen sehen. Sie lässt die Blume fallen, hebt die Hand und berührt ganz sanft Sandys verwittertes Gesicht. Er schließt die Augen, Tränen quillen unter seinen Lidern hervor, und sie sieht zu, wie die Farbe über sein Gesicht hinwegspült, wie sie seine Haut, seine Lippen, seine dunklen Haare und seinen Schnurrbart aufleuchten lässt. Er öffnet die Augen und sie keucht auf, als sie erkennt, dass sie grün sind.
»Wo ist denn die ganze Farbe hin?«, fragt sie.
Er umfasst ihre kleine Hand mit seiner. »Der König hat sie genommen«, antwortet er.
Hopes Nase rümpft sich ganz von selbst, während ihr Gehirn versucht, dieses Rätsel zu lösen. Natürlich hat sie von dem König gehört, vor allem im Geflüster der Menschen an den vielen Orten, die Sandy und sie besucht haben. Der König nimmt ihnen etwas weg, das er Steuern nennt, und im Gegenzug dürfen sie auf seinem Land leben und seine Felder bestellen – nur kann Hope nicht begreifen, wer irgendwann entschieden hat, dass das Land dem König gehört. Und genauso hat er auch die Farben genommen?
»Warum hat er das getan?«, fragt sie. »Wollte er die ganze Farbe für sich haben?«
Sandy schüttelt den Kopf. Hope kann sehen, dass dieses Thema ihm arg zu schaffen macht. »Er hat es aus Neid getan. Verstehste, Hope, der König wurde in eine Familie von mächtigen Magiern reingeboren. Aber als er zur Welt kam, war er nur schwarz und weiß und grau. Keine Farbe lebte in ihm und niemand konnte ihn heilen, nich mal seine mächtigen Eltern. Das alte Königspaar hat ihn deshalb versteckt. Sie wollten ihn beschützen, verstehste, weil sie wussten, dass die Menschen ihn niemals akzeptieren würden. Sie würden sich vor ihm fürchten – und Angst und Unwissenheit können Leute dazu bringen, schreckliche Dinge zu tun. Aber er war einsam und sein Herz wurde kalt und bitter. Als seine Eltern gestorben waren …« Sandy legt eine Pause ein, und Hope sieht, dass er zittert. Es ist wirklich eine traurige Geschichte, findet sie, doch sie kann nicht begreifen, warum sie Sandy so stark berührt. »Als sie gestorben waren, hat der Junge den Thron bestiegen, und er hat seine Tante zu seiner Ratgeberin ernannt. Sie besitzt große Macht in der dunklen Kunst der Nekromantie.«
»Was ist das denn?«, fragt Hope.
»Wenn Leute sich an Dingen zu schaffen machen, von denen sie lieber die Finger lassen sollten«, erklärt Sandy.
»Was sind das für Dinge?«
Sandy zögert, und Hope sieht ihm an, dass er überlegt, ob er es ihr sagen soll. Endlich gibt er sich einen Ruck: »Nekromanten verwenden Magie auf eine Weise, die nicht richtig ist. Sie reden mit den Toten. Sie rufen ihre Seelen und Dämonen und solche Wesen herbei. Und nie war jemand von ihnen so mächtig wie die Tante des Königs. Mithilfe von Nekromantie haben die beiden sämtliche Farben aus dem Leben gestohlen und eine Armee von Schwarzröcken und Fetzerhunden zusammengerufen, um all jene zu vernichten, die versuchen, die Farbe zurückzuholen. Du kannst ins Gefängnis geworfen werden, wenn du auch nur über Farbe redest, Hope.«
Sie hebt ihre kleine Hand und reißt die Augen auf. In ihrem Magen dreht sich alles vor Angst.
»Ich will nicht ins Gefängnis!«
»Das würd ich auch nich zulassen«, versichert Sandy. »Deswegen haste deinen Trank ja schon genommen, als du ganz klein warst. Der versteckt deine Farbe, Hope. Er versteckt, dass du anders bist.«
Hope überlegt. »Wieso bin ich denn anders?«
Sandy richtet sich auf und schiebt die Hände in die Taschen. »Das weiß ich nich, Deern, ich wünschte, ich könnte es dir sagen. Und ich wünschte, du bräuchtest das nich zu verstecken. Aber das musste.«
Als sie zurück in den Wohnwagen gehen, überlegt Hope noch mehr. Jetzt hat sie eine neue brennende Frage im Kopf. »Meinst du, meine Eltern waren so wie ich?«
Sie setzt sich auf die Bettkante und Sandy läuft hin und her. Dann geht er wieder in die Hocke. Er nimmt ihre Hände und die Farbe springt von ihrer Hand auf seine über. Seine Augen sind groß und traurig.
»In der Nacht, als ich dich gefunden hab«, erzählt er, »haben deine Eltern versucht, dich aus der Stadt rauszubringen. Sie hatten sicher Angst, der König würde dich umbringen, sowie er von dir erfährt – und sie hatten recht. Die Fetzerhunde und die Schwarzröcke haben deine Eltern verfolgt und sie im Wald kurz hinter den Stadtmauern eingeholt.«
»Haben die ihnen was getan?« Hope hat die Augen jetzt ganz weit aufgerissen.
Sandy drückt ihre Hand. »Aye, Deern. Das haben sie. Ich geh nich gern in die Nähe der Stadt, aber in der Nacht, als das passiert ist, wollte ich einige Kräuter pflücken, die nur da im Wald wachsen. Als ich deine Eltern gefunden hab, war’s zu spät. Sie sind bei dem Versuch gestorben, dich zu beschützen. Ich hab dich aufgehoben und weggebracht und seither hab ich dich immer beschützt.«
Hope reibt sich mit den Fingerknöcheln über die Augen. »Dann ist es meine Schuld.«
»Was denn?« Sandy runzelt die Stirn.
»Na ja, meine Eltern wären doch noch am Leben, wenn ich nicht gewesen wäre, oder?«
Sandy legt eine Hand unter ihr Kinn und hebt es behutsam an, bis ihre Augen in seine schauen. »So darfste nie im Leben denken«, sagt er. »Haste gehört? Wir haben alle keinen Einfluss darauf, wie wir auf die Welt kommen. Aber wir haben Einfluss darauf, was wir werden und welche Spuren wir hinterlassen. Der König und seine Nekromantin, die sind schuld, Deern. Nich du. Nie im Leben du. Die sind das doch, die die Farbe weggenommen haben. Die sind das, die Angst vor dir hatten und dich umbringen wollten. Und die würden auch heut noch Angst vor dir haben, wenn sie wüssten, dass du lebst.«
»Angst vor mir?« Das klingt so albern, dass Hope es sich fast nicht vorstellen kann. »Wieso sollten die denn vor einem kleinen Mädchen Angst haben?«
»Weil es jede Menge Leute gibt«, erklärt Sandy, »die deine Gabe für ein Wunder halten würden, die sich daran erinnern würden, wie es früher war. Und das macht dich mächtig. Aber du musst deine Farbe verstecken, solang du jung bist. Du musst sie verstecken, bis der Augenblick kommt, wo du beschließt, sie zu nutzen. Und das muss deine Entscheidung sein.«
Sie nickt, hat aber von seinen Worten nicht viel verstanden. Er redet so viel! Sie gähnt. »Ich bin müde.«
»Aye.« Er lächelt. »Nimm deinen Trank, sei ein braves Mädchen.«
Er reicht ihr die winzige Zaubertrankflasche, sie zieht den Stöpsel heraus und lässt einige Tropfen auf ihre Zunge fallen. Der Trank schmeckt süß wie Honig und wärmt, als Hope ihn hinunterschluckt. Fast sofort fängt die Farbe in ihrer Hand und ihrem Arm an, sich zurückzuziehen, verlässt ihr Handgelenk, ihre Handfläche, ihre Fingerknöchel. Verlässt all ihre Finger, ihre Fingerspitzen.
Hope untersucht jeden Teil ihrer Hand, sieht aber nur noch Grautöne. Die Farbe ist verschwunden.
»Von jetzt an«, mahnt Sandy, »musste deinen Trank immer bei dir haben. Verstanden? Und ich glaube, du nimmst am besten jeden Morgen, Mittag und Abend ein paar Tropfen.« Er hockt noch immer neben ihr und streichelt ihre Schulter. »Ich weiß, das ist ganz schön viel zu verarbeiten, Deern. Und ich geh nich davon aus, dass du alles sofort begreifst. Aber eins kann ich dir sagen: Solange ich noch atme, haste ’nen Ort, wo du hingehörst.«
Hope nickt. Sie steckt die Flasche ein, während Sandy sich aufrichtet und zum Kutschbock zurückkehrt. Bald poltern die Räder wieder über den unebenen Boden, als das Pferd sie zurück auf die Straße zieht.
Hope rollt sich auf ihrem Bett zusammen und Oliver, der Hund, springt hinauf und schmiegt sich an sie.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragt er.
»Nein. Ich will nicht anders sein als alle anderen.«
»Weiß ich. Hast du Angst?«
»Nein. Vielleicht. Ein kleines bisschen.«
»Ich werde dich auch beschützen«, versichert Oliver.
Sie krault ihn hinter den Ohren und er drückt den Kopf in ihre Hand. »Das weiß ich.«
Oliver legt den Kopf auf ihre Beine, schließt die Augen und ist, wie nur ein Hund das kann, in Sekundenschnelle eingeschlafen. Hope schaut sich im Wohnwagen um und fragt sich, wie es möglich ist, dass ihr Leben ihr noch vor einer halben Stunde so sicher und grau und alltäglich vorkam.
Jetzt kennt sie eine wichtige und grauenhafte Wahrheit: dass die Welt eine Maske trägt. Dass das, was sie sieht, nicht echt ist. Dass es hinter der Maske Farben gibt – und dass Farben wunderschön und leuchtend sind. Sie hat es nur für einige Minuten gesehen, aber schon fühlt ihr Kopf sich ohne Farben ein bisschen leer an. Das ist nicht fair, denkt sie, dass alle im Land ohne leben müssen, bloß weil eine Person das so will.
Und ihr Herz kommt ihr noch leerer vor, weil diese eine Person, der König, Hope ihr mögliches Leben gestohlen hat. Ein Schattenleben mit einer Mama und einem Papa tanzt durch ihren Kopf. Vielleicht ein Leben mit Schule und Freundinnen und Freunden in ihrem Alter und einem echten Haus aus Stein.
Nicht, dass ihr Leben so schrecklich ist, denkt sie, während sie den schnarchenden Oliver hinter den Ohren krault. Aber dennoch …
Eines Tages möchte sie dem König gegenübertreten. Sie weiß nicht genau, was sie tun will, wenn es so weit ist, aber in ihrem tiefsten Herzen weiß sie, dass es für den König kein guter Tag sein wird.
Kapitel zwei,
in welchem Darroch mit einem neuen Projekt beginnt
Weit weg von Sandys Wohnwagen, am Rand der leuchtend grauen Stadt, fegt Darroch Gwendle den gepflasterten Vorplatz auf dem tiefgrauen Bauernhof seiner Großmutter. Es ist ein heißer Tag, und während er hin und her fegt, hin und her, sieht Darroch zu, wie Schweißperlen seine sanft geschwungene Nase hinabkullern und auf das Pflaster fallen.
Er fegt bis zur Hofecke und zu dem Haufen aus losem Heu und Schmutz, der dort schon liegt, dann hält er inne, stützt sich auf den Besen und schaut auf. Der Himmel ist eine riesige, niemals endende Weite aus Diamantgrau. Doch obwohl Darroch es genießt, wie die Sonne sein Gesicht wärmt, macht ihm eine bohrende Traurigkeit zu schaffen.
Der Himmel dürfte nicht grau sein, denkt er. Der müsste blau sein, wie immer Blau auch aussehen mag.
»Du bist ja eine Million Meilen weit entfernt«, schreckt die Stimme seiner Großmutter ihn auf.
Die alte Dame kommt über den Hofplatz und hält ihm ein Glas Wasser hin. Er leert es in durstigen Zügen.
»Das sieht ja großartig hier aus«, stellt sie fest und schaut sich um. »Makellos sauber.« Sie tippt mit dem Fuß auf das Pflaster. »Aye. Hervorragend. Ich finde, da kannst du jetzt Feierabend machen.«
Darroch schaut zuerst das leere Glas und dann seine Großmutter an. »Feierabend? So früh schon, Granny?«
Mrs Gwendle nickt. »Na ja, ich kann doch wohl kaum erwarten, dass du den ganzen Tag arbeitest, oder? Nicht an deinem Geburtstag.«
Darroch blinzelt. »Du meinst … aber ich dachte …«
»Du hast gedacht, ich hätte den elften Geburtstag meines einzigen Enkels vergessen? Meine Güte, Jungchen, so alt und verwirrt bin ich nicht. Noch nicht.« Sie lächelt ihn an. »Also los.«
Darroch folgt der alten Frau ins Haus und in die Küche, wo ihn der Duft von würziger Möhrensuppe empfängt wie eine Umarmung.
»Mein Lieblingsessen.« Er lugt in den blubbernden Topf und atmet tief ein.
»Mach die Augen zu.«
Er dreht sich zu Granny um. »Was?«
»Mach die Augen zu, Junge.«
Wie immer gehorcht er. Er hört, wie eine Schranktür geöffnet wird, hört etwas rascheln, aber wagt nicht, die Augen auch nur einen Spaltbreit zu öffnen.
Endlich, als er schon glaubt, gleich vor Neugier zu platzen, sagt sie: »So. Augen auf.«
Er schaut hin. Sie steht vor ihm und reicht ihm etwas. Es ist ein länglicher Lederbeutel. Langsam streckt Darroch die Hand danach aus, spürt das weiche Leder, riecht es. Und drinnen fühlt er … etwas anderes. Sein Herz hämmert los, als seine Finger die Umrisse der dünnen, harten Gegenstände darin betasten.
»Mach schon auf.« Mrs Gwendle schmunzelt.
Darrochs zitternde Hände finden die Öffnung und ziehen daran. Er schaut hinein und findet … fünf nagelneue Pinsel. Nicht solche großen, mit denen Wände oder Zäune auf dem Hof gestrichen werden. Sondern welche von der anderen Sorte. Der Sorte, mit der Bilder gemalt werden.
Er zieht einen Pinsel nach dem anderen hervor, betrachtet das glatte Holz, fährt mit den Fingern über die unterschiedlich großen weichen Zobelborsten.
»Ich weiß, die alten Pinsel deines Großvaters haben ihre besten Tage langsam hinter sich«, erklärt Granny. »Obwohl du so sorgfältig damit umgegangen bist, hat eben alles seine Zeit. Ich dachte, du solltest allmählich deine eigenen Sachen haben. Ein paar Pinsel, die nur dir gehören.«
Darroch weiß nicht, was er sagen soll. Tränen trüben seinen Blick. »Danke, Granny.« Er umarmt sie. »Ich werde Großvaters Pinsel trotzdem behalten. Ich würde sie niemals hergeben.«
»Ach, das weiß ich doch«, sagt Granny und schnieft. »Aber jetzt mach. Probier sie aus!«
Sie scheucht ihn weg und er läuft los, rennt nach oben in sein Zimmer. Er legt den Lederbeutel vorsichtig auf sein Bett, öffnet ihn, legt die neuen Pinsel der Größe nach nebeneinander und betrachtet sie lächelnd. Dann dreht er sich zum anderen Ende des Zimmers um, wo eine wacklige Staffelei steht, umgeben von Holzstücken und Resten alter Leinwand. Neben der Staffelei ist Darrochs kleiner Schreibtisch fast komplett unter einem Wirrwarr aus Holzresten, Töpfen mit grauer Farbe, einer Palette und den alten Pinseln seines Großvaters verschwunden. Hier, in diesem kleinen Raum, hat Darroch in den letzten Jahren versucht, malen zu lernen.
Sein Großvater hat sehr gern gemalt, das hat Granny ihm jedenfalls erzählt. Großvaters Bilder hängen überall im Haus. Sie sind wirklich schön, meistens zeigen sie den Hof und das Meer und die sanft geschwungenen Hügel. Es gibt sogar ein Bild von Granny, aber das wurde gemalt, als sie viel jünger war.
Darroch geht zu dem überfüllten Schreibtisch, und seine Finger berühren die Farbtuben, deren Namen sein Herz aufleuchten lassen. Ockergelb. Umbra. Gebrannte Siena. In Darrochs Augen sind das alles nur unterschiedliche Grautöne. Er fragt sich, wie schon unendlich oft, wie diese Farben ausgesehen haben, als sein Großvater sie benutzt hat. Als es auf der Welt noch Farbe gab.
Die Sehnsucht danach, es zu wissen, tut fast weh.
Darroch tritt hinter den Schreibtisch und hebt einige seiner eigenen Malversuche auf. Es gibt ein Bild vom Hof bei Sonnenaufgang, vom höchsten Punkt auf Grannys Land aus betrachtet. Dieses Bild gefällt ihm. Ein anderes zeigt die Boote der Krabbenfischer, die von der Stadt aus auf das offene Meer zuhalten. Darroch würde das zwar niemals laut sagen, aber er glaubt, dass er ziemlich gut wird. Sein neuestes Bild, das noch auf der Staffelei steht, ist ein Selbstporträt. Als Granny es gesehen hat, hatte sie Tränen in den Augen. Tränen des Stolzes.
Darroch tritt wieder zurück und verschränkt die Arme. Diesmal betrachtet er kein besonderes Bild, keinen Pinsel, er denkt auch nicht über Farben nach. Nein. Diesmal starrt er die leere graue Wand an und stellt sich etwas vor.
Er weiß schon seit einer ganzen Weile, dass er das hier tun will. Aber es ist eine große Aufgabe, und er wollte warten, bis er gut genug wäre. Jetzt glaubt er, dass es so weit sein könnte. Und Granny hat ihm gerade neue Pinsel geschenkt, nicht wahr? Das muss doch ein Zeichen sein?
Er nickt, starrt noch immer die leere Wand an und stellt sich vor, wie sie wohl aussehen wird, wenn er fertig ist. Auf seinem Gesicht breitet sich ein verstohlenes Lächeln aus, während er zum Schreibtisch geht, die Palette nimmt und mehrere graue Farbkleckse darauf verteilt. Dann sucht er sich einen der neuen Pinsel aus, stellt sich vor die Wand, schaut sie an und krault sich mit dem Pinsel unterm Kinn. Nach einer Weile holt er ganz tief Luft, tunkt den Pinsel in die Farbe, streckt die Hand aus, atmet langsam aus und berührt die Wand mit der Pinselspitze.
Einige Stunden später kommt Mrs Gwendle an Darrochs Tür vorbei. Sie wollte gar nicht stehen bleiben, aber ein Geräusch dringt an ihr Ohr, also tut sie es doch und lauscht. Was sie hört, zaubert ein Lächeln auf ihr Gesicht: Darroch summt bei der Arbeit vor sich hin.
Mrs Gwendle nickt. Das ist gut. Darroch ist glücklich. Schon als er noch winzig klein war, wusste sie bereits, dass er neugieriger auf die Welt ist, als ihm guttut. Er ist genauso, wie sie früher war. Immer stellt er Fragen. Gibt sich nie mit den blöden Antworten zufrieden, auf die andere Kinder hereinfallen. Nein. Darroch konnte immer schon sehen, dass die Welt eine Maske trägt.
Eines Tages, da ist sie sicher, wird er sich der Regenbogenliga anschließen und helfen, die Farben zurückzuholen. Sie hat schon Bilder aus dieser Zukunft gesehen. Kurze Momentaufnahmen in den Teeblättern, die ihre eigene Großmutter sie zu deuten gelehrt hat. Geflüster in ihren Träumen. Und wird sie Darroch zurückhalten? Natürlich nicht. Wenn sie jünger wäre, ohne Verantwortung, wäre sie doch selbst dort draußen, oder nicht?
Dennoch macht die Vorstellung, dass ihr einziger Enkel sich in Gefahr begibt, ihr eine Gänsehaut.
Eines Tages wird er gehen. Aber jetzt noch nicht.
Kapitel drei,
in welchem Mondlicht gesammelt wird
Einen Mondumlauf, nachdem Hope zum ersten Mal Farben gesehen hat, wartet sie neben Sandy vor der offenen Tür einer bescheidenen Hütte, aus der Licht hinaus in die Nacht fällt. In der Tür steht ein magerer, heruntergekommener Mann von Mitte zwanzig. Wie wild schüttelt er Sandy die Hand.
»Danke«, wiederholt er immer wieder. »Danke, danke! Und noch eine Million Mal, danke. Ach, wie kann unsere Familie je wiedergutmachen, was du getan hast? Ich wünschte, wir hätten ein bisschen Geld übrig!«
Sandy schafft es, seine Hand zu befreien. Er krümmt die Finger, um sie wieder zum Leben zu erwecken. »Geld? Davon will ich wirklich nichts hören.«
»Aber du hast unsere Kleine gerettet«, betont der Mann in der Tür und starrt Sandy mit großen Augen und in tiefer Verehrung an. »Als sie von dem Baum gefallen ist …« Er schluckt. »Sie war so schwer verletzt, dass wir dachten, wir würden sie verlieren. Wenn du nicht gerade vorbeigekommen wärst …«
»Wir kommen immer irgendwo vorbei«, wiegelt Sandy ab. »Ich freue mich, dass wir helfen konnten.«
»Aber wir müssen das doch auf irgendeine Weise wiedergutmachen können?«, beharrt der Mann.
Sandy lächelt und legt dem Mann die Hand auf die Schulter. »Es ist die Pflicht eines Wandermagiers, denen zu helfen, die in Not sind. Die einzige Gegenleistung, um die ich bitte, ist, dass ihr auch freundlich zu uns seid, falls wir jemals in Not geraten.«
»Natürlich«, versichert der Mann.
Sandy nickt und tippt an seinen Hut. »Aye. Dann ist ja alles in Ordnung. Wir ziehen weiter. Denk dran, deiner Kleinen den Rest des Tranks zu geben, wenn sie aufwacht.«
»Werde ich.«
Sandy wendet sich ab, dann hält er inne. »Und lass sie in nächster Zeit nicht auf die Bäume!«
»Wohin wollen wir so spät noch?« Hope reibt sich die Augen und schaut hinauf in den klaren Nachthimmel. Mitternacht ist schon vorüber, der volle Mond leuchtet hell. Sie haben den Wohnwagen in dem winzigen Dorf stehen lassen, wo Sandy die Verletzungen des kleinen Mädchens behandelt hat.
»Wirste gleich sehen.« Sandy hält eine Laterne in der Hand, obwohl in dieser Nacht das Mondlicht wirklich ausreicht, um ihnen den Weg zu zeigen.
Hope schaut stirnrunzelnd hinunter zu Oliver, der neben ihr herläuft, als sie den steilen, steinigen Hang hochsteigen. Tief unter ihnen liegt der Wald, der in diesem Licht aussieht wie ein riesiges schwarzes Meer. Hier und da kann Hope die Dorflichter erkennen, die funkeln wie die Lampen weit entfernter Schiffe. »Warum kann er mir das nicht einfach sagen?«, fragt sie leise.
»Er spielt den Geheimnisvollen«, sagt Oliver. Er bleibt ab und zu stehen, um zu schnuppern und seine Duftmarke zu setzen. »Du weißt doch, wie gern er das tut.«
»Meine Beine tun weh«, jammert Hope.
Sandy wird nicht langsamer. Hope hat sogar den Eindruck, dass er seine Schritte noch beschleunigt hat. »Fast am Ziel. Komm schon, Deern.«
»Weißt du, wohin wir gehen?«, fragt Hope Oliver.
Der struppige schwarze Hund zuckt mit einem Ohr. »Es steht mir nicht frei, darüber Auskunft zu erteilen.«
»Das ist nur eine hochgestochene Art, mir zu sagen, dass du es nicht verraten willst, oder?«
»Mit einem Wort: ja.«
Hope schnaubt, bohrt die Hände in die Taschen ihres grauen Mantels und läuft schneller.
»Nicht schmollen«, sagt Oliver. »Das steht dir nicht.«
Sie gehen schweigend weiter, bis Hope sich plötzlich bückt und eine kleine graue Blume vom felsigen Boden pflückt. »Was hat die hier wohl für eine Farbe?«
»Ach, Hope«, seufzt Oliver. »Nicht schon wieder. Sandy hat dir doch gesagt, dass es gefährlich ist, darüber zu reden. Du musst die Sache mit den Farben vergessen.«
»Aber das kann ich nicht«, erwidert sie und ihre Wangen werden heiß. »Wie könnte ich denn so etwas Wunderbares vergessen?«
»Wenn du es nicht tust, kommen bald die Schwarzröcke des Königs auf ihren riesigen Fetzerhunden durch den Wald geritten und holen dich.«
»Sandy würde das nicht zulassen«, sagt Hope.
»Ach was, dann wärst du also bereit, ihn in Gefahr zu bringen? Und mich auch?«
»Na ja, nein … aber …«
»Weil du genau das tust, Hope, wenn du die Regeln brichst. Willst du das?«
»Nein!«
»Worüber redet ihr denn schon wieder?«
Sandy ist stehen geblieben und schaut sich mit misstrauischer Miene zu ihnen um.
»Ach, nichts«, antwortet Oliver. »Hope meinte nur gerade, dass sie glaubt, du hast dich verirrt. Ich hab dich natürlich verteidigt.«
Sandy runzelt die Stirn. »Ach, aye? Verirrt, was? Ha! Folgt mir, dann werdet ihr ja sehen!«
Er wendet sich ab, und Hope klettert hinter ihm her, den immer steileren Hang hoch, bis sie oben angekommen sind. Von dort aus sehen sie über ein weites Heidemoor. Der Boden ist weich und schwammig, es ist ziemlich schwierig, darüber zu laufen.
»Du solltest versuchen, dir noch ein Paar Beine wachsen zu lassen«, sagt Oliver selbstzufrieden.
Nach weiteren zehn Minuten des Herumstolperns stoßen sie mitten im Moor auf einen sehr großen See, der umgeben ist von grauem Schilf und mageren, knorrigen Bäumen. Das Wasser ist kohlschwarz und sanft gekräuselt. Hope kann sehen, wie das Mondlicht sich darin spiegelt.
»Was wollen wir hier?«, fragt sie. Dann fügt sie hinzu: »Und wo ist hier überhaupt?«
Sandy geht bereits mit großen Schritten auf den Moorsee zu. »Komm schon, Hope!«
Sie holt ihn am Seeufer ein, während Oliver im Heidekraut herumschnüffelt, Witterung aufnimmt und seine Nase in alles bohrt, was ein Kaninchenbau sein könnte.
»Du hast doch schon oft zugeschaut, wenn ich einen Zauber hergestellt hab, oder?«, fragt Sandy.
»Aye.«
»Und welche besondere Zutat sorgt dafür, dass ein Zauber funktioniert?«
»Mondlicht«, antwortet Hope, »ist doch klar.«
Sandy lächelt. »Aye, Mondlicht. Hab mein letztes gerade verbraucht. Was glaubste, wo wir jetzt Nachschub hernehmen?«
Hope macht schon den Mund auf. Dann hält sie inne. »Holst du das nicht einfach vom Himmel?«
Sandy schmunzelt. »Vom Himmel holen, sagt sie! Als ob das so leicht wär, wie nen reifen Appel vom Baum zu pflücken!«
Hope spürt schon wieder, dass ihre Wangen glühen. Sie verschränkt die Arme und streckt die Zunge heraus. »Mach dich nicht lustig über mich!«
»Ich mach mich nich lustig«, stellt Sandy klar. »Du kannst kein Mondlicht vom Himmel holen. Das ist viel zu weit verteilt und zu wild. Du musst irgendwohin gehen, wo es sich sammelt, verstehst du? Eine Stelle, wo es nich wegkann.«
Hope schaut in sein Gesicht, und dann blickt sie auf das Wasser hinaus, wo das Mondlicht sich auf der kräuseligen Oberfläche ausbreitet. Ihre großen dunklen Augen werden noch größer. »Du meinst, wie so ein See?«
Sandy lächelt sie voller Stolz an. »Aye. Wie so ein See. Aber nich irgendein See. Es muss ein Mondsee sein.« Er zeigt auf das glitzernde Wasser. »Es gibt viele davon, überall im Land. Mondseen sind uralte magische Stätten. Angeblich wurden sie vor langer Zeit von Feen verzaubert. Aber egal aus welchem Grund, ein Mondsee fängt das Mondlicht ein. Und das Licht bleibt, bis die Sonne aufgeht.«
Hope schaut auf die ruhige Schwärze des Wassers, und ihre Augen huschen über die Stellen, wo sich das Mondlicht in silbernen Lachen und Wirbeln gesammelt hat.
»Willste wissen, wie man ’nen Mondsee von anderen Seen unterscheidet?«, fragt Sandy jetzt.
Hope nickt. »Das möchte ich wirklich, wirklich gern.«
»Da.« Sandy zeigt auf einen der Bäume am Seeufer. Es ist eine große, knorrige Eiche, viel größer als die übrigen Bäume.
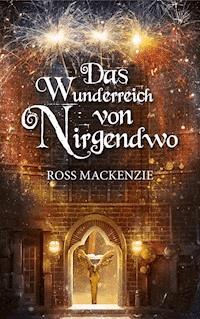













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














