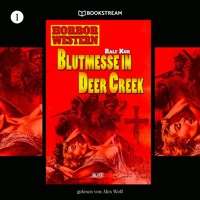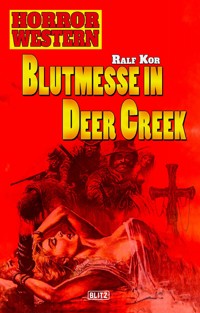
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Horror Western
- Sprache: Deutsch
Es heißt, jeder Mensch trägt ein dunkles Geheimnis mit sich, tief begraben in seiner Seele, das nur darauf wartet, aus ihr auszubrechen. Für Town Marshal Gerard riecht es gewaltig nach Ärger, als der narbengesichtige US-Marshal und ein einarmiger Comanche in Bond eintreffen, um dem mysteriösen Mord an einem Siedler auf den Grund zu gehen. Die Tat soll ausgerechnet dessen Tochter begangen haben. Gemeinsam folgen sie der Spur nach Deer Creek und finden den exzentrischen geistlichen Führer der Siedlung. Hinter alldem steckt ein unglaubliches Geheimnis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 211
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Horror Western
In dieser Reihe bisher erschienen
3801 Ralf Kor Blutmesse in Deer Creek
3802 Earl Warren Manitous Fluch
3803 Ralph G. Kretschmann Im Sattel saß der Tod
3804 Ralph G. Kretschmann Der Fluch des Mexikaners
Ralf Kor
Blutmesse in Deer Creek
Ein Horror-Western
Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Rudolf Sieber-LonatiUmschlaggestaltung: Mario HeyerSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-281-3Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!
Kapitel 1 – Die Flucht
„Was auch immer du hörst, oder glaubst zu hören, dreh dich nicht um. Lass mich nicht los, bis ich es dir sage“, flüsterte Conrad Weiser seiner Tochter ins Ohr, kurz bevor er sie auf den Gaul setzte und sie der Siedlung den Rücken kehrten. Sie hatte genickt und die Lippen fest aufeinandergepresst, da er ihr verboten hatte, einen Mucks von sich zu geben.
Die dünnen Arme schlangen sich während des Ritts immer enger um ihn und drückten ihm die Luft ab. Ihr Kopf schmiegte sich an seinen Rücken, und er glaubte, ein leises Schluchzen zu hören.
Ein Luftzug traf ihn im schweißnassen Nacken. Er missachtete den eigenen Rat und warf einen Blick über die Schulter hinweg. Für wenige Sekunden stockte ihm der Atem, und das lag nicht allein an seiner Tochter, deren Umklammerung immer enger wurde und gegen die Rippen drückte. Die Luft flimmerte, wie in den heißen Monaten über den Great Plains, wenn sich kein Lüftchen regte und die sengende Hitze Mensch und Vieh zu schaffen machte. Doch das konnte nicht sein. Es war Ende März, und der Mond stand in beinahe kompletter Fülle am Himmel. Sie mussten bei ihrer Flucht entdeckt worden sein. Welch ein Narr er war, zu glauben, dass sie einfach aus der Siedlung verschwinden konnten.
Conrad Weiser drehte sich hastig nach vorne und stieß die Fersen seiner Stiefel in die Seiten des Pferdes. Die Muskulatur des Tieres spannte sich zum Bersten an, und sie legten an Geschwindigkeit zu. Die Zügel wickelte er sich stramm um die Fäuste, und das abgewetzte Leder schnitt ihm in die Haut. Er beugte sich nach vorne, um den Galopp auszugleichen. Der alte Klepper war schneller, als er es ihm zugetraut hätte. Am Horizont erkannte er den Wasserspeicher der Stadt. Sie würden bald Bond erreicht haben.
Erneut gab er dem Pferd die nicht vorhandenen Sporen. Ein Fehler. Der Gaul bockte.
Conrad redete auf das Tier ein und versuchte, es wieder auf Kurs zu bringen. Wiehernd protestierte es gegen die stramm gezogenen Zügel. Mit einem spitzen Aufschrei verlor das Mädchen den Halt und rutschte zur Seite weg. Gedankenschnell griff er nach hinten und bekam sie am Kleid zu packen, bevor sie vom Pferd fallen konnte. Da leckte die Hitze an seiner Wange. Sie umfing ihn wie die erdrückende Wärme eines Heizofens. Die Luft fraß den Sauerstoff und erschwerte das Atmen. Er schmeckte Schwefel auf der Zunge, wie der Vorgeschmack zur Hölle.
„Mach, dass es aufhört“, flehte seine Tochter, der die Hitze Tränen in die Augen trieb.
Mit einem beherzten Ruck beförderte er sie zurück auf den Rücken des Pferdes und peitschte den Gaul nach vorn. Er musste die drohende Gefahr ebenfalls spüren, denn ohne aufzubegehren, galoppierte das Tier los.
Die Hitze folgte ihnen und sabberte frische Schweißperlen in seinen Nacken.
Häuser zeichneten sich am Horizont ab und kündigten die rettende Stadt an. Zumindest hoffte er, dass sie dort Hilfe finden würden.
Erneut trat er dem Tier in die Seite und flüsterte ihm das Versprechen in die Ohren, ihm die verdiente Ruhe zu gönnen, sobald sie Bond erreicht hatten. Sie passierten die Stadtgrenze, da traf sie eine neue Hitzewelle wie der Atem eines Drachen. Der Gaul sackte unter ihnen weg. Conrad flog über ihn hinweg und landete mit dem Gesicht voran im Staub. Ein stechender Schmerz bohrte sich ihm wie eine Lanze in die Schulter. Sein Körper bremste den Fall seiner Tochter, die einige Meter weiter rollte und liegen blieb. Der Aufprall trieb ihm die Luft aus den Lungen. Keuchend rappelte sich Conrad auf und spuckte Dreck und Blut auf den Boden. Mit der Zunge glitt er über die Schneidezähne, die wackelig im Mund saßen. Er schloss ihn, und Sand knirschte zwischen seinen Zähnen. Mit dem Ärmel wischte er sich durchs Gesicht, das wie Feuer brannte. Frisches Blut klebte am schmutzigen Stoff.
Bevor er den Fehler begehen konnte, sich selbst zu bemitleiden, hörte er das Schluchzen seiner Tochter und blickte auf. Mit angezogenen Beinen hockte sie wenige Meter von ihm entfernt. Ihre Knie verunzierten kreisrunde Abschürfungen, in denen Dreck klebte.
„Geht es dir gut?“, fragte er hastig. Das Mädchen verbarg ihr Gesicht hinter den Knien und nickte zum Pferd, das schnaubend am Boden lag. Ihr Vater folgte ihrem Blick und erschrak. Er konnte nicht sagen, was sie mehr mitnahm: Der Sturz oder das bemitleidenswerte Tier, dessen Glieder unnatürlich zu den Seiten angewinkelt waren und der Anblick der Knochen, die wie geborstenes Geäst aus dem Fleisch ragten.
„Wir müssen ihm helfen“, wimmerte das Mädchen und lehnte sich zu ihrem Vater, der den Arm um sie legte. Unter dem Kragen ihres Kleides erkannte er die schrecklichen Vernarbungen. Sein Brandzeichen. Auch unterhalb des Ärmels schlängelte sich sein Mahl wie schwarze Würmer. Er durfte sie nicht kriegen.
„Das geht nicht“, antwortete er und schluckte den Kloß hinunter, der ihm das Atmen erschwerte. „Wir müssen weiter. Kannst du gehen?“
Sie nickte knapp. Mühselig kämpfte er sich auf die Beine und griff seiner Tochter helfend unter die Arme.
„Komm“, forderte er und zog sie mit sich. Nicht, ohne mit gehetztem Blick das Terrain zu sondieren. Es war nichts auszumachen. Kein Flirren der Luft oder ein Windzug, doch das bedeutete wenig. In Sicherheit waren sie noch lange nicht.
Das Mädchen weinte bitterlich und humpelte aufgrund der Abschürfungen, ließ sich aber ohne Widerworte in die Stadt führen.
Sie erreichten die Stallungen von Bond. Im Inneren der Häuser brannte kein Licht. Entweder schliefen sich die Bürger die Plackerei des Tages aus den Knochen oder verschleuderten ihr Geld im hiesigen Saloon und dem Freudenhaus.
Das war aber nicht sein Ziel. Er suchte den Town Marshal. Gerard war zwar nicht das, was man landläufig als Menschenfreund bezeichnen konnte. Nein, ganz sicher nicht. Er war ein verdammter Dixie, der sich einen Dreck um Spätsiedler wie ihn scherte, aber zum Teufel, sie waren ihm zumindest keine Fremden. Er würde ihnen helfen. Er musste.
Eine Bewegung zwischen zwei Häusern ließ ihn innehalten. Das Rauschen des Blutes dröhnte ihm im Ohr, und er spannte den Körper an. Erlag er Hirngespinsten? Der bleiche Schein des Mondes vermochte nicht preiszugeben, was im Schatten der Gasse umherschlich. „Vater, du tust mir weh“, riss ihn das Jammern seiner Tochter aus der Trance. Erst jetzt bemerkte er, dass er ihre schmale Hand fest umschlossen hatte. Zu fest. Erschrocken von sich selbst, ließ er sie los, und sie rieb sich die gequetschten Finger.
Er kniete sich zu ihr und drückte ihren zitternden Körper an seine Brust. „Wir müssen Gerard finden“, beschwor er sie. „Du weißt, wen ich meine?“
Sie nickte.
„Er wird uns …“ In dem Augenblick drang ein tiefes Grollen aus der Gasse, und die Anspannung kehrte zurück. Der Vater erhob sich langsam und schob das Mädchen schützend hinter sich. Das Knurren kam näher, und ein Schemen bewegte sich im Zwielicht. Eine Schnauze mit gebleckten Reißzähnen und ein Augenpaar blitzten auf.
„Ist es …“, flüsterte die Tochter, wagte es aber nicht, die Frage zu formulieren. Ihr Vater wusste ohnehin, was sie quälte.
Der Schatten gebar einen Hund. Einen Köter hätte man ihn in der alten Heimat genannt. Ein räudiges Exemplar, mit kahlen Stellen im Fell, das wohl nie einen Herren gehabt hatte und vom Unrat der Stadt lebte. Dort, wo die Haardecke die Sicht auf gerötete Haut freigab, klafften schorfige Ekzeme. Eitrige Flüssigkeit verklebte das struppige Haar.
Knurrend trat das Vieh auf die beiden zu und entblößte fleckiges, blutiges Zahnfleisch.
Der Vater bückte sich wie in Zeitlupe, ohne das Tier aus den Augen zu verlieren, und klaubte einen faustgroßen Stein vom Boden auf. Er warf mit aller Kraft, die er aufbringen konnte und traf das Tier an der Stirn. Die Haut platzte auf, und der Hund ergriff die Flucht in den Schatten. Das Jaulen war noch in den Gassen zu hören.
„Nein“, antwortete der Vater beruhigt über das normale Verhalten des Tieres, „es war nur ein hungriger Streuner. Komm!“
Sie schritten weiter die Hauptstraße entlang, auf der sich kein Nachtschwärmer verirrt hatte, bis sie das Office des Town Marshal erreicht hatten. Nun war es weniger ein Office, als ein Gemischtwarenhandel und der Haupterwerb des Gesetzeshüters der kleinen Stadt. Es war dunkel, aber das hieß nichts.
Drei harte Schläge mit der Faust trafen die Tür. Conrad Weisers Blick schweifte über die menschenleere Straße, und er zog das Mädchen zu sich heran. Er musste einfach da sein.
Unstet zuckten seine Augen hin und her. Er glaubte eine Bewegung hinter einem umgeworfenen Fass zu erkennen, woanders huschte ein Schatten im Augenwinkel. Dann schlich wieder etwas in der Gasse auf der gegenüberliegenden Straßenseite umher, ohne dass er das Geringste ausmachen konnte. Es war da und lauerte, das wusste er.
Wo bleibt der verdammte Marshal?
„Machen Sie schon auf!“, schrie er und schlug erneut auf die Tür ein. Niemand reagierte. Conrad sog die Unterlippe ein und knabberte daran. Ein Windzug traf sie, und er drückte sie beide dichter an die Hauswand. Sie mussten fort. Weg von der Straße und unter Menschen.
Er trat auf die Mainstreet und sah sich um. Da sah er es. Das Kreuz am Himmel.
„Komm“, sagte er und zog seine Tochter mit sich. Er spürte, wie es sie aus den Gassen anstarrte und darauf lauerte, nach ihnen zu greifen und mit sich zu ziehen. Der Weg zur Kapelle führte einen kleinen Hügel hoch. Ein windschiefer Zaun grenzte das Kirchengelände ein. Der Siedler trat das unverschlossene Holztor auf und wollte gerade über die Schwelle treten, da stoppte ihn seine Tochter.
„Wir müssen weiter“, drängte er und zog an ihrem Arm, aber das Mädchen blieb ungerührt stehen.
Ihr Vater drehte sich wütend zu ihr um. Ihm lagen Flüche auf den Lippen, was sie sich denke, ihm nicht zu gehorchen, doch als er in das Gesicht blickte, drang nur ein heiseres Krächzen aus seiner trockenen Kehle.
Das Mädchen grinste ihn feist an. Ihre Grübchen auf der Porzellanhaut waren tiefen Falten gewichen, die sie wie eine Greisin aussehen ließen. Die Haut büßte ihre jugendliche Reinheit ein und schorfige, blutige Ekzeme überzogen sie.
„Wo willst du mit uns hin, Vater?“, fragte das Mädchen betont vorwurfsvoll. Ihre Stimme klang, als würde sie Nägel gurgeln.
Conrad Weiser fehlten die Worte, und er schnappte nach Luft. Seine Tochter legte den Kopf schräg, als sie mit rasselndem Nachklang fragte: „Was habt ihr mit uns vor, der Pfarrer und du, Vater?“
„Ich … du musst in Sicherheit …“
Das Mädchen griff sich unter das Kleid und streckte ihm dann die Hand hin. Zwischen den Fingern und in der Handfläche glänzte das frische Blut. Es verströmte einen herben Duft wie ranziger Fisch.
„Wolltet ihr das von uns? Der Priester ist auch ganz vernarrt darin.“
Mit diesen Worten schmierte sie Conrad Weiser das Blut ins Gesicht. Angeekelt schrak er zurück. Sein Blick wurde vom Rot verschleiert. Hitze stieg in ihm auf, und es kribbelte, als wuselten unzählige Ameisen darüber hinweg. Aus dem Kribbeln erwuchs ein Brennen, als stünde sein Gesicht in Flammen. Mit den Fingern wollte er sich das höllische Blut abwischen, aber seine Nägel gruben sich in die Haut wie in zähen Schlamm. Er nahm die Hände weg, doch sie klebten fest. Mit Gewalt löste er sie. Fäden aus Fleisch zogen sich in die Länge und hingen wie Lianen durch. Er brüllte vor Schmerzen.
„Was hast du mit mir gemacht? Was?“, schrie er das Mädchen an.
Seine Tochter blieb ihm eine Antwort schuldig. Stattdessen kicherte sie und grub ihre Nägel in sein zerlaufendes Gesicht.
Kapitel 2 – Ein verdammt neugieriger Zeuge
Ein Donnern riss Edward Duncan aus dem Schlaf. Auf den Lippen schmeckte er bitteren Schlamm. Er spuckte aus und dem Klümpchen Dreck folgte ein Schwall Erbrochenes, der ihm über Kinn und Mundwinkel rann und sich in einer Mulde im Erdboden sammelte. Mit dem Ärmel wischte er die Reste vom Mund. Seine Augen klebten. Ob von der feuchten Erde, Blut oder Tränen, vermochte er nicht zu sagen. Womöglich traf alles zusammen. Er sah sich um und erkannte die Hintertür des Saloons. Ächzend wälzte sich Duncan im Morast, bis er aufrecht saß. Seine Hose und das Hemd hatten die Feuchtigkeit vom schlammigen Untergrund gierig aufgesogen und klebten ihm schwer an der Haut. Die Bewegungen verursachten dröhnende Kopfschmerzen, wie zwei Schmiede, die seinen Schädel abwechselnd mit Hämmern bearbeiteten.
Dass er sich hier, im Morast hinter dem Saloon, wiederfand, konnte nur bedeuten, dass man ihn rausgeschmissen hatte. Das Warum würde er vermutlich nie herausfinden. Es gab aber weitaus schlimmere Orte aufzuwachen, als die Hintertür des Saloons. Beispielsweise in der Zelle des verdammten Marshal. Der hätte ihn nicht nur für ein paar Tage hinter Gittern gesteckt, sondern auch sein Gesicht in eiskaltes Wasser gedrückt, bis Edward seine Mama zu sehen bekam. Sie trug das weiße Kleid, das sie jeden Sonntag anzog, wenn die Familie in die Kirche ging. Doch weder seine Brüder, die ihn stundenlang in die Vorratskammer gesperrt hatten, wenn ihnen der Sinn danach war – und es stand ihnen verdammt oft der Sinn danach – noch sein alter Herr, Mr Duncan, wie er ihn zu nennen hatte, zeigten sich ihm. Auch um ihn war es nicht schade, denn wenn Edward eines in Erinnerung behielt, dann das Bild von Mr Duncan mit dem Gürtel im Anschlag. Nein, für solche Menschen, seine Brüder und Mr Duncan, war kein Platz im Himmel. Nur für seine Mutter war dort, das wusste Edward ganz sicher. Und immer, wenn sein Gesicht im Wasser landete und die Panik der Atemnot in vereinnahmte, streckte sie die Hand aus, um ihn zu sich zu holen. Er streckte seine Arme nach ihr aus, doch kurz bevor ihre Finger sich berühren konnten, schmolz das Bild von ihr zu einer dämonischen Grimasse und ging vor seinen Augen in Flammen auf. Genauso wie die Kirche, die eine Horde Wilder in Brand gesteckt hatte und seine gesamte Familie, bis auf ihn, mit dem Feuertod bestraften. Erst dann zog der Marshal Edwards Kopf aus dem Wasser.
Ja, Sir, es gab schlimmere Orte aufzuwachen.
Wieder drang das Donnern an seine Ohren, Schläge gegen Holz, gefolgt von den Rufen eines Mannes. Duncan stemmte sich an der Wand des Saloons hoch und kämpfte sich auf die Beine. Zwar verlangte das Hämmern im Schädel ihm alles ab, aber die Schläge von der anderen Straßenseite weckten seine Neugier. Und gegen sie kam er nicht an.
Duncan drückte sich an die Wand des Gebäudes und spähte um die Ecke. Vor dem Marshal Office, dem er lieber fernblieb, machte er zwei Gestalten aus. Die eine groß gewachsen und die andere etwa halb so groß. Erst, als die beiden auf die Hauptstraße traten, erkannte er ihre Gesichter. Der Mann hieß Conrad Weiser. Einer der Siedler aus Deer Creek. Ein Mädchen klammerte sich an ihn, seine Tochter, soweit sich Duncan erinnern konnte. Ein bildhübsches Ding mit ebenmäßiger Haut. Er sah sie häufiger in Bond, und das ein oder andere Mal versuchte er, ihnen Schusswaffen anzudrehen, aber diese Siedler vertrauten lieber Gott als blauen Bohnen. Sie hätten mal seine Mama fragen sollen, wie es in der Neuen Welt um den Schutz durch ihren Schöpfer bestellt war. Es war das Land der Wilden, und dort gab es ihren Heilsbringer nicht.
Was Duncans Neugier vor allem weckte, war die Tatsache, dass die Siedler aus Deer Creek sich niemals zu so später Stunde in Bond aufhielten. Sie frönten keinem der hiesigen Gelüste nach Frauen, Glücksspiel und Alkohol. Zumindest nicht, dass es ihm bekannt wäre. Und wenn es aber einer wüsste, dann er, denn nichts anderes tat er Tag für Tag. Gehetzt sahen sie die Straße hinauf, da schien der Siedler ein neues Ziel ausgemacht zu haben und zog seine Tochter mit sich.
Edward folgte ihnen im Schatten der Häuser. Die Kopfschmerzen, die klebrige Kleidung, ja, selbst der bittere Gallegeschmack waren vergessen. Duncan hatte oft genug einen Riecher für solche Situationen, und fast ebenso häufig sprang für ihn etwas Lohnendes dabei heraus. Und dass zwei Siedler des Nachts durch Bond streiften wie gehetzte Hunde, roch für Duncan zehn Meilen gegen den Wind. Er mochte im Höllenfeuer schmoren, wenn da nichts dran war. Dieses Versprechen fiel ihm leicht, denn ein guter Mensch war er beileibe nicht.
Er erkannte, wohin es die Siedler trieb. Den Ort, den er seit seiner Kindheit mied wie der Teufel das Weihwasser. Man konnte sich nie sicher sein, ob sich nicht ein paar fackelschwingende Wilde in der Nähe aufhielten. Doch kurz bevor sie das Tor zu der Kirche passiert hatten, stoppte das Mädchen. Duncan hielt ebenfalls inne und versteckte sich hinter der Ecke des Fleischers. Vorsichtig wagte er einen Blick auf das Geschehen auf dem kleinen Hügel, auf dem die Kirche stand. Die Kleine hatte ihm den Rücken zugewandt, aber den Siedler erkannte er ganz genau. Ihn und seine schreckensweiten Augen. Dann griff sich das Mädchen unters Kleid, schmierte ihrem Vater etwas ins Gesicht. Dieser versuchte verzweifelt, es wieder abzubekommen. Die Kleine hob die Hand vor und … da drehte sich ihr Kopf mit einem Ruck um einhundertundachtzig Grad und sah Duncan direkt in die Augen. Statt mit gebrochenem Genick umzufallen, grinste sie ihn an. Doch es war nicht mehr das Mädchen mit der ebenmäßigen Haut und den unschuldigen Rehaugen. Was ihn angrinste, war etwas, das ihn immer wieder heimsuchte. Vor allem, wenn der Marshal ihm die Luft im Wasserfass aus den Lungen zwang und das Gesicht seiner Mama schmolz, und nur noch das dämonische Antlitz übrig ließ. Genau dieses grinste ihn von der Straße aus breit an.
Duncan zog den Kopf ein, kaum dass das Ding ihn erblickt hatte. Reflexartig schnappte er nach Luft, als drücke der Marshal sein Gesicht unter Wasser. Die Angst trieb ihm den Schweiß auf die Stirn. Alles in ihm schrie danach, die Flucht zu ergreifen. Rennen, bis ihn die Erschöpfung einfach umfallen ließ, Hauptsache weit weg vor diesem Albtraum.
Duncan wähnte sich bereits im Höllenfeuer schmoren, weil er wider jeglichen Reflexes neugierig um die Ecke stierte. Überrascht stellte er fest, dass von dem Mädchen jede Spur fehlte. Nur ihr Vater, der verdammte Siedler, lag mit dem Gesicht im Dreck, vor der Pforte des heiligen Ackers. Duncans Verstand malte sich das Bild aus, das er in diesem Moment abgeben musste. Ein betrunkener Ganove und ein abgemurkster Siedler. Oh, er würde seiner Mama folgen, denn der Marshal konnte ein mieser Drecksack sein, wenn es um Kleinigkeiten wie Waffenhandel ging, aber bei Mord wollte er von ihm nicht in der Nähe eines Toten erwischt werden. No, Sir!
Hastig drehte er sich um, und ein Schrei erstickte in seiner Kehle.
Zwei, wie mit schwarzem Öl gefüllte Augen starrten ihn direkt an. Ihre Nasenspitzen berührten sich fast. Duncan war kein reinlicher Mensch und konnte wirklich viel ertragen, aber als ihm der Gestank von verschmortem Fleisch entgegenwehte, würgte er. Zwischen den zum breiten Grinsen verzogenen Lippen wuchsen schiefe, dolchartige Zähne aus entzündetem Zahnfleisch. Ein Finger schoss vor und drückte sich auf seine Stirn. Dann schrie Edward Duncan.
Kapitel 3 – Keine Geschäfte ohne den Marshal
„Robert! Hör auf!“, schrie Kitty, die Besitzerin vom Kitty’s, wütend auf, doch Robert Gerard hob sein Bein und dachte nicht im Traum daran, aufzuhören. Er steckte den angestauten Zorn auf diese Ratte in den einen Tritt und sprengte das verriegelte Schloss mit dem ersten Versuch auf. Die Tür flog nach innen und schlug krachend gegen die Wand im Zimmer, sodass sie ihm wieder entgegenkam. Sogar das Scharnier bog sich, und die Tür hing windschief im Rahmen.
„Das wirst du mir bezahlen, Robert“, drohte Kitty dem Town Marshal.
Anna, die jüngste, und somit begehrteste Stute in Kittys Stall, sprang kreischend von ihrem Freier und bedeckte ihre nicht zu verachtende Blöße.
„Da haben wir die dreckige Ratte ja“, knurrte Gerard und stapfte zum Fußende des Bettes, an dem er sich breitbeinig positionierte und die behandschuhten Hände in den Patronengurt klemmte. Er wusste genau, wie sein Gegenüber auf die Pose reagieren würde, nämlich so, wie es dreckige Ratten in Bond taten, wenn sie ihm gegenüberstanden.
Der Freier trug nur ausgetretene Stiefel am Leib, dessen Sohlen gespickt mit daumendicken Löchern waren. Das mickrige Ding zwischen seinen Beinen zog sich zurück wie ein Schildkrötenkopf bei drohender Gefahr.
„Ge… Ge… Gerard“, stammelte der Freier und strampelte sich bis zum Kopfende, bis er aufrecht im Bett saß.
„Marshal Gerard“, korrigierte ihn der Gesetzeshüter und zog die Mundwinkel, kaum merklich, nach oben. „Ich habe gehört, dass du gro…“ Ein Wimmern schnitt ihm das Wort ab. Seine zu Schlitzen verengten Augen wanderten zu dem Freudenmädchen.
Anna kauerte eingeengt zwischen Fenster und Kommode, umschlang schützend ihren Körper und zitterte wie Espenlaub. Das großzügig aufgetragene Rouge verlief unter der Flut von Tränen. Mit einem theatralischen Kopfnicken bedeutete der Marshal ihr, dass sie gefahrlos durch die Schussbahn laufen durfte. Sie ließ sich nicht zweimal bitten und huschte an ihm vorbei und in die Arme ihrer Chefin.
Diese drückte das Mädchen an ihre, durch ein Korsett hochgepushte Brust und rieb ihr tröstend den Rücken. „Das wird ein Nachspiel haben, Robert“, drohte die Frau und zog ihren Schützling mit sich.
Gerard sah den beiden nach, bis sie das Zimmer verlassen hatten, dann bedachte er den Freier mit einem Blick, der Grizzlybären tot umfallen ließ. „Jetzt zu dir.“
Amüsiert erkannte der Marshal, dass sich das Laken zwischen den Beinen des Kerls dunkel verfärbt hatte.
„Ich habe gehört“, begann er seine Frage erneut zu stellen, „dass du neuerdings besonders heiße Ware in Umlauf bringst. Stimmt das?“
Der Freier schnappte nach Luft. Schweiß verschmierte den Dreck in seinem Gesicht, und sein Kehlkopf wippte auf und ab. Dann schüttelte er den Kopf und antwortete: „Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen, Gerard.“
Der Gesetzeshüter hob eine Augenbraue, und mit großen Augen wurde dem Freier sein Fehler bewusst und korrigierte: „Marshal Gerard, Sir!“
Gerard strich sich nachdenklich durch den dichten grauen Bart. Dann steckte er sich die Finger zwischen die Lippen und gab einen schrillen Pfiff ab. Wenige Augenblicke später betrat Deputy Skinny das Zimmer. Der Freier sog die Luft scharf durch die maisgelben Zähne ein, als er erkannte, was er bei sich trug.
Skinny stellte eine quadratische Kiste vor die Füße des Marshals ab. Dieser bemerkte die schreckensweiten Augen des Freiers und konnte sich ein dezentes Lächeln nicht verkneifen.
„Kommt dir die bekannt vor?“
„Hab die nie im Leben gesehen“, kam die Antwort überraschend sicher zwischen den spröden Lippen hervor. Gerard gefiel, wie der Kerl das Spielchen spielte, und grinste.
„Du weißt nicht, was sich darin befindet?“, hakte er gespielt verwundert nach.
„Nein, Sir“, erklärte der Freier und leckte sich nervös über die Oberlippe.
„Deputy Skinny“, sagte der Graubärtige, und dieser zuckte zusammen, als er seinen Namen hörte.
Skinny war nur ein Spitzname, der zum einen am Nachnamen Skinner lag, zum anderen der schlaksigen, annähernd zwei Meter großen Statur des Mannes zuzuschreiben war.
„Hör auf, von dem Arsch der Nutte zu träumen, und lass uns wissen, was sich in der Kiste befindet.“
Ertappt sah Skinny sich um, bis er bemerkte, dass das Brecheisen auf der Kiste lag. Er trat auf die Holzkiste zu und setzte den Kuhfuß an. Knackend gab der Deckel nach und den Blick auf das Innere frei.
„Danke, Deputy Skinny“, sagte sein Boss und griff hinein. Aus der mit Stroh gefüllten Kiste fischte er eine bräunliche Stange und begutachtete sie neugierig.
„Weißt du, was das ist?“, fragte der Gesetzeshüter und schnupperte daran wie an einer kostspieligen Zigarre.
„Das ist Dynamit, Marshal Gerard“, knurrte sein Gegenüber.
„Na so was“, tat dieser überrascht und hielt sie von sich wie einen stinkenden Kadaver, der zu lange in der Sonne gelegen hatte. „Hast du eine Ahnung, wo wir das gefunden haben könnten?“
Der Freier verzog den Mund. „Bitte nicht das Wasser, Sir.“
Gerard seufzte und schlenderte ums Bett herum, um sich zu dem Nackten auf die Bettkante zu setzen. Mit geweiteten Augen beobachtete dieser, wie der Marshal ihm den Sprengstoff zwischen Laken und Arsch steckte.
„Wir haben das Zeug in einem deiner kleinen Rattenlöcher gefunden, Ed. Oder sollte ich Eddie the Rifle sagen? So nennt man dich doch auf der Straße, hm?“
Bei dem Spitznamen fing die Unterlippe von Ed an zu zittern.
„Ich hab‘ gehört“, sprach der Marshal weiter und zog sich eine Zigarette aus der Tasche, die er sich zwischen die Lippen schob, „dass du die an die Rothäute verkaufen wolltest. Man erzählt sich außerdem, dass besagte Indianer gedachten, damit die neue Eisenbahnstrecke zu sabotieren.“ Er fischte ein Zündholz aus der Innentasche seiner Jacke und entzündete es am Bettpfosten. Einen nicht enden wollenden Augenblick hielt er es nahe an der Lunte der Dynamitstange. Lang genug, dass Eddie the Rifle nach Luft schnappte und Blut und Wasser schwitzte. Dann zündete der Marshal sich die Zigarette an und nahm einen bedächtigen Zug.
„Möchtest du nicht anfangen zu reden, bevor ich die Geduld verliere?“
Ed schluckte geräuschvoll und sammelte die letzten Reste seines Mutes für das folgende Wort zusammen: „Ne.“