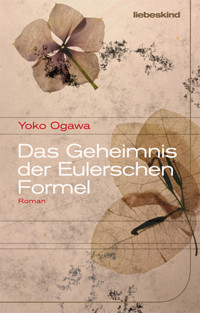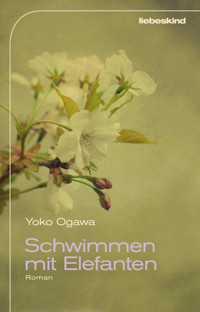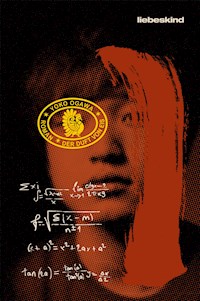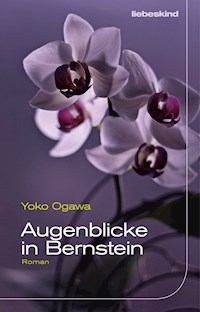8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Liebeskind
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die siebzehnjährige Mari führt zusammen mit ihrer Mutter ein bescheidenes Hotel in einem Badeort an der Küste. Eines Abends wird sie Zeuge eines heftigen Streits zwischen zwei Gästen, einem älteren Herrn und einer Prostituierten. Mari ist tief beeindruckt von der Würde und der Eleganz des Mannes, dem seine Begleiterin abartige sexuelle Neigungen vorhält. Als sie den Mann einige Tage später in der Stadt wiedersieht, macht sie seine Bekanntschaft und folgt ihm auf eine unbewohnte Insel, auf der er zurückgezogen lebt. Seit Jahren arbeitet er dort an der Übersetzung eines russischen Romans, dessen Heldin ein gewaltsames Ende findet, genau wie seine eigene Frau Jahre zuvor ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Yôko Ogawa
HOTEL IRIS
Roman
Aus dem Japanischen von
Die japanische Printausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Titel
»Hoteru Airisisu« im Verlag Gentosha, Tokio.
© Yoko Ogawa 1996
© Verlagsbuchhandlung Liebeskind, München 2001
Alle Rechte vorbehalten
Yoko Ogawa wird durch das Japan Foreign-Rights Centre vertreten.
Umschlaggestaltung: Camilla Jødal, Hamburg
Satz und Typografie: Karlheinz Rau, München
1
Es war kurz vor Beginn der Sommersaison, als der Mann im Hotel Iris übernachtete. Seit dem Morgen hatte es unablässig geregnet, und gegen Abend wurde der Regen noch stärker. Das Meer war aufgewühlt und grau. Beim Ein- und Ausgehen der Gäste wehte die Nässe ins Foyer, so dass der Teppich einen unangenehm feuchten Geruch verströmte. Die umliegenden Geschäfte hatten ihre Leuchtreklamen ausgeschaltet. Nur wenn gelegentlich ein Wagen durch die menschenleeren Straßen fuhr, konnte man die Regentropfen im Licht der Scheinwerfer sehen.
Ich war gerade dabei, die Kasse abzuschließen und das Licht im Foyer auszuschalten, ehe ich mich wie immer um diese Zeit auf mein Zimmer zurückziehen wollte, als plötzlich ein Poltern zu hören war, wie wenn etwas Schweres zu Boden fällt, gefolgt vom Schrei einer Frau.
Es war ein lang anhaltender Schrei. So anhaltend, dass ich mich schon fragte, ob es sich nicht in Wirklichkeit um Gelächter handelte.
»Du perverses Schwein!«
Aus Zimmer 202 kam eine Frau gestürzt.
»Alter Widerling!«
Die Frau stolperte über den Teppichsaum und fiel der Länge nach auf den Treppenabsatz. Noch im Liegen stieß sie einen für Zimmer 202 bestimmten Schwall von Beschimpfungen hervor.
»Ich lass mich doch nicht verarschen! Und du willst mit einer Frau schlafen, du verdammter Betrüger? Du Scheißkerl! Du impotenter Sack!«
Es handelte sich eindeutig um eine Prostituierte. Soviel konnte sogar ich erkennen. Und sie war nicht mehr jung. Ihr Haar hing wirr um ihren faltigen Hals, und ihr greller Lippenstift war verschmiert. Durch Schweiß und Tränen war ihr die Wimperntusche in die Augenwinkel gelaufen. An ihrer Bluse fehlten mehrere Knöpfe, so dass ihre linke Brust entblößt war. Ihr Minirock ließ ihre geröteten Oberschenkel unbedeckt, die in mir die Vorstellung erweckten, dass sich bis vor einem Augenblick noch die Hände eines Mannes auf ihnen nach oben getastet hatten. An einer Ferse hing noch der eine ihrer billigen Synthetik-Stilettos.
Als einzige Antwort auf ihr Gezeter wurde aus dem Zimmer ein Kissen geschleudert, das sie mitten ins Gesicht traf, worauf sie noch einmal wütend aufschrie. Der Bezug des Kissens, das nun auf dem Treppenabsatz lag, war mit Lippenstift beschmiert.
Inzwischen hatte der Lärm auch andere Gäste geweckt, die jetzt verschlafen in den Gängen herumstanden. Sogar meine Mutter kam aus ihrem Zimmer.
»Du Idiot! Wer würde schon mit dir schlafen wollen? Und wenn du mich auf Knien anflehst, das verzeih ich dir nie! Such dir doch eine streunende Katze für deinen Kram. Die wär gerade gut genug für dich!«
Keuchend und mit tränenerstickter, heiserer Stimme stieß die Frau ihre Worte hervor. Geifer lief ihr aus dem Mund.
Erbarmungslos warf jemand einen Kleiderbügel, einen BH, den anderen Stöckelschuh und eine Handtasche aus dem Zimmer. Die Handtasche öffnete sich, so dass ihr Inhalt sich über den Boden verstreute. Die Frau wollte die Treppe hinunterflüchten, schaffte es aber kaum aufzustehen. Vielleicht hatte sie sich den Fuß verstaucht oder war einfach zu aufgeregt.
»Was ist das für ein Krach? Schluss jetzt!«
»Ruhe! Man kann ja kein Auge zutun!«
Durch die Beschwerden der Gäste entstand zusätzlicher Tumult.
Nur Zimmer 202 atmete tiefe Stille.
Von dem Mann, der sich offenbar darin befand, war nichts zu sehen. Er hatte auch noch kein einziges Wort gesagt. Einzig die bösen Blicke der Frau und die aus dem Zimmer geschleuderten Gegenstände belegten seine Existenz. Die Frau kreischte weiter in die schweigende Öffnung hinein.
»Meine Dame, mäßigen Sie sich doch. Streiten Sie sich bitte draußen«, sagte meine Mutter.
»Ich habe schon verstanden. Dann gehe ich eben, aber bilden Sie sich nicht ein, dass Sie mich hier noch einmal wiedersehen!«
»Ich will auf keinen Fall die Polizei im Haus haben«, sagte meine Mutter. »Sie müssen für den Schaden aufkommen. Und der ist nicht gerade klein. Was glauben Sie eigentlich? Es geht ja nicht nur um das Zimmer!« Dann an die Gäste gewandt: »Meine Herrschaften, bitte, gehen Sie wieder zu Bett. Entschuldigen Sie den Aufruhr.«
Während meine Mutter die Treppe hinaufstieg, sammelte die Frau den Inhalt ihrer Handtasche ein und rannte dann, ohne ihre Bluse zuzuknöpfen, mit wippendem Busen nach unten. Ein Gast pfiff ihr nach.
»Einen Moment. Wer bezahlt jetzt die Rechnung? Denken Sie ja nicht, dass Sie die Zeche prellen können!«
Meine Mutter dachte immer nur an Geld. Ohne sie eines Blickes zu würdigen, öffnete die Frau die Tür zur Straße.
Da geschah es.
»Schweig, Hure!« durchdrang eine Männerstimme den Raum. Alle verstummten. Die Stimme hatte einen vollen, tiefen Klang, bar jeder Gereiztheit oder Wut, und einen überlegenen Tonfall. Wie wenn der erste Ton eines Cellos oder Horns sich aus der Stille erhebt.
Ich drehte mich um. Auf dem Treppenabsatz stand ein Mann, der seine besten Jahre bereits hinter sich hatte. Er trug ein gebügeltes weißes Oberhemd und eine dunkelbraune Hose. Das passende Jackett hing über seinem Arm. Im Gegensatz zu der völlig aufgelösten Frau atmete der Mann ruhig, er schwitzte nicht einmal. Er wirkte auch nicht verlegen. Nur seine schütteren Stirnhaare waren ein wenig zerzaust.
Noch nie hatte ich einen derart wohlklingenden Befehl gehört – gelassen, würdevoll und gebieterisch. Selbst das Wort »Hure« hatte aus seinem Mund bewundernswert geklungen. »Schweig, Hure«, wiederholte ich in Gedanken. Aber der Mann sprach nicht mehr.
Ohne jede Aussicht auf Erfolg spuckte die Frau in seine Richtung und floh aus dem Hotel. Ihr Speichel landete auf dem Teppich.
»Sie tragen die Verantwortung. Ich muss Sie auffordern, uns unsere Auslagen zu ersetzen, für die Reinigung zum Beispiel. Außerdem haben Sie ab sofort Hausverbot. Ich will hier keine Gäste, die sich mit solchen Weibern einlassen. Merken Sie sich das!« schrie meine Mutter den Mann an.
Die anderen Gäste kehrten allmählich in ihre Zimmer zurück. Schweigend, mit gesenktem Blick ging der Mann die Treppe hinunter und zog dabei sein Jackett an. Er kramte zwei zerknitterte Geldscheine aus der Hosentasche und legte sie auf die Rezeption. Ich nahm die Scheine und glättete sie mit der Handfläche.
Dabei hatte ich den Eindruck, an ihnen noch die Körpertemperatur des Mannes zu spüren. Ohne mich auch nur einmal anzusehen, ging er in den Regen hinaus und war meinen Blicken bald entschwunden.
Früher habe ich mich oft gefragt, wer wohl unserem Hotel den seltsamen Namen »Iris« gegeben hat. Die Namen aller anderen Hotels in unserer Gegend haben irgendwie mit dem Meer zu tun. Nur unseres heißt Iris.
»Die Iris ist eine wunderschöne Blume. Außerdem heißt in der griechischen Mythologie die Göttin des Regenbogens auch Iris. Klingt doch irgendwie vornehm, oder?« pflegte mir mein Großvater stolz zu erklären, als ich noch Kind war.
Dabei blühten im Garten unseres Hotels überhaupt keine Iris. Auch Rosen, Stiefmütterchen oder Narzissen nicht. Es gab nur wuchernden Hartriegel, einen Keyaki-Baum und jede Menge Unkraut.
Das einzig Außergewöhnliche war ein längst versiegter Springbrunnen aus Backstein, dessen Mitte die mit Vogeldreck bedeckte Gipsstatue eines lockigen Jünglings im Frack zierte. Er spielte mit gesenktem Kopf auf einer Harfe und bot mit seinen fehlenden Lippen und Augenlidern einen recht traurigen Anblick.
Woher mein Großvater wohl von der Regenbogengöttin wusste? Wir besaßen nicht mal ein Bücherregal, ganz zu schweigen von Büchern über griechische Mythologie.
In meiner Vorstellung hatte die Göttin des Regenbogens einen grazilen Hals, volle Brüste und trug ein transparentes Gewand, das sieben Farben zierten. Ihr Blick war in die Ferne gerichtet, und schon das leiseste Rauschen dieses Gewandes vermochte die Welt im Nu mit der magischen Schönheit des Regenbogens zu überziehen.
Würde die Göttin auch nur den winzigsten Winkel unseres Hotels bewohnen, müsste der Jüngling mit der Harfe nicht so traurig sein.
Das R von »Hotel Iris« auf dem Schild über dem zweiten Stock hatte das Gleichgewicht verloren und war nach rechts gekippt. Es sah albern aus, als ob es gestolpert wäre oder sich gebeugt düsteren Gedanken hingäbe, dennoch machte nie jemand Anstalten, den Schaden zu reparieren.
Mein Großvater war zwei Jahre zuvor gestorben. An Bauchspeicheldrüsen- oder Gallenkrebs. Am Ende hatten sich Metastasen in den Hüftknochen, in der Lunge und im Gehirn gebildet, so dass es ohnehin keine Rolle mehr spielte, wo die Krankheit ihren Anfang genommen hatte. Nachdem er sich sechs Monate gequält hatte, starb mein Großvater zu Hause in seinem Bett.
Unsere Familie bewohnte drei kleine Zimmer ohne Sonnenlicht im hinteren Teil des Hauses. Nach meiner Geburt waren wir zu fünft. Als ich noch ein Baby war, starb meine Großmutter an einem Herzleiden, aber daran kann ich mich natürlich nicht erinnern, wohingegen ich mich an den Tod meines Vaters, der als nächster starb, bis in alle Einzelheiten erinnere, denn zu dem Zeitpunkt war ich schon acht.
Nach ihm war mein Großvater an der Reihe. Er lag in einem ausrangierten Hotelbett mit ausgeleierten Sprungfedern, die bei jeder seiner Bewegungen einen Laut von sich gaben, wie wenn man auf einen Frosch tritt.
Nach der Schule war es meine Aufgabe, erst einmal den Drainagebeutel zu leeren, den mein Großvater auf der rechten Seite trug, und den dazugehörigen Schlauch zu desinfizieren. So wollte es meine Mutter. Mir graute es immer davor, den Schlauch zu berühren, denn ich fürchtete – sollte er mir durch eine ungeschickte Bewegung entgleiten –, die inneren Organe meines Großvaters könnten aus ihm hervorquellen.
Der Inhalt des Beutels war dünnflüssig und von so angenehmer Farbe, dass ich mich jedes Mal fragte, wie der menschliche Körper eine so schöne Farbe hervorzubringen vermochte. Weil ich die Flüssigkeit immer in den Brunnen im Garten goss, waren die Zehenspitzen des Jünglings mit der Harfe stets ein wenig feucht.
Mein Großvater hatte ständig Schmerzen, die jedoch bei Tagesanbruch besonders heftig waren. Sein immerwährendes, vom Quietschen und Knarren des Bettes begleitetes Stöhnen schien aus einer finsteren Tiefe heraufzukriechen. Obwohl Fenster und Läden fest verschlossen waren, drangen die unheimlichen Geräusche irgendwann doch an die Ohren der Hotelgäste, so dass es zu Beschwerden kam.
»Ja, es tut mir sehr leid, aber abends haben wir oft läufige Katzen im Garten«, erklärte meine Mutter dann mit vor Liebenswürdigkeit triefender Stimme, während sie mit einer Füllerkappe herumspielte, die auf der Rezeption lag.
Nicht einmal am Tag, als mein Großvater starb, schlossen wir das Hotel. Es war eigentlich keine Saison, aber ausgerechnet an diesem Tag war ein aus mehreren Damen bestehender Mütterchor eingetroffen. Während des Totengebetes ertönte »Edelweiß«, »Lorelei« und »Ein Licht im Tal«, auch wenn der Priester von Anfang an so tat, als höre er nichts, und mit gesenktem Blick ungerührt weiterrezitierte. Die Besitzerin des Kurzwarenladens, mit der mein Großvater sich ab und zu ein Gläschen genehmigt hatte, schluchzte im Chor mit den Sopranstimmen der Mütter. Im Bad, im Speisesaal, auf der Veranda, irgendwo trällerte es immer, so dass der Gesang des Mütterchors die Leiche regelrecht berieselte. Nicht einmal zum Schluss hatte die Regenbogengöttin ihr siebenfarbiges Gewand für meinen Großvater wehen lassen.
An einem Sonntagnachmittag zwei Wochen nach dem Zwischenfall im Hotel sah ich den Mann wieder. Ich war zu Fuß in der Stadt unterwegs, um Einkäufe für meine Mutter zu machen.
Die Sonne brannte, und mir war heiß. Der Strand war voller junger Leute in Badeanzügen, die sich sonnten. Es herrschte Ebbe, und die Felsen um die Festungsmauer lagen frei. An der Anlegestelle der Ausflugsfähren und auf den Terrassen der Cafés wimmelte es von Touristen. Auch wenn das Meer noch kalt war, kündigten das von der nassen Festungsmauer reflektierende Sonnenlicht und die Geräusche der Stadt den Sommer an.
Unsere Stadt erwacht nämlich nur während der drei Sommermonate zum Leben, danach fällt sie sofort wieder in eine fossilienhafte Starre. Im Sommer jedoch, wenn das Meer sie sanft in seine Arme schließt und der sich in ost-westlicher Richtung erstreckende Sandstrand golden im Sonnenschein leuchtet, machen die nur bei Ebbe sichtbare Festungsruine und die wogenden grünen Hügel des dahinter liegenden Kaps den gesamten Küstenstreifen zu einer bezaubernden Landschaft. Dann sind die Straßen voller Menschen, die ihren Urlaub genießen. Aufgespannte Sonnenschirme leuchten, Duschen spritzen, Champagnerkorken und Feuerwerkskörper knallen. Die Restaurants und Bars, die Hotels, die Ausflugsschiffe, die Souvenirläden, der Jachthafen und sogar das Iris – alle putzen sich für die Saison heraus. Die Verschönerungsarbeiten im Hotel Iris beschränken sich allerdings auf das Herunterlassen einer Markise über der Terrasse, die Verstärkung der Beleuchtung im Foyer und das Anbringen der geänderten Zimmerpreisliste für die Hochsaison.
Das Ende der Saison kommt immer ganz plötzlich. Unvermittelt dreht sich der Wind, und das Meer wird rau. Die Gäste kehren an ihre mir unbekannten, weit entfernten Heimatorte zurück. Eiskrempapier, das gestern noch glitzernd am Wegrand gelegen hatte, wird über Nacht grau und klebt unansehnlich auf dem Asphalt.
Ich erkannte ihn sofort an seinem Profil, als ich in der Drogerie Zahnputzpulver kaufte. An jenem Abend hatte ich sein Gesicht zwar nur undeutlich gesehen, aber auch in der trüben Neonbeleuchtung des Ladens kamen mir die Umrisse seiner Gestalt und die Bewegungen seiner Hände sofort bekannt vor. Er kaufte Kleiderseife.
Er überlegte lange, nahm jede Seife in die Hand, las die Aufschrift und prüfte den Preis. Auch wenn er eine Seife schon in seinen Einkaufskorb gelegt hatte, nahm er sie wieder heraus und las nochmals die Beschreibung, um sie dann doch ins Regal zurückzulegen und weiter konzentriert auf die Seifen zu starren. Am Ende nahm er die billigste.
Warum ich ihm nachging, kann ich nicht erklären. Gewiss nicht wegen des Vorfalls im Hotel Iris.
Allerdings hatte ich den Klang seiner Worte noch im Ohr. Der Befehlston, in dem er gesprochen hatte, zog mich zu ihm hin.
Nach der Drogerie ging er in eine Apotheke, gab eine Art Rezept ab und erhielt zwei Tütchen mit Medikamenten, die er in seiner Jackettasche verstaute. Anschließend betrat er einen Schreibwarenladen. Gegen eine Straßenlaterne gelehnt, spähte ich in den Laden. Der Mann diskutierte lange mit dem Inhaber, offenbar über die Reparatur eines Füllfederhalters, deutete eifrig auf die Einzelteile, in die er ihn zerlegt hatte und über die er sich heftig zu beklagen schien. Völlig unbeeindruckt von der offensichtlichen Verlegenheit seines Gegenübers fuhr der Mann mit seinen Beanstandungen fort. Gern hätte ich seine Stimme gehört, aber sie drang nicht bis zu mir. Am Ende schien der Inhaber einverstanden zu sein, denn er nickte, wenn auch widerwillig.
Anschließend machte sich der Mann über die Strandpromenade in Richtung Osten auf. Ungeachtet der Hitze trug er Anzug und Krawatte. In aufrechter Haltung, die Augen geradeaus gerichtet, schritt er die Promenade entlang. In seiner Linken hielt er die Plastiktüte mit der Kleiderseife. Die Tütchen mit den Medikamenten beulten seine Jackettaschen aus. Mitunter stieß ein Passant gegen die Tüte mit der Seife, dennoch nahm niemand wirklich Notiz von ihm. Ich war die einzige, die den Mann beobachtete, und diese Erkenntnis zog mich immer tiefer in dieses seltsame Spiel hinein. Vor der Blumenuhr auf dem Hauptplatz spielte ein Junge auf einem Akkordeon. Er war ungefähr in meinem Alter. Ob es daran lag, dass sein Instrument nicht mehr neu war, oder an seiner besonderen Begabung – jedenfalls lag in seinem Spiel ein Anflug von Melancholie und Vergänglichkeit.
Während alle anderen Passanten nach einem flüchtigen Blick auf den Jungen vorbeigingen, blieb der Mann eine Zeitlang stehen, um zu lauschen. Wieder wartete ich in einiger Entfernung. Weder applaudierte der Mann, noch äußerte er einen Musikwunsch. Er stand einfach nur da, umgeben von den Klängen des Akkordeons, die der Junge erzeugte. Hinter den beiden zog der Zeiger der Blumenuhr langsam seine Bahn.
Es klimperte leise, als der Mann eine Münze in den Akkordeonkasten warf. Wortlos und ohne seine Miene zu verändern, drehte er sich um und ging auf der Promenade weiter. Das Gesicht des jungen Akkordeonspielers erinnerte mich an die Statue in unserem Garten.
Wie lange sollte ich ihm noch nachgehen? Von der Einkaufsliste meiner Mutter hatte ich bisher nur das Zahnputzpulver besorgt, und allmählich wurde ich unruhig. Was trödelst du nur immer so herum, die Gäste warten schon, hörte ich meine Mutter schon schimpfen, dennoch war ich außerstande, meinen Blick vom Rücken des Mannes abzuwenden.
Der Mann betrat den Warteraum an der Anlegestelle. Gleich würde er die Fähre besteigen. Es wimmelte von Paaren und Familien mit Kindern. Die kleinen Schiffe fuhren zur Insel F. hinüber, umkreisten sie einmal, legten für eine halbe Stunde dort an und kamen wieder zurück. Bis zur Abfahrt des nächsten Schiffes waren es noch zwanzig Minuten.
»Warum verfolgen Sie mich?« sagte plötzlich eine Stimme.
In dem ringsherum herrschenden Lärm begriff ich zuerst überhaupt nicht, dass er mit mir sprach, und erst mit einiger Verzögerung merkte ich, dass dieselbe Stimme, die »Schweig, Hure« gerufen hatte, sich jetzt an mich wandte.
»Wollen Sie etwas von mir?«
Hastig schüttelte ich den Kopf. Allerdings schien der Mann noch ängstlicher zu sein als ich, denn er fuhr sich nervös blinzelnd nach jedem Wort mit der Zunge über die Lippen. Es war kaum zu glauben, dass das derselbe Mann sein sollte, der an jenem Abend im Hotel Iris diesen kristallklaren Befehl ausgesprochen hatte.
»Sie sind doch das Mädchen aus dem Hotel Iris?« fragte der Mann nun.
»Ja«, antwortete ich mit gesenktem Blick.
»Sie saßen an der Rezeption. Schon in der Drogerie merkte ich, dass Sie mir nachgehen.«
Eine Gruppe von Grundschülern betrat mit großem Lärm den Wartesaal. Von der Menschenmenge bedrängt, fanden wir uns plötzlich nebeneinander am Fenster wieder.
Beunruhigt fragte ich mich, was der Mann mit mir vorhatte. Natürlich war ich nicht darauf gefasst gewesen, dass er mich ansprechen würde. Mit welchen Worten konnte ich mich verabschieden? Oder wäre es vielleicht besser, gar nichts zu sagen? Ich war ratlos.
»Haben Sie noch eine Forderung an mich?«
»Forderung? Nein …«
»Entschuldigen Sie nochmals die Ungelegenheiten, die ich Ihnen bereitet habe«, sagte er.
Seine höflichen Worte wollten überhaupt nicht zu dem Mann passen, der im Hotel so unflätig von der Prostituierten beschimpft worden war. Dieser Widerspruch verstärkte meine Anspannung.
»Machen Sie sich bitte nichts aus dem, was meine Mutter gesagt hat. Sie haben sowieso viel zu viel bezahlt.«
»Das war ein schrecklicher Abend.«
»Ja, es hat sehr stark geregnet.«
»Ich weiß selbst nicht mehr, wie mir so etwas passieren konnte.«
Unsere Unterhaltung war aufs Äußerste befangen. Ich erinnerte mich an den BH, der noch auf dem Treppenabsatz gelegen hatte, als der Mann längst gegangen war. Ein lila BH, an den Körbchen auffällig mit Spitzen und Rüschen besetzt. Mit spitzen Fingern hatte ich ihn wie ein totes Tier aufgehoben und in den Mülleimer in der Küche geworfen.
Die Kinder tobten durch den Warteraum. Vor dem Fenster glitzerte das weite Meer im immer noch gleißenden Sonnenlicht. In der diesigen Ferne schwebte die Insel F. Sie hatte die Form eines Ohrs. Ich beobachtete, wie die Fähre die letzte Spitze der Insel umschiffte und auf uns zuhielt. Auf jedem Pfahl an der Anlegestelle saß eine Möwe.
Aus der Nähe betrachtet war der Mann sehr viel zierlicher, als ich zuerst vermutet hatte. Er war nicht größer als ich, und seine Brust wirkte beinahe eingefallen. Im Gegensatz zu damals hatte er seine Haare jetzt ordentlich und glatt zurückgekämmt. Sein Hinterkopf war fast kahl.
Sooft unser Gespräch versiegte, schauten wir beide aufs Meer hinaus. Etwas anderes fiel uns nicht ein. Wenn der Mann, von der grellen Sonne geblendet, die Augen zusammenkniff, nahm sein Gesicht einen leidenden Ausdruck an, so als ob er plötzlich Schmerzen hätte.
»Warten Sie auf die Fähre?« fragte ich, da ich das Schweigen als bedrückend empfand.
»Ja«, antwortete der Mann.
»Wir Einheimischen fahren normalerweise nie damit. Ich bin nur als Kind einmal mit so einem Schiff gefahren.«
»Ich lebe auf der Insel.«
»Ach, da wohnen Leute?«
»Ja, wenn auch nur einige wenige. Jedenfalls muss ich immer das Schiff nehmen, wenn ich nach Hause will.«
Es gab zwar auf der Insel einen Laden für Tauchzubehör und ein Ferienheim für die Mitarbeiter eines Stahlwerkes, aber dass Leute dort richtig wohnten, war mir bis dahin nicht bekannt gewesen.
Nervös spielte der Mann mit der Spitze seiner Krawatte, die inzwischen völlig zerknittert war. Die Fähre kam immer näher. Schubsend stellten sich die Kinder am Landungssteg auf.
»Von den ganzen Leuten mit ihren Fotoapparaten, dem Angelzeug, den Schnorcheln und den Schwimmflossen bin ich immer der einzige, der mit einer Einkaufstüte an Bord geht.«
»Warum wohnen Sie denn dort, wenn es so unpraktisch ist?«
»Mir gefällt es dort drüben, und außerdem arbeite ich sowieso zu Hause.«
»Was sind Sie denn von Beruf?«
»Ich bin Russischübersetzer.«
»Übersetzer …«, wiederholte ich.
»Ist das ungewöhnlich?«
»Ich kenne niemanden, der diesen Beruf hat, deshalb hört sich das Wort fremd für mich an.«
»Ich sitze den ganzen Tag am Schreibtisch und schlage Wörter nach. Darin besteht meine Arbeit. Und Sie? Sind Sie noch Schülerin?«
»Nein, ich war nur ein halbes Jahr auf der Oberschule.«
»Wie alt sind Sie denn?«
»Siebzehn.«
»Siebzehn …«
Diesmal war es der Mann, der meine Antwort wiederholte, so als wäre siebzehn eine ganz besondere Zahl.
»Eigentlich finde ich es toll, wenn man mit dem Schiff nach Hause fahren kann.«
»Ich wohne in einem kleinen Haus, das sich jemand als Sommerresidenz gebaut hat. Es liegt am Strand hinter der Anlegestelle, sozusagen am Ohransatz.« Der Mann neigte den Kopf und zeigte auf die Stelle, an der das Ohrläppchen ansetzt. Ich starrte die Stelle an, auf die er mit dem Finger deutete. Unsere Körper waren sich einen Augenblick lang sehr nah. Wir spürten es beide sofort. Ich wandte den Blick ab, und der Mann wich zurück. Zum ersten Mal wurde mir bewusst, dass auch die Ohren eines Menschen altern. Das Ohr des Mannes war schlaff, sein Fleisch ohne Glanz.
Mit lautem Signal lief das Schiff ein, so dass die Möwen aufflatterten. Die Kette vor dem Einstieg wurde geöffnet, und eine Durchsage ertönte.
»Es wird Zeit für mich«, murmelte der Übersetzer.
»Auf Wiedersehen«, sagte ich.
»Auf Wiedersehen.«
Ich hatte das Gefühl, dass wir etwas viel Wichtigeres als einen belanglosen Abschiedsgruß ausgetauscht hatten.
Ich beobachtete, wie er über den Steg ging und sich in die Schlange der Wartenden einreihte. Obwohl er klein war, erkannte ich ihn trotz der vielen Touristen mühelos an seinem Anzug. Er drehte sich noch einmal um. Ich winkte ihm und dachte gleichzeitig, wie lächerlich das bei einem Mann war, zu dem ich gar keine Beziehung hatte und dessen Namen ich nicht einmal kannte. Er machte Anstalten zurückzuwinken, steckte jedoch die Hand, die er schon aus der Tasche gezogen hatte, verlegen sofort wieder zurück.
Das Schiff gab ein Signal und legte ab.
Meine Mutter bestrafte mich. Es war bereits nach fünf Uhr, als ich wieder im Hotel Iris ankam. Vor lauter Aufregung hatte ich außerdem vergessen, ein bestimmtes Kleid für meine Mutter aus der Reinigung zu holen.
»Was fällt dir ein? Das wollte ich heute Abend in der Tanzschule tragen«, zeterte sie. An der Rezeption klingelte jemand.
»Als ob du nicht genau wüsstest, dass das mein einziges Ausgehkleid ist. Wegen dir kann ich jetzt nicht tanzen gehen. Um halb sechs fängt es an, bis dahin schaffe ich es nicht mehr. Ich hab die ganze Zeit auf dich gewartet. Jetzt ist es zu spät. Daran bist nur du schuld.«
»Entschuldige Mama, aber in der Stadt ist auf einmal einer älteren Dame schlecht geworden. Sie wurde ganz blass und hat am ganzen Körper gezittert. Sie hat sich wirklich elend gefühlt. Deswegen habe ich sie ins Krankenhaus begleitet und mich ein bisschen um sie gekümmert. Ich konnte sie doch nicht sich selbst überlassen. Deshalb komme ich erst so spät.«
Die Ausrede hatte ich mir auf dem Heimweg zurechtgelegt. An der Rezeption schrillte ununterbrochen die Klingel, als ob sie die Wut meiner Mutter noch steigern wollte.
»Ach, geh mir aus den Augen«, schrie sie auch gleich.
Sie sprach zwar immer von ihrer »Tanzschule«, aber eigentlich war es nur ein Lokal, in dem sich Nachbarinnen, Arbeiter aus der Fischfabrik und Rentner – insgesamt etwa zehn Personen – zu irgendwelchen täppischen Tanzversuchen zusammenfanden. Nichts von Bedeutung, auch nicht für meine Mutter. Selbst wenn ich das Kleid pflichtgemäß abgeholt hätte, wäre sie vielleicht nicht einmal hingegangen, weil sie sowieso an allem etwas auszusetzen hatte.
Ich hatte meine Mutter noch nie tanzen gesehen. Die fetten Waden, die bei jeder Drehung erzitterten, ihre geschwollenen, aus den Schuhen quellenden Füße, ihre von den Armen fremder Männer umschlungenen Hüften, die von Schweiß verschmierte Schminke … Mir wurde schon übel, wenn ich nur daran dachte.
Seit meiner Kindheit prahlte meine Mutter vor den Leuten mit meinem Aussehen. Ihre bevorzugten Gäste waren zwar in erster Linie jene, die großzügige Trinkgelder gaben, aber gleich danach auf der Beliebtheitsskala kamen diejenigen, die sie zur Schönheit ihrer Tochter beglückwünschten.
»Haben Sie schon jemals eine so zarte Haut gesehen?« schwärmte sie bei jeder Gelegenheit. »Es ist fast unheimlich, wie transparent sie ist. Schon als Baby hatte sie diese großen schwarzen Augen mit den langen Wimpern. Wenn ich mit ihr spazieren ging, blieb alle naselang jemand stehen und rief ›wie süß!‹. Einmal hat sie sogar einem Bildhauer – wie hieß er noch? – Modell gestanden, und er hat eine Goldmedaille gewonnen.«
Meine Mutter lobte mich in den höchsten Tönen, auch wenn ein Gutteil ihrer Lobpreisungen frei erfunden war.
Der selbsternannte Bildhauer war ein Lustmolch gewesen, der seine Finger nicht hatte von mir lassen können.
Dass meine Mutter mich so maßlos lobte, lag weiß Gott nicht an ihrer innigen Liebe zu mir, und je mehr sie meine Schönheit anpries, desto hässlicher fühlte ich mich. Nicht einen Augenblick lang hielt ich es für möglich, dass ich wirklich hübsch sein könnte.