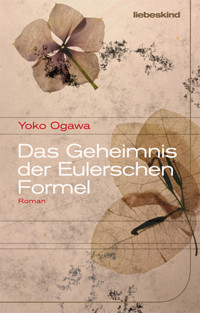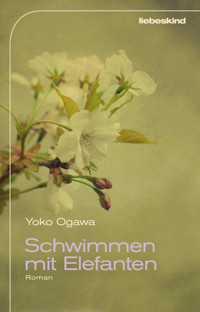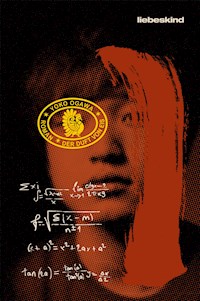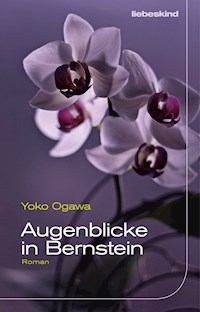9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlagsbuchhandlung Liebeskind
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tief verletzt durch die Untreue ihres Mannes, flieht Ruriko aus Tokio und zieht sich in ein einsam gelegenes Landhaus zurück. Sie arbeitet als Kalligrafin und will dort Ruhe finden, um die Transkription der Lebenserinnerungen einer englischen Dame abzuschließen. Bald schon lernt sie ihre neuen Nachbarn kennen. Nitta war früher ein bekannter Pianist und widmet sich nun dem Bau von Cembalos. Dabei geht ihm eine junge Frau namens Kaoru zur Hand, die er als seine Assistentin vorstellt. Von ihr erfährt Ruriko, dass Nitta nicht mehr vermag, in der Gegenwart anderer Klavier zu spielen. Es ist, als wäre sein Herz zu Stein geworden und die Musik zur bloßen Erinnerung … Ruriko und Nitta fühlen sich zueinander hingezogen, und doch spürt die Kalligrafin, dass zwischen ihm und seiner Assistentin unsichtbare Bande bestehen, die stärker sind als das, was Nitta für sie empfindet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Yoko Ogawa
Zärtliche Klagen
Roman
Aus dem Japanischen übersetztvon Sabine Mangold
Die Originalausgabe erschien 1996 unter dem Titel»Yasashii uttae« im Verlag Bungeishunju, Tokio.
Yoko Ogawa wird durch das Japan Foreign-Rights Centre vertreten.
© Yoko Ogawa 1996© Verlagsbuchhandlung Liebeskind 2017Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Sieveking, MünchenUmschlagmotiv: Jude McConkey / Arcangel
ISBN 978-3-95438-076-3
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
1
Es war bereits dunkel, als wir beim Landhaus eintrafen.
»Soll ich Sie zur Tür begleiten? Sie haben so viel Gepäck«, bot sich der Taxifahrer freundlicherweise an und war schon im Begriff, die Taschenlampe aus dem Handschuhfach zu holen.
»Nein, das ist nicht nötig. Ich kenne den Weg.«
Die Handtasche unter die Achselhöhle geklemmt, griff ich beide Reisetaschen und kletterte mühsam aus dem Wagen.
»Nun gut, dann werde ich zumindest wenden, damit die Scheinwerfer Ihnen den Weg leuchten.«
Am Himmel schien der Vollmond und der Bordstein zeichnete sich im Licht der Pension »Grashüpfer« ab, sodass ich nicht völlig im Dunkeln stand. Trotzdem drehte der Fahrer hastig am Lenkrad, um die hellen Scheinwerfer auf die Bäume zu richten.
»Vielen Dank.«
Sobald ich von der Straße auf den Waldpfad abbog, wurde es noch stiller um mich herum. Nur meine Schritte auf dem Weg waren deutlich vernehmbar. Kein Lufthauch ging und die Zweige der Lärchen verschmolzen lautlos mit der Finsternis.
Unterwegs wandte ich mich noch einmal um, doch das Taxi war bereits von den Bäumen verdeckt. Allein das diffuse Licht der Scheinwerfer wies mir den Weg.
Ich hatte zwar behauptet, die Gegend zu kennen, doch tatsächlich war ich seit acht Jahren nicht mehr in dieser Gegend gewesen. Damals hatte ich hier mit meinem Mann einen kurzen Sommerurlaub verbracht. Im Jahr davor waren wir im tiefsten Winter angereist, um den Jahreswechsel zu feiern. Später war die Familie meiner Schwester dazugestoßen, und mein Mann hatte unserem kleinen Neffen das Skifahren beigebracht. Es muss kurz nach unserer Hochzeit gewesen sein, als mein Vater uns zum letzten Mal hier besuchte. Er hatte Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium und war völlig ausgezehrt. Dennoch schaffte er den Weg von der Landstraße zum Haus allein.
In meiner Kindheit pflegten wir hier unsere Sommerferien zu verbringen. Zusammen mit meiner Schwester habe ich Insekten gesammelt und im Fluss gebadet; die Nachmittage verbrachten wir auf der Terrasse, wo wir die »Gesammelten Werke der Kinderliteratur aus aller Welt« lasen oder von unserer Mutter das Sticken lernten.
Natürlich war mein Vater damals noch jung und strotzte vor Kraft. Er kletterte auf jeden noch so hohen Baum, um in der Krone Nistkästen für Vögel anzubringen, oder stürzte sich in die rauschenden Wildwasser-Kaskaden.
Noch heute habe ich seinen nassen Oberkörper vor Augen, die Wasserperlen, die im Sonnenlicht auf seiner Haut schimmern. Es gab nicht das geringste Anzeichen für einen wuchernden Tumor und erbärmliches Siechtum. Die Welt mochte sich weiterdrehen, aber die Tage auf dem Land würden alle Ewigkeit überdauern, davon war ich überzeugt. Seine Brust strahlte eine Zuversicht aus, die mich in Sicherheit wiegte.
Die beiden Taschen waren übervoll, aus dem klaffenden Reißverschluss der einen lugte sogar ein Stoffzipfel hervor. Es war das Cocktailkleid, das ich mir anlässlich der Praxiseröffnung meines Mannes gekauft hatte.
Wieso hatte ich es mitgenommen? So etwas Dummes! Was hatte ein Kleid aus Seide bei einer Flucht in die Berge verloren? Ich musste über mich selbst lachen, über meinen merkwürdigen Einfall. Während ich noch darüber den Kopf schüttelte, verließ mich plötzlich der Mut, ich fühlte mich hilflos. Die Tragegriffe schnitten mir schmerzhaft ins Fleisch. Das Gepäck wog derart schwer, dass ich kaum vorankam. Um mich herum gab es nur den finsteren Wald.
Schließlich stieg der Pfad sanft an und machte einen Bogen nach rechts. Am äußeren Rand der Kurve kam das Haus in Sicht, es sah aus wie eh und je – mit dem Ziegelschornstein und der hellblau getünchten Terrasse.
Was für ein Glück, dachte ich erleichtert.
Seitdem ich Tokio verlassen hatte, war ich von der grundlosen Angst befallen gewesen, dass es das Haus nicht mehr geben könnte. Ich fragte mich, ob nicht nur das Gebäude, sondern die gesamte Landschaft aus meiner Erinnerung in eine unerreichbare Ferne gerückt sei.
Vermutlich versuchte ich mit derart diffusen, abstrusen Gedanken lediglich die ganz banalen Sorgen, die einen Ausreißer plagen mögen, zu verdrängen: beispielsweise, wer sich um die am kommenden Sonntag fällige Reinigung der Rinnsteine kümmern würde. Und wie ich ohne Auto Einkäufe erledigen konnte, oder, schlimmer, was ich tun sollte, wenn mir das Geld ausging?
Aber die Landschaft war nicht verschwunden. Sie erwartete mich wie ein treuer Hüter meiner Erinnerung.
Ich drehte den Schlüssel im Schloss und stieß die Tür auf. Nachdem ich mein Gepäck in der Diele abgestellt hatte, knipste ich die Beleuchtung am Portal mehrfach an und aus, um dem Fahrer ein Signal zu geben. Ob er es wahrgenommen hatte? Jedenfalls hörte ich kurz darauf ein Hupen und sah, wie sich das Licht jenseits der Bäume entfernte.
»Was mag das für ein Stück sein?«, murmelte ich beim Verquirlen der Eier, die ich in einer Schüssel aufgeschlagen hatte.
»Hm …«
Mein Mann blätterte in der Zeitung.
Ich habe dich doch gar nicht gefragt, sondern nur mit mir selbst geredet. Diesmal sprach ich es nicht aus und murmelte es im Stillen. Ich stellte die Pfanne aufs Feuer und rührte die Eier erneut gründlich durch.
»Jedenfalls klingt es nicht nach einer bloßen Fingerübung.«
Es war Sonntag, spät am Morgen, die Sonne stand schon hoch am Himmel. Seit dem Aufwachen hörten wir ununterbrochen das Spiel einer Geige. Der zehnjährige Junge von nebenan übte Violine. Vor zwei Wochen war seine Mutter zu uns gekommen, um sich vorsorglich für die Störung zu entschuldigen, da ihr Sohn wegen eines bevorstehenden Wettbewerbs möglichst bis abends zehn Uhr üben sollte.
Tagtäglich spielte er unablässig nur dieses eine Stück. Mit der Zeit kannte ich die Melodie auswendig und wusste sogar, an welcher Stelle er immer wieder patzte. Genau um zehn beendete er, sich an die Verabredung haltend, seine Übungen.
»Das Stück hat doch bestimmt einen Titel.«
Ich gab Champignons, zerdrückte Tomaten und Käse in die Schüssel. Mit dem Ei vermengte sich alles zu einer zähen Masse.
»Woher willst du das so genau wissen?«, brummte mein Mann, ohne den Blick von seiner Zeitung zu wenden.
»Jede Komposition hat einen Titel. Suite Nr. 1 oder Konzert Nr. 2, das klingt doch vornehm.«
Das erhitzte Öl zischte, als ich die Ei-Masse in die Pfanne goss, und das Brutzeln übertönte teilweise meine Stimme. Daraufhin schwiegen wir beide. Obwohl ich mich an dieses Schweigen gewöhnt hatte, erschien es mir wie ein kleiner Trost, als die Violine ihr Spiel fortsetzte.
Für einen Jungen von zehn Jahren fand ich das Stück in Moll ziemlich melancholisch.
Die Melodie begann in einer gedankenversunkenen Stimmung und wandelte sich zunehmend. An seinem Höhepunkt bäumte sie sich zu einer mäandernden Woge auf, ohne dass die einzelnen Töne zerstreut umherflirrten, sondern sich einfach nur auf dem Trommelfell schwebend überlagerten. Aber vielleicht hatte dieser Eindruck weniger mit der Natur des Stückes zu tun als mit der mangelhaften Technik des Jungen. Der Klang war unrein, und unmittelbar vor dem Höhepunkt ließ er beim Tonwechsel die letzte Note aus.
»Irgendwie klingt es osteuropäisch, nach Budapest oder Sofia«, sagte ich.
Die glibberige Masse schlug bereits Blasen. Den Pfannenstiel mit beiden Händen umfassend, beobachtete ich, wie langsam der Käse schmolz.
»Obwohl du noch niemals dort gewesen bist …«, warf er ein.
Mein Mann faltete sorgfältig die Zeitung zusammen, nachdem er sie vollständig ausgelesen hatte. Es war eine Geste, die so gar nicht zum Ton seiner Stimme passte.
»Ich stelle mir ein Dorf in Osteuropa vor, wo ein hübscher Jüngling mit kastanienbraunen Augen in der Abenddämmerung diese Melodie summt. Ringsumher blüht der Mohn, und auf einem Hügel erkennt man das verfallene Gemäuer einer Schlossruine und einen Kirchturm.«
»Was für Hirngespinste …«
»Und das Stück hat gewiss einen schönen Titel.«
»Da wäre ich mir nicht sicher …«
Mit dem Bratenwender schichtete ich die Masse zu einem Omelett auf. Der wabernde Brei nahm langsam eine feste Form an.
»Mir ist so, als hätte ich das Stück früher schon einmal gehört.«
»Das glaubst du nur, weil du es tagaus, tagein zu hören bekommst.«
»Wenn ich tagsüber hier alleine herumsitze, dann überkommt mich das Gefühl, dass mir der Titel, den ich eigentlich gar nicht kenne, förmlich auf der Zunge liegt.«
»Ich möchte jetzt einfach nur noch das Omelett essen.«
»Wie bitte?«, gab ich zurück.
»Das Omelett!«, erwiderte er, als würde er ein vulgäres Wort in den Mund nehmen.
»Du siehst doch, dass ich es gerade zubereite.«
»Mir ist dieses stümperhafte Geschrammel von dem Bengel nebenan wirklich egal.«
»Es gibt doch einen Wettbewerb. Deshalb muss er so viel üben.«
»Will er etwa mit diesem Gefiedel auftreten?«
»Das ist doch nicht seine Schuld.«
»Na gut, dann kann eben niemand etwas dafür. Im Übrigen verlange ich nichts Besonderes. Ich will einfach nur mein Omelett essen, und zwar in Ruhe und Frieden.«
»Dann verrat mir den Titel!«
Im diesem Moment brach das Violinspiel ab. Hatte der Junge vielleicht die Stimme meines Mannes vernommen? Oder legte er einfach nur eine Pause ein?
»Meinetwegen Osteuropa oder Mohnblüten, was geht mich das an!«
Er erhob sich, wobei er mit einem lauten Scharren den Stuhl beiseiteschob, nahm Schlüsselbund, Geldbörse und Feuerzeug von der Ablage auf dem Fernseher und fuhr mit dem Auto davon. Zu ihr.
In der Pfanne brannte das Omelett an. Ich drehte schnell das Gas aus und warf den trockenen Klumpen ins Spülbecken.
Er hatte doch sowieso vorgehabt, sich heute mit ihr zu treffen. Es lag also nicht an der Violine.
Der Junge übte weiter. Der Anfang gemächlich, ein kleines Intervall, ein akzentuierter Rhythmus …
Es klappte hervorragend. Wenn der Junge auch den Übergang zum Höhepunkt meistern würde, hätte er vom Auftakt bis zum Ende perfekt gespielt. Trotzdem scheiterte er, wie zu erwarten war, an der üblichen Stelle.
Nachdem mein Mann weggefahren war, begann ich mit den Vorbereitungen für meine Abreise. Aus der hintersten Ecke des Kleiderschranks holte ich die beiden größten Reisetaschen hervor und stopfte sämtliche Kleidungsstücke, derer ich habhaft werden konnte, und alle Utensilien, die ich für meine Arbeit benötigte, hinein: eine Sammlung von Federhaltern und Pinseln, Tinte, Papier, ein Lineal. Nach kurzer Überlegung nahm ich auch noch einige Medikamente, meine Kreditkarte und den Lockenstab mit.
Als Nächstes schickte ich ein Fax an meine Auftraggeberin, um ihr meine geänderten Kontaktdaten mitzuteilen, und prüfte den Fahrplan des Shinkansen in Richtung Osten, bevor ich schließlich im Grashüpfer anrief. Früher hieß die Pension »Asahiya«, deren Wirtin mein Vater mit der Verwaltung des Landhauses betraut hatte, nachdem es erbaut war.
Ich sagte ihr, dass ich heute alleine kommen würde, und sie möge entschuldigen, dass ich sie so plötzlich mit der Bitte überfiel, das Haus für mich vorzubereiten.
Die Wirtin war ganz gerührt, als sie mich nach so langer Zeit am Telefon vernahm, und stellte keine aufdringlichen Fragen. Ich fügte als Ausrede hinzu, dass ich einen wichtigen Auftrag zu erledigen habe und mich auf die Arbeit konzentrieren müsse.
Alles verlief reibungslos, viel besser, als ich erwartet hatte. Ganz so, als hätte ich es lange im Voraus geplant.
Vor drei Jahren hatte ich gemerkt, dass mein Mann eine Geliebte hatte, aber zwischen uns war schon zuvor vieles schiefgelaufen. Einer von uns beiden hatte bereits vorgeschlagen, getrennt zu leben, sogar von Scheidung war die Rede. Wenn man alle harmonischen Phasen in unserem zwölfjährigen Eheleben zusammenzählen würde, käme nur eine sehr kurze Zeitspanne heraus, in der wir uns einmal nicht gestritten haben. Und dann passierten alle möglichen Dinge in meinem Leben: Mein Mann machte sich selbstständig und eröffnete eine Augenarztpraxis in der Innenstadt, mein Vater verstarb und ich fasste als Kalligrafin Fuß. Letzten Endes haben wir den unausgegorenen Zustand unserer Beziehung einfach beibehalten.
Aus welchem Milieu seine Geliebte stammt, ist mir nicht bekannt. Es könnte die Orthoptistin sein, die er damals kennengelernt hatte, als er noch in der Klinik beschäftigt war, aber ich selbst bin ihr nie begegnet. Mein Mann pendelt zwischen zwei Haushalten hin und her.
Natürlich war ich nicht glücklich mit der Situation, aber mich klammheimlich aus dem Staub zu machen, scheint mir auch keine geeignete Lösung zu sein. Das würde ihn bestimmt maßlos ärgern und die ganze Situation noch verschlimmern. Aber ich konnte nicht mehr tatenlos zusehen.
Als die Violine sich von einem bedeutsamen Ton lossagte und sich in den Schwingungen des heiseren, rauen Nachhalls verlor, kam mir plötzlich das Landhaus in den Sinn. Ich war seit Jahren nicht mehr dort gewesen, konnte mich jedoch noch lebhaft an jedes Detail in dem geräumigen, wenn auch schlichten Gebäude erinnern. Das Haus würde mir Unterschlupf bieten und Geborgenheit schenken.
Ohne eine Zeile zu hinterlassen, ohne die schmutzige Pfanne abzuwaschen, eine halbe Tomate auf dem Schneidbrett zurücklassend, ging ich fort.
2
Dass ich glaubte, alles sei unverändert, hing damit zusammen, dass ich nachts eingetroffen war. Als ich am nächsten Morgen die Umgebung genauer in Augenschein nahm, stellte ich durchaus einige Veränderungen fest, die im Laufe der Jahre eingetreten waren.
Dank der Wirtin des Grashüpfers waren Fenster und Böden geputzt, die Betten frisch bezogen, ohne klamm zu sein, und auch die Wasserleitungen und Öfen funktionierten einwandfrei. Dennoch hatte die Zeit ihre unvermeidlichen Sedimente wie eine Art Patina über alles gelegt.
Das Sofa stand zwar noch genauso wie in meinen Kindertagen, aber sein stumpfer, spröder Lederbezug gab einem das Gefühl, als hätte es seit Langem keinen menschlichen Kontakt mehr genossen.
Das Bücherregal, wo einst die »Gesammelten Werke der Kinderliteratur aus aller Welt« gestanden hatten, war leer geräumt worden, bis auf zwei alte Kochbücher in verblichenen Farben. Eines hieß »Gerichte für jeden Tag«, das andere »Backrezepte für alle zwölf Monate«. Auf dem Umschlag des Letzteren war ein Haufen Mehl mit Butterflöckchen abgebildet.
Auch die wenigen Bilder, die einst die Wände geschmückt hatten, waren verschwunden. Meine Mutter, der im fortgeschrittenen Alter die Anreise zu beschwerlich geworden war, hatte sie wahrscheinlich mit zu sich nach Hause genommen. Auf den ausgeblichenen Tapeten konnte man noch die helleren Quadrate erkennen, die vom Sonnenlicht verschont worden waren.
Ich konnte mich noch gut an das Stillleben erinnern, das über der Stereoanlage hing. Es zeigte eine Glasschale, drei Turteltauben und einige Maiskolben. Die toten Vögel lagen einträchtig nebeneinander, und mit ihrem blutbefleckten Gefieder sahen sie aus, als seien sie gerade erst erlegt worden.
Gleich nach dem Aufwachen war ich auf die Terrasse hinausgetreten. Etwas anderes fiel mir im Moment nicht ein. Ich hatte alles durchstöbert, aber nichts Essbares gefunden, nicht einmal Tee zum Aufbrühen gab es.
Die Terrasse war mit Tau benetzt und glitzerte in der Morgensonne. Die hellblaue Wandfarbe blätterte an vielen Stellen ab, und einige der Stützstreben des Geländers lagen zerbrochen im Garten.
Von der Westseite aus trat ich auf jede einzelne Bodenplanke und zählte sie schrittweise ab. Eine von ihnen hatte früher gequietscht, als würde eine Katze miauen, und meine Schwester hatte mir damit oft Angst eingejagt: »Wenn du darauf trittst, wird dir nachts im Traum eine Geisterkatze erscheinen.«
Eins, zwei, drei, vier … Tatsächlich! Es quietschte. Die Diele unter meinem Fuß gab einen jämmerlichen Klagelaut von sich.
Kurz vor Mittag brachte mir die Wirtin die im Voraus bestellten Lebensmittel und ein paar Dinge für den täglichen Bedarf vorbei.
»Verzeihen Sie, dass ich Ihnen so viele Umstände bereite.«
Wir setzten uns auf die Bank auf der Terrasse.
»Aber nicht doch. Die Feiertage sind ja vorbei, jetzt kann ich durchatmen. Außerdem muss ich doch sowieso täglich einkaufen gehen, da machen mir ein paar Sachen mehr oder weniger nichts aus.«
Die Wirtin schien überhaupt nicht gealtert. Sie war immer noch die dickste Frau, der ich jemals begegnet bin. Überall hatte sie Speckrollen und Fettpölsterchen: an den Fingerkuppen, hinter den Ohren, an den Fesseln, am Grübchen des Kinns. Weiß, prall und zart, dass man unwillkürlich Lust verspürte, sie anzufassen. Sie bewegte sich mit einer wiegenden Geschmeidigkeit und plapperte unbekümmert daher.
»Trotz meiner kurzfristigen Ankündigung haben Sie alles sauber bekommen.«
»Haben Sie denn gut schlafen können?«
»Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass ich zum ersten Mal ganz allein hier bin.«
»Damals, als wir noch eine Herberge waren, herrschte hier ein ziemlicher Trubel, was? Ihr wart noch so klein, Ihre Schwester und Sie, Ruriko.«
Den Kopf zur Seite geneigt, senkte sie ihre Handfläche.
»Wie geht es Ihrer Frau Mama?«
»Ach, ihr Rheuma hat sich verschlimmert. Sie wohnt jetzt bei meiner Schwester. Seit dem Tod meines Vaters hat sich ihr Gesundheitszustand abrupt verschlechtert.«
»Wie lange mag das her sein?«
»Zehn Jahre. Man glaubt es kaum, die Zeit vergeht wie im Flug, nicht wahr? Es ist, als wäre keine einzige Minute verstrichen …«
»Ja, das stimmt!«
Wolken zogen über den Himmel. Während wir schweigend dasaßen, konnten wir die verschiedensten Geräusche wahrnehmen: das Rascheln von Blättern, Vogelgezwitscher, ab und zu ein säuselnder Windhauch. Vielleicht lag es am Verschmelzen all dieser Töne, dass ich trotzdem eine tiefe Stille empfand.
»Aber hier hat sich so gut wie nichts verändert, oder? Es scheinen kaum neue Häuser gebaut worden zu sein.«
»Weil die Immobiliengesellschaft bankrott ist. Aber es hat sich schon einiges geändert, was auf den ersten Blick nicht auffällt. Unsere Katze ist tot, die Ziege ebenfalls. Und einige Leute aus der Nachbarschaft sind auch gestorben. Nun ja, da kann man nichts machen.«
»Ach, die Ziege ist tot?«
Ich hatte ab und zu beim Melken geholfen.
»An ihrer Stelle haben wir jetzt einen Pfau.«
»Einen Pfau?«
»Ja, einen richtigen Pfau. Kommen Sie doch mal vorbei, um ihn anzuschauen. Er schlägt ein Rad auf mein Kommando! Wirklich! Ich habe es ihm beigebracht. Also dann, falls Sie noch irgendetwas brauchen, scheuen Sie sich nicht, mir Bescheid zu sagen.«
Sie erhob sich und stieß dabei mehrmals mit ihrem dicken Bauch gegen die Tischkante. Ich gab ihr das Geld für die Einkäufe, eingewickelt in ein Stück Papier, das ich gefunden hatte. Mit einer Verbeugung nahm sie es mit beiden Händen entgegen. Ihre mollige Erscheinung ließ jede ihrer Gesten gefühlvoll erscheinen.
»Die nächsten Male komme ich aber bei Ihnen vorbei, um die Sachen zu holen.«
»Nein, nein! Ich muss mich doch ein bisschen bewegen. Wenn ich noch dicker werde, passe ich irgendwann nicht mehr durch die Toilettentür.«
»Oje, glauben Sie? Haben Sie jedenfalls vielen Dank für alles.«
»Gern geschehen. Auf Wiedersehen.«
Zum Abschied winkend, entfernte sie sich auf dem Waldpfad. Ein Laubblatt hatte sich in ihrem weißen Haarknoten verfangen.
Die nächsten Tage verliefen ereignislos. Es passierte nichts. Ich verließ weder das Haus, noch wechselte ich mit irgendjemandem ein Wort. Ich verbrachte die Zeit damit, in den beiden Kochbüchern, die als Einzige noch im Regal standen, zu blättern oder auf der Terrasse zu sitzen, Tee zu trinken und dabei Radio zu hören. Unten im Schrank entdeckte ich alte vergilbte Zeitungen, die von wundersamen, höchst verwickelten Vorfällen berichteten. Ein Mann mittleren Alters, der mit einer Pilotenuniform bekleidet als Heiratsschwindler sein Unwesen trieb, war verhaftet worden. Die Gäste eines Hochzeitsbanketts hatten sich beim Hummeressen mit Cholera infiziert; ein Löwe und ein Leopard hatten einen Mischling gezeugt; eine Frau hatte einen Mann mit einer Ahle erstochen, weil er sie verlassen wollte. Ich las diese Geschichten wie Märchen aus einem fernen Land.
Das schöne Wetter hielt an, der weite Himmel zeigte tagsüber immer das gleiche Blau. Die Fensterläden der anderen Hütten waren allesamt geschlossen. Hin und wieder erblickte ich Gestalten, offenbar Einheimische, auf dem Pfad, der am Haus vorbeiführte, aber sie nahmen keine Notiz von mir.
Wenn die Nacht hereinbrach, schloss ich die Fenster, verriegelte die Haustür und zog mich in das europäisch eingerichtete Zimmer im oberen Stockwerk zurück, um zu arbeiten. Die Stille lastete auf meinen Ohren, und wenn ich müde wurde, begab ich mich zu Bett.
Meistens konnte ich nicht einschlafen. Sobald ich die Augen schloss, hatte ich das Gefühl, von einer tiefen Finsternis verschluckt zu werden. Nirgendwo dort gab es einen Halt oder Wärme.
Ich hatte zahllose Nächte, in denen mein Mann nicht nach Hause kam, in Einsamkeit verbracht. Es ging nur um ihn, er fehlte mir. Ich hatte mir sehnsüchtig gewünscht, er möge nach Hause kommen und alles würde sich regeln.
Aber es war eine andere Art von Finsternis, die mich hier im Wald heimsuchte. Die eisige Kälte, die sich in meinem Herzen breitmachte, ließ mich erstarren. Ich begriff, dass selbst seine Gegenwart diesen angstvollen Zustand nicht würde ändern können. Es war viel eindringlicher, überwältigender. Ein Gefühl, als befände ich mich auf dem Meeresgrund, einsam, fern von allem Licht.
Es war nicht mein Mann, nach dem ich mich sehnte. Sondern ein warmer Lichtstrahl, der nur mich erleuchtete. Dies wurde mir in jenem Moment zum ersten Mal bewusst.
Er meldete sich nicht. Das Telefon duckte sich in die Ecke und gab keinen Laut von sich.
Meine kargen, einsamen Mahlzeiten waren schnell eingenommen. Wie sehr ich mir auch bei der Zubereitung Mühe gab, die Zeit kroch nur langsam voran. Ich putzte Salat, kochte Spargel, raspelte Karotten und bereitete mir daraus ein Mahl. Obwohl ich mich fast nur davon ernährte, wurde der Salatkopf nicht kleiner, ganz gleich, wie viele Blätter ich von ihm abzupfte. Dann erwärmte ich eine Maissuppe aus der Dose und legte dazu eine Scheibe Baguette auf den Teller. Das war’s. Im Spülbecken blieben nur die schmutzige Kasserolle und Karottenschalen zurück.
Wenn ich auf die Rückkehr meines Mannes wartete, habe ich oft gedankenversunken dagesessen und auf das Essen gestiert, das ich eigens für ihn gekocht hatte. Es waren Gerichte, für deren Zutaten ich oft zu entlegenen Märkten gefahren war und für die ich ganze Nachmittage brauchte, um sie zuzubereiten. Ich schaute zu, wie die Sauce kalt wurde, das Gemüse trocken, das Fleisch dürr. Irgendwann konnte ich nicht mehr unterscheiden, ob es das Essen war oder mein eigenes Herz, was da vor meinen Augen verkümmerte.
Das Grausamste daran war, wenn sich mir am nächsten Morgen der gedeckte Tisch genauso darbot wie am Abend zuvor. Ich kippte dann alles in die Mülltonne. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, die Speisen, die stehen geblieben waren, weil mein Mann die Nacht mit einer anderen Frau verbrachte, selbst zu verzehren.
Während ich die Maissuppe löffelte, wanderte mein Blick unwillkürlich zum Telefon hinüber. Wann mochte es ihm wohl aufgefallen sein, dass ich weg war? Versuchte er mich dort zu erreichen, wo er mich vermutete? Die Auswahl an Möglichkeiten war beschränkt. Infrage kamen lediglich meine Familie und eine Handvoll Freunde. Keine Ahnung, ob seine Vorstellungskraft ausreichte, auch das Landhaus in Betracht zu ziehen. Vermutlich würde er allein schon die Idee als unsinnig verwerfen.
Der Teller Suppe war im Nu leer. Ich war soeben der Illusion verfallen, dass er mich anrufen würde. Das durfte ich mir nicht erlauben.
Am fünften Abend, ich nahm gerade ein Bad, fing es an zu regnen. Kaum hörte ich die ersten Tropfen aufs Dach schlagen, wurde das Prasseln zunehmend stärker, bis binnen weniger Minuten ein heftiges Unwetter tobte.
Ich saß in der Wanne und schaute zum Fenster hoch, wo das Wasser gegen die Scheiben trommelte. Draußen war es stockdunkel. Der Regen brandete schubweise in Wogen heran. Es war ein Wolkenbruch, der alles zu zersprengen drohte: das Haus, die Bäume, den Himmel.
Bei dem draußen herrschenden übermächtigen Brausen erschien mir das Badezimmer umso stiller. Ich hatte mich offenbar übernommen, mein rechter Arm war ganz taub. In letzter Zeit erholte ich mich nicht mehr so leicht von der Anstrengung meiner Arbeit. Vom Halten der Feder war der Mittelfinger meiner rechten Hand durch eine verhornte Stelle ganz krumm geworden. Meinem Mann war diese Beule unheimlich. Er sagte, sie sehe aus, als könnte sie jeden Moment aufplatzen und eine Raupe herausschlüpfen.
Deshalb hatte ich es mir angewöhnt, in seiner Gegenwart meine Hände zu verbergen. Ich trug weder Ringe noch Armbänder, und ich lackierte mir auch nicht die Fingernägel. So hatte mein Körper in seinen Augen allmählich an Reiz verloren. Nicht bloß der Mittelfinger, sondern auch meine Ohrläppchen, mein Nacken, mein Rücken, meine Brüste.
Zum Regen gesellten sich Donner und Blitze, die am Himmel zuckten. Selbst durch die beschlagene Luke sah ich die hellen Lichtreflexe. Nackt wie ich war, kam ich mir noch verletzlicher vor, und in dem Moment, als ich mich erhob, um aus der Badewanne zu steigen, gab es einen Kurzschluss.
Notgedrungen kauerte ich mich wieder ins Wasser. Um mich herum war nur Finsternis. An den Wannenrand gelehnt, betrachtete ich, sobald es draußen blitzte, meinen kurz beleuchteten Körper.
Wie lange mochte das nun schon dauern? Das elektrische Licht flackerte nicht einmal kurz auf, während das heftige Unwetter immer weiter tobte.
Plötzlich war mir, als hörte ich eine Stimme. Zuerst vernahm ich sie ganz schwach, wie das Summen eines Insekts, das sich in die Pausen zwischen dem Donnergrollen schlich. Vielleicht hatte ich mich auch verhört, und es war nur eine Einbildung, aber dann wurde sie immer lauter. Es war nicht mehr zu leugnen.
»Hallo?«, hörte ich jemanden deutlich rufen.
Es war eine Frauenstimme.
»Hallo, ist jemand da?«
Diesmal war gleichzeitig ein Klopfen an der Tür vernehmbar. Im selben Moment ertönte ein heftiger Donnerschlag.
Wer sollte das sein? Unangemeldet, und dann noch bei diesem Unwetter? Ich verspürte jedoch kein Unbehagen, denn die Stimme der Frau hatte sehr zurückhaltend geklungen.
»Frau Hino? Frau Ruriko Hino? Sind Sie da?«
Ich griff nach meinem Bademantel, zog ihn über und stolperte zur Haustür.
»Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie einfach so überfalle.«
Als sei das schlimme Unwetter ihr Verschulden, senkte sie den Kopf, die Kapuze ihres Regencapes hatte sie tief ins Gesicht gezogen.
»Die Wirtin des Grashüpfers hat mich gebeten, Ihnen eine Kerze und Streichhölzer zu bringen. Von mir aus ist es nicht so weit wie von der Pension.«
Sie legte ihre Taschenlampe auf der Kommode ab und hob das Cape ein wenig an, um in die Hosentasche ihrer Jeans zu greifen. Sie holte die wegen der Nässe in Zellophan gewickelte Kerze und die Streichholzschachtel hervor.
»Oje, jetzt mussten Sie wegen mir aus dem Haus, und das bei diesem Unwetter!«
»Die Wirtin war besorgt, weil die Notbeleuchtung ausgefallen ist. In dem Fall ist die Stromversorgung für längere Zeit unterbrochen.«
Ihr Cape triefte vom Regen, in der Diele hatte sich gleich eine Pfütze gebildet. Sie zog die Kapuze herunter. Das Licht der Taschenlampe beleuchtete ihr Profil. Eine junge Frau mit hellem Teint und feinen Gesichtszügen. Sie trug ihr Haar kurz und war ungeschminkt. Doch ihr Blick war ausdrucksstark und die Lippen schimmerten in einem natürlichen frischen Rot. Unter dem linken Jochbein hatte sie einen Leberfleck. Über ihr Gesicht perlten Regentropfen.
»Treten Sie doch bitte ein. Hier auf der Schwelle kann ich Ihnen schlecht danken.«
»Nein, ich muss gleich wieder zurück. Ich wollte das nur schnell vorbeibringen.«
Ich nahm Kerze und Streichhölzer entgegen.
»Aber ist es nicht zu riskant, bei diesem Unwetter draußen herumzulaufen? Es wäre doch besser, Sie warten hier, bis es sich beruhigt hat. Besonders die Blitze können gefährlich werden.«
»Das geht schon. Sie treffen uns hier nicht. Am Wasserspeicher ganz in der Nähe gibt es einen Blitzableiter.«
Schüchtern senkte sie beim Sprechen den Blick. Sie war höflich, ohne dabei steif zu wirken, ganz im Gegenteil, sie besaß eine ungezwungene, offenherzige Art.
»Außerdem habe ich es nicht weit. Es ist gleich da drüben.«
Mit der linken Hand zeigte sie Richtung Norden. Jedes Mal, wenn sie sich bewegte, tropfte es an ihr herunter. Das Regencape war offensichtlich eine Männergröße, denn es bauschte sich unförmig auf, was sie recht zierlich aussehen ließ.
»Also noch tiefer im Wald?«
»Ja, am Ende des Pfades. Ein Bach führt dort entlang und gleich dahinter kommt eine steile Böschung.«
Ich wusste, welches Haus sie meinte. Es war das mit dem ziegelroten Dach. Davor befand sich ein Feld mit Kohl und Kartoffeln. Als Kinder durften wir über das Grundstück laufen, wenn wir im Bach angeln wollten, und meine Mutter lieh sich manchmal dort Gewürze aus, wenn ihr welche fehlten. Damals lebte dort ein kinderloses altes Ehepaar, weshalb ich mich fragte, in welcher Beziehung die junge Frau zu ihnen stehen mochte.
»Also dann auf Wiedersehen.«
Sie zog die Kapuze über den Kopf und öffnete geschwind die Tür.
»Vielen Dank für alles. Im Haus war es stockfinster, ich hatte eine ziemliche Angst.«
»Wenn Sie allein sind und sich fürchten, kommen Sie ruhig vorbei. Sie bleiben doch sicher noch eine Weile, oder?«, vergewisserte sie sich, bevor sie endgültig im Regen verschwand.
»Kommen Sie gut nach Hause!«, rief ich ihr hinterher.
Sie winkte, ohne sich umzudrehen. Nur die Pfütze auf dem Boden blieb zurück.
Am nächsten Morgen hatte sich das Unwetter verzogen. Die Sonne strahlte wie tags zuvor. Es war überall noch feucht, aber der Wald sah unverändert aus, als wäre nichts geschehen.
Ich rief die Wirtin an, um mich bei ihr für die Aufmerksamkeit am gestrigen Abend zu bedanken, und konnte bei der Gelegenheit, da ihr Einkaufstag war, meine kleine Wunschliste übermitteln: Mehl, Backpulver und Vanillezucker.
Von ihr erfuhr ich, dass die alten Leute aus dem Haus mit dem ziegelroten Dach längst verstorben waren. Nach ihrem Tod war das Haus lange Zeit leer gestanden, bis ein gewisser Herr Nitta aus Tokio es vor fünf, sechs Jahren erworben hatte. Dieser Nitta fertigte Musikinstrumente, und die junge Frau, die mir gestern die Kerze vorbeigebracht hatte, war seine Assistentin.
»Musikinstrumente?«
»Ja, wie heißt das doch gleich … Ich frage ihn immer danach, vergesse es aber sofort wieder …«
Sie schien am anderen Ende der Leitung nachzudenken, kam jedoch zu keinem Ergebnis.
Am Nachmittag, als die bestellten Sachen geliefert wurden, holte ich den kleinen Ofen aus dem Küchenschrank und backte Kekse.
Das uralte Gerät schien jahrelang nicht benutzt worden zu sein, und ich hatte schon die Befürchtung, dass es gar nicht mehr funktionierte, aber als ich den Thermostat einstellte, erreichte er wie gewünscht die Temperatur von 180 Grad.
»Backrezepte für alle zwölf Monate«, eines der beiden Kochbücher, kam nun zum Einsatz. Mit den frisch gebackenen Keksen machte ich mich anschließend auf den Weg zum Haus des Instrumentenbauers.
Als ich ans Ende des Pfades gelangte, breitete sich zu meiner Überraschung eine große Lichtung vor mir aus. Wo früher der Gemüseacker gelegen hatte, war nun Brachland, auf dem eine Halle stand, die offenbar als Lager diente. Ganz am Rand des Grundstücks, halb abgewandt vom Weg, erblickte ich das Haus.
Als ich näher kam, konnte ich deutlich das Murmeln des Bachs hören. Durch das weit geöffnete Fenster war etwas erkennbar, das an das Bein eines verzierten Möbelstücks erinnerte.
»Oh, Sie kommen uns besuchen?«, rief sie mir freundlich zu, und schon stand sie vor mir.
Im Sonnenlicht wirkte ihre Haut blass und makellos. Das am gestrigen Abend klatschnasse Haar war nun trocken und seidig und ließ ihre hübschen Ohren erkennen.
»Vielen Dank noch einmal für gestern Abend. Sie haben mir wirklich sehr geholfen.«
Ich überreichte ihr die Kekse. Sie hielt das Päckchen mit beiden Händen, versenkte ihr Gesicht darin und lobte mich, wie gut sie dufteten.
»Bitte, kommen Sie doch herein. Es trifft sich gut, ich bin gerade dabei, Tee zuzubereiten.«
»Störe ich Sie denn nicht bei der Arbeit?«
»Nicht im Geringsten. Treten Sie ein!«
Sie öffnete mir weit die Tür und winkte mich hinein.
Solch einen Raum hatte ich mein Lebtag noch nicht gesehen. Ein Dielenboden von sechzehn Tatamis, mit ausgeblichenen Flecken übersät. Auch die Wände und die Decke waren voll davon. Die hölzernen Stützpfeiler waren zerkratzt, die Fensterrahmen aus Metall stellenweise angerostet, und trotzdem wirkte es keineswegs schäbig. All diese Gebrauchsspuren verliehen dem Raum einen eher würdevollen Charakter.
Im Regal an der Wand, die nach Norden ging, zierte Nippes aus Glas, ordentlich aufgereiht, die Borde: kleine Teller, Bonbonnieren, Parfümflakons, Arzneifläschchen, Weinkelche, Likörgläschen. Blau, rosa, orangefarben, milchig weiß. Ein umfangreiches Sortiment.
Von irgendwoher kam ein Hund angelaufen. Er sprang um mich herum und rieb sein Gesicht an meinen Beinen. Es war ein dunkelbrauner Mops.
»Entschuldigung. Haben Sie keine Angst, er beißt nicht. Er ist eigentlich ganz zahm, aber schon ziemlich alt und kann nicht mehr richtig sehen und hören. Deshalb beschnüffelt er jeden Gast, um festzustellen, mit wem er es zu tun hat. He, Dona, lass das, komm her!«
Sie klopfte dem Mops auf den Rücken, woraufhin er eine Art Rülpsen von sich gab.
Auf einer Kommode stand ein Telefon mit Faxgerät, daneben lagen ein Stapel Briefe und ein Notizblock. Inmitten des Zimmers befand sich ein runder Tisch mit vier unterschiedlichen Stühlen, und in einer Ecke stand eine Stereoanlage.
Außerdem entdeckte ich zwei Paar an die Wand gelehnte Skier, eine Reihe von Werkzeugkästen, die über das Zimmer verteilt waren, einen achtlos hingeschmissenen alten Lederkoffer und verschiedenartige Lampen, die von der Decke baumelten.
Der restliche Raum war mit Musikinstrumenten und seltsamem Zubehör vollgestellt. Holzflöten verschiedenster Größen und Orgelpfeifen an der Wand, noch nicht fertiggestellte Geigen, ein Harmonium, Triangeln, Hörner, Akkordeons, Notenständer, Partituren, Metronome.
Ganz besonders fielen mir jedoch die Instrumente auf, die aussahen wie Miniaturflügel. Es waren drei, die links vom Eingang auf der Fensterseite ganz hinten im Raum standen.
Ich wies auf das erste, das sich direkt neben dem Fenster befand.
»Das ist ein Cembalo«, sagte eine Männerstimme.
»Ein Cembalo …«, wiederholte ich im gleichen Tonfall. Das Wort hatte einen wundervollen Klang.
»Sie wissen, was das ist?«
»Nein, ich sehe es zum ersten Mal«, erwiderte ich ehrlich. »Kaoru, mach uns doch heute bitte einen schwarzen Tee. Du kannst eine neue Dose öffnen.«
Die junge Frau, die er Kaoru nannte, brachte ein Teeservice aus der Küche und stellte sich vor dem Regal auf die Zehenspitzen, um vom obersten Bord einen Teller aus Kristallglas zu nehmen, auf dem sie die Kekse arrangierte.
»Sie bauen also diese Cembalos?«
»Ja«, erwiderte Nitta und nickte.
»Was für ein schönes Musikinstrument! Mit den zierlichen Beinen wirkt es von Weitem wie ein antikes Möbelstück.«
»Es war ja auch vom 16. bis zum 18. Jahrhundert beliebt.«
Nitta war groß und geschmeidig, sein langes gewelltes Haar fiel ihm über die Schultern. Er sah aus wie Mitte vierzig. Ab und zu legte er die Hand ans Kinn, und er sprach mit sonorer Stimme.
Kaoru schenkte drei Tassen Tee ein. Nitta stellte eine vor mich und hob den Deckel der Zuckerdose. Mir fielen die langgliedrigen Finger der beiden auf, expressiv in ihren Bewegungen, was die robusten Sehnen auf den Handrücken sichtbar machte. So sahen vermutlich die Finger von Instrumentenbauern aus.
Die Unterhaltung war nicht besonders lebhaft, aber jeder von uns trug etwa gleich viel dazu bei und es herrschte eine angenehme Stimmung. Wenn die Konversation einmal stockte, war es meistens Kaoru, die sie wieder in Gang brachte, indem sie ein neues Thema anschnitt, Tee nachschenkte oder den Geschmack der Kekse lobte.
Dona wuselte wie zuerst unruhig hin und her, bis er schließlich einen bequemen Platz unterm Tisch gefunden und sein Kinn auf meinen Fuß gelegt hatte. Seine hinter den halb geschlossenen Lidern hervorlugenden Glubschaugen hatten trotz offenkundiger Altersschwäche eine hübsche Farbe, es war, als hätte man himmelblaue Pigmente in Joghurt aufgelöst.
Ich gab Dona einen Keks, den er ausdruckslos und mit puderbestäubter Schnauze geräuschvoll auffraß. Nach diesem kleinen Imbiss legte er sich wieder zum Schlafen auf meinen Fuß. Die schlaffe Zunge hing ihm seitlich aus dem Maul.
Als der Tee in der Kanne zur Neige ging, wusste ich schon ein wenig mehr über die beiden.
Nitta war auf dem Konservatorium im Klavierspiel ausgebildet worden, hatte sich dann jedoch gegen die Laufbahn eines Berufsmusikers entschieden und war vor siebzehn Jahren nach Belgien gezogen. Nachdem er dort das Handwerk des Cembalobauers erlernt hatte, richtete er sich eine Werkstatt in einem Vorort von Tokio ein. Doch wegen persönlicher Umstände seines Vermieters war er gezwungen gewesen, das Grundstück zu räumen. Daraufhin war er in diese Gegend gezogen, denn hier konnte er nicht nur günstig Rohmaterialien für sein Handwerk beziehen, sondern auch das Klima erwies sich als sehr vorteilhaft für die Instrumente.