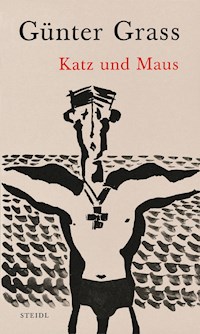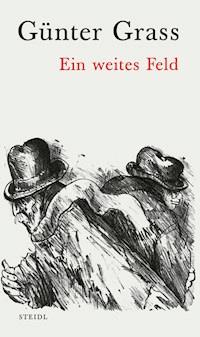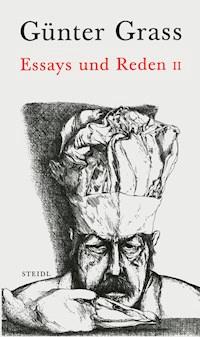Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Erzähler schreiben zur Jahreswende 1960/61 gleichzeitig drei Bücher und werden so in Vorkriegs-, Kriegs- und Nachkriegszeit Chronisten der „Hundejahre“ unseres Jahrhunderts: Eddi Amsel, das Opfer, Harry Liebenau, der Zeuge, und Walter Matern, der Täter. Deutsche Schäferhunde, die Mädchen Tulla und Jenny und ein Reigen von Vogelscheuchen begleiten sie auf ihrer Odyssee von Danzig nach Westdeutschland, bis weit hinab in die Unterwelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 949
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Grass
Hundejahre
ERSTES BUCH
FRÜHSCHICHTEN
Erste Frühschicht
Erzähl Du. Nein, erzählen Sie! Oder Du erzählst. Soll etwa der Schauspieler anfangen? Sollen die Scheuchen, alle durcheinander? Oder wollen wir abwarten, bis sich die acht Planeten im Zeichen Wassermann geballt haben? Bitte, fangen Sie an! Schließlich hat Ihr Hund damals. Doch bevor mein Hund, hat schon Ihr Hund, und der Hund vom Hund. Einer muß anfangen: Du oder Er oder Sie oder Ich… Vor vielen vielen Sonnenuntergängen, lange bevor es uns gab, floß, ohne uns zu spiegeln, tagtäglich die Weichsel und mündete immerfort.
Der hier die Feder führt, wird zur Zeit Brauxel genannt, steht einem Bergwerk vor, das weder Kali, Erz noch Kohle fördert und dennoch hundertvierunddreißig Arbeiter und Angestellte auf Förderstrecken und Teilsohlen, in Firstenkammern und Querschlägen, an der Lohnkasse und in der Packerei beschäftigt: von Schichtwechsel zu Schichtwechsel.
Unreguliert und gefährlich floß früher die Weichsel. So rief man tausend Erdarbeiter und ließ im Jahre achtzehnhundertfünfundneunzig von Einlage nordwärts, zwischen den Nehrungsdörfern Schiewenhorst und Nickelswalde, den sogenannten Durchstich graben. Der verringerte, indem er der Weichsel eine neue und schnurgerade Mündung gab, die Überschwemmungsgefahr.
Der Federführende schreibt Brauksel zumeist wie Castrop-Rauxel und manchmal wie Häksel. Bei Laune schreibt Brauxel seinen Namen wie Weichsel. Spieltrieb und Pedanterie diktieren und widersprechen sich nicht.
Von Horizont zu Horizont liefen die Deiche der Weichsel und hatten sich, unter Aufsicht des Deichregulierungskommissarius zu Marienwerder, gegen die hochgehenden Frühjahrsfluten und gegen das Dominikswasser zu stemmen. Wehe, wenn Mäuse im Deich waren.
Der hier die Feder führt, dem Bergwerk vorsteht und seinen Namen verschieden schreibt, hat sich mit dreiundsiebzig Zigarettenstummeln, mit der errauchten Ausbeute der letzten zwei Tage, den Lauf der Weichsel, vor und nach der Regulierung, auf geräumter Schreibtischplatte zurechtgelegt: Tabakkrümel und mehlige Asche bedeuten den Fluß und seine drei Mündungen; abgebrannte Streichhölzer sind Deiche und dämmen ihn ein.
Vor vielen vielen Sonnenuntergängen: da kommt der Herr Deichregulierungskommissarius vom Kulmischen her, wo im Jahre fünfundfünfzig bei Kokotzko, auf Höhe des Mennonitenfriedhofes, der Deich brach – noch Wochen später hingen die Särge in den Bäumen –, er aber, zu Fuß, zu Pferde oder im Boot, in seinem Gehrock und nie ohne das Fläschchen Arrak in weiter Tasche, er, Wilhelm Ehrenthal, der in antiken und dennoch humorigen Versen jene »Deichbeschauliche Epistel« geschrieben hatte, die kurz nach Erscheinen allen Deichgräfen, Dorfschulzen und Mennonitenpredigern mit freundlicher Widmung zugestellt wurde, er, hier genannt, um nie wieder genannt zu werden, inspiziert stromauf stromab das Deckwerk, die Rauhwehren und Buhnen, treibt Ferkel vom Deich, weil es nach Feldpolizeiordnung, Paragraph acht, vom November achtzehnhundertsiebenundvierzig, jeglichem Vieh, ob Feder oder Klaue, verboten ist, auf dem Deich zu weiden und zu wühlen.
Linker Hand ging die Sonne unter. Brauxel zerbricht ein Streichholz: Die zweite Mündung der Weichsel entstand ohne Hilfe der Erdarbeiter am zweiten Februar achtzehnhundertvierzig, als der Fluß, weil das Eis sich gestaut hatte, unterhalb Plehnendorf die Nehrung durchbrach, zwei Dörfer wegnahm und die Gründung zweier neuer Flecken, der Fischerdörfer Östlich-Neufähr und Westlich-Neufähr erlaubte. Wir aber haben es, so reich die beiden Neufähr an Geschichten, Dorfklatsch und unerhörten Begebenheiten waren, in der Hauptsache mit den Dörfern östlich und westlich der ersten, wenn auch jüngsten Mündung zu tun: Schiewenhorst und Nickelswalde waren oder sind rechts und links des Weichseldurchstiches die letzten Dörfer mit Fährbetrieb; denn fünfhundert Meter flußabwärts mischt heute noch die offene See ihr nullkommaachtprozentiges Salzwasser mit dem oft aschgrauen, zumeist lehmgelben Ausfluß der weithingelagerten Republik Polen.
Beschwörende Worte: »Die Weichsel ist ein breiter, in der Erinnerung immer breiter werdender, trotz der vielen Sandbänke schiffbarer Strom…« spricht Brauchsel vor sich hin, läßt auf seiner Schreibtischplatte, die zum anschaulichen Weichseldelta wurde, einen Rest Radiergummi zwischen Streichholzdeichen als Fähre verkehren und stellt nun, da die Frühschicht eingefahren ist, da der Tag laut mit Sperlingen beginnt, den neunjährigen Walter Matern – Betonung auf der letzten Silbe – der untergehenden Sonne gegenüber auf die Nickelswaldener Deichkrone; er knirscht mit den Zähnen.
Was geht vor, wenn ein neunjähriger Müllerssohn auf dem Deich steht, dem Fluß zuschaut, der untergehenden Sonne ausgesetzt ist und gegen den Wind mit den Zähnen knirscht? Das hat er von seiner Großmutter, die neun Jahre lang fest im Stuhl saß und nur die Augäpfel bewegen konnte.
Vieles treibt vorbei, und Walter Matern sieht es. Von Montau bis Käsemark Hochwasser. Hier, kurz vor der Mündung, hilft die See. Man sagt, es waren Mäuse im Deich. Immer wenn ein Deich bricht, sagt man, es waren Mäuse im Deich. Katholiken aus dem Polnischen sollen über Nacht Mäuse im Deich angesiedelt haben, sagen die Mennoniten. Andere wollen den Deichgräfe auf seinem Schimmel gesehen haben. Aber die Versicherungsgesellschaft will weder an Wühlmäuse noch an den Deichgräfe von Güttland glauben. Als der Deich, der Mäuse wegen, brach, sprang der Schimmel mit dem Deichgräfe, wie es die Sage vorschreibt, in den hochgehenden Fluß, aber das half nicht viel: Denn die Weichsel nahm alle Deichgeschworenen. Und die Weichsel nahm die katholischen Mäuse aus dem Polnischen. Und sie nahm die groben Mennoniten mit Haken und Ösen aber ohne Taschen, nahm die feineren Mennoniten mit Knöpfen, Knopflöchern und teuflischen Taschen, nahm auch Güttlands drei Evangelische und den Lehrer, den Sozi. Nahm Güttlands brüllendes Vieh und Güttlands geschnitzte Wiegen, nahm ganz Güttland: Güttlands Betten und Güttlands Schränke, Güttlands Uhren und Güttlands Kanarienvögel, nahm Güttlands Prediger – der war grob und hatte Haken und Ösen –, nahm auch des Predigers Tochter, und die soll schön gewesen sein.
Das alles und noch mehr trieb vorbei. Was treibt ein Fluß wie die Weichsel vor sich her? Was in die Brüche geht: Holz, Glas, Bleistifte, Bündnisse zwischen Brauxel und Brauchsel, Stühle, Knöchlein, auch Sonnenuntergänge. Was längst vergessen war, bringt sich bäuchlings und rücklings als Schwimmer und mit Hilfe der Weichsel in Erinnerung: Adalbert kam. Adalbert kommt zu Fuß. Da trifft ihn die Axt. Aber Svantopolk läßt sich taufen. Was wird aus Mestwins Töchtern? Läuft eine barfuß davon? Wer nimmt sie mit? Der Riese Miligedo mit seiner Bleikeule? Der feuerrote Perkunos? Der bleiche Pikollos, der immer von unten nach oben schaut? Der Knabe Potrimpos lacht und kaut seine Weizenähre. Eichen werden gefällt. Die knirschenden Zähne – und Herzog Kynstutes Töchterlein, die ins Kloster ging: zwölf Ritter ohne Kopf und zwölf Nonnen ohne Kopf, die tanzen in der Mühle: die Mühle geht langsam, die Mühle geht schneller, mahlt Seelchen zu Mehl, doch der Schnee fällt viel heller: die Mühle geht langsam, die Mühle geht schneller, sie aß mit zwölf Rittern vom selbigen Teller: die Mühle geht langsam, die Mühle geht schneller, es geigen zwölf Ritter zwölf Nonnen im Keller: die Mühle geht langsam, die Mühle geht schneller, so feiern sie Lichtmeß mit Furz und Geträller: die Mühle geht langsam, die Mühle geht schneller … als aber die Mühle von innen nach außen brannte und Kutschen für kopflose Ritter und kopflose Nonnen vorfuhren, als viel später – Sonnenuntergänge – der heilige Bruno durchs Feuer ging und der Räuber Bobrowski mit seinem Kumpan Materna, von dem alles sich herleitet, Brände in vorher gezinkte Häuser legte – Sonnenuntergänge Sonnenuntergänge – Napoleon vorher und nachher: da wurde die Stadt kunstvoll belagert, denn sie erprobten mehrmals und mit wechselndem Erfolg congrevesche Raketen: in der Stadt aber und auf den Wällen, auf den Bastionen Wolf, Bär, Braunes Roß, auf den Bastionen Aussprung, Maidloch und Kaninchen husteten die Franzosen unter Rapp, spuckten die Polen mit ihrem Fürsten Radzivil, heiserte das Corps des einarmigen Capitaine de Chambure. Doch am fünften August kam das Dominikswasser, erkletterte ohne Leitern die Bastionen Braunes Roß, Kaninchen und Aussprung, machte das Pulver naß, ließ die congreveschen Raketen zischend untergehen und führte viele Fische, besonders Hechte, in die Gassen und Küchen: wunderbar wurden alle satt, obgleich die Speicher längs der Hopfengasse abgebrannt waren – Sonnenuntergänge. Was alles der Weichsel gut zu Gesicht steht, was einen Fluß wie die Weichsel färbt: Sonnenuntergänge, Blut, Lehm und Asche. Dabei sollte der Wind sie haben. Nicht alle Befehle werden ausgeführt; Flüsse, die in den Himmel wollen, münden in die Weichsel.
Zweite Frühschicht
Hier, auf Brauxels Schreibtischplatte, und über den Schiewenhorster Deich rollt sie, jeden Tag. Und auf dem Nickelswaldener Deich steht Walter Matern und knirscht mit den Zähnen; denn sie geht unter. Leergefegt verjüngen sich Deiche. Nur das Rutenzeug der Windmühlen, stumpfe Kirchtürme und Pappeln – die ließ Napoleon für seine Artillerie pflanzen – kleben auf den Deichkronen. Er allein steht. Allenfalls der Hund. Aber der ist weg und mal hier mal dort. Hinter ihm, schon im Schatten und unter dem Spiegel des Flusses, liegt das Werder und riecht nach Butter, Glumse, nach Käsereien, riecht gesundmachend und zum Erbrechen nach Milch. Neunjährig breitbeinig, mit blauroten Märzknien steht Walter Matern, spreizt zehn Finger, schlitzt die Augen, läßt alle Narben seines kurzgeschorenen Kopfes, die von Stürzen, Schlägereien und Stacheldrahtrissen zeugen, anschwellen, Profil gewinnen, knirscht von links nach rechts mit den Zähnen – das hat er von seiner Großmutter – und sucht einen Stein.
Auf dem Deich gibt es keinen Stein. Er aber sucht. Dürre Stöcke findet er. Aber einen dürren Stock kann man nicht gegen den Wind. Er will muß will aber schmeißen. Könnte Senta, mal hier mal weg, heranpfeifen, pfeift aber nicht, knirscht nur – das macht den Wind stumpf – und will schmeißen. Könnte Amsels Blick mit Häh! und Häh! von der Deichsohle auf sich ziehen, hat aber den Mund voller Knirschen und nicht voller Häh! und Häh! – will muß will dennoch, hat aber auch in den Taschen keinen Stein; hat sonst immer in der einen oder in der anderen Tasche einen oder zwei. Steine nennt man hier Zellacken. Die Evangelischen sagen: Zellacken, die paar Katholischen: Zellacken. Die groben Mennoniten: Zellacken. Die feinen: Zellacken. Auch Amsel, der gerne Ausnahmen macht, sagt Zellack, wenn er einen Stein meint; und Senta holt einen Stein, sagt wer zu ihr: Hol einen Zellack. Kriwe sagt Zellacken, Kornelius Kabrun, Beister, Folchert, August Sponagel und die Majorin von Ankum, alle sagen; und der Prediger Daniel Kliewer aus Pasewark sagt zu seiner groben und feinen Gemeinde: »Da häd sech dä klaine David ain Zellack jenomm ond häd dem Tullatsch, dem Goliath…« Denn ein Zellack ist ein handlicher taubeneigroßer Stein.
Jedoch Walter Matern findet weder noch in den Taschen. Rechts nur Krümel und Sonnenblumenkerne, links zwischen Bindfäden und knisternden Heuschreckenüberresten – während es oben knirscht, während die Sonne weg ist, während die Weichsel fließt, etwas aus Güttland, etwas aus Montau vorbeitreibt, Amsel gebückt und immerzu Wolken, während Senta gegen den Wind, die Möwen mit dem Wind, die Deiche sauber zum Horizont, während sie weg weg weg ist – findet er sein Taschenmesser. Sonnenuntergänge dauern in östlichen Gegenden länger als in westlichen: das weiß jedes Kind. Da fließt die Weichsel von einem Himmel zum gegenüberliegenden. Schon macht sich am Schiewenhorster Anleger die Dampffähre los und will schräg und bissig gegen den Fluß zwei Güterwagen der Kleinbahn nach Nickelswalde bringen, aufs Gleis nach Stutthof. Soeben dreht das Stück Leder, Kriwe genannt, sein Rindsledergesicht aus dem Wind und klappert wimperlos die Deichkrone gegenüber ab: bißchen gehendes Rutenzeug und Pappeln zum Abzählen. Hat nun was Starres im Auge, das bückt sich nicht, hat aber die Hand in der Tasche. Und läßt sein Auge von der Böschung rutschen: Da ist was komisch Rundes, das bückt sich, will wohl der Weichsel was wegnehmen. Das ist Amsel, der ist auf Klamotten aus – wofür Klamotten? –, das weiß jedes Kind.
Aber das Leder Kriwe weiß nicht, was Walter Matern, der einen Zellack in der Tasche suchte, in seiner Tasche fand. Während Kriwe sein Gesicht aus dem Wind zieht, wird das Taschenmesser in Walter Materns Hand wärmer. Dieses hat ihm Amsel geschenkt. Drei Klingen, einen Korkenzieher, eine Säge, einen Dorn hat es. Amsel dicklich rötlich und zum Lachen, wenn er weint. Amsel fischt an der Deichsohle im Schlamm, denn die Weichsel reicht, weil von Montau bis Käsemark Hochwasser ist und obgleich sie Fingerbreite um Fingerbreite fällt, bis zur Deichkrone und bringt Sachen mit, die es vorher in Palschau gab.
Weg. Sie ist drüben hinterm Deich und hat ein Rot hinterlassen, welches zunimmt. Da macht – was nur Brauxel wissen kann – Walter Matern eine Faust um das Messer in seiner Tasche. Amsel ist bißchen jünger als Walter Matern. Senta, weit weg und auf Mäuse aus, ist etwa so schwarz, wie der Himmel, von der Schiewenhorster Deichkrone aufwärts, rot ist. Da bleibt eine treibende Katze im Treibholz hängen. Möwen vermehren sich fliegend: gerissenes Seidenpapier knüllt, wird geglättet, klaftert; und die gläsernen Stecknadelkopfaugen sehen alles, was treibt, hängt, rennt, steht oder nur da ist, wie Amsels zweitausend Sommersprossen; auch daß er einen Helm trägt, wie er vor Verdun getragen wurde. Und der Helm rutscht, muß zurück in den Nacken, rutscht wieder, während Amsel Zaunlatten und Bohnenstangen, auch bleischwere Klamotten aus dem Schlamm fischt: Da löst sich die Katze, kreiselt weg, fällt den Möwen zu. Die Mäuse im Deich rühren sich wieder. Und die Fähre nähert sich immer. Da treibt ein toter gelber Hund und dreht sich. Senta steht gegen den Wind. Schräg und bissig bringt die Fähre zwei Güterwagen. Es treibt ein Kalb, das lebt nicht mehr. Jetzt stolpert der Wind, aber schlägt nicht um. Da bleiben die Möwen in der Luft stehn, sie zaudern. Jetzt hat Walter Matern – während Fähre, Wind und Kalb und die Sonne hinterm Deich und die Mäuse im Deich und die Möwen auf einem Fleck – die Faust mit dem Taschenmesser aus der Tasche heraus, hat sie, während die Weichsel fließt, vor den Pullover geführt und läßt, dem zunehmenden Rot gegenüber, alle Knöchel kreidig werden.
Dritte Frühschicht
Alle Kinder zwischen Hildesheim und Sarstedt wissen, was in Brauksels Bergwerk, das zwischen Hildesheim und Sarstedt liegt, gefördert wird.
Alle Kinder wissen, warum das Infanterieregiment hundertachtundzwanzig jenen Stahlhelm, den Amsel trägt, mit anderen Stahlhelmen neben einem Haufen Drillichzeug und einigen Gulaschkanonen in Bohnsack liegenlassen mußte, als es mit der Eisenbahn im Jahre zwanzig wegfuhr.
Die Katze ist schon wieder da. Alle Kinder wissen: Es ist nicht dieselbe Katze, nur die Mäuse wissen nicht und die Möwen wissen nicht. Die Katze ist naß naß naß. Da treibt etwas vorbei, das ist kein Hund und kein Schaf, das ist ein Kleiderschrank. Der Schrank stößt nicht mit der Fähre zusammen. Und als Amsel eine Bohnenstange aus dem Schlamm zieht und Walter Materns Faust über dem Taschenmesser ins Zittern kommt, gibt es Freiheit für eine Katze: Der offenen See, die bis zum Himmel reicht, treibt sie zu. Die Möwen verringern sich, die Mäuse im Deich rühren sich, die Weichsel fließt, die Faust überm Messer zittert, Nordwest heißt der Wind, die Deiche verjüngen sich, die offene See stemmt alles was sie hat gegen den Fluß, noch immer und immerzu geht die Sonne unter, noch immer und immerzu bringt die Fähre sich selber und zwei Güterwagen: Die Fähre kentert nicht, die Deiche brechen nicht, die Mäuse fürchten sich nicht, die Sonne will nicht zurück, die Weichsel will nicht zurück, die Fähre will nicht zurück, die Katze will nicht, die Möwen wollen nicht, die Wolken nicht, das Infanterieregiment nicht, Senta will nicht zu den Wölfen zurück, sondern bravbravbrav… Auch Walter Matern will jenes Taschenmesser, das ihm Amsel dick kurz fett schenkte, nicht in die Tasche zurückkehren lassen; vielmehr gelingt es der Faust über dem Messer, noch einen Anstrich kreidiger zu werden. Und es knirschen oben Zähne von links nach rechts. Es entspannt sich, während es fließt kommt untergeht treibt kreiselt zu- und abnimmt, die Faust über dem Taschenmesser, daß alles vertriebene Blut in die nunmehr locker geschlossene Hand schießt: Walter Matern wirft die Faust um den heißgewordenen Gegenstand hinter sich, steht nur noch auf einem Bein Fuß Ballen, auf fünf Zehen in einem Schnürschuh, hebt ohne Strumpf im Schuh sein Gewicht auf, läßt all sein Gewicht in die Hand hinter sich rutschen, zielt nicht, knirscht kaum; und in jenem fließenden treibenden untergehenden verlorenen Moment – denn auch Brauchsel kann ihn nicht retten, weil er vergaß, etwas vergaß – jetzt also, da Amsel vom Modder der Deichsohle aufblickt, dabei mit linkem Handrücken und einem Teil seiner zweitausend Sommersprossen den Stahlhelm in den Nacken, zu einem anderen Teil seiner zweitausend Sommersprossen schiebt, ist Walter Materns Hand weit voraus, leer, leicht und zeigt nur noch die Druckstellen eines Taschenmessers, das drei Klingen, einen Korkenzieher, eine Säge und einen Dorn hatte; in dessen Gehäuse Seesand, ein Rest Marmelade, Kiefernnadeln, Borkenmehl und eine Spur Maulwurfsblut sich verkrustet hatten; dessen Tauschwert eine neue Fahrradklingel gewesen wäre; das niemand gestohlen, das Amsel mit selbstverdientem Geld im Laden seiner Mutter gekauft, dann seinem Freund Walter Matern geschenkt hatte; das im letzten Sommer an Folcherts Schuppentor einen Schmetterling genagelt, unter der Anlegebrücke von Kriwes Fähre innerhalb eines Tages vier Ratten, in den Dünen beinahe ein Kaninchen und vor zwei Wochen einen Maulwurf getroffen hatte, bevor Senta ihn erwischen konnte. Weiterhin zeigt die Innenfläche der Hand Druckstellen desselben Messers, mit dem sich Walter Matern und Eduard Amsel, als sie acht Jahre alt und auf Blutsbrüderschaft aus waren, den Oberarm ritzten, weil ihnen Kornelius Kabrun, der in Deutsch-Südwest gewesen war und über Hottentotten Bescheid wußte, davon erzählt hatte.
Vierte Frühschicht
Mittlerweile – denn während Brauxel die Vergangenheit eines Taschenmessers aufdeckt und das gleiche Taschenmesser als geworfener Gegenstand der Wurfkraft, der Kraft des gegen ihn angehenden Windes und der eigenen Schwerkraft gehorcht, bleibt Zeit genug übrig, von Frühschicht zu Frühschicht einen Arbeitstag abzubuchen und mittlerweile zu sagen –, mittlerweile also hatte Amsel seinen Stahlhelm mit dem Handrücken in den Nacken geschoben. Er übersprang mit einem Blick die Deichböschung, erfaßte mit demselben Blick den Werfer, schickte den Blick dem geworfenen Gegenstand hinterdrein; und das Taschenmesser hat, behauptet Brauxel, mittlerweile jenen endlichen Punkt erreicht, der jedem aufstrebenden Gegenstand gesetzt ist, hat erreicht, während die Weichsel fließt, die Katze treibt, die Möwe schreit, die Fähre kommt, während die Hündin Senta schwarz ist und die Sonne nicht aufhört mit dem Untergehen.
Mittlerweile – denn wenn ein geworfener Gegenstand jenes Pünktchen erreicht hat, hinter dem der Abstieg beginnt, zaudert er einen Augenblick lang, täuscht Stillstand vor –, während das Taschenmesser also oben still steht, reißt Amsel seinen Blick von dem Pünktchen Gegenstand fort und hat wieder – schon fällt das Messer rasch ruckhaft, weil stärker dem Gegenwind ausgesetzt, dem Fluß zu – seinen Freund Walter Matern im Auge, der immer noch mit Ballen und Zehenspitzen ohne Strumpf im Schnürschuh wippt, die rechte Hand hoch und weit von sich hält, während sein linker Arm rudert und ihm das Gleichgewicht bewahren will.
Mittlerweile – denn während Walter Matern einbeinig wippt und ums Gleichgewicht besorgt ist, während Weichsel und Katze, Mäuse und Fähre, Hund und Sonne, während das Taschenmesser dem Fluß zufällt, ist in Brauchsels Bergwerk die Frühschicht eingefahren, die Nachtschicht ausgefahren und auf Fahrrädern davon, hat der Kauenwärter die Kaue abgeschlossen, haben die Sperlinge in allen Regenrinnen den Tag angefangen… Es gelang damals Amsel, mit kurzem Blick und gleich darauffolgendem Anruf Walter Matern aus dem knapp bewahrten Gleichgewicht zu bringen. Zwar kam der Junge auf der Nickelswaldener Deichkrone nicht zu Fall, geriet aber doch dergestalt wild ins Torkeln und Stolpern, daß er sein Taschenmesser aus dem Auge verlor, bevor es die fließende Weichsel berührte und unsichtbar wurde.
»Häh, Knirscher!« ruft Amsel. »Häst allwedder midde Zähne jeknirscht ond jeschmissen wie neilich?«
Walter Matern, der hier als Knirscher angesprochen wird, steht wieder breitbeinig mit durchgedrückten Knien und reibt sich die Innenfläche seiner rechten Hand, die immer noch nachglühende Profile eines Taschenmessers im Negativ zeigt.
»Häst doch jesehn, daas ech mißt schmeißen, was frägs noch.«
»Häst aber nech middem Zellack jeschmissen.«
»Na wenn hier kain Zellack nech ist.«
»Waas schmeißt denn, wenn kain Zellack nech hass?«
»Na wennech ain Zellack jehabt hädd, häddech och middem Zellack jeschmissen.«
»Wenn hädst de Senta jeschickt, hädse diä och jebracht ain Zellack.«
»Naachhä kann jeder sagen, häddst de Senta jeschickt. Schick du ma ain Gissert, wennä off Mäuse is.«
»Mid waas häst denn jeschmissen, wenn kain Zellack nech jehabt häst?«
»Waas frägs immer. Mid irjend son Dingsdam. Hass doch jesehn.«
»Häst mid main Knief jeschmissen.«
»Wa main Knief. Ond jeschenkt is jeschenkt. Ond wennech ain Zellack jehabt hädd, denn häddech nech middem Knief, denn häddech middem Zellack jeschmissen.«
»Hädst doch waas jesagt, ain Wortchen, daas da kain Zellack nech findst, denn häddech diä raufgeschmissen ainen, wo hier jenug hat.«
»Waas rädst ond schawieterst, wo ä nu weg ist.«
»Vlaicht krieg ech ain neuen Knief off Hemmelfaart.«
»Will aber kain neuen Knief nech.«
»Na wennech diä jäb, wirst schon nähmen.«
»Wätten wä, daas nech?«
»Wätten wä, daas nämmst?«
»Wätten wä?«
»Wätten wä!«
Dann wetten sie mit Handschlag: Husaren gegen Brennglas, indem Amsel seine Hand mit den vielen Sommersprossen den Deich hinaufreicht, Walter Matern seine Hand mit den Druckstellen des Taschenmessers hinunterreicht und mit dem Handschlag Amsel auf die Deichkrone zieht.
Amsel bleibt freundlich: »Du best jenau wie daine Oma inne Miehle. Die knirscht och immer midde paar Zähne, wo se noch hädd. Bloos schmeißen tut se nech. Dafier schlächt se middem Leffel.«
Amsel ist auf dem Deich etwas kleiner als Walter Matern. Während er spricht, zeigt sein Daumen über seine Schulter dorthin, wo hinter dem Deich das Straßendorf Nickelswalde und die Maternsche Bockwindmühle liegen. Die Deichböschung hinauf zieht Amsel ein sperriges Bündel Dachlatten, Bohnenstangen, ausgewrungene Lumpen. Immer wieder muß sein Handrücken den vorderen Rand des Stahlhelms heben. Die Fähre hat an der Nickelswaldener Anlegebrücke festgemacht. Man hört die beiden Güterwagen. Senta wird größer, kleiner, größer, nähert sich schwarz. Wieder treibt totes Kleinvieh vorbei. Breitschultrig fließt die Weichsel. Walter Matern wickelt seine rechte Hand in den unteren ausgefransten Rand seines Pullovers. Senta steht auf vier Beinen zwischen dem einen und dem anderen. Ihre Zunge hängt links heraus und zuckt. Sie hat ihre Augen auf Walter Matern gerichtet, weil der mit den Zähnen. Das hat er von seiner Großmutter, die neun Jahre lang fest im Stuhl und nur die Augäpfel.
Jetzt ziehen sie ab: verschieden groß auf der Deichkrone gegen die Anlegebrücke der Fähre. Schwarz die Hündin. Einen halben Schritt voran: Amsel. Hinterdrein: Walter Matern. Er schleppt Amsels Klamotten. Hinter dem Bündel richtet sich das Gras, während die drei auf dem Deich kleiner werden, langsam wieder auf.
Fünfte Frühschicht
Brauksel hat sich also, wie vorgesehen, übers Papier gebeugt, hat, während die anderen Chronisten sich gleichfalls und termingerecht über die Vergangenheit gebeugt und mit den Niederschriften begonnen haben, die Weichsel fließen lassen. Noch macht es ihm Spaß, sich genau zu erinnern: Vor vielen vielen Jahren, als das Kind zur Welt kam, aber noch nicht mit den Zähnen knirschen konnte, weil es zahnlos wie alle Kinder zur Welt gekommen war, saß die Großmutter Matern in der Hängestube fest im Stuhl, konnte seit neun Jahren nichts als die Augäpfel bewegen, nur blubbern und seibern.
Die Hängestube hing über der Küche, hatte ein Fenster zur Diele, von dem aus die Arbeit der Mägde beobachtet werden konnte, hatte ein Fenster hinten hinaus zur Maternschen Windmühle, die mit dem Stert auf dem Bock saß, also eine original Bockwindmühle war; das war sie schon seit hundert Jahren. Die Materns hatten sie im Jahre achtzehnhundertfünfzehn, kurz nach der Eroberung der Stadt und Festung Danzig durch die siegreichen russischen und preußischen Waffen, erbauen lassen; hatte es August Matern, der Großvater unserer fest im Stuhl sitzenden Großmutter, doch verstanden, während der langwierigen und lustlos geführten Belagerung ein Doppelgeschäft zu unterhalten: Einerseits begann er, gegen gute Konventionstaler, im Frühjahr Sturmleitern herzustellen; andererseits wußte er, gegen Laubtaler und noch bessere Brabanter Währung, in eingeschmuggelten Briefchen dem General Graf d’Heudelet mitzuteilen, daß es doch merkwürdig sei, wenn die Russen im Frühjahr, da man noch keine Äpfel ernten könne, Leitern in Mengen herstellen ließen.
Als schließlich der Gouverneur, Graf Rapp, die Kapitulation der Festung unterschrieben hatte, zählte August Matern im abgelegenen Nickelswalde die Dänischen Spezies und Zweidrittelstücke, die geschwind steigenden Rubel, die Hamburger Markstücke, Laubtaler und Konventionstaler, das Säckchen Holländische Gulden sowie die frischerstandenen Danziger Papiere, fand sich gut versorgt und gab sich der Lust des Wiederaufbaus hin: Die alte Mühle, in der nach Preußens Niederlage die flüchtende Königin Luise übernachtet haben soll, jene historische Mühle, deren Rutenzeug zuerst bei einem dänischen Überfall von der Seeseite her, dann bei nächtlichem Gefecht mit dem ausschwärmenden Freiwilligencorps des Capitaine de Chambure gelitten hatte, ließ er, bis auf den Bock, der noch gut im Holz war, abreißen und erbaute auf altem Bock jene neue Mühle, die immer noch mit dem Stert auf dem Bock saß, als sich die Großmutter Matern fest und unbeweglich in den Stuhl setzen mußte. Hier will Brauxel, bevor es zu spät ist, einräumen, daß August Matern mit den teils mühsam teils leicht erworbenen Mitteln nicht nur die neue Bockwindmühle erbaute, sondern auch dem Kapellchen in Steegen, wo es Katholische gab, eine Madonna stiftete, der es zwar nicht an Blattgold mangelte, die aber weder nennenswerte Pilgerfahrten auslöste noch Wunder wirkte.
Der Katholizismus der Maternschen Familie war, wie es sich bei einer Müllerfamilie gehört, vom Winde abhängig, und da im Werder immer ein brauchbares Lüftchen ging, ging auch das ganze Jahr über die Maternsche Mühle und hielt vom übermäßigen, die Mennoniten verärgernden Kirchgang ab. Allein Kindstaufen wie Begräbnisse, Hochzeiten und die hohen Feiertage trieben einen Teil der Familie nach Steegen; auch wurde einmal im Jahr, anläßlich der Steegener Feldprozession am Fronleichnamstag, der Mühle, dem Bock mit allen Dübeln, dem Mehlbalken wie dem Mahlkasten, dem großen Hausbaum wie dem Stert, besonders aber dem Rutenzeug Segen und Weihwasser zuteil; ein Luxus, den sich die Materns nie in grobmennonitischen Dörfern wie Junkeracker und Pasewark hätten leisten können. Die Mennoniten des Dorfes Nickelswalde jedoch, die alle auf fettem Werderboden Weizen anbauten und auf die katholische Mühle angewiesen waren, zeigten sich als Mennoniten feinerer Art, hatten also Knöpfe, Knopflöcher und richtige Taschen, in die man etwas hineinstecken konnte. Einzig der Fischer und Kleinbauer Simon Beister war ein echter Haken-und-Ösen-Mennonit, grob und taschenlos; deshalb hing über seinem Bootsschuppen ein gemaltes Holzschild, drauf schnörkelige Inschrift:
Mit Haken un Ösen: Dem ward lieb Gottke erlösen. Mit Knöpp un Taschen: Dem ward der Düwel erhaschen.
Doch Simon Beister blieb der einzige Nickelswaldener, der seinen Weizen nicht in der katholischen Mühle, sondern in der Pasewarker mahlen ließ. Dennoch muß nicht er es gewesen sein, der einen verkommenen Melker aus Freienhuben im Jahre dreizehn, kurz vor Ausbruch des großen Krieges anstiftete, mit allerlei Zunder die Maternsche Bockwindmühle in Brand zu stecken. Es päserte schon unterm Bock und Stert, als Perkun, der junge Schäferhund des Mahlknechtes Pawel, den aber alle Paulchen riefen, schwarz und mit gestrecktem Schweif immer engere Kreise um Hügelchen, Bock und Mühle zog und mit trockenem Blaffen Mahlknecht und Müller aus dem Haus trieb.
Pawel oder Paul hatte das Tier aus dem Litauischen mitgebracht und zeigte auf Verlangen eine Art Stammbaum vor, dem jedermann entnehmen konnte, daß Perkuns Großmutter väterlicherseits eine litauische, russische oder polnische Wölfin gewesen war.
Sechste Frühschicht
Vor langer langer Zeit – zählt Brauxel an seinen Fingern ab – als die Welt im dritten Kriegsjahr stand, Paulchen in Masuren geblieben war, Lorchen mit dem Hund herumirrte, der Müller Matern aber weiterhin Mehlsäcke schleppen durfte, weil er beiderseits schlecht hörte, saß die Großmutter Matern eines sonnigen Tages, da Kindstaufe gefeiert werden sollte – der taschenmesserwerfende Bengel vergangener Frühschichten bekam den Namen Walter vorgesetzt –, fest im Stuhl, rollte mit Augäpfeln, blubberte, seiberte und brachte dennoch kein Wort zusammen.
In der Hängestube saß sie und wurde von rasenden Schatten getroffen. Sie blitzte auf, verging im Halbdunkel, saß grell, saß düster. Auch Stücke Möbel, der Aufsatz des Vertikos, der gebuckelte Deckel der Truhe und der rote, seit neun Jahren unbenutzte Sammet des geschnitzten Betschemelchens leuchteten auf, vergingen, zeigten Profile, dunkelten klobig: flittriger Staub, staubloses Dämmern über der Großmutter und ihren Möbeln. Ihr Häubchen und der Pokal, glasblau auf dem Vertiko. Die gefransten Ärmel des Bettjäckchens. Das blindgescheuerte Dielenholz, auf dem die bewegliche, etwa handgroße Schildkröte, die der Mahlknecht Paul ihr geschenkt hatte, von Ecke zu Ecke wechselte, aufleuchtete und den Mahlknecht überlebte, indem sie mit kleinem Biß grünen Salatblättern halbrunde Profile gab. Und alle in der Hängestube verstreuten Salatblätter mit ihren Schildkrötenbißornamenten traf es grell grell grell; denn draußen, hinterm Haus, mahlte die Maternsche Bockwindmühle, bei einer Windgeschwindigkeit von acht Metern pro Sekunde, Weizen zu Mehl und wischte mit ihren vier Flügeln viermal in dreieinhalb Sekunden die Sonne aus.
Um die gleiche Zeit, da es in Großmutters Stube dämonisch grell düster zuging, wurde das Kind auf der Landstraße durch Pasewark, Junkeracker nach Steegen zur Taufe gefahren, wurden die Sonnenblumen am Zaun, der den Maternschen Gemüsegarten zur Landstraße hin abgrenzte, größer und größer, beteten einander an und wurden von der gleichen Sonne, die viermal in dreieinhalb Sekunden vom Rutenzeug der Windmühle ausgelöscht wurde, pausenlos verherrlicht; denn die Bockwindmühle hatte sich nicht zwischen Sonne und Sonnenblumen, nur, und das am Vormittag, zwischen die festsitzende Großmutter und eine Sonne geschoben, die im Werder nicht immer aber oft schien.
Seit wieviel Jahren saß die Großmutter fest?
Neun Jahre Hängestube.
Wie lange schon hinter Astern, Eisblumen, Wicken oder Winden?
Neun Jahre lang grell düster grell seitlich der Bockwindmühle.
Wer hatte sie so fest in den Stuhl gedrückt?
Das hatte die Schwiegertochter Ernestine, eine geborene Stange, ihr zugefügt.
Wie konnte das passieren?
Die Evangelische aus Junkeracker hatte Tilde Matern, die damals noch keine Großmutter, eher rüstig und lautstark gewesen war, zuerst aus der Küche getrieben, sich dann auf der Diele breitgemacht und putzte nun auf Fronleichnam die Fensterscheiben. Als Stine ihre Schwiegermutter aus den Stallungen vertrieb, ging es zwischen den Hühnern, die dabei Federn verloren, zum erstenmal handfest zu: Mit Futterschüsseln schlugen die Frauen aufeinander ein.
Das muß sich, zählt Brauxel nach, im Jahre neunzehnhundertfünf zugetragen haben; denn als zwei Jahre später Stine Matern, geborene Stange, noch immer nicht nach grünen Äpfeln und sauren Gurken verlangte und ihre Tage unerschütterlich nach dem Kalender bekam, sagte Tilde Matern zu ihrer Schwiegertochter, die mit verschränktem Armzeug vor ihr in der Hängestube stand: »Daas hab ech mä emmer schon jedacht, daas de Evangjelschen em Loch drinn dem Deikert sain Mäuschen ham. Ond daas knabbert alls wech, daas nuscht nech mecht rauskommen. Daas stinkt bloos!«
Es kam nach diesen Worten zu einem mit hölzernen Kochlöffeln ausgetragenen Religionskrieg, der für die Katholsche im Stuhl endete: Denn jener eichene Lehnstuhl, der vor dem Fenster, zwischen Kachelofen und Betschemelchen stand, fing eine vom Schlag gerührte Tilde Matern auf. Seit neun Jahren saß sie nun in diesem Gestühl, wenn sie nicht vom Lorchen und den Mägden, der Reinlichkeit wegen, für die Dauer eines Bedürfnisses weggehoben wurde.
Als die neun Jahre vorbei waren und sich erwiesen hatte, daß die Evangelischen im Schoß kein teuflisches Mäuschen, das alles wegfrißt und nichts keimen läßt, beherbergen, daß vielmehr etwas ausgetragen, als Sohn zur Welt gekommen und abgenabelt worden war, saß die Großmutter, während bei günstiger Witterung in Steegen getauft wurde, immer noch und unverrückt fest in der Hängestube. Unter der Stube, in der Küche, lag eine Gans im Backofen und zischelte mit ihrem eigenen Fett. Das tat die Gans im dritten Kriegsjahr des großen Krieges, da Gänse so selten geworden waren, daß man die Gans zu den aussterbenden Tierarten zählte. Lorchen Matern mit dem Muttermal, mit der flachen Brust, mit dem krausen Haar, Lorchen, die keinen Mann bekommen hatte – denn Paulchen war in die Erde gekrochen und hatte nur seinen schwarzen Hund hinterlassen –, Lorchen, die auf die Gans im Ofen aufpassen sollte, war nicht in der Küche, begoß die Gans nie, versäumte, die Gans zu wenden, besprach die Gans mit keinen Sprüchen, stand vielmehr mit den Sonnenblumen in einer Reihe hinter dem Zaun – den hatte der neue Mahlknecht im Frühjahr frisch gekälkt – und sprach zuerst freundlich, dann besorgt, zwei Sätze ärgerlich, gleich wieder vertraulich mit jemandem, der nicht auf der anderen Seite des Zaunes stand, der nicht in gefetteten und gleichwohl knarrenden Stiefeln vorbeiging, der keine Pluderhosen trug und dennoch Paul oder Paulchen genannt wurde und ihr, dem Lorchen Matern mit dem Wasserblick, etwas zurückgeben sollte, das er ihr genommen hatte. Aber Paul gab nicht zurück, obgleich die Stunde günstig – viel Stille, allenfalls Gesumm – und der Wind mit einer Geschwindigkeit von acht Metern pro Sekunde die rechte Schuhgröße hatte, die Mühle auf dem Bock dergestalt zu treten, daß sie eine Spur schneller ging als der Wind und in einem einzigen Mahlgang Miehlkes Weizen – der ließ gerade mahlen – zu Miehlkes Weizenmehl beuteln konnte.
Denn wenn auch ein Müllerssohn in Steegens hölzernem Kapellchen getauft wurde, stand dennoch Materns Mühle nicht still. Wenn Mahlwind war, mußte gemahlen werden. Eine Windmühle kennt nur Tage mit und Tage ohne Mahlwind. Lorchen Matern kannte nur Tage, an denen Paulchen vorbeiging und am Zaun stand, und Tage, da nichts vorbeiging, niemand am Zaun stand. Weil die Mühle mahlte, ging Paulchen vorbei und blieb stehen. Perkun blaffte. Fern hinter Napoleons Pappeln, hinter Folcherts, Miehlkes, Kabruns, Beisters, Momberts und Kriewes Gehöften, hinter der flachen Schule und Lührmanns Krug und Milchzentrale, lösten die Stimmen der Kühe einander ab. Da sagte Lorchen freundlich »Paulchen«, mehrmals »Paulchen«, sagte, während die Gans im Ofen unbegossen, nichtbesprochen und niegewendet immer röscher und sonntäglicher wurde: »Nu jibb mech daas wedder zurick. Ond nu sai doch nech so. Ond nu hab dech nech so. Ond nu jibb mech daas wedder zurick, wo echess breucht neetich. Ond nu jibb, ond nu sai nech, ond mechst mä nech jeben…«
Niemand erstattete etwas. Der Hund Perkun drehte den Kopf auf dem Hals und sah dem Davongehenden leise kujiehnend nach. Unter den Kühen nahm die Milch zu. Die Windmühle saß mit dem Stert auf dem Bock und mahlte. Sonnenblumen beteten einander Sonnenblumengebete vor. Die Luft summte. Und die Gans im Ofen begann zuerst langsam, dann so schnell und brenzlich anzubrennen, daß die Großmutter Matern in ihrer Hängestube über der Küche die Augäpfel schneller kreisen ließ, als es das Rutenzeug der Mühle vermochte. Während in Steegen das Taufkapellchen verlassen wurde, während die Schildkröte in der Hängestube handgroß von einer gescheuerten Diele zur nächsten wechselte, geriet sie jener bis in die Hängestube hinauf brenzlichen Gans wegen grell düster grell ins Blubbern Seibern und Schnauben. Zuerst stieß sie Haare, wie alle Großmütter sie in der Nase haben, durch Naslöcher aus, als aber bitterer Dunst die Stube grell durchzuckt ausmaß und die Schildkröte zaudern, die Salatblätter schrumpfen ließ, entfuhren ihr keine Naslochhaare mehr, sondern Dampf. Neunjähriger großmütterlicher Groll entlud sich: In Fahrt kam die großmütterliche Lokomotive. Vesuv und Ätna. Der Hölle bevorzugtes Element: Feuer ließ die entfesselte Großmutter zucken, trug drachengleich bei zum Grelldüster, und sie versuchte inmitten wechselnder Beleuchtung nach neun Jahren wiederum trockenes Zähneknirschen. Sie hatte Erfolg: Von links nach rechts, durchs Brenzliche stumpf gemacht, rieben sich die letzten ihr verbliebenen Stümpfe; und endlich mischte sich Krachen und Splittern ins Drachenschnauben, Dampfablassen, Feuerspeien, Zähneknirschen: Jener Eichenstuhl, den vornapoleonische Zeiten gefügt hatten, der die Großmutter neun Jahre lang, bis auf die kurzen Pausen der Reinlichkeit wegen, getragen hatte, gab sich auf und zerfiel im Moment, da es die Schildkröte von den Dielen her hoch und auf den Rücken warf. Gleichzeitig sprangen mehrere Kacheln des Ofens netzartig. Unten platzte die Gans und ließ ihre Füllung quellen. Zu pulvrigem Holzmehl, feiner als die Maternsche Bockwindmühle es mahlen konnte, zerfiel das Gestühl, stieg wolkig auf, wucherte als pomphaft belichtetes Denkmal der Vergänglichkeit und verhüllte die Großmutter Matern, die nicht etwa mit dem Stuhl mitgemacht hatte und zu großmütterlichem Staub geworden war. Was da auf schrumpligen Salatblättern, auf der rücklings liegenden Schildkröte, auf Möbeln und Dielen ablagerte, war nur Staub des Eichenholzes; sie, die Schreckliche, lagerte nicht ab, stand knisternd und elektrisch, dabei grelldüster vom Wechselspiel der Windmühlenflügel getroffen, aufrecht inmitten Staub und Moder, knirschte von links nach rechts, machte aus dem Knirschen heraus den ersten Schritt: schritt aus Grellem ins Düstere, schritt grell, schritt düster, überschritt die beinahe mit sich fertige Schildkröte, deren Bauch schwefelgelb und schön war, machte nach neunjährigem Stillsitzen zielbewußt Schritte, glitt nicht auf Salatblättern aus, trat die Tür der Hängestube auf, stieg, ein Ausbund von Großmutter, in Filzschuhen die Stiege zur Küche hinab, war, nun auf Fliesen und Sägespänen, mit zwei Händen in einem Regal und versuchte mit großmütterlichen Kochtricks die bitterlich anbrennende Taufgans zu retten. Und sie rettete auch ein wenig, indem sie das Versengte kratzte und löschte und die Gans umbettete. Doch jedermann in Nickelswalde, der ein Ohr hatte, hörte die Großmutter, während sie rettete, wild und aus ausgeruhter Kehle schrecklich deutlich schreien: »Luder, du Luder! Wo best denn, du Luder! Lorrchen, du Luder. Ech wärd dir, du Luder. Vädammichtes Luder! Luder, du Luder!«
Da war sie schon mit harthölzernem Kochlöffel aus brenzlicher Küche heraus, mitten im summenden Garten, und hatte die Mühle im Rücken. Links trat sie in die Erdbeeren, rechts in den Blumenkohl, blieb nicht in den Stachelbeeren hängen, war seit Jahren erstmals wieder zwischen den Saubohnen, dann aber gleich hinter und zwischen den Sonnenblumen und hieb, rechts hochgeschwungen und vom regelmäßigen Rutenzeug der Bockwindmühle in jeder Bewegung unterstützt, auf das arme Lorchen ein, auch auf die Sonnenblumen, nicht auf Perkun, der schwarz zwischen Saubohnenspalieren davonsprang.
Trotz der Schläge und obgleich ganz und gar ohne Paulchen, wimmerte das arme Lorchen in seine Richtung: »Nu hälf mä doch Paulchen, ond nu hälf mä doch Paulchen…«, aber es kamen ihr nur hölzerne Schläge zu und das Lied der entfesselten Großmutter: »Luder, du Luder du! Vädammichtes Luder du!«
Siebente Frühschicht
Brauksel fragt sich, ob er beim Auferstehungsfest der Großmutter Matern nicht zuviel höllischen Aufwand getrieben hat. Wäre es nicht Wunder genug gewesen, wenn die gute Frau schlicht und etwas steifbeinig aufgestanden und in die Küche gegangen wäre, die Gans zu retten? Mußte Dampf geschnaubt, Feuer gespien werden? Mußten Ofenkacheln springen und Salatblätter schrumpfen? Bedurfte es der sterbenden Schildkröte und des zu Staub zerfallenen Lehnstuhles?
Wenn Brauksel, heute ein nüchterner Mann der freien Marktwirtschaft, dennoch diese Fragen bejahen und auf Feuer und Dampf bestehen muß, wird er Gründe nennen müssen. Es gab und gibt nur einen Grund für das pomphafte Staffieren des großmütterlichen Auferstehungsfestes: Die Materns, besonders der zähneknirschende Zweig der Familie, vom mittelalterlichen Räuber Materna über die Großmutter, die eine echte Matern war – sie hatte ihren Cousin geheiratet –, bis zum Täufling Walter Matern, hatten den angeborenen Sinn für große, ja opernhafte Auftritte; und in Tat und Wahrheit machte sich die Großmutter Matern im Mai des Jahres siebzehn nicht still und wie selbstverständlich auf den Weg und rettete die Gans, sondern brannte zuvor das oben beschriebene Feuerwerk ab.
Zudem muß gesagt werden: Während die Großmutter Matern die Gans zu retten versuchte und gleich darauf dem armen Lorchen mit dem Kochlöffel zusetzte, rollten von Steegen kommend, an Junkeracker, Pasewark vorbei, die drei Zweispänner mit der hungrigen Taufgesellschaft. Und wie es Brauxel auch jucken mag, von dem nun folgenden Taufessen zu berichten – man holte, weil die Gans nicht genug hergab, Weißsauer und Gepökeltes aus dem Keller –, er muß dennoch die Taufgesellschaft ohne Zeugen zu Tische sitzen lassen. Niemand wird jemals erfahren, wie sich Romeikes und Kabruns, wie sich Miehlke und die Witwe Stange mit brenzlicher Gans, Weißsauer, Gepökeltem und Kürbis in Essig mitten im dritten Kriegsjahr vollschlugen. Besonders um den großen Auftritt der entfesselten, neu behenden Großmutter Matern tut es Brauxel leid; einzig die Witwe Amsel darf er aus dörflichem Idyll lösen, denn sie ist die Mutter unseres dicklichen Eduard Amsel, der während der ersten bis vierten Frühschicht Bohnenstangen, Dachlatten und bleischwere Klamotten aus der hochgehenden Weichsel fischte und jetzt, gleich Walter Matern, im Nachtrag getauft werden soll.
Achte Frühschicht
Vor vielen vielen Jahren – denn nichts erzählt sich Brauksel lieber als Märchen – lebte in Schiewenhorst, einem Fischerdorf links der Weichselmündung, der Händler Albrecht Amsel. Petroleum, Segeltuch, Frischwasserkanister, Tauwerk, Netze, Aalkästen, Reusen, jegliches Angelgerät, Teer, Farbe, Glaspapier, Garn, Öltuch, Pech und Talg verkaufte er, führte aber auch Werkzeug, vom Beil bis zum Taschenmesser, hatte kleine Hobelbänke, Schleifsteine, Fahrradschläuche, Karbidlampen, Flaschenzüge, Winden und Zwingen auf Lager. Schiffszwieback stapelte sich vor Korkwesten; ein Rettungsring, der nur noch beschriftet werden mußte, umschloß das große Glas mit den Malzbonbons; ein Kornschnaps, »Brotchen« genannt, wurde aus beleibter grünglasiger Korbflasche abgefüllt; Stoffe als Meterware, Stoffreste, aber auch neue wie getragene Kleider bot er an, dazu Kleiderbügel, gebrauchte Nähmaschinen und Mottenkugeln. Und trotz der Kugeln, trotz Pech und Petroleum, Schellack und Karbid roch es in Albrecht Amsels Laden, einem geräumigen Holzbau auf Betonfundament, der alle sieben Jahre dunkelgrün gestrichen wurde, zuerst und vordringlich nach Kölnisch Wasser und dann erst, noch ehe von Mottenkugeln die Rede sein konnte, nach geräucherten Fischen; denn Albrecht Amsel galt, neben all dem Kleinhandel, als Großeinkäufer der Flußfische wie der Seefische: Kisten aus leichtestem Kiefernholz, goldgelb und gedrängt voll mit Räucherflundern, Räucheraalen, lose und bundweis’ Sprotten, Neunaugen, Dorschrogen und streng wie lieblich geräuchertem Weichsellachs, zeigten an den Stirnbrettern eingebrannt den Namen der Firma A. Amsel – Frische Fische – Räucherfische – Schiewenhorst – Großes Werder – und wurden in der Danziger Markthalle, die zwischen Lawendelgasse und Junkergasse, zwischen der Dominikanerkirche und dem Altstädtischen Graben aus Backsteinen bestand, mit mittleren Stemmeisen aufgebrochen: Trocken knallte das Deckelholz. Quietschend entzogen sich Nägel den Seitenbrettchen. Und aus neugotischen Spitzbogenfenstern fiel Markthallenlicht auf frischgeräucherte Fische.
Obendrein und als weitplanender Händler, dem die Zukunft der Fischräuchereien im Weichseldelta und längs der Nehrung am Herzen lag, beschäftigte Albrecht Amsel einen Kaminmaurer, der von Plehnendorf bis Einlage, also in allen Dörfern entlang der Toten Weichsel, denen die Räuchereikamine ein ruinenhaft bizarres Aussehen gaben, Arbeit genug fand: Da galt es einem Kamin, der schlecht zog, beizukommen; da mußte einer jener mächtigen Räucherkamine, die alle Fliederbüsche und geduckten Fischerhäuser überragten, neu errichtet werden; das alles im Namen Albrecht Amsels, der, nicht ohne Grund, reich genannt wurde. Der reiche Amsel, sagte man – oder: »Der Jud Amsel.« Natürlich war Amsel kein Jude. Wenn er auch kein Mennonit war, nannte er sich doch gutevangelisch, hatte in der Fischerkirche zu Bohnsack einen festen, Sonntag für Sonntag besetzten Platz und heiratete Lottchen Tiede, eine rotblonde, zur Fülle neigende Bauerntochter aus Groß-Zünder; was besagen soll: Wie konnte Albrecht Amsel ein Jude sein, wenn ihm der Großbauer Tiede, der nur vierspännig und in Lackstiefeln von Groß-Zünder nach Käsemark fuhr, der beim Landrat ein und aus ging, der seine Söhne bei der Kavallerie, genauer gesagt, bei den ziemlich teuren Langfuhrer Husaren dienen ließ, dennoch seine Tochter Lottchen zur Frau gab.
Später sollen viele gesagt haben, der alte Tiede habe dem Juden Amsel sein Lottchen nur gegeben, weil er, wie viele Bauern, Händler, Fischer, Müller – so auch der Müller Matern aus Nickelswalde –, beim Albrecht Amsel hoch, für den Fortbestand seines Vierspänners gefährlich hoch in der Kreide gestanden habe. Zudem, sagte man, um etwas beweisen zu wollen, habe Albrecht Amsel, der Provinzial-Marktregulierungskommission gegenüber, die übermäßige Förderung der Schweinezucht eindeutig abgelehnt.
Brauksel, der alles besser weiß, zieht unter allen Vermutungen einen vorläufigen Schlußstrich: Denn ob ihm nun Liebe oder Wechselschulden das Lottchen Tiede ins Haus führten; ob er als getaufter Jude oder getaufter Christ sonntags in der Fischerkirche zu Bohnsack saß; Albrecht Amsel, der rührige Händler vom Weichselufer, ein, nebenbei gesagt, breitschultriger Mitbegründer des Turnvereines Bohnsack 05 e.V. und stimmstarker Bariton im Kirchenchor, brachte es an den Ufern der Flüsse Somme und Marne zum mehrfach dekorierten Reserveleutnant und fiel im Jahre siebzehn, knappe zwei Monate vor der Geburt seines Sohnes Eduard, nahe der Festung Verdun.
Neunte Frühschicht
Walter Matern erblickte im April, vom Widder gestoßen, das Licht dieser Welt. Die Fische des Monats März zogen beweglich und begabt Eduard Amsel aus Mutters Höhle. Im Mai, als die Gans anbrannte und die Großmutter Matern aufstand, wurde der Müllerssohn getauft. Dabei ging es katholisch zu. Schon Ende April wurde der Sohn des toten Händlers Albrecht Amsel in der Fischerkirche zu Bohnsack gutevangelisch und, wie es dort Sitte war, zur Hälfte mit Weichselwasser zur anderen Hälfte mit Ostseewasser besprenkelt.
Was immer die anderen Chronisten, die mit Brauksel seit neun Frühschichten um die Wette schreiben, abweichend von Brauksels Meinung berichten werden, in Sachen des Täuflings aus Schiewenhorst werden sie mir beipflichten müssen: Eduard Amsel oder Eddi Amsel, Haseloff, Goldmäulchen und so weiter ist unter allen Personen, die diese Festschrift – Brauchsels Bergwerk fördert seit bald zehn Jahren weder Kohle, Erz noch Kali – beleben sollen, der beweglichste Held, Brauxel ausgenommen.
Sein Beruf lag von Anfang an im Erfinden von Vogelscheuchen. Dennoch hatte er nichts gegen Vögel; wohl aber hatten die Vögel, gleich welcher Flug- und Federart sie sein mochten, etwas gegen ihn und seinen vogelscheuchenerfindenden Geist. Gleich nach der Taufe – die Glocken waren noch nicht fertig – erkannten sie ihn. Eduard Amsel jedoch lag prall unter straffem Taufkissen und gab nicht zu erkennen, ob Vögel ihm etwas bedeuteten. Die Taufpatin hieß Gertrud Karweise und strickte ihm später Jahr für Jahr Wollsocken, pünktlich zu Weihnachten. Auf ihren kräftigen Armen wurde der Täufling der vielköpfigen, auf ein endloses Taufessen eingeladenen Taufgesellschaft vorangetragen. Die Witwe Amsel, geborene Tiede, war zu Hause geblieben, überwachte das Tischdecken, gab in der Küche letzte Anweisungen und schmeckte die Soßen ab. Aber alle Tiedes aus Groß-Zünder, außer den vier Söhnen, die bei der Kavallerie gefährlich lebten – später fiel der Zweitjüngste –, stapften in gutem Tuch hinter dem Taufkissen. Es ging der Toten Weichsel entlang: die Schiewenhorster Fischer Christian Glomme und Frau Martha Glomme, geborene Liedke; Herbert Kienast und seine Frau Johanna, geborene Probst; Carl Jakob Ayke, dessen Sohn Daniel Ayke auf der Doggerbank, im Dienste der kaiserlichen Marine, zu Tode gekommen war; die Fischerwitwe Brigitte Kabus, deren Kutter ihr Bruder Jakob Nilenz führte; zwischen Ernst Wilhelm Tiedes Schwiegertöchtern, die städtisch in rosa, lindgrün und veilchenblau stöckelten, schwarzblankgebürstet: der alte Pastor Blech – ein Nachfahr jenes berühmten Diakons A.F. Blech, der als Pfarrer zu St.Marien die Chronik der Stadt Danzig von achtzehnhundertsieben bis achtzehnhundertvierzehn, also während der Franzosenzeit, geschrieben hatte. Großräuchereibesitzer Friedrich Bollhagen aus Westlich-Neufähr ging neben dem pensionierten Kapitän Bronsard, der während der Kriegszeit als freiwilliger Schleusenwärter zu Plehnendorf eine Aufgabe gefunden hatte. August Sponagel, den Gastwirt zu Wesslinken, überragte die Majorin von Ankum um Kopfeslänge. Da es Dirk Heinrich von Ankum, Gutsbesitzer zu Klein-Zünder, seit Anfang fünfzehn nicht mehr gab, hielt Sponagel die Majorin am starr rechtwinklig gebotenen Arm. Den Schluß, hinter dem Ehepaar Busenitz, das in Bohnsack eine Kohlenhandlung betrieb, machte der invalide Schiewenhorster Dorfschulze Erich Lau mit seiner hochschwangeren Margarete Lau, die als Tochter des Nickelswaldener Dorfschulzen Momber nicht unter ihre Verhältnisse geheiratet hatte. Der Deichinspektor Haberland hatte sich, weil er streng im Dienst war, schon vor dem Kirchenportal verabschieden müssen. Mag sein, daß noch ein Schock Kinder, alle zu blond und in zu feierlichen Kleidern, den Zug verlängerte.
Über Sandwege, die nur schütter die kriechenden Wurzeln der Strandkiefern bedeckten, ging es am rechten Ufer des Flusses entlang zu den wartenden Zweispännern, zu dem Vierspänner des alten Tiede, den jener sich trotz Kriegszeit und Pferdemangel zu halten wußte. Sand in den Schuhen. Kapitän Bronsard lachte atemlos laut, hustete dann lange. Gespräche wollten erst nach dem Taufessen geführt werden. Der Strandwald roch preußisch. Kaum floß der Fluß, ein toter Arm der Weichsel, der erst weiter unterhalb, durch den Zufluß der Mottlau einigen Antrieb erhielt. Die Sonne schien vorsichtig auf Feiertagskleider. Tiedes Schwiegertöchter fröstelten rosa lindgrün veilchenblau und hätten gerne die Umhängetücher der Witwen gehabt. Mag sein, daß das viele Witwenschwarz, die riesenhafte Majorin und der monumental schwankende Gang des Invaliden ein Ereignis förderten, das sich von Anfang an vorbereitet hatte: Kaum aus der Bohnsacker Fischerkirche heraus, wölken auf dem Kirchplatz die sonst kaum zu rührenden Möwen auf. Keine Tauben, denn Fischerkirchen halten sich Möwen und keine Tauben. Jetzt steigen schräg und steil aus Uferschilf und Entenflott: Dommeln, Seeschwalben, Krickenten. Weg sind alle Haubentaucher. Aus den Kiefern des Strandwaldes hebt es die Krähen. Stare und Amseln geben den Friedhof und die Gärten vor weißgekälkten Fischerhäusern auf. Aus Flieder und Rotdorn: die Stelzen, die Meisen, die Kehlchen, Finken und Drosseln, was alles im Lied vorkommt; wolkenweis Sperlinge aus Rinnen, von Drähten; Schwalben aus Stallungen und Mauerfugen; was der Familie der Vögel zugerechnet wird, bricht auf, zerstiebt, sirrt pfeilschnell, sobald das Taufkissen leuchtet, läßt sich vom Seewind über den Fluß tragen, bildet eine schwarze, entsetzt hin und her gerissene Wolke, in der sich Vögel, die sonst einander meiden, wahllos treffen, vom gleichen Schrecken gehetzt: Möwen und Krähen; das Habichtpärchen inmitten gescheckter Singvögel; die Elster die Elster!
Und fünfhundert Vögel, die Sperlinge nicht gerechnet, flüchten sich als Masse zwischen die Sonne und die Taufgesellschaft. Und fünfhundert Vögel werfen auf die Taufgäste, das Taufkissen und den Täufling einen Schatten, bedeutungsvoll.
Und fünfhundert Vögel – wer will Spatzen zählen? – bewirken, daß die Taufgäste, vom invaliden Dorfschulzen Lau bis zu den Tiedes, zusammenrücken und zuerst schweigend, dann murmelnd und unter starrem Blickewerfen, von hinten nach vorn drängen und dem schnellen, dem hastigen Schritt verfallen. August Sponagel stolpert über Kiefernwurzeln. Zwischen Kapitän Bronsard und Pastor Blech, der nur andeutungsweise die Arme hebt und ein berufsmäßiges Beschwichtigen versucht, stürmt, die Röcke wie beim Platzregen gerafft, die riesige Majorin voran und reißt alle mit: die Glommes und Kienast mit Frau, den Ayke und die Kabus, Bollhagen und das Ehepaar Busenitz; selbst der invalide Lau und sein hochschwangeres Weib, das später nicht etwa schreckhaft, das mit normalem Mädchen niederkommen soll, halten schweratmend Schritt – und nur die Patin mit den starken Armen fällt zurück und erreicht mit Täufling und verrutschtem Taufkissen als letzte die wartenden Zweispänner und den Vierspänner der Tiedes zwischen den ersten Pappeln der Landstraße nach Schiewenhorst.
Schrie der Täufling? Er greinte nicht, schlief aber auch nicht. Löste sich die Wolke aus fünfhundert Vögeln und ungezählten Sperlingen nach dem hastigen und gar nicht festlichen Davonrollen der Wagen sogleich auf? Noch lange fand die Wolke über dem trägen Fluß keine Ruhe: Mal stand sie über Bohnsack, mal spitz überm Strandwald und den Dünen, dann breit und fließend über dem anderen Ufer, und ließ eine Krähe auf eine Sumpfwiese fallen: Dort hob sie sich grau und starr ab. Erst als Zweispänner und Vierspänner in Schiewenhorst einfuhren, zerfiel die Wolke in Vogelarten, fand zum Kirchplatz, Friedhof, in die Gärten, Stallungen, ins Schilf, Fliedergebüsch, in die Kiefern zurück; aber bis zum Abend, als die Taufgesellschaft schon satt und trunken mit Ellenbogen den langen Tisch belastete, blieb die Unruhe in vielen verschieden großen Vogelherzen lebendig; denn Eduard Amsels vogelscheuchenerfindender Geist hatte sich, da er noch im Taufkissen lag, allen Vögeln mitgeteilt. Fortan wußten sie um ihn.
Zehnte Frühschicht
Wer will wissen, ob der Händler und Reserveleutnant Albrecht Amsel vielleicht doch Jude gewesen war? Ganz ohne Grund werden die Leute in Schiewenhorst, Einlage und Neufähr ihn nicht einen reichen Juden genannt haben. Und der Name? Ist der nicht typisch? Was? Aus dem Holländischen soll sich der Vogel herleiten, weil im frühen Mittelalter holländische Siedler die Weichselniederung entwässerten, sprachliche Eigentümlichkeiten, Windmühlen und ihre Namen mitbrachten?
Nachdem Brauksel während abgebuchter Frühschichten mehrmals beteuert hat, A. Amsel sei kein Jude gewesen, wörtlich sagte: »Natürlich war Amsel kein Jude«, kann er jetzt, mit gleichem Recht – denn beliebig ist alle Herkunft – überzeugen wollen: Natürlich war Albrecht Amsel ein Jude. Einer alteingesessenen jüdischen Schneiderfamilie aus Preußisch-Stargard entstammte er, hatte früh, schon als Sechzehnjähriger, Preußisch-Stargard in Richtung Schneidemühl, Frankfurt an der Oder, Berlin verlassen müssen – denn das Haus seines Vaters war voller Kinder – und kam vierzehn Jahre später – gewandelt rechtgläubig wohlhabend – über Schneidemühl, Neustadt, Dirschau an die Weichselmündung. Jener Durchstich, der Schiewenhorst zu einem Dorf am Fluß gemacht hatte, war, als Albrecht Amsel sich günstig einkaufte, noch kein Jahr alt.
Also begann er seinen Handel. Was hätte er sonst beginnen sollen? Also sang er im Kirchenchor. Warum hätte er als Bariton nicht im Kirchenchor singen sollen? Also gründete er mit anderen einen Turnverein und war unter allen Dorfbewohnern derjenige, der am festesten glaubte, er, Albrecht Amsel, sei kein Jude, der Name Amsel komme aus dem Holländischen: viele Leute heißen Specht, und ein berühmter Afrikapionier hieß sogar Nachtigall, nur Adler ist ein typisch jüdischer Name, niemals Amsel: der Schneiderssohn hatte sich vierzehn Jahre lang mit dem Vergessen seiner Herkunft und nur nebenbei aber genauso erfolgreich mit dem Zusammentragen eines gutevangelischen Vermögens beschäftigt.
Da schrieb im Jahre neunzehnhundertdrei ein junger altkluger Mann namens Otto Weininger ein Buch. Dieses einmalige Buch hieß »Geschlecht und Charakter«, wurde in Wien und Leipzig verlegt und gab sich auf sechshundert Seiten Mühe, dem Weib die Seele abzusprechen. Weil sich dieses Thema, zur Zeit der Emanzipation, als aktuell erwies, besonders aber, weil das dreizehnte Kapitel des einmaligen Buches, unter der Überschrift »Das Judentum«, den Juden, als einer weiblichen Rasse zugehörig, gleichfalls die Seele absprach, erreichte die Neuerscheinung hohe, schwindelerregende Auflagen und gelangte in Haushalte, in denen sonst nur die Bibel gelesen wurde. So fand Weiningers Geniestreich auch in Albrecht Amsels Haus.
Vielleicht hätte der Händler das dicke Buch nicht aufgeschlagen, wenn er gewußt hätte, daß ein Herr Pfennig dabei war, den Otto Weininger einen Plagiator zu nennen: Denn schon im Jahre nullsechs erschien eine böse Broschüre, die den toten Weininger – der junge Mann hatte sich eigenhändig ein Ende gesetzt – und Weiningers Kollegen Swoboda grob beschuldigte. Selbst S. Freud, der den verstorbenen Weininger einen hochbegabten Jüngling genannt hatte, konnte, so sehr er den Tonfall der bösen Broschüre mißbilligte, an der verbrieften Tatsache nicht vorbei: Weiningers Zentralidee der Bisexualität war nicht original, sondern war zuerst einem Herrn Fließ eingefallen. – Unwissend also schlug Albrecht Amsel das Buch auf und las bei Weininger – der sich mittels einer Fußnote als zum Judentum gehörig betrachtete: Der Jude hat keine Seele. Der Jude singt nicht. Der Jude treibt keinen Sport. Der Jude muß das Judentum in sich überwinden… Und Albrecht Amsel überwand, indem er im Kirchenchor sang, indem er den Turnverein Bohnsack 05 e.V. nicht nur begründete, sondern sich entsprechend gekleidet in die Turnriege stellte, am Barren, am Reck mitturnte, hoch und weit sprang, den Stafettenwechsel übte und gegen Widerstände – hier abermals Gründer und Pionier – das Schlagballspiel, eine verhältnismäßig junge Sportart, links und rechts aller drei Weichselmündungen beheimatete.
Brauksel, der hier nach bestem Wissen die Feder führt, wüßte gleich den Dorfbewohnern des Werders nichts von dem Städtchen Preußisch-Stargard und Eduard Amsels schneiderndem Großvater, hätte Lottchen Amsel, geborene Tiede, Stille bewahrt. Viele Jahre nach dem tödlichen Tag vor Verdun machte sie ihren Mund auf.
Der junge Amsel, von dem hier fortan, wenn auch mit Pausen, die Rede sein wird, war aus der Stadt ans Sterbebett seiner Mutter geeilt, und sie, der Zuckerkrankheit verfallen, fieberte dem Sohn ins Ohr: »Och Jonkchen. Väzaih dain arme Modder. Dä Amsel, dem de nech kennst, waas abä laibhaftich dain Vadder waar jewesen, daas warren Beschnittner, wie man so secht. Wennse dir nur nech mechten äwischen, wose doch jätz so scharf sind midde Jesätze.«
Eduard Amsel erbte zur Zeit der scharfen Gesetze – die aber im Gebiet des Freistaates noch keine Anwendung fanden – das Geschäft und Vermögen, Haus und Inventar, so auch ein Regal Bücher: Preußens Könige – Preußens große Männer – Der Alte Fritz – Anekdoten – Graf Schlieffen – Der Choral von Leuthen – Friedrich und Katte – Die Barbarina – und Otto Weiningers einzigartiges Buch, das Amsel, während die anderen Bücher nach und nach verlorengingen, fortan mit sich trug. Er las auf seine Art darin, las auch die Randnotizen, die sein turnender singender Vater gemacht hatte, rettete das Buch über schlimme Zeiten hinweg und sorgte dafür, daß es auf Brauxels Schreibtisch heute und jederzeit aufgeschlagen werden kann: Weininger hat dem Federführenden schon manchen Einfall gepfropft. Die Vogelscheuche wird nach dem Bild des Menschen erschaffen.
Elfte Frühschicht
Brauchsels Haare wachsen nach. Während er schreibt oder dem Bergwerk vorsteht, wachsen sie nach. Während er speist, geht, schlummert, atmet oder die Luft anhält, während die Frühschicht einfährt, die Nachtschicht ausfährt und Sperlinge den Tag beginnen, wachsen sie. Ja, während der Friseur mit kalten Fingern Brauksels Haare, weil das Jahr zu Ende geht, wunschgemäß kürzt, wachsen sie ihm unter der Schere nach. Einst wird Brauksel, wie Weininger, tot sein, aber seine Haare, Fußnägel, Fingernägel werden ihn eine Weile überleben – wie dieses Handbuch über den Bau wirksamer Vogelscheuchen gelesen werden wird, wenn es den Federführenden schon lange nicht mehr gibt.
Von scharfen Gesetzen war gestern die Rede. Aber zur Zeit unserer gerade anhebenden Erzählung sind die Gesetze noch milde, bestrafen Amsels Herkunft überhaupt nicht; Lottchen Amsel, geborene Tiede, weiß nichts von der entsetzlichen Zuckerkrankheit; Albrecht Amsel war »natürlich« kein Jude; Eduard Amsel ist gleichfalls gutevangelisch, trägt das schnellwachsende rotblonde Haar seiner Mutter und treibt sich dicklich, bereits im Besitz aller Sommersprossen, zwischen trocknenden Fischernetzen herum und betrachtet die Umwelt mit Vorliebe durch Fischernetze: was Wunder, wenn ihm die Welt bald netzartig gemustert vorkommen will und mit Bohnenstangen verstellt.
Vogelscheuchen! Hier wird behauptet, der kleine Eduard Amsel habe anfangs – und als Fünfeinhalbjähriger etwa baute er seine erste nennenswerte Scheuche – nicht die Absicht gehabt, Vogelscheuchen zu bauen. Leute aus dem Dorf und durchreisende Vertreter, die mit Feuerversicherungen und Saatgutproben das Werder bereisten, Bauern, die vom Notar zurückkamen, alle die ihm zuschauten, wenn er auf dem Deich neben der Schiewenhorster Anlegebrücke seine Figuren flattern ließ, dachten aber in diese Richtung; und Kriwe sagte zu Herbert Kienast: »Liebärchen, nu kick dech ma an, waas dem Amsel sain Jong jemacht häd: laibhaftische Vogelschaichen.« Wie schon nach der Taufe hatte Eduard Amsel auch später nichts gegen die Vögel; aber alles, was sich rechts und links der Weichsel vogelleicht vom Wind tragen ließ, hatte etwas gegen seine Produkte, Vogelscheuchen genannt. Diese, und er baute täglich eine, glichen sich niemals. Was er gestern aus gestreiften Hosen, einem großkarierten jackenähnlichen Fetzen, einem krempenlosen Hut und mit Hilfe einer lückenhaften, dazu brüchigen Leiter und einem Arm frischer Weidenzweige in dreistündiger Arbeit gebaut hatte, riß er am folgenden Morgen nieder und baute aus den gleichen Requisiten ein Unikum anderen Geschlechtes, anderen Glaubens – in jedem Fall aber ein Gebilde, das den Vögeln Distanz befahl.
Wenn all diese vergänglichen Bauwerke immer wieder Fleiß und Anteil der Phantasie des Baumeisters verrieten, war es dennoch Eduard Amsels wacher Sinn für die vielgestaltete Realität, war es sein über feisten Wangen neugieriges Auge, das seine Produkte mit gutbeobachteten Details ausstattete, funktionieren ließ und zu vogelscheuchenden Produkten machte. Sie unterschieden sich von den landläufigen Vogelscheuchen, die rings in den Gärten und Feldern schwankten, nicht nur formal, sondern auch im Effekt: Wenn die x-beliebigen Scheuchen der Vogelwelt gegenüber nur geringe, kaum Achtungserfolge buchen konnten, wohnte seinen Geschöpfen, die ja zwecklos und gegen nichts gebaut waren, die Möglichkeit inne, Panik unter den Vögeln zu bewirken.