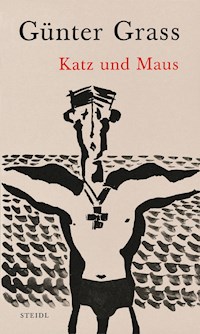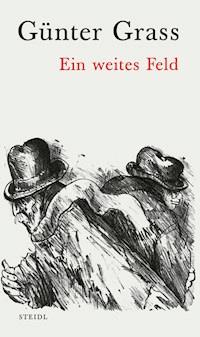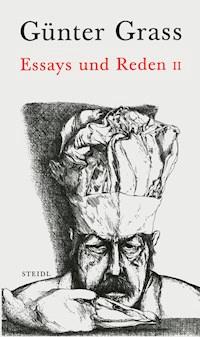Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Steidl
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Band erzählt zu jedem Jahr des 20. Jahrhunderts aus wechselnder Perspektive eine Geschichte – einhundert Erzählungen, die ein farbiges Porträt dieses an Großartigkeiten und Schrecknissen reichen Jahrhunderts ergeben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Günter Grass
1900
Ich, ausgetauscht gegen mich, bin Jahr für Jahr dabeigewesen. Nicht immer in vorderster Linie, denn da alleweil Krieg war, zog sich unsereins gerne in die Etappe zurück. Anfangs jedoch, als es gegen die Chinesen ging und unser Bataillon in Bremerhaven aufmarschierte, stand ich zuvorderst im mittleren Block. Freiwillig waren fast alle, aber aus Straubing hatte einzig ich mich gemeldet, obgleich seit kurzem mit Resi, meiner Therese, verlobt.
Wir hatten zwecks Einschiffung den Überseebau des Norddeutschen Lloyd im Rücken und die Sonne im Gesicht. Vor uns auf hohem Podest sprach der Kaiser recht forsch über uns weg. Gegen die Sonne schützten neue breitkrempige Hüte, Südwester genannt. Schmuck sah unsereins aus. Der Kaiser jedoch trug einen Spezialhelm, drauf der auf blauem Grund schimmernde Adler. Er sprach von großen Aufgaben, vom grausamen Feind. Seine Rede riß mit. Er sagte: »Kommt ihr an, so wißt: Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht…« Dann erzählte er vom König Etzel und dessen Hunnenhorden. Die Hunnen belobigte er, wenngleich sie recht grausig gehaust hätten. Weshalb die Sozis später freche Hunnenbriefe gedruckt und über des Kaisers Hunnenrede gottserbärmlich gelästert haben. Zum Schluß gab er uns Order für China: »Öffnet der Kultur den Weg ein für allemal!« Wir riefen ein dreimaliges Hurra.
Für mich, der aus dem Niederbayerischen kommt, verlief die lange Seereise saumäßig. Als wir endlich in Tientsin ankamen, waren alle schon da: Briten, Amerikaner, der Russe, sogar richtige Japaner und Trüppchen aus kleinen Ländern. Die Briten waren eigentlich Inder. Wir zählten anfangs nur wenige, verfügten aber zum Glück über die neuen 5-cm-Schnellfeuerkanonen von Krupp. Und die Amerikaner erprobten ihre Maxim-Maschinengewehre, ein wahres Teufelszeug. So war Peking schnell erstürmt. Denn als unsere Kompanie einmarschierte, schien alles vorbei zu sein, was bedauerlich war. Dennoch gaben einige Boxer keine Ruh. Die wurden so genannt, weil sie insgeheim eine Gesellschaft waren, die »Tatauhuei« oder in unserer Sprache »die mit der Faust Kämpfenden« heißt. Deshalb redete zuerst der Engländer, dann ein jeglicher vom Boxeraufstand. Die Boxer haßten Ausländer, weil diese den Chinesen allerlei Zeug, die Briten besonders gerne Opium verkauften. Und so kam es, wie der Kaiser befohlen hatte: Gefangene wurden nicht gemacht.
Der Ordnung halber hat man die Boxer auf dem Platz am Chienmentor, direkt vor der Mauer, welche die Mandschustadt vom gewöhnlichen Teil Pekings trennt, zusammengetrieben. Ihre Zöpfe waren aneinandergebunden, was komisch aussah. Dann wurden sie in Gruppen erschossen oder einzeln geköpft. Doch über das Grausige hab ich meiner Verlobten kein Sterbenswörtchen geschrieben, nur über hundertjährige Eier und Dampfknödeln auf chinesische Art. Die Briten und wir Deutsche machten am liebsten mit dem Gewehr kurzen Prozeß, während der Japaner beim Enthaupten seiner altehrwürdigen Tradition folgte. Aber die Boxer zogen es vor, erschossen zu werden, weil sie Furcht hatten, alsbald mit dem Kopf unterm Arm in der Hölle herumlaufen zu müssen. Sonst hatten sie keine Angst. Ich sah jemand, der noch gierig, bevor er erschossen wurde, einen in Sirup getunkten Reiskuchen aß.
Auf dem Platz Chienmen wehte ein Wind, welcher von der Wüste kam und immerfort gelbe Staubwolken aufwirbelte. Alles war gelb, auch wir. Das habe ich meiner Verlobten geschrieben und ihr ein wenig Wüstensand in den Brief getan. Weil aber die japanischen Scharfrichter den Boxern, die ganz junge Burschen waren wie wir, den Nackenzopf abschnitten, um zu einem sauberen Hieb zu kommen, lagen auf dem Platz oft Häuflein abgeschnittener Chinesenzöpfe im Staub. Einen hab ich mitgenommen und als Andenken nach Hause geschickt. Zurück in der Heimat trug ich ihn dann zur allgemeinen Gaudi beim Fasching, bis meine Verlobte das Mitbringsel verbrannt hat. »Sowas bringt Spuk ins Haus«, sagte Resi zwei Tage vor unserer Hochzeit.
1901
Wer sucht, der findet. Ich habe schon immer im Trödel gekramt. Am Chamissoplatz, und zwar bei einem Händler, der mit schwarzweißem Ladenschild Antiquitäten versprach, doch zwischen dessen Ramsch sich wertvolle Stücke nur tief verborgen fanden, wohl aber Kuriositäten meine Neugierde weckten, entdeckte ich gegen Ende der fünfziger Jahre drei mit einem Bindfaden verschnürte Ansichtskarten, deren Motive als Moschee, Grabkirche und Klagemauer matt schimmerten. Im Januar fünfundvierzig in Jerusalem gestempelt, waren sie an einen gewissen Doktor Benn mit Adresse in Berlin gerichtet, doch war es der Post während der letzten Kriegsmonate nicht gelungen, den Adressaten – was ein Stempel beglaubigte – zwischen den Trümmern der Stadt ausfindig zu machen. Ein Glück, daß ihnen Kurtchen Mühlenhaupts Fundgrube im Bezirk Kreuzberg Zuflucht gewährt hatte.
Der von Strichmännchen und Kometenschweifen durchwebte Text, fortlaufend über alle drei Karten, war nur mühsam zu entziffern und las sich so: »Wie doch die Zeit kopfsteht! Heute, am allerersten März, da das grad erblühte Jahrhundert steifbeinig mit einer Eins prangt und Du, mein Barbar und Tiger, in fernen Dschungeln gierig nach Fleisch bist, nahm mich mein Vater Schüler bei seiner Eulenspiegelhand, um mit mir und meinem gläsernen Herzen die Schwebebahn von Barmen nach Elberfeld zur jungfräulichen Fahrt zu besteigen. Über die schwarze Wupper hinweg! Ein stahlharter Drachen ist es, der tausendfüßig sich windet und wendet über dem Fluß, den die bibelfrommen Färber gegen wenig Lohn mit den Abwässern ihrer Tinten schwärzen. Und immerfort fliegt mit tosendem Getön das Bahnschiff durch die Lüfte, während auf schweren Ringfüßen der Drache schreitet. Ach, könntest doch Du, mein Giselher, an dessen süßem Mund ich soviel Seligkeiten durchbebte, mit mir, Deiner Sulamit – oder soll ich Jussuf der Prinz sein? –, so über den Totenfluß Styx, der die andere Wupper ist, hinschweben, bis wir im Sturz verjüngt vereint verglühn. Aber nein, ich bin ja gerettet auf heiliger Erde und lebe ganz dem Messias versprochen, während Du verloren bleibst, mir abtrünnig geworden, hartgesichtiger Verräter, Barbar, der Du bist. Wehgeschrei! Siehst Du den schwarzen Schwan auf schwarzer Wupper? Hörst Du mein Lied, klagend gestimmt auf blauem Klavier? – Doch nun müssen wir aussteigen, sagt Vater Schüler zu seiner Else. Auf Erden war ich ihm zumeist ein folgsames Kind…«
Nun ist zwar bekannt, daß Else Schüler am Tag, als die erste, viereinhalb Kilometer lange Teilstrecke der Wuppertaler Schwebebahn festlich für den öffentlichen Verkehr freigegeben wurde, kein Kind, vielmehr gut dreißig Jahre alt, mit Berthold Lasker verheiratet und seit zwei Jahren Mutter eines Sohnes war, aber das Alter ist ihren Wünschen jederzeit gefügig gewesen, weshalb die drei Lebenszeichen aus Jerusalem, adressiert an Doktor Benn, frankiert und abgeschickt kurz vor ihrem Tod, ohnehin alles besser wußten.
Ich feilschte nicht lange, zahlte für die wiederum verschnürten Karten einen Liebhaberpreis, und Kurtchen Mühlenhaupt, dessen Trödel schon immer besonders war, zwinkerte mir zu.
1902
So etwas wurde in Lübeck zum kleinen Ereignis, als sich der Gymnasiast in mir eigens für Promenaden zum Mühlentor oder den Ufern der Trave entlang seinen ersten Strohhut kaufte. Keinen weichen Filz, keine Melone, einen flachen, butterblumengelb prahlenden Strohhut, der, neuerdings in Mode, entweder vornehm »Canotier« oder volkstümlich »Kreissäge« genannt wurde. Auch Damen trugen bändergeschmückte Strohhüte, schnürten sich aber gleichwohl und noch lange ins fischbeingestützte Korsett; nur wenige wagten es, sich etwa vorm Katharineum, uns Primaner zum Spotte reizend, im luftdurchlässigen Reformkleid zu zeigen.
Damals war vieles neu. Zum Beispiel brachte die Reichspost reichseinheitliche Briefmarken in Umlauf, drauf die Germania metallbusig im Profil. Und weil allerorts Fortschritt verkündet wurde, zeigten sich viele Strohhutträger neugierig auf die kommende Zeit. Meiner hat manches erlebt. Ich schob ihn in den Nacken, als ich den ersten Zeppelin bestaunte. Im Café Niederegger legte ich ihn zu den druckfrischen und den Bürgersinn heftig aufreizenden »Buddenbrooks«. Dann führte ich ihn als Student durch Hagenbecks Tierpark, der jüngst eröffnet worden war, und sah, so uniform behütet, Affen und Kamele im Freigehege, wie mich hochmütig Kamele und Affen begehrlich mit Strohhut sahen.
Vertauscht auf dem Paukboden, vergessen im Alsterpavillon. Einige litten wiederholt unter Prüfungsschweiß. Mal um Mal war ein neuer Strohhut fällig, den ich schwungvoll oder nur lässig vor Damen zog. Bald schob ich ihn mir seitlich schräg zurecht, wie ihn Buster Keaton im Stummfilm trug, nur daß mich nichts todtraurig stimmte, sondern jeglicher Anlaß zum Lachen brachte, so daß mir in Göttingen, wo ich nach zweitem Examen als Brillenträger die Universität verließ, eher Harold Lloyd glich, der in späteren Jahren turmhoch zappelnd mit Strohhut und filmgerecht komisch am Uhrzeiger hing.
Wieder in Hamburg war ich einer der vielen Strohhutmänner, die sich bei der Einweihung des Elbtunnels drängten. Vom Handelskontor zur Speicherstadt, vom Gericht zur Anwaltskanzlei eilten wir mit unseren Kreissägen und schwenkten sie, als der Welt größtes Schiff, der Nordatlantik-Schnelldampfer »Imperator«, zur Jungfernfahrt den Hafen verließ.
Oft genug fand sich Gelegenheit zum Hüteschwenken. Und dann, als ich mich mit einer Pfarrerstochter am Arm, die später einen Tierarzt ehelichte, am Elbufer bei Blankenese erging – weiß nicht mehr, ob im Frühling oder Herbst –, entführte ein Windstoß meinen leichtgewichtigen Kopfputz. Er rollte, segelte. Ich lief ihm nach, vergeblich. Ich sah ihn flußabwärts treiben, war untröstlich, sosehr Elisabeth, der zeitweilig meine Liebe galt, um mich bemüht blieb.
Erst als Referendar, dann als Assessor leistete ich mir Strohhüte besserer Qualität, solche mit Prägung der Hutmacherfirma im Schweißband. Sie blieben in Mode, bis vieltausend Strohhutmänner in Klein- und Großstädten – ich in Schwerin beim Kammergericht – um jeweils einen Gendarmen versammelt standen, der uns auf offener Straße und im Namen Seiner Majestät an einem Spätsommertag, vom Blatt lesend, den Kriegszustand verkündete. Da warfen viele ihre Kreissägen in die Luft, erlebten sich vom öden Zivilleben befreit und tauschten freiwillig – nicht wenige endgültig – ihre butterblumengelb leuchtenden Strohhüte gegen feldgraue Helme ein, Pickelhauben genannt.
1903
Auf Pfingsten begann kurz nach halb fünf das Finale. Wir Leipziger hatten den Nachtzug genommen: unsere Elf, drei Ersatzspieler, der Mannschaftstrainer, zwei Herren vom Vorstand. Von wegen Schlafwagen! Klar, daß alle, auch ich, dritter Klasse fuhren, hatten wir doch die Penunzen für die Fahrt mühsam zusammenkratzen müssen. Unsere Jungs jedoch haben sich klaglos auf den harten Bänken langgelegt, und mir wurde bis kurz vor Uelzen ein wahres Schnarchkonzert geboten.
So liefen wir in Altona zwar ziemlich gerädert, aber dennoch frischgemut auf. Wie anderswo üblich, empfing uns auch hier ein ordinärer Exerzierplatz, den sogar ein kiesgestreuter Weg kreuzte. Da half kein Protest. Herr Behr, der Unparteiische vom Altonaer FC 93, hatte das sandige, aber sonst tadellos ebene Spielfeld bereits mit einem Tau umzäunt und die Strafräume sowie die Mittellinie eigenhändig mit Sägespänen markiert.
Daß unsere Gegner, die Jungs aus Prag, hatten anreisen dürfen, verdankten sie nur den schusseligen Herren vom Vorstand des Karlsruher FV, die auf einen üblen Trick reingefallen, an ein irreführendes Telegramm geglaubt und deshalb nicht mit ihrer Mannschaft zur Vorrunde nach Sachsen gereist waren. Also schickte der Deutsche Fußballbund kurzentschlossen den DFC Prag ins Endspiel. War übrigens das erste, das stattfand, und zwar bei schönstem Wetter, so daß Herr Behr von den rund zweitausend Zuschauern ein hübsches Sümmchen Eintrittsgeld abkassieren konnte, in eine Blechschüssel hinein. Dennoch reichten die knapp fünfhundert Mark nicht, alle Kosten zu decken.
Gleich zu Beginn eine Panne: vorm Anpfiff fehlte der Ball. Prompt protestierten die Prager. Doch die Zuschauer haben mehr gelacht als geschimpft. Entsprechend groß war der Jubel, als endlich das Leder auf der Mittellinie lag und unser Gegner mit Wind und Sonne im Rücken den Anstoß hatte. Waren auch bald vor unserem Tor, gaben von links eine Flanke rein, und nur knapp konnte Raydt, unser baumlanger Schlußmann, Leipzig vor einem frühen Rückstand retten. Nun hielten wir gegen, doch die Pässe von rechts kamen zu scharf. Dann aber gelang den Pragern aus dem Gedränge vor unserem Strafraum ein Goal, das wir erst nach einer Reihe heftiger Angriffe gegen Prag, das mit Pick einen zuverlässigen Torhüter hatte, vor der Halftime ausgleichen konnten.
Nach dem Seitenwechsel waren wir nicht mehr zu halten. In knapp fünf Minuten gelang es Stany und Riso dreimal einzusenden, nachdem Friedrich unseren zweiten Punkt und Stany noch vor dem Torsegen sein erstes Goal erzielt hatte. Zwar konnten die Prager nach einem Fehlpaß von uns noch einmal scoren, nun aber – wie gesagt – ging die Post ab, und der Jubel war groß. Selbst der tüchtige Mittelläufer Robitsek, der allerdings Stany schwer foulte, konnte unsere Männer nicht stoppen. Nachdem Herr Behr den unfairen Robi verwarnt hatte, holte Riso kurz vor Abpfiff den siebten Punkt.
Die Prager – vorher so hoch gelobt – enttäuschten ziemlich, besonders die Stürmerreihe. Zu viele Rückpässe, zu lasch im Strafraum. Später hieß es, Stany und Riso seien die Helden des Tages gewesen. Aber das stimmt nicht. Die ganze Elf kämpfte wie ein Mann, wenngleich Bruno Stanischewski, der bei uns nur Stany hieß, schon damals zu erkennen gab, was die Feldspieler polnischer Herkunft im Verlauf der Jahre für den deutschen Fußball geleistet haben. Da ich bei uns im Vorstand noch lange aktiv war, die letzten Jahre als Kassenwart, und häufig bei Auswärtsspielen dabeigewesen bin, auch noch Fritz Szepan und seinen Schwager Ernst Kuzorra, also den Schalker Kreisel, Schalkes große Triumphe erlebt habe, kann ich getrost sagen: Von der Altonaer Meisterschaft an ging es mit dem deutschen Fußball nur noch bergauf, nicht zuletzt dank der Spielfreude und Torgefährlichkeit eingedeutschter Polen.
Zurück nach Altona: Es war ein gutes, wenn auch kein großes Spiel. Aber schon damals, als der VfB Leipzig klar und unbestritten als deutscher Meister galt, war manch ein Journalist versucht, sein Süppchen in der Legendenküche zu wärmen. Jedenfalls hat sich das Gerücht, die Prager hätten in der Vornacht auf Sankt Paulis Reeperbahn mit Weibern rumgesumpft und wären deshalb, besonders in der zweiten Halbzeit, so flau im Angriff gewesen, als Ausrede erwiesen. Eigenhändig hat mir der Unparteiische, Herr Behr, geschrieben: »Die Besseren haben gesiegt!«
1904
»Bei uns in Herne ging datt schon kurz vor Weihnacht los…«
»Datt sin dem Hugo Stinnes seine Zechen…«
»Aber datt Wagennullen gibs auch woanners, beim Harpener Bergbau, wenn der ihre Wagen nich ganz voll sin oder bißken unreine Kohle zwischen…«
»Da gibs nochen Strafgeld drauf…«
»Gewiß, Herr Bergrat. Aber mit ein Grund für den Streik der ansonsten friedfertigen Bergleute mag wohl die im ganzen Revier verbreitete und von den Grubenverwaltungen verharmloste Wurmkrankheit sein, von der ein Fünftel aller Knappen…«
»Wenne mich frags, denn sin von datt Gewürm sogar die Grubenpferde befallen…«
»Ach watt, datt waren die Polacken, die datt Dingens eingeschleppt ham…«
»Aber streiken tun alle, auch die polnischen Bergleute, die ja, wie Sie wissen, Herr Bergrat, sonst leicht zu beruhigen sind…«
»Mit Schnaps!«
»Son Kappes! Am Saufen sin die hier alle…«
»Jedenfalls beruft sich die Streikleitung auf das Berliner Friedensprotokoll von neunundachtzig, also auf die achtstündige Normalschicht…«
»Gibts nirgendwo! Überall werden die Seilfahrten verlängert…«
»Bei uns in Herne sin wir an die zehn Stunden unter Tage…«
»Aber wenne mich frags, isset datt Wagennullen, datt inne lezze Zeit immer mehr am Zunehmen is…«
»Jetzt werden schon über sechzig Schächte bestreikt…«
»Außerdem gibs wieder mal schwarze Listen…«
»Und in Wesel steht das Infanterieregiment 57 auf Abruf schon und Gewehr bei Fuß…«
»Unsinn, Leute! Bisher sind im ganzen Revier nur Gendarmen im Einsatz…«
»Aber bei uns in Herne ham se Bergbeamte, wie Sie einer sind, als Zechenpolizei mit Armbinde und Schlagstock bewaffnet…«
»Pinkertons werden die genannt, weil nämlich der Amerikaner Pinkerton als erster auf diesen fiesen Dreh gekommen is…«
»Und weil nu überall Generalstreik is, is der Stinnes Hugo am Stillegen von seine Zechen…«
»Dafür is gezz in Rußland sowatt wiene Revluzzjon am Laufen…«
»Und in Berlin hat der Genosse Liebknecht…«
»Aber da is gleich Militär aufmarschiert un hat losgeballert…«
»Wie in Südwest, da räumen unsere Männer ruckzuck mit all die Hottentotten auf…«
»Jedenfalls werden jetzt im ganzen Revier über zweihundert Zechen bestreikt…«
»Hat man gerechnet, sind fünfundachtzig Prozent…«
»Läuft aber bisher ziemlich ruhig, geordnet, Herr Bergrat, weil selbst die Gewerkschaftsleitung…«
»Nich wie in Rußland, wo die Revluzzjon immer mehr am Zunehmen is…«
»Und deshalb, Genossen, wurde in Herne erstmals gegen Streikbrecher eingeschritten…«
»Weil Stinnes jedoch immer noch jede Einigung ablehnt, muß man befürchten…«
»Jetzt herrscht in Rußland Kriegszustand…«
»Aber unsere Jungs haben diese Hereros und ähnliche Hottentotten einfach inne Wüste gejagt…«
»Jedenfalls hat Liebknecht die Arbeiter in Petersburg und uns im Revier Helden des Proletariats genannt…«
»Doch mit den Japanern wird der Russe nicht so fix fertig…«
»Und bei uns in Herne ham se nu doch geschossen…«
»Aber nur inne Luft…«
»Jedenfalls sin alle am Laufen gewesen…«
»Vom Zechentor weg quer übern Vorplatz…«
»Nein, Herr Bergrat, kein Militär, Polizei nur…«
»Aber gelaufen sind wir trotzdem…«
1905
Schon mein Herr Vater war im Auftrag einer Bremer Reederei in Tanger, Casablanca und Marrakesch tätig, und zwar lange vor der ersten Marokkokrise. Ein immer besorgter Mann, dem die Politik, insbesondere der fernab regierende Kanzler Bülow, die Bilanzen trübte. Als seinem Sohn, der zwar unser Handelshaus leidlich neben der starken französischen und spanischen Konkurrenz über Wasser hielt, aber den Tagesgeschäften mit Safran und Feigen, Datteln und Kokosnüssen ohne wahre Leidenschaft nachging, deshalb das Kontor gerne mit dem Teehaus tauschte und auch sonst zu allerlei Kurzweil die Souks aufsuchte, war mir das ständige Krisengerede bei Tisch und im Club eher lächerlich. So habe ich denn auch des Kaisers spontane Visite beim Sultan aus Distanz und nur durchs ironische Monokel betrachtet, zumal es Abd Al Aziz verstand, selbst auf unangemeldeten Staatsbesuch mit bestaunenswertem Spektakel zu reagieren, den hohen Gast mit malerischer Leibgarde und englischen Agenten abzuschirmen und sich insgeheim dennoch Frankreichs Gunst und Schutz zu sichern.
Trotz der vielbelächelten Pannen bei der Landung – fast wäre die Barkasse samt Souverän gekentert – war des Kaisers Auftritt imposant. Auf einem geliehenen, sichtlich nervösen Schimmel ritt er, durchaus sattelfest, in Tanger ein. Sogar Jubel war zu haben. Spontan jedoch wurde insbesondere sein Helm bewundert, von dem mit der Sonne korrespondierende Lichtsignale ausgingen.
Später kursierten in den Teehäusern, aber auch im Club karikierende Zeichnungen, auf denen die adlergeschmückte Haube, bei Aussparung aller Gesichtszüge, mit dem majestätischen Schnurrbart lebhaft Zwiesprache hielt. Zudem verstand es der Zeichner – nein, nicht ich war der Übeltäter, sondern ein Künstler, den ich von Bremen her kannte und der mit dem Künstlervölkchen in Worpswede verkehrte –, Helm und Zwirbelbart dergestalt vor marokkanischer Kulisse zur Schau zu stellen, daß sich die Kuppeln der Moscheen und deren Minarette mit der Rundung der reichverzierten Haube und dem spitzen Pickel aufs Lebendigste in Einklang befanden.
Außer besorgten Depeschen brachte der demonstrative Auftritt nichts ein. Während Seine Majestät forsche Reden hielt, einigten sich Frankreich und England, was Ägypten und Marokko betraf. Mir war das Ganze ohnehin lachhaft. Und ähnlich lächerlich wirkte sechs Jahre später das Aufkreuzen unseres Kanonenbootes »Panther« vor Agadir. Gewiß, sowas brachte nachgrollenden Theaterdonner. Doch bleibenden Eindruck hat einzig des Kaisers im Sonnenglast blitzender Helm hinterlassen. Die hiesigen Kupferschmiede haben ihn fleißig nachgebildet und auf alle Märkte gebracht. Noch lange – jedenfalls länger, als unser Export-Import sich hielt – konnte man in den Souks von Tanger und Marrakesch die preußischen Pickelhauben en miniature und überlebensgroß als Souvenir, aber auch als nützlichen Spucknapf kaufen; mir ist bis auf den heutigen Tag solch eine Haube, die mit dem Pickel in einer Sandkiste steckt, von Nutzen.
Meinem Vater jedoch, dem nicht nur im Geschäftlichen ein immer das Schlimmste befürchtender Weitblick eigen war und der seinen Sohn gelegentlich und nicht ganz grundlos als »Bruder Leichtfuß« titulierte, konnten meine witzigsten Einfälle nicht den Lachmuskel stimulieren, vielmehr sah er zunehmend Anlaß, seinen besorgten Befund »Wir werden eingekreist, im Bund mit den Russen kreisen Briten und Franzosen uns ein« nicht nur bei Tisch zu äußern. Und manchmal beunruhigte er uns mit dem Nachsatz: »Zwar versteht es der Kaiser, mit dem Säbel zu rasseln, aber die wirkliche Politik machen andere.«
1906
Man nenne mich Kapitän Sirius. Mein Erfinder heißt Sir Arthur Conan Doyle, berühmt als Autor weltweit verbreiteter Sherlock-Holmes-Geschichten, in denen die Kriminalistik streng wissenschaftlich betrieben wird. Und wie nebenbei hat er versucht, das insulare England vor drohender Gefahr zu warnen, als – acht Jahre nachdem unser erstes seetüchtiges U-Boot zu Wasser gelassen war – eine Erzählung von ihm unter dem Titel »Danger!« veröffentlicht wurde, die im Kriegsjahr fünfzehn als »Der Tauchbootkrieg – wie Kapitän Sirius England niederzwang« in deutscher Übersetzung erschien, bis gegen Kriegsende achtzehn Auflagen erlebte, inzwischen jedoch leider vergessen zu sein scheint.
Diesem vorausblickenden Büchlein zufolge gelang es mir als Kapitän Sirius, den König von Norland, mit dem unser Reich gemeint war, von der gewagten, aber dennoch zu beweisenden Möglichkeit zu überzeugen, mit nur acht Unterseebooten – mehr hatten wir nicht – England von jeglicher Lebensmittelzufuhr abzuschneiden und regelrecht auszuhungern. Unsere Boote hießen: Alpha, Beta, Gamma, Theta, Delta, Epsilon, Jota und Kappa. Das zuletzt genannte Boot ging leider im Verlauf des insgesamt erfolgreichen Unternehmens im Englischen Kanal verloren. Ich war Kapitän der »Jota« und führte die gesamte Flottille an. Erste Erfolge konnten wir in der Themsemündung, nahe der Insel Sheerness, verbuchen: Kurz nacheinander versenkte ich mit Torpedotreffern mittschiffs die »Adela«, beladen mit Hammelfleisch aus Neuseeland, gleich darauf die »Moldavia« der Oriental-Gesellschaft, danach die »Cusco«, beide Schiffe mit Getreide beladen. Nach weiteren Erfolgen vor der Kanalküste und fleißigem Schiffeversenken bis in die Irische See hinein, wobei unsere gesamte Flottille in Rudeln oder bei Einzelaktionen beteiligt war, begannen zuerst in London, dann auf der ganzen Insel die Preise zu steigen: ein Fünfpence-Brotlaib kostete bald eineinhalb Shilling. Durch systematische Blockierung aller wichtigen Einfuhrhäfen trieben wir die Wucherpreise weiter in die Höhe und lösten landesweit eine Hungersnot aus. Die darbende Bevölkerung protestierte gewalttätig gegen die Regierung. Die Börse, des Empire Heiligtum, wurde gestürmt. Wer zur Oberschicht gehörte oder es sich sonst leisten konnte, flüchtete nach Irland, wo es immerhin ausreichend Kartoffeln gab. Schließlich mußte das stolze England gedemütigt mit Norland Frieden schließen.
Im zweiten Teil des Buches äußerten sich Marinefachleute und andere Sachverständige, die alle des Autors Conan Doyle publizierte Warnung vor der U-Bootgefahr bekräftigten. Jemand – ein Vizeadmiral a.D. – gab den Ratschlag, wie einst Joseph in Ägypten nunmehr in England Getreidespeicher zu bauen und die Produkte der einheimischen Landwirtschaft durch Zölle zu schützen. Dringlich wurde gefordert, vom dogmatischen Inseldenken Abstand zu nehmen und endlich den Tunnel nach Frankreich zu graben. Ein anderer Vizeadmiral schlug vor, Handelsschiffe nur noch im Konvoi fahren zu lassen und schnell bewegliche Kriegsschiffe speziell für die U-Bootjagd umzurüsten. Lauter kluge Hinweise, deren Nützlichkeit im wirklichen Kriegsverlauf leider bestätigt worden sind. Ich könnte, was die Wirkung von Wasserbomben betrifft, ein besonderes Lied davon singen.
Bedauerlicherweise hat mein Erfinder, Sir Arthur, vergessen zu berichten, daß ich als junger Leutnant in Kiel dabeigewesen bin, als am 4.August 1906 auf der Germaniawerft unser erstes seetaugliches Boot mit dem Werftkran auf Wasser gesetzt wurde, streng abgeschirmt, weil geheim. Bis dahin war ich zweiter Offizier auf einem Torpedoboot gewesen, hatte mich aber nun freiwillig zur Erprobung unserer noch unterentwickelten Unterwasserwaffe gemeldet. Zur Mannschaft gehörend, erlebte ich erstmals, wie »U1« auf dreißig Meter Tiefe gebracht wurde und wenig später mit eigener Kraft die offene See erreichte. Einräumen muß ich allerdings, daß die Firma Krupp schon zuvor nach den Plänen eines spanischen Ingenieurs ein Dreizehnmeterboot, das unter Wasser fünfeinhalb Knoten lief, hat bauen lassen. Die »Forelle« erregte sogar des Kaisers Interesse. Prinz Heinrich nahm persönlich an einer Tauchfahrt teil. Leider hat das Reichsmarineamt die zügige Weiterentwicklung der »Forelle« verzögert. Und überdies gab es Schwierigkeiten mit dem Petroleummotor. Als aber nach einem Jahr Verspätung »U1« in Eckernförde in Dienst gestellt wurde, war kein Halten mehr, auch wenn man die »Forelle« und ein Neununddreißigmeterboot, die »Kambala«, die bereits mit drei Torpedos armiert war, später nach Rußland verkauft hat. Ich sah mich peinlicherweise zur feierlichen Übergabe abkommandiert. Extra aus Petersburg angereiste Popen segneten die Boote von vorn bis achtern mit Weihwasser. Nach langwierigem Landtransport hat man sie in Wladiwostok zu Wasser gelassen, zu spät, um sie gegen Japan zum Einsatz zu bringen.
Aber mein Traum ging dennoch in Erfüllung. Trotz seines in unzähligen Geschichten bewiesenen Detektivgespürs hat Conan Doyle nicht ahnen können, wie viele deutsche Jungmänner sich – gleich mir – das schnelle Abtauchen, den schweifenden Sehrohrblick, die zielgerecht dümpelnden Tanker, das Kommando »Torpedo los!«, die vielen bejubelten Treffer, das kameradschaftlich enge Beieinander und die wimpelgeschmückte Heimfahrt erträumt haben. Und ich, der ich von Anfang an dabeigewesen bin und inzwischen zur Literatur gehöre, habe nicht ahnen können, daß Zehntausende unserer Jungs aus ihrem Unterwassertraum nicht auftauchen würden.
Leider mißlang, dank Sir Arthurs Warnung, unser wiederholter Versuch, England in die Knie zu zwingen. So viele Tote. Doch Kapitän Sirius blieb verurteilt, jedes Abtauchen zu überleben.
1907
Ende November brannte an der Celler Chaussee unser Walzwerk aus: Totalschaden. Dabei waren wir prima in Schwung. Ungelogen: Sechsunddreißigtausend Platten pro Tag spuckten wir aus. Man riß uns die Dinger aus der Hand. Und der Umsatz von unserem Grammophonsortiment kletterte auf jährlich zwölf Millionen Mark. Besonders gut lief das Geschäft, weil wir in Hannover seit zwei Jahren beiderseits abspielbare Platten preßten. Die gab’s sonst nur in Amerika. Viel Militärgeschmetter. Wenig, das gehobenem Anspruch genügte. Doch dann endlich gelang es Rappaport, das ist meine Wenigkeit, Nellie Melba, die »große Melba«, zur Aufnahme zu überreden. Anfangs zierte sie sich wie später Schaljapin, der eine heidnische Angst hatte, durch das Teufelszeug, wie er unsere neueste Technik nannte, seine weiche Baßstimme zu verlieren. Joseph Berliner, der mit seinem Bruder Emile noch vorm Jahrhundertende »Die Deutsche Grammophon« in Hannover gegründet, dann deren Sitz nach Berlin verlegt hatte und bei nur zwanzigtausend Mark Gründungskapital ein ziemliches Risiko eingegangen war, sagte eines schönen Morgens zu mir: »Pack die Koffer, Rappaport, du mußt schleunigst nach Moskau abdampfen und, frag mich nicht wie, den Schaljapin rumkriegen.«
Ungelogen! Ich stieg in den nächsten Zug, ohne lange zu packen, nahm aber unsere ersten Schellackplatten mit, die mit der Melba drauf, sozusagen als Gastgeschenk. War das ne Reise! Kennen Sie das Restaurant Yar? Exquisit! Wurde dann eine lange Nacht im Chambre séparée. Anfangs tranken wir nur Wodka aus Wassergläsern, bis Fedor sich schließlich bekreuzigte und zu singen begann. Nein, nicht seine Boris-Godunov-Glanznummer, nur immer dieses fromme Zeug, das die Mönche mit ihren abgrundtiefen Bässen brummen. Dann gingen wir zu Champagner über. Aber erst gegen Morgengrauen unterschrieb er weinend und immerzu kreuzschlagend. Weil ich von Kindheit an hinke, hat er in mir, als ich zur Signatur drängte, wohl den Teufel gesehen. Und zur Unterschrift kam es nur, weil wir den großen Tenor Sobinow bereits an Land gezogen hatten und ich ihm dessen Vertrag vorlegen konnte, sozusagen als Muster. Jedenfalls wurde Schaljapin unser erster wirklicher Plattenstar.
Nun kamen sie alle: Leo Slezak, Alessandro Moreschi, den wir als letzten Kastraten auf Platte nahmen. Und dann gelang es mir, im Hotel di Milano – unglaublich, ich weiß, nämlich eine Etage über Verdis Sterbezimmer – die ersten Aufnahmen mit Enrico Caruso – zehn Arien! – unter Dach und Fach zu bringen. Selbstverständlich mit Exklusivvertrag. Bald sang auch Adelina Patti und wer sonst noch für uns. Wir lieferten in aller Herren Länder. Das englische und das spanische Königshaus gehörten zu unseren Stammkunden. Was das Pariser Haus Rothschild betrifft, gelang es Rappaport sogar, mit ein paar Tricks dessen amerikanischen Lieferanten auszubooten. Trotzdem war mir als Plattenhändler klar, daß wir nicht exklusiv bleiben durften, weil nämlich nur die Masse es macht, und daß wir dezentralisieren mußten, um mit weiteren Preßwerken in Barcelona, Wien und – ungelogen! – Calcutta auf dem Weltmarkt bestehen zu können. Deshalb war der Brand in Hannover auch kein totales Desaster. Aber bekümmert hat uns das schon, weil wir an der Celler Chaussee mit den Brüdern Berliner ganz klein angefangen haben. Zwar waren die beiden Genies, ich nur Plattenhändler, aber Rappaport hat immer gewußt: Mit der Schallplatte und dem Grammophon erfindet die Welt sich neu. Trotzdem hat sich Schaljapin noch lange vor jeder Aufnahme x-mal bekreuzigt.
1908
Das ist so Usus in unserer Familie: der Vater nimmt den Sohn mit. Schon mein Großvater, der bei der Eisenbahn und gewerkschaftlich organisiert war, nahm seinen Stammhalter mit, wenn Wilhelm Liebknecht wieder mal in der Hasenheide sprach. Und mein Vater, der auch bei der Eisenbahn und Genosse war, hat mir von diesen Großkundgebungen, die, solang Bismarck dran war, verboten wurden, den gewissermaßen prophetischen Satz »Die Annexion von Elsaß-Lothringen bringt uns nicht den Frieden, sondern den Krieg!« regelrecht eingetrichtert.
Nun nahm er mich, den neun- oder zehnjährigen Steppke, mit, wenn Wilhelms Sohn, der Genosse Karl Liebknecht, entweder im Freien oder, wenn das verboten wurde, in verräucherten Wirtshäusern sprach. Auch nach Spandau fuhr er mit mir, weil Liebknecht da für Wahlen kandidierte. Und im Jahr nullfünf durfte ich mit der Eisenbahn, weil Vater als Lokomotivführer Freifahrten zustanden, sogar nach Leipzig, denn im Felsenkeller in Plagwitz sprach Karl Liebknecht über den großen Streik im Ruhrrevier, der damals durch alle Zeitungen ging. Aber er redete nicht nur über Bergleute und agitierte nicht nur gegen die preußischen Kraut- und Schlotjunker, sondern verbreitete sich hauptsächlich und regelrecht prophetisch über den Generalstreik als zukünftiges Kampfmittel der proletarischen Massen. Er sprach frei und holte sich die Wörter aus der Luft. Und schon war er bei der Revolution in Rußland und beim blutbefleckten Zarismus.
Zwischendurch gab’s immer wieder Beifall. Und zum Schluß wurde einstimmig eine Resolution angenommen, in der sich die Versammelten – mein Vater sagte, es sind bestimmt über zweitausend gewesen – mit den heldenmütigen Kämpfern im Ruhrrevier und in Rußland solidarisiert haben.
Vielleicht waren es sogar dreitausend, die sich im Felsenkeller drängten. Ich sah ja mehr als mein Vater, weil er mich auf seine Schultern gesetzt hatte, wie schon sein Vater es tat, wenn Wilhelm Liebknecht oder der Genosse Bebel zur Lage der Arbeiterklasse sprachen. Das war ja so Usus bei uns. Jedenfalls habe ich als Steppke den Genossen Liebknecht immer erhöht, gewissermaßen von hoher Warte nicht nur gesehen, auch gehört. Er war ein Massenredner. Dem gingen die Worte nie aus. Besonders gerne hat er die Jugend agitiert. Auf freiem Feld hörte ich ihn über die Köpfe der Zigtausend hinweg rufen: »Wer die Jugend hat, der hat die Armee!« Was ja auch wieder prophetisch gewesen ist. Jedenfalls hab ich auf Vaters Schultern richtig Angst bekommen, wenn er uns anschrie: »Der Militarismus ist der brutale Exekutor und blutig-eiserne Schutzwall des Kapitalismus!«
Denn das weiß ich noch wie heute, daß er mir regelrecht Angst eingeredet hat, sobald er vom inneren Feind sprach, den man bekämpfen muß. Wahrscheinlich mußte ich deshalb so dringend pinkeln und auf den Schultern hin- und herrutschen. Aber mein Vater merkte nichts von meinem Bedürfnis, weil er begeistert war. Da konnt ich mich auf meinem Hochsitz nicht mehr zurückhalten. Und das geschah im Jahr nullsieben, daß ich meinem Vater durch die Latzhose durch in den Nacken gepißt habe. Bald danach wurde der Genosse Liebknecht verhaftet und mußte, weil vom Reichsgericht wegen seiner Kampfschrift gegen den Militarismus verurteilt, ein ganzes Jahr, 1908 und länger, Festungshaft in Glatz absitzen.
Mein Vater jedoch hat mich, als ich ihm in höchster Not den Rücken runter bepinkelt hatte, von seinen Schultern genommen und während der Kundgebung und während noch der Genosse Liebknecht die Jugend agitierte, regelrecht durchgeprügelt, so daß ich seine Hand noch lange gespürt habe. Und deshalb, nur deshalb bin ich später, als es endlich losging, zum Wehrbezirk gelaufen, habe mich freiwillig gemeldet, bin sogar wegen Tapferkeit ausgezeichnet worden und habe es nach zweimaliger Verwundung bei Arras und vor Verdun bis zum Unteroffizier gebracht, auch wenn mir immer, selbst als Stoßtruppführer in Flandern, gewiß gewesen ist, daß der Genosse Liebknecht, den einige Kameraden vom Freikorps später, viel später wie die Genossin Rosa erschossen und eine der Leichen sogar in den Landwehrkanal geworfen haben, hundertmal recht gehabt hat, als er die Jugend agitierte.
1909
Weil ich meinen Weg zum Urban-Krankenhaus tagtäglich mit dem Fahrrad abstrampelte und überhaupt als Velo-Enthusiast galt, wurde ich Dr.Willners Assistent beim Sechstagerennen, das auf dem Wintervelodrom am Zoologischen Garten stattfand, übrigens nicht nur erstmals in Berlin und im Reich, sondern überhaupt in Europa. Nur in Amerika kannte man diese Strapaze schon seit einigen Jahren, weil dort sowieso alles, was kolossal ist, Publikum anzieht. Deshalb galten denn auch die New Yorker Sieger der letzten Saison, Floyd MacFarland und Jimmy Moran, als Favoriten. Schade, daß der deutsche Fahrer Rütt, der zwei Jahre zuvor mit seinem holländischen Partner Stol das amerikanische Rennen gewonnen hatte, in Berlin nicht dabeisein durfte. Im Reich fahnenflüchtig geworden, galt er als straffällig und konnte keine Einreise in sein Vaterland wagen. Aber Stol, dieser hübsche Bengel, war auf der Bahn und bald gefeierter Liebling des Publikums. Natürlich hoffte ich, daß Robl, Stellbrink und unser Velo-As, Willy Arend, die deutschen Farben nach besten Kräften vertreten würden.
Ständig, das heißt rund um die Uhr, leitete Dr.Willner die ärztliche Station des Sechstagerennens. Auch wir bezogen, wie die Fahrer, hühnerstallgroße Schlafkojen, die an der Längsseite des Innenraumes zusammengezimmert worden waren, gleich neben der kleinen Mechanikerwerkstatt und der einigermaßen abgeschirmten Station für medizinische Betreuung. Und wir bekamen zu tun. Schon am ersten Tag des Rennens stürzte Poulain und riß im Sturz unseren Willy Arend mit sich. Für beide, die einige Runden lang aussetzen mußten, fuhren Georget und Rosenlöcher weiter, der letztere hat dann später erschöpft ausscheiden müssen.
Nach unserem Medizinplan hatte Dr.Willner schon vor Beginn des Rennens angeordnet, das Körpergewicht aller Teilnehmer zu erfassen, was abermals nach Ende der Sechstagefrist geschah. Ferner bot er allen Rennfahrern, nicht nur den deutschblütigen, Sauerstoffinhalationen an. Ein Vorschlag, dem fast alle Konkurrenten nachgekommen sind. Täglich wurden in unserer Station sechs bis sieben Flaschen Sauerstoff verbraucht, was die enormen Belastungen des Rennens bezeugt.
Nach dem grad noch rechtzeitig beendeten Umbau zeigte die Hundertfünfzigmeterbahn im Velodrom ein verändertes Aussehen. Die frisch gestampfte Rennpiste war grün angestrichen. Auf den Stehplätzen der Galerie drängte Jugend. In den Logen und auf den Sperrsitzen des Innenraumes sah man Herren in Frack und weißer Bauchbinde aus Berlin W. Mit ihren Riesenhüten behinderten die Damen die Sicht. Zwar wurde die Hofloge schon am zweiten Tag, als unser Willy Arend bereits zwei Runden zurücklag, von Prinz Oskar und Gefolge besucht, aber als sich am vierten Tag zwischen den Favoriten MacFarland-Moran und Stol-Berthet während fünfundzwanzig Runden stürmische Überholkämpfe abspielten und der Franzose Jacquelin unseren Fahrer Stellbrink geohrfeigt hat, worauf es auf der Galerie zu Tumulten kam und das Publikum Jacquelin zu lynchen drohte, weshalb das Rennen für kurze Zeit abgeläutet und der Franzose disqualifiziert wurde, erschien mit prächtig aufgeputztem Hofstaat Seine Kaiserliche Hoheit der Kronprinz und blieb gutgelaunt bis lange nach Mitternacht. Großer Jubel bei seinem Erscheinen. Dazu flotte Militärmärsche, aber auch Gassenhauer für die mitjohlende Galerie. Selbst während ruhiger Stunden, wenn die Fahrer ihre Runden ganz sachte drehten, erschallte, um alle wach zu halten, stramme Musik. Stellbrink, ein zäher Bursche, der nun mit Mandoline im Arm fuhr, kam gegen das Marschgeschmetter natürlich nicht an.
Sogar am frühen Morgen, wenn sich absolut nichts Aufregendes ereignete, hatten wir zu tun. Dank der Elektrizitätsgesellschaft »Sanitas« war unsere Station mit den neuesten Rotar-Röntgen-Apparaten ausgestattet, so daß Dr.Willner, als wir vom Generaloberstabsarzt, Professor Dr.Schjerning, inspiziert wurden, bereits sechzig Röntgenaufnahmen von den beteiligten oder bereits ausgeschiedenen Rennfahrern gemacht hatte und nun Professor Schjerning vorzeigen konnte. Der Professor riet Dr.Willner, dieses und anderes Material später zu veröffentlichen, was in einer maßgeblichen Fachzeitschrift, ohne daß allerdings meine Tätigkeit erwähnt wurde, geschehen ist.
Aber auch das Rennen war unserem hohen Besuch einige Neugierde wert. Der Professor sah, wie das bisherige Spitzenteam Stol-Berthet am fünften Tag von den amerikanischen Favoriten überrundet wurde. Später, nachdem Brocco beim Spurt Berthet behindert hatte, behauptete dieser, daß sein Partner Stol vom Team MacFarland-Moran bestochen worden sei, ohne diese Anschuldigung vor der Rennaufsicht beweisen zu können. So blieb Stol, auch wenn sich der Verdacht hielt, weiterhin Publikumsliebling.
Dr.Willner hat unseren Fahrern als aufbauende Nahrung Biocitin und Biomalz, rohe Eier und Roastbeef, Reis, Nudeln und Pudding empfohlen. Robl, ein mürrischer Einzelgänger, löffelte auf Rat seines Privatarztes mächtige Portionen Kaviar in sich hinein. Fast alle Fahrer rauchten, tranken Sekt, Jacquelin bis zum Ausscheiden sogar Portwein. Wir glaubten, Grund zur Annahme zu haben, daß einige der ausländischen Fahrer von anregenden Mitteln, mehr oder weniger gefährlichen Giftstoffen, Gebrauch machten; Dr.Willner vermutete Strychnin- und Coffein-Präparate. Bei Berthet, einem schwarzlockigen Millionärssohn, konnte ich beobachten, wie er in seiner Koje süchtig an einer Ingwerwurzel kaute.
Trotzdem fiel das Team Stol-Berthet überrundet zurück, und Floyd MacFarland und Jimmy Moran holten sich am siebten Tag abends um zehn Uhr den Sieg. Sie konnten die Preissumme von fünftausend Mark einstreichen. Natürlich hat unser Willy Arend mit siebzehn Runden Rückstand selbst seine treuesten Anhänger enttäuscht. Das Velodrom jedoch blieb, trotz der gegen Schluß aufs Doppelte erhöhten Eintrittspreise, bis zum 21.März ausverkauft. Von anfangs fünfzehn Paaren waren am Ende nur noch neun auf der Bahn. Rauschender Beifall beim Abläuten. Auch wenn Stol, dieser hübsche Bengel, Sonderapplaus bekam, wurde den Amerikanern, als sie die Ehrenrunde abfuhren, fairer Beifall gespendet. Selbstverständlich war die Hofloge mit Kronprinz, den Prinzen von Thurn und Taxis sowie weiterem Adel besetzt. Ein veloverrückter Mäzen spendierte sogar unseren Fahrern Arend und Robl für aufgeholte Runden ansehnliche Trostpreise. Mir schenkte Stol als Andenken eine seiner in Holland fabrizierten Luftpumpen. Und Dr.
1910
Gezz will ich ma erzähln, warum mich die Kerls hier, nur weil ich Berta heiß un ne volle Figur hab, sowatt wien Spitznamen angehängt ham. Wir waren damals inne Kolonie am Wohnen. Die war vom Werk un ganz nah anne Arbeit dran. Deshalb kriegten wir auch von dem ganzen Qualm ab. Aber wenn ich am Schimpfen gewesen bin, weil die Wäsche schon wieder ganz grau beim Trocknen un die Blagen immerzu am Husten warn, hat Vatter gesagt: Laß ma, Berta. Wer bei Krupp auf Akkord is, der muß ganz schnell bei die Arbeit sein.
Warn wir denn auch bis inne lezze Zeit all die Jahre, auch wennes eng is gewesen, weil wir die Kammer nach hinten, die zum Karnickelstall raus, für zwei Alleinstehende, watt man bei uns Kostgänger genannt hat, haben abgeben gemußt un ich für meine Strickmaschin, die ich von mein eigenes Erspartes mir abgeknapst hab, kein Platz nich fand. Aber was mein Köbes is, der hat immer für mich gesagt: Laß ma, Berta, Hauptsach, es regnet nich rein.
Er war inne Gießerei. Da warn se Kanonenrohre am Gießen. Mit allem Drum un Dran. War ja paar Jahr nur vorm Krieg. Da gabs zu tun. Und da ham se ein Dingens gegossen, worauf se ganz stolz sin gewesen alle, weils son Riesendingens noch nie inne Welt gegeben hat. Un weil bei uns inne Kolonie viele inne Gießerei warn, sogar unsre Kostgänger beide, warn se immerzu über datt Dingens am Reden, auch wennes angeblich noch so geheim is gewesen. Aber datt wurd un wurd nich fertig. Sollt anfürsich sowatt wien Mörser sein. Datt sin die mitte Stummelrohre. Zweiundvierzig Zentimeter Durchmesser genau hat es geheißen. Aber paarmal ging dem Rohr sein Guß daneben. Un auch sonst zog sich datt hin. Aber Vatter hat immer gesagt: Wenne mich frags, datt kriegen wir schon noch hin, bisses losgeht richtig. Oder watt Krupp is, der verkauft datt Dingens beim Zar in Rußland womöglich.
Als es dann aber richtig losging, paar Jahr später, ham se nich verkauft, sondern von weit weg sogar mit datt Dingens auf Paris draufgeballert. Wurd denn überall Dicke Berta genannt. Auch wo mich keiner gekannt hat. Datt warn nur die Gießer von uns inne Kolonie, die datt als erste nach mir genannt ham, weil ich nu mal bei uns die am dicksten war. Hat mir gar nich gefallen, daß ich nu überall ins Gerede kam, auch wenn mein Köbes für mich gesagt hat: Is ja nich bös gemeint. Dabei hab ich noch nie watt für Kanonen übergehabt, auch wenn wir von dem Krupp seine Dinger gelebt ham. Wennse mich fragen, gar nich mal schlecht. Sogar Gänse und Hühner sin bei uns inne Kolonie am Rumlaufen gewesen. Fast jeder hat sein Schwein im Koben gefüttert. Un denn noch, wenns Frühling war, all die Karnickel…
1911
Mein lieber Eulenburg, wenn ich Sie noch so nennen darf, nachdem uns die Kanaille Harden mit seinen Zeitungsschmierereien so arg besudelt hat, worauf ich, wenn auch murrend, der Staatsraison gehorchen und meinen mir treu ergebenen Reisebegleiter und beratenden Freund im Stich lassen mußte. Dennoch, lieber Fürst, bitte ich Sie, nun mit mir zu triumphieren: Es ist soweit! Heute habe ich meinen Marineminister Tirpitz, der im Reichstag so trefflich den Linksliberalen einzuheizen wußte, zum Großadmiral ernannt. All meine Skizzen zum Flottenbestand, deren Akribie Sie oft milde gerügt haben, weil ich während allerlangweiligster Sitzungen nicht müde wurde, auf Aktendeckel, ja, sogar in die überaus drögen Akten hinein meinem kleinen Talent zu frönen und – uns zur Mahnung – Frankreichs »Charles Martel« und seine Panzerkreuzer I.Klasse, voran die »Jeanne d’Arc«, dann Rußlands Neubauten, vorab die Panzerschiffe »Petropawlowsk«, »Poltawa« und »Sewastopol«, mit allen Geschütztürmen als geballte Seemacht zu notieren. Denn was hatten wir Englands »Dreadnoughts« entgegenzusetzen, bevor uns die Flottengesetze nach und nach freie Hand verschafften? Allenfalls die vier Panzerkreuzer der Brandenburgklasse, sonst nichts. Doch dieses den denkbaren Feind umfassende Skizzenwerk findet nun – wie Sie, lieber Freund, dem beigelegten Material entnehmen können – unsererseits Antwort, ist nicht mehr nur Entwurf, sondern pflügt bereits die Nord- und Ostsee oder liegt in Kiel, Wilhelmshaven und Danzig auf Stapel.
Ich weiß, wir haben Jahre verloren. Unsere Leute waren in rebus navalibus leider äußerst unkundig. Es galt, im Volke eine allgemeine Bewegung, mehr noch, Begeisterung für das Flottenwesen auszulösen. Der Flottenverein, ein Flottengesetz mußte her, wobei mir die Engländer – oder sage ich besser, meine liebenswerten englischen Vettern? – wider Willen geholfen haben, als sie während des Burenkrieges – Sie erinnern sich, lieber Freund – zwei unserer Dampfer ganz und gar widerrechtlich vor der ostafrikanischen Küste aufbrachten. Da war die Empörung im Reiche groß. Das half im Reichstag. Wenn auch mein Ausspruch »Wir Deutsche müssen den englischen ›Dreadnoughts‹ unsere gepanzerten ›Fürchtenichts‹ entgegensetzen« allerlei Lärm verursacht hat. (Jaja, lieber Eulenburg, ich weiß: meine größte Versuchung ist und bleibt Wolff’s Telegraphenbüro.)
Aber nun schwimmen die ersten verwirklichten Träume. Und das Weitere? Tirpitz wird’s richten. Mir jedenfalls bleibt es ein heiliges Vergnügen, fernerhin Linienschiffe und Panzerkreuzer zu skizzieren. Nunmehr ernsthaft an meinem Schreibsekretär, vor dem ich, wie Sie wissen, auf einem Sattel sitze, allzeit bereit zur Attacke. Nach dem üblichen Ausritt ist es mir morgendliche Pflicht, in kühnem Vorentwurf unsere noch so junge Flotte angesichts feindlicher Übermacht zu Papier zu bringen, weiß ich doch, daß Tirpitz, wie ich, auf Großschiffe setzt. Wir müssen schneller, beweglicher, feuerstärker werden. Entsprechende Einfälle fliegen mir zu. Es ist oft so, als purzelten mir bei diesem Schöpfungsakt die Großschiffe aus dem Kopfe. Gestern sind mir etliche schwere Kreuzer, die »Seydlitz«, die »Blücher«, vor Augen gewesen und dann von der Hand gegangen. Ganze Geschwader sehe ich in Kiellinie aufkreuzen. Immer noch fehlt es an Großkampfschiffen. Allein deshalb müssen die Unterseeboote warten, meint Tirpitz.
Ach, hätte ich doch Sie, meinen besten Freund, den Schöngeist und Liebhaber der Künste, wie einst in der Nähe! Wie kühn und hellsichtig kämen wir ins Plaudern. Wie eifrig würde ich Ihre Ängste beschwichtigen. Jadoch, liebster Eulenburg, ich will ein Friedensfürst sein, aber einer in Waffen…
1912
Wenngleich beim Wasserbauamt Potsdam als Uferaufseher in Lohn und Brot, schrieb ich dennoch Gedichte, in denen der Weltuntergang dämmerte und der Tod seines Amtes waltete, war also auf jegliches Schrecknis vorbereitet. Es geschah Mitte Januar. Zwei Jahre zuvor hatte ich seinen Auftritt im Nollendorf-Casino, wo sich an Mittwochabenden der »Neue Club« in der Kleiststraße traf, zum ersten Mal erlebt. Danach häufiger, sooft mir die lange Anreise möglich war. Ich fand mit meinen Sonetten kaum Aufmerksamkeit, er jedoch war nicht zu überhören. Später widerfuhr mir seine Wortkraft beim »Neopathetischen Cabaret«. Blass und Wolfenstein waren anwesend. In polternden Kolonnen zogen Verse vorbei. Ein Marsch monotoner Monologe, der geradewegs zur Schlachtbank führte. Dann aber explodierte der kindliche Riese. Es war wie beim Ausbruch des Krakatau vom Vorjahr. Da schrieb er schon für Pfemferts »Aktion«, zum Beispiel gleich nach der jüngsten Marokkokrise, als alles auf der Kippe stand und wir schon hoffen durften, jetzt geht’s ins Gefecht, sein Gedicht »Der Krieg«. Höre ich noch: »Zahllos sind die Leichen schon im Schilf gestreckt / Von des Todes starken Vögeln weiß bedeckt…« Überhaupt hatte er es mit Schwarz und Weiß, besonders mit Weiß. Kein Wunder, daß sich auf der seit Wochen zugefrorenen Havel im endlosen Weiß der begehbaren Fläche jenes schwarze, wie auf ihn wartende Loch fand.
Welch ein Verlust! Doch warum, fragten wir uns, hat ihm die »Vossische« keinen Nachruf geschrieben? Nur die Kurzmeldung: »Am Dienstag nachmittag gerieten beim Schlittschuhlaufen der Referendar Dr.Georg Heym und der Cand.jur.Ernst Balcke gegenüber von Kladow in eine offene Stelle, die für Wasservögel in die Eisdecke geschlagen worden war.«