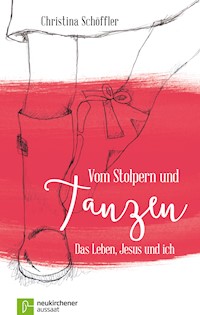Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerth Medien
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
In einer Zeit, in der ein Großteil unseres Lebens nur noch digital stattfindet und die Vision einer von Künstlicher Intelligenz gesteuerten Welt sich bedrohlich vor vielen auftürmt, wächst die Sehnsucht nach analogem Leben mit echten Begegnungen. Christina Schöffler hat sich intensiv damit auseinandergesetzt, wie es ihr gelingen kann (oder warum es auch oft so schwerfällt!), in ihrem Leben ganz DA zu sein - gerade im Ringen mit der digitalen Technik, sozialen Medien und einem Kind, das nun auch endlich ein Handy will …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 163
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über die Autorin
Christina Schöffler ist Autorin, Referentin und Bloggerin. Sie liebt es, mit Jesus unterwegs zu sein und vom Stolpern und Tanzen durch ihren ganz normalen, bunten und manchmal chaotischen Alltag zu berichten.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Die Bibelzitate wurden folgenden Übersetzungen entnommen Revidierte Elberfelder Bibel (Rev. 26), © 1985/1991/2008 SCM Brockhaus im SCM-Verlag GmbH & Co. KG, Witten.Lutherbibel, revidiert 2017, durchgesehene Ausgabe, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart. (LU)Willkommen daheim. © 2009 by Gerth Medien GmbH, Asslar. (WD)
Copyright © 2025 Gerth Medien in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Berliner Ring 62, 35576 Wetzlar
Erschienen im März 2025ISBN9783961226863
Umschlaggestaltung: Lisa AntonacciUmschlagmotiv: Christoper Jolly, UnsplashSatz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
www.gerth.de
Die Ehre Gottes ist der lebendige Mensch.
(Irenäus von Lyon)
Inhalt
Damit ich das richtig verstehe (Warum dieses Buch? – Eine Einleitung)
Namen lernen
Ein Wecker für die Liebe
Immer schneller, immer mehr
Alle suchen dich
(R)auszeit
Kleine Feuer
Lebendig sein schmerzt
Meine Nachbarin und der Türöffner
Schau hin
Ein Tritt in den Rücken
Die Haptik der Liebe
Alle haben eins! Nur ich nicht
Echt jetzt?
Vom Aussterben aller Arten von Lücken
Wie hat Ihnen dieses Buch bisher gefallen?
Die Gefährten
Die Tür zum Glück
Ich bin ein unbegrenztes Wesen.
40 Tage offline
Gott einholen
Freundschaft in digitalen Zeiten
Perfekt und ohne Mühe?
Ich find’s schön
Teilen?
Darf ich bitten?
Mein Ort
Der Ich-bin-da-Gott
Ein paar konkrete Tipps
Quellenangaben
Damit ich das richtig verstehe
(Warum dieses Buch? – Eine Einleitung)
Eigentlich fing alles recht harmlos an, als mein Schwager mir vor 30 Jahren dabei half, einen schweren Rechner in meine Stuttgarter Altbauwohnung zu schleppen. Mit klopfendem Herzen habe ich mich einmal am Tag auf diesem Gerät eingewählt, um mich mit dem weltweiten Netz zu verbinden. Manchmal hat es funktioniert und an manchen Tagen endete mein Versuch in einem langen Piepton. (Der eine oder die andere kann sich vielleicht daran erinnern?) Dann hat sich dieser Apparat in den letzten zwei Jahrzehnten mit rasanter Geschwindigkeit zu einem kleinen mobilen Computer in unser aller Händen entwickelt, der aus unseren Leben kaum mehr wegzudenken ist. Ein Minicomputer, der „das Potential hat, unser Denken, Fühlen und Handeln auf eine so mächtige Weise zu steuern wie noch nie eine Technologie in der Menschheitsgeschichte zuvor“.[1]
Nun ist es nicht so, dass ich die Nützlichkeit dieses digitalen Geräts nicht schätzen könnte! Ich lebe nicht technikverweigernd und habe auch in naher Zukunft nicht geplant, mich in eine Waldhütte ohne Strom und WLAN zurückzuziehen. (Ich würde jegliches Survivaltraining sofort abbrechen, wenn ich dafür mein Glätteisen und das Smartphone zurücklassen müsste.) Dem Erfinder des Internets bin ich also durchaus sehr dankbar! Auch weil ich seinetwegen gerade googeln konnte, ob es so einen Erfinder überhaupt gibt. Gibt es, sagt mir die Internetseite des Kindermagazins Logo!. (Man sollte immer dort nach Informationen suchen, wo sie auf einem Niveau vermittelt werden, das man versteht.)
Logo! erklärt mir also, dass es am 29. Oktober 1969 dem US-Professor Leonard Kleinrock zum ersten Mal gelang, einzelne Computer, die nicht weit voneinander entfernt standen und in etwa so groß wie Kühlschränke waren, über eine Telefonleitung miteinander zu verbinden und darüber einzelne Buchstaben zu versenden. 1969 ist auch mein Geburtsjahr, was vielleicht erklärt, warum ich mich bei einem kindgerechten Portal über solche Dinge informieren muss, damit ich technisch den Anschluss nicht ganz verpasse.
Aber zurück zum Thema. Ich bin Mr Kleinrock und allen, die seither daran gearbeitet haben, das Internet zu dem zu machen, was es heute ist, zu großem Dank verpflichtet! Deshalb hier zuallererst eine Danksagung:
Liebes Internet!
Danke. Danke, dass ich bei dir mit nur einem Klick so viele meiner Fragen beantwortet bekomme und dadurch so tun kann, als wüsste ich über ganz viele Dinge richtig gut Bescheid (inklusive, wer dich erfunden hat!).
Danke, dass du unfassbar vielen Menschen eine Bühne schenkst, damit sie sich äußern können. Gut, manchen sollte man das Mikro vielleicht freundlich, aber bestimmt aus der Hand nehmen, aber der große Rest von uns genießt die gemeinsame Party.
Danke, dass du auch mir eine Blog-Ecke geschenkt hast, in der ich meine öffentliche Stimme finden konnte, und überhaupt: Zu meiner kleinen Karriere als Autorin hast du einen nicht unerheblichen Beitrag geleistet.
Danke für die vielen wunderbaren Menschen, die du mir vorgestellt hast. Manche davon sind sogar Freundinnen geworden.
Danke für all die guten Buchtipps, für Blogs und Podcasts, für die „Real Life Guys“ und „Hartls Senf“, für „Hotel Matze“ und alle anderen Kanäle, die mich inspirieren und meinen Horizont erweitern. Und danke für jeden Aufstand zum Guten, der mit deiner Hilfe schon angezettelt werden konnte!
Und vor allem danke ich dir – eine Frau, die sich schon auf dem Weg zur Toilette verirrt und aus dem Kaufhaus „Harrods“ in London fast nicht mehr herausgefunden hätte! – für die vielen Male, bei denen du mir geholfen hast, meinen Weg zu finden, und dass du mir, einem Menschen, der das Gefühl hat, nie wirklich mit etwas fertig zu werden, immer wieder diese wunderbaren Worte zusprichst: „Sie haben Ihr Ziel erreicht!“ Danke.
Aber über alles andere müssen wir auch reden. Dass unsere Kinder ganz wild auf dich sind und sich fast immer auf deine Seite schlagen, wenn sie die Wahl haben, auf irgendein Display zu starren oder stattdessen gemeinsam einen Ball durch die Gegend zu kicken. Dass wir durch deine Anwesenheit ständig ablenkt sind, dass wir zwar hier sind, aber gleichzeitig auch immer woanders. Dass inzwischen viele gute Gespräche vom Vibrieren des Smartphones unterbrochen werden und sich unsere Aufmerksamkeitsspanne langsam in Richtung der eines Goldfischs entwickelt[2]. Und dass du uns so unfassbar viel Lebenszeit klaust! (Angeblich sind wir Deutschen zurzeit 70 bis 90 Stunden pro Woche online – Tendenz steigend[3].)
Nicht zu vergessen die warmen Momente auf einem Konzert, wenn wir alle unsere Feuerzeuge nach oben gehalten und in inniger Verbundenheit unsere Lieblingssongs mitgeschmettert haben, die hast du mir auch geraubt. Bis ich nämlich die Taschenlampenfunktion an meinem Handy aktiviert habe, ist das Lied meistens schon vorbei. Danke auch!
Dabei fällt mir ein, was der Sänger Lenny Kravitz gesagt hat: „Wenn ich den ersten Song spiele, sehe ich nichts als Handys. Es ist sehr interessant, wie sehr die Leute konditioniert sind. Für sie ist es das Größte, anderen zu beweisen, dass sie da waren – anstatt einfach da zu sein.“[4]
Und genau um dieses „Einfach da sein“ geht es mir in diesem Buch. Auch mit meinem Handy in der Hosentasche. Weil ich hellwach sein will in diesem kostbaren und einzigartigen Leben, das mir von meinem Schöpfer geschenkt wurde. Gut, „hellwach“ ist ein Zustand, den ich seit der Geburt meines Kindes vor fast 13 Jahren nicht mehr wirklich oft erlebe, aber gerade deshalb muss ich mich manchmal ein wenig schütteln und mir sagen:
„Schau hin! Das ist dein Leben! Verpasse es nicht.“
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns ab und zu bewusst machen, wie die Dinge, mit denen wir uns umgeben, uns formen, um uns dann zu überlegen, ob wir das tatsächlich so wollen. Oder ob wir es nicht doch lieber anders haben möchten. Und wie dieses „Anders“ gegebenenfallsaussehen könnte. Genau das habe ich getan. Ich habe mir bewusst angeschaut, wie die digitalen Medien mich und mein Umfeld formen. Wie sie meinen Alltag prägen, meine Familie, meine Freundschaften. Ich habe viel darüber gelesen (es gibt so unfassbar viele gute Bücher zu diesem Thema), und ich habe mir überlegt, was ich gern anders machen würde. Daraus sind die Gedanken und Alltagsgeschichten entstanden, die jetzt vor euch liegen. Während des Schreibens ist es für mich ein bisschen so wie beim Nachschlagen beim Kindermagazin Logo!: Ich schreibe über dieses Thema so, dass ich das richtig verstehe. Also ziemlich einfach. Und zum Mitschreiben. Wenn ihr gern intellektuell anspruchsvolle und ausgewogene Sachliteratur zum Thema lesen wollt, dann stellt das Buch besser zurück ins Ladenregal (oder verschenkt es weiter, falls ihr es zum Geburtstag bekommen habt).
Allen anderen ein herzliches Willkommen! Diese Geschichten habe ich für euch und für mich aufgeschrieben. Ich lade euch ein in mein ganz gewöhnliches Leben. Nehmt Platz auf dem Sofa, blättert in den Seiten und nehmt mit, was ihr gebrauchen könnt. Hier ist mein Versuch zu sagen:
„Schau hin! Das ist dein Leben! Verpass es nicht!“
„This is such a wild and heavy thing to say: ‚I will choose the way I live.‘ But the biggest trouble with it is that it works.“[5](Esther Emery)
Namen lernen
Die Geschichte beginnt hier. An diesem Ort, an dem ich gerade lebe und an dem ich lernen möchte, hellwach und ganz da zu sein. Vor ein paar Jahren sind wir von unserer Landeshauptstadt hierhergezogen, in den Teilort einer schwäbischen Kleinstadt. Neben sehr viel Gepäck (mein Mann ist ein Sammler!) habe ich auch die romantisierte Vorstellung meiner Kindheit auf dem Dorf mitgebracht: Menschen, die mich mit Namen grüßen, Kinder, die auf der Straße Ball spielen, und eine großzügige Bäckersfrau, die mir eine Extrabrezel in die Tüte legt. Solche Dinge. Nun hat unser Ortsteil leider noch nicht mal eine Bäckerei. Nur eine trostlose Fußballkneipe, aus der spätabends ein paar dunkle Gestalten wanken, die man erstaunlicherweise nie hineingehen sieht (als würden sie dort drinnen hergestellt). An der Haltestelle um die Ecke sammeln sich morgens eine Handvoll müder Menschen, die alle ihren Blick stur auf die mobilen Endgeräte in ihrer Hand richten, bis sie das Zischen der Türen vernehmen, um anschließend mit dem Bus Richtung Stadt zu verschwinden. Am Abend kehren sie dann in eines der Mehrfamilienhäuser zurück, die sich in unserer Siedlung aneinanderreihen. All das wirkt wenig dörflich, sondern gewollt distanziert.
So wie das Paar, das mehrmals am Tag seine Raucherpausen gegenüber unserer Garage einlegt. Wir vermuten, dass es Russen sind. Leider haben wir den Moment verpasst, sie nach ihren Namen zu fragen. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine grüße ich sie aber ganz besonders freundlich, damit sie nicht denken, wir hätten etwas gegen sie. Unser Kind hat zwar ganz zu Beginn des Krieges ein Herz mit russischer und ukrainischer Flagge ins Fenster gemalt, aber irgendwann haben wir festgestellt, dass es die niederländische und nicht die russische Flagge war, was die erstaunten Blicke der rauchenden Nachbarn zu unserem Fenster erklären könnte. Ob ich sie doch mal nach ihrem Namen fragen sollte?
Eigentlich eine kleine Sache, könnte man meinen und sich gleichzeitig fragen, ob unsere Namen wirklich so wichtig sind. Und welchen Unterschied es macht, ob ich die Namen meiner Nachbarn weiß oder ob ich einen allgemeinen Gruß in ihre Richtung werfe. Aber ich glaube tatsächlich, dass solche vermeintlich „kleinen Dinge“ etwas sehr Wertvolles in sich tragen: Interesse. Aufmerksamkeit. Und, ja, sogar Liebe. Alles Kostbarkeiten, die niemals abstrakt und verallgemeinernd sind, sondern immer sehr konkret und ganz persönlich. Wenn ich jemanden nach seinem Namen frage, frage ich nach der Einzigartigkeit des anderen. Und ich drücke damit aus: Du interessierst mich.
„Wenn du einen Namen hast, hast du den Beginn einer Beziehung“, meint der amerikanische Theologe und Autor Eugene Peterson und erzählt davon, wie verletzend er es empfunden hat, dass er als Kind und junger Erwachsener von seinem Pastor immer nur mit der Floskel „Wie geht es dir, Sohn?“ begrüßt wurde, ohne dass dieser jemals nach seinem Namen gefragt hätte.[6]
Namen sind Teil unserer Identität, und wann immer wir sie einander sagen, geben wir auch etwas von uns preis. Im Internet sind wir deshalb vorsichtig damit, unsere echten Namen zu nennen. Oft bleiben wir lieber anonym. Daher blühen Fantasienamen und man kann mit falschen Angaben sogar eine Fake-Identität aufbauen. Letzteres gelingt an einem realen Ort natürlich eher nicht, aber anonym kann man trotzdem bleiben. Bis zu dem Moment, in dem wir einander sagen, wie wir heißen. Und ich finde, selten klingen wir verletzlicher, wie wenn wir unsere eigenen Namen sagen.
In der Bibel steht, dass Gott seine Menschen mit Namen ruft.[7] Was ist das doch für ein schöner Gedanke! Dass der Schöpfer dieser Welt meinen Namen kennt. Und deinen auch. Und den Namen meiner zwei Nachbarn (nur leider verrät er sie mir nicht).
Vor einiger Zeit habe ich folgenden Satz gehört: „Wenn du dich an einem Ort verwurzeln willst, dann lerne die Namen der Bäume in deiner Umgebung und der Vögel im Garten und deiner Nachbarn. Und pflanze eine Tomatenstaude.“[8] Die Reihenfolge gefällt mir. Vielleicht könnte ich mit den Namen der Vögel und Bäume beginnen?
Gleich beim nächsten Spaziergang fange ich damit an. Zuerst entdecke ich eine ganze Horde Spatzen im Gebüsch vor unserem Haus. Dann komme ich an meinen zwei Lieblingsbäumen vorbei, von denen ich vermute, dass es Eichen sind. Vor mir hüpft ein Rotkelchen über die Straße. Als ich auf den Feldweg einbiege, überholt mich eine Frau mit Walkingstöcken. Sie drosselt das Tempo und wir laufen ein wenig nebeneinanderher und führen ganz spontan ein richtig nettes Gespräch. Kurz bevor wir uns an der Wegkreuzung verabschieden, denke ich plötzlich: Das ist die Gelegenheit! Vielleicht sehe ich sie nie wieder. Ich könnte ein wenig üben. Also gebe ich mir einen Ruck und frage sie nach ihrem Namen. Etwas erstaunt schaut sie mich an. Mir steigt die Hitze ins Gesicht. Wie peinlich! Nicht dass sie denkt, ich hätte keine Freunde. Aber dann merke ich, dass sie sich richtig freut. Und sie fragt auch nach meinem Namen. Wir schauen uns an – zwei Frauen, die sich zufällig auf dem Weg getroffen haben. Und plötzlich sind wir uns nicht mehr fremd. Mit der Preisgabe unserer Namen haben wir uns ein wenig füreinander geöffnet. Wir verabschieden uns richtig herzlich voneinander. Ganz beschwingt von diesem Erlebnis laufe ich nach Hause zurück.
Einige Tage später traue ich mich endlich: Nach monatelangem distanziert-freundlichem Zunicken fragen mein Mann und ich unsere Nachbarn nach ihren Namen. Es sind tatsächlich Russen. Aus St. Petersburg. Einer Stadt, in der ich schon zweimal war und die ich wegen der wunderbaren Begegnungen dort in mein Herz geschlossen habe. Alles das erzähle ich ihnen ganz überschwänglich, und sie drücken uns, leicht überfordert, eine riesengroße Zucchini aus ihrem Garten in die Hand. Seither beschenken sie uns immer mal wieder mit Gemüse und ich grüße sie mit Namen. Unsere Nachbarn: Antonia und Dimitri.
Als Nächstes pflanze ich eine Tomatenstaude.
Darf ich vorstellen?
Darf ich mich dir zu Anfang dieses Buches vorstellen: Mein Name ist Christina. Meine Eltern haben mir den zweiten Namen meiner großen Schwester gegeben, die ein paar Tage nach ihrer Geburt verstorben ist. Wäre sie nicht gestorben, dann wäre ich, ihr jüngstes Kind, wahrscheinlich nicht da. So jedenfalls hat mir das meine Mutter mal erklärt. Mein Leben hat also auch etwas mit dem Tod eines anderen Menschen zu tun.
Christina ist eine Ableitung von „Christus“ und kann mit „Anhängerin Christi“ übersetzt werden. Ich mag meinen Namen. Er erzählt eine Geschichte. Und wie gerne würde ich deinen Namen und deine Geschichte hören …
Ein Wecker für die Liebe
Jetzt habe ich mir doch tatsächlich – so richtig oldschool – einen Wecker angeschafft. Ein hässliches grünes Teil mit digitaler Anzeige, das ich vor ein paar Wochen auf einem Flohmarkt erstanden habe. Die letzten Jahre bin ich ganz gut ohne Wecker klargekommen. Ich hatte schließlich mein Handy. Aber dummerweise hat dieser „Wecker“ noch viele andere Funktionen, die ich kurz nach dem Aufwachen eigentlich gar nicht brauche, deren Nutzung ich aber im müden Zustand kaum widerstehen kann. Wenn ich am Morgen den Flugmodus ausschalte und sehe, dass ich neue Nachrichten bekommen habe, dann klicke ich sie „nur kurz mal“ an. Auch die Sprachnachricht höre ich noch ab – es könnte ja etwas Wichtiges sein (und wenn die Zeit zum Aufstehen drängt, dann höre ich sie eben in doppelter Geschwindigkeit ab). Nebenher locken mich die neuen Statusmeldungen meiner Freunde und die Wetter-App … und vielleicht noch ein kurzer Blick auf die Nachrichten des Tages, damit ich informiert bin, wie sich die Krisenherde dieser Welt über Nacht entwickelt haben. Währenddessen entsteht meistens schon ein Krisenherd vor meiner Schlafzimmertür, weil unser 12-Jähriger schimpfend nach seiner liebsten Sporthose sucht oder seine Busfahrkarte nicht finden kann, und ich stolpere – schon ausreichend schlecht gelaunt – über unsere steile Treppe hinunter Richtung Esszimmer. So in etwa sah bis vor Kurzem mein Tagesbeginn aus.
Dann hat eine kluge Freundin mir gegenüber geäußert, dass sie morgens keine Nachrichten auf nüchterne Seele verträgt.[9] Das hat mich innerlich aufhorchen lassen. Denn genau das ist mein Problem: Ich lasse am Morgen viel zu viel auf meine nüchterne Seele einströmen! Wenn ich dann unser Kind mitsamt Busfahrkarte aus der Tür geschoben habe und mit der Kaffeetasse in der Hand meine Bibel aufschlage, tobt es in meinem Kopf schon so wild durcheinander, als würden meine Gedanken eine Schneeballschlacht veranstalten. Dieser Raum am Morgen, den sogar viele Psychologen als „heilige Zeit“ bezeichnen, ist viel zu vollgestopft mit Stimmen, die ich nicht als Grundton meines Tages haben möchte. Sie hetzen mich in ein lautes und geschäftiges Leben, das nur noch auf äußere Reize reagiert. Das kann dazu führen, dass irgendwelche Dringlichkeiten meinen Tag bestimmen und nicht die Dinge, die mir wirklich wichtig sind.
Gottes Stimme empfinde ich nie als laut und drängend. Sie ist so viel sanfter. Ein liebevolles Flüstern. Eine leise Ahnung. Eine ruhige Erinnerung. Ein stiller Friede. Es ist diese innere Stimme der Liebe (wie es der Priester und Psychologe Henry Nouwen immer so wunderbar ausgedrückt hat), die ich vor allen anderen hören möchte. Die Stimme, die mir sagt, dass ich Gottes geliebtes Kind bin und dass sein Wohlgefallen auf meinem Leben ruht. Ich muss nichts tun oder leisten, um diese Liebe zu entfachen. Sie ist an keine Bedingungen geknüpft. Sie ist einfach da. An jedem Tag meines Lebens.
Und weil ich diese liebevolle Stimme so gern als Erstes am Anfang meines Tages hören möchte, habe ich mir diesen hässlichen Wecker angeschafft. Mein Handy schalte ich seither abends aus und deponiere es ein Stockwerk tiefer auf unserem höchsten Regal – damit ich nicht, ohne nachzudenken, danach greife und damit ich nicht mehr von seiner bloßen Gegenwart abgelenkt werde. (Ich habe gelesen, dass allein die räumliche Anwesenheit eines Mobiltelefons unsere Konzentration um mehr als 30 Prozent verringert.[10])
Nun beginne ich also meinen Tag, indem ich beim Aufwachen müde in Gottes Richtung lächle. Das Handy schalte ich am Morgen erst dann ein, wenn meine Seele und mein Körper nicht mehr im nüchternen Zustand sind.
Obwohl ich keine Notärztin in Bereitschaft bin, fiel mir das die ersten Tage richtig schwer. Was, wenn über Nacht irgendetwas sehr Wichtiges passiert ist? Ein Atomunfall zum Beispiel? Und ich sitze fröhlich beim Frühstück und wundere mich, wo alle anderen sind. Oder die öffentlichen Verkehrsmittel streiken und mein Kind steht wartend an der Haltestelle? (Gut, er könnte die 50 Meter zu unserem Haus einfach wieder zurücklaufen, damit ich ihn zur Schule fahren kann.) Oder jemand benötigt vor acht Uhr ganz dringend meine Hilfe oder einen wichtigen Rat von mir? (Manchmal habe ich das leise Gefühl, dass ich mich ein wenig zu wichtig nehme!)
Aber dann, nach einigen Tagen, geschah etwas Erstaunliches: Die Unruhe verschwand! Und inzwischen vergesse ich manchmal den halben Vormittag, dass ich überhaupt ein Handy besitze. Aber manchmal vergesse ich auch meine guten Vorsätze wieder und mein mobiles Teil landet abends nach alter Gewohnheit auf dem Nachttisch. Dann greife ich am Morgen als Erstes danach, wenn ich wach bin. Es ist wohl so, wie der Podcaster und Autor Jefferson Bethke schreibt: